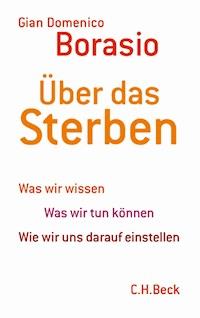Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Komplett-Media Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Der Tod gehört zum Leben #h3#Schweizer Ausgabe#/h3# Gian Domenico Borasio, einer der führenden Palliativmediziner Europas, steht seit vielen Jahren für eine Medizin am Lebensende, die das Leiden lebensbedrohlich Erkrankter lindert, ihre Lebensqualität und die ihrer Angehörigen verbessern will – statt künstlich den Sterbeprozess zu verlängern. In seinem Buch beschreibt er, was wir heute über das Sterben wissen und welche Mittel und Möglichkeiten wir haben, unsere Angst vor dem Tod zu verringern sowie uns auf das Lebensende vorzubereiten. Wie das Gesundheitswesen organisiert und geregelt ist, einschließlich der ärztlichen Ausbildung und der Patientenversorgung am Lebensende, unterscheidet sich von Land zu Land. Damit sind auch die Strukturen der Sterbebegleitung in der Schweiz ganz andere als in Deutschland. Das gilt für den Krankenhaussektor wie für den ambulanten Bereich, für die Patientenvertretung und Patientenverfügung sowie für den Umgang mit dem Thema Sterbehilfe. Mit der Nationalen Strategie Palliative Care wurden zudem in der Schweiz seit 2010 grundlegende Impulse für die weitere Entwicklung der Versorgungsstrukturen am Lebensende gesetzt. Um all dem Rechnung zu tragen, legt der Palliativmediziner Gian Domenico Borasio jetzt eine komplett überarbeitete, auf die Situation in der Schweiz zugeschnittene Ausgabe vor.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gian Domenico Borasio
Über das Sterben
Was wir wissen Was wir tun können Wie wir uns darauf einstellen
Schweizer Ausgabe
Vorwort
Der Anstoss zum Schreiben dieses Buches kam vor allem von Zuhörern meiner Vorträge über das Sterben, die mich immer wieder danach fragten, ob sie das, was sie gerade gehört und als hilfreich empfunden haben, nicht in einem Buch nachlesen könnten. Einige Zuhörer, die schon eigene Erfahrungen mit dem Sterben von Freunden oder Familienangehörigen gemacht hatten, sagten mir, dass sie sich im Nachhinein gewünscht hätten, vieles davon schon zu einem früheren Zeitpunkt erfahren und reflektiert zu haben.
Ein weiterer Anstoss für dieses Buch entstammt einer wiederholten Beobachtung: Viele Menschen, auch (und gerade) hochgebildete und blitzgescheite, verhalten sich im Angesicht des Todes auf erstaunliche Weise irrational. Das gilt für Sterbende und ihre Angehörigen, was vielleicht weniger verwunderlich ist. Es gilt aber genauso für professionell Beteiligte wie insbesondere Ärzte. Zahlreiche Beispiele in diesem Buch verdeutlichen diesen Aspekt. Was ist die Ursache solch irrationalen Verhaltens? Die Antwort lautet fast immer: Angst.
«Angst» ist die unausgesprochene Überschrift über viele hitzig geführte Debatten über das Lebensende; sie ist das, was bei Arzt-Patienten-Gesprächen über lebensbedrohliche Erkrankungen unausgesprochen im Raum steht und so oft geflissentlich übersehen wird; sie ist das grösste Hindernis für die Kommunikation über und im Sterben; und sie ist (gemeinsam mit der verbesserungswürdigen ärztlichen Fachkompetenz am Lebensende) der Hauptgrund für Fehlentscheidungen und leidvolle Sterbeverläufe.
Trotz der Fülle an Literatur zum Thema ist immer noch eine Tabuisierung des Todes in unserer Gesellschaft zu beobachten, die zum einen mit der grundsätzlichen Angst vor der Auslöschung des eigenen Ichs beim Sterben zusammenhängt. Hinzu kommt aber die konkrete, weit verbreitete Angst vor einem qualvollen Sterbeverlauf und auch die Angst vor dem Ausgeliefertsein an lebensverlängernde medizintechnische Massnahmen, die – ohne dass man selbst die Chance zum Eingreifen hätte – den Sterbeprozess unnötig in die Länge ziehen.
Hauptziel dieses Buches ist es, den Menschen die Angst vor dem Sterben, vor allem die Angst vor einem qualvollen Sterben, ein Stück weit zu nehmen. Die sehr konkreten Ängste vieler Menschen vor Leiden und Kontrollverlust führen paradoxerweise in einer Art von selffulfilling prophecy (sich selbst erfüllender Voraussage) dazu, dass die Befürchtungen der Menschen in dem Masse eintreten, in dem sie ihren Ängsten erlauben, die Kontrolle über ihr eigenes Handeln zu übernehmen. Denn Angst verzerrt die Wahrnehmung, vermeidet die Information und verhindert den Dialog. Diese drei Voraussetzungen sind aber zentral für eine gute Vorbereitung auf das eigene Lebensende. Und die Menschen, die wir am Lebensende betreuen dürfen, lehren uns, dass die Vorbereitung auf das Sterben die beste Vorbereitung für das Leben ist.
München/Lausanne, im August 2011
Gian Domenico Borasio
Vorwort zur Schweizer Ausgabe
Dass dieses kleine Buch in seiner ersten Fassung so viele Leser in der Schweiz finden würde, hätte niemand erwartet. Offensichtlich besteht ein gesellschaftliches Bedürfnis an Informationen über das Sterben sowie eine zunehmende Bereitschaft, sich mit dem Thema «Lebensende» auseinanderzusetzen. Das zeigen mir zahlreiche Zuschriften von Lesern, darunter Hochbetagte, Schwerkranke, pflegende Angehörige und Kollegen aus allen Gesundheitsberufen. Es wird auch deutlich durch die Schweizer Nationale Strategie Palliative Care, die seit 2010 darauf hinwirkt, den Menschen in der Schweiz eine friedliche und würdige letzte Lebensphase zu ermöglichen. Da ich seit 2011 in Lausanne arbeite, entstand der Wunsch, eine Schweizer Ausgabe vorzulegen, für die grosse Teile des Buches (vor allem in den Kapiteln 2, 3, 8, 9 und 10) neu geschrieben wurden.
Mein grösster Wunsch ist weiterhin, dass dieses Buch das im Allgemeinen doch sehr hohe Angstniveau vor dem Sterben um ein paar Millimeter senken und den Dialog am und über das Lebensende etwas erleichtern möge.
Lausanne, im Dezember 2013
Gian Domenico Borasio
1 Was wissen wir über das Sterben?
Es ist erstaunlich: Mit Ausnahme der Geburt betrifft kein medizinisches Ereignis so unweigerlich alle lebenden Menschen wie das Sterben. Und doch ist es ein weitgehend unerforschtes Gebiet. Über das Geborenwerden wissen wir sehr viel: Hunderttausende Publikationen und Tausende von Lehrbüchern beschäftigen sich mit den Vorgängen vor und während der Geburt eines Menschen. Die Embryologie hat die Schritte von der Befruchtung der Eizelle bis hin zur Entwicklung eines lebensfähigen Fötus in allen Einzelheiten studiert. Zum Teil ist sogar bekannt, welche Genabschnitte welche embryonalen Stadien wann und wie steuern. Aber was wissen wir über das Sterben? Hier sind die meisten Fragen noch offen, angefangen von der wichtigsten:
Warum sterben wir?
Die Frage ist weniger banal, als sie scheint. Immerhin ist es Wissenschaftlern gelungen, durch genetische Manipulation die biologische Lebensspanne niederer Organismen (z.B. einer bestimmten Algenspezies) scheinbar unbegrenzt zu verlängern. Dies wurde möglich, seit bekannt ist, dass spezielle Abschnitte an den Enden unserer Chromosomen (sogenannte Telomere) die zu erwartende Lebensspanne der Einzelzellen bestimmen, aus denen jeder Organismus zusammengesetzt ist. Den biologischen Sinn einer begrenzten Lebenszeit sehen die Evolutionsforscher1 in der Optimierung der Weitergabe unseres genetischen Materials. Nach der sogenannten «Selfish-DNA-Hypothesis» (Hypothese der egoistischen Erbsubstanz) sind alle Lebewesen nur biologische Maschinen mit dem Ziel der maximalen Weitergabe, Vermehrung und Vermischung ihres genetischen Materials. Denkt man diese Hypothese weiter, so ist die evolutionär-biologische Funktion eines jeden Lebewesens spätestens dann erschöpft, wenn es möglichst viele Nachkommen gezeugt und für ihr Überleben bis ins fortpflanzungsfähige Alter gesorgt hat. Danach wird es bestenfalls zum Nahrungsmittelkonkurrenten für die eigenen Nachkommen ohne erkennbaren Vorteil für die Genverbreitung und sollte daher zum Vorteil der eigenen Gattung seine Existenz baldmöglichst beenden.
Dass der Mensch sich in seinem Fortpflanzungs- und Sozialverhalten nicht mehr evolutionskonform verhält, liegt auf der Hand. Einige der neueren Diskussionsbeiträge zur Sterbeproblematik, wie die Forderung nach dem «sozialverträglichen Frühableben», liessen sich allerdings problemlos evolutionstheoretisch unterfüttern. Darin liegt auch ihre Gefährlichkeit in einer Welt, in der die Ressourcenverteilung zunehmend nach dem (aus der Evolution hinlänglich bekannten) Gesetz des Stärkeren erfolgt.
Glücklicherweise hat die Menschheit in ihrer Kulturgeschichte auch andere kulturelle, moralische und religiöse Deutungen des Lebens und des Sterbens entwickelt, die den Strategien der Evolutionsbiologie und Ökonomie gegenüberstehen. Eine umfassende Darstellung würde den Rahmen dieses Buches sprengen, aber einige davon werden in den folgenden Kapiteln Erwähnung finden.
Der programmierte Zelltod
Wenn man in Physiologie-Lehrbüchern nach dem Stichwort «Sterben» sucht, wird man durchaus fündig – allerdings nur, was den Tod einzelner Zellen, Gewebeteile oder bestenfalls Organe betrifft. Der Zelltod ist besonders gut untersucht, weil ihm eine zentrale Rolle gerade in der Embryonalentwicklung zukommt. Hier kommt es zum sogenannten «programmierten Zelltod» (Apoptose): Neue Zellen werden während des Wachstums und der Differenzierung der Organe im Überschuss gebildet und konkurrieren dann miteinander um eine beschränkte Menge von Wachstumsfaktoren. Diejenigen Zellen, die keinen Zugang zum Wachstumsfaktor bekommen, sterben – aber nicht einfach so: Sie schalten regelrechte Selbsttötungsgene an und bringen sich selbst, zum Wohle des Ganzen, damit aktiv um. Das tun sie in einer Weise, die für den Organismus am wenigsten schädlich ist: durch eine Art Zellimplosion, welche die potentiell schädliche Freisetzung von Zellinhalt verhindert und das Abräumen der Zellreste durch spezielle Immunzellen (die Müllabfuhr des Körpers sozusagen) erleichtert. Diesem Prozess ist es wesentlich zu verdanken, dass die hochkomplizierten Vorgänge bei der Embryonalentwicklung in der Regel zufriedenstellend ablaufen. Deshalb, und nur deshalb, besitzen Kinder bei ihrer Geburt fast immer die vorgesehene Anzahl an Gliedmassen, Organen und Nervenzellen – was jedes Mal einem kleinen Wunder gleichkommt.
Durch diese Erkenntnisse bekommt der alte Spruch «Media vita in morte sumus» (mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen) eine unerwartete Bedeutung. Der Tod begleitet uns nicht nur von Geburt an, sondern sogar schon vorher; er ist unabdingbare Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt als lebensfähige Organismen auf die Welt kommen können. Auch während unseres Lebens spielt der Zelltod in der Physiologie des Organismus eine wichtige Rolle, vor allem im Immunsystem. Bestimmte weisse Blutkörperchen (sogenannte T-Lymphozyten) haben die Aufgabe, virusinfizierte oder bösartig entartete (krebsverursachende) Körperzellen zu erkennen und sie mittels Anschaltung ihres eigenen Zelltodprogramms zu vernichten. Ebenso werden bei der Reifung von weissen Blutkörperchen diejenigen Zellen, die sich gegen das eigene Gewebe richten würden, durch programmierten Zelltod beseitigt. Das ist nicht trivial, denn wenn dabei etwas schiefläuft, können schwere Autoimmunkrankheiten wie z.B. die Multiple Sklerose oder die rheumatoide Arthritis die Folge sein.
Der Organtod
Dass Teile von Organen oder sogar ganze Organe sterben können, ohne dass der gesamte Mensch deswegen sterben muss, ist hinreichend bekannt. Ursache dafür ist meistens eine Einschränkung der Blutversorgung, wie beim Hirn- oder Herzinfarkt, oder ein Trauma, etwa bei der Milzruptur. Auf die Milz können wir im Notfall verzichten, auf Herz oder Hirn allerdings nicht, daher sind bei diesen beiden nur Teilschädigungen erlaubt, wenn der Organismus insgesamt weiterleben soll.
Auch Gliedmassen können absterben und durch Amputation entfernt werden, ohne dass dies zwingend den Tod zur Folge hätte. Viele Tierarten sind in der Lage, zerstörte Organe oder sogar ganze Gliedmassen zu regenerieren, also neu zu bilden. Diese Fähigkeit ist mit zunehmender Spezialisierung und Komplexität der einzelnen Organe im Laufe der Evolution immer mehr eingeschränkt worden. Aber auch beim Menschen besitzt beispielsweise die Leber eine hohe Regenerationsfähigkeit, die Haut sowieso, und nach neuesten Befunden kann sich sogar das Gehirn mit Hilfe sogenannter neuronaler Stammzellen nach Schäden in begrenztem Masse selbst regenerieren. Dieses Wechselspiel zwischen Tod und Leben begleitet uns also von der Befruchtung bis zur Bahre.
Gesamttod des Organismus
Hierzu wissen wir mit Abstand am wenigsten. Ein Beweis dafür findet sich auf den meisten Todesbescheinigungen, auf denen als unmittelbare Todesursache «Herz-Kreislauf-Versagen» eingetragen wird. Das Herz-Kreislauf-Versagen, also das Ende der Herzfunktion und des Blutkreislaufs, ist aber in den meisten Fällen nicht die Ursache des Todes, sondern lediglich ein sichtbares Zeichen hierfür. Was verursacht wirklich den Tod eines Gesamtorganismus? Und wann tritt dieser genau ein? Darüber gibt es kaum Untersuchungen. Diese wären jedoch sehr hilfreich, denn Ärzte werden immer wieder von den Sterbeverläufen ihrer Patienten überrascht, wie die folgenden Fallbeispiele zeigen.
Heinz F., 73 Jahre alt, hatte Lungenkrebs mit Tochtergeschwülsten in Leber, Knochen, Haut und Gehirn. Seine Nieren funktionierten so gut wie nicht mehr, sein Bauch und seine Lungen waren voller Wasser, und seine Blutwerte waren weit von dem entfernt, was in Lehrbüchern als mit dem Leben vereinbar betrachtet wird. Er war auf 40kg abgemagert, woran auch die künstliche Ernährung nichts zu ändern vermocht hatte. Diese hatte er zuletzt abgelehnt, wie auch die Dialyse und alle lebensverlängernden Massnahmen. Er wünschte sich nichts sehnlicher, als zu sterben, und dieser Wunsch blieb auch bestehen, nachdem die Atemnot mit Morphin erfolgreich gelindert werden konnte. Aber sein Wunsch erfüllte sich nicht. Jeden Tag fragte er die Ärzte aufs Neue, wann es denn mit ihm «so weit» sei. Um Sterbehilfe bat er nicht, aber das Leiden an der eigenen Existenz war überdeutlich. Er hatte sich von seiner Familie verabschiedet, es gab aus seiner Sicht keine «unerledigten Geschäfte», und doch dauerte es weitere zwei Wochen, bis er schliesslich sterben durfte – zwei Wochen, die nach Ansicht auch der erfahrensten Ärzte eigentlich jenseits des physiologisch Möglichen lagen.
Mathilde W., 85 Jahre, hatte Brustkrebs mit Knochenmetastasen und brauchte eine bessere Einstellung ihrer Schmerzmedikation. Sie kam auf die Palliativstation, und die allgemeine Einschätzung war, dass sie nach der Verbesserung ihrer Schmerzsituation nach Hause verlegt werden und dort noch einige Monate mit guter Lebensqualität verbringen könne. Am Abend des dritten Tages (die Schmerzen waren schon deutlich gebessert) sagte sie zur Nachtschwester: «Ich werde heute Nacht sterben.» Die Krankenschwester war erstaunt, denn nichts deutete darauf hin, und die Entlassung war für Ende der Woche schon geplant. Sie versuchte, die Patientin zu beruhigen, die aber gar nicht beunruhigt schien, sondern gelassen bei ihrer Meinung blieb. Und tatsächlich starb sie gegen 4 Uhr morgens im Schlaf.
Fast alle Ärzte wissen von Patienten zu berichten, die nach klinischer Einschätzung wegen des fortgeschrittenen, durch Laborwerte eindeutig dokumentierten Ausfalls mehrerer lebenswichtiger Funktionen ihres Körpers eigentlich schon längst hätten tot sein sollen – und dennoch viel länger weiterlebten. Auf der anderen Seite stehen Menschen, die zwar alt und/oder schwer krank sind, aber nach Meinung der sie versorgenden Ärzte und Pflegenden sich noch lange nicht im Sterbeprozess befinden – und doch «unerwartet» sterben, ohne dass sich dafür selbst bei der Obduktion eine plausible Ursache finden lässt. Wie sind diese Beobachtungen zu erklären?
Was wir sicher wissen, ist, dass der Mensch nicht «auf einmal» stirbt, sondern dass die einzelnen Organe mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihre Funktion einschränken und später ganz einstellen. In der Sterbephase ist meistens eine sogenannte Kreislaufzentralisation zu beobachten: Die herzfernen Körperteile werden weniger durchblutet, zugunsten der inneren Organe und des Gehirns. Dies geht einher mit einem Blutdruckabfall, worunter besonders die Funktionsfähigkeit der Nieren stark leidet. Der eigentliche Tod stellt einen Zusammenbruch der koordinierten Tätigkeit der lebenswichtigen Körperorgane dar, deren Hauptfunktion es ist, das Gehirn mit Zucker und Sauerstoff zu versorgen. Äusserer Ausdruck dieses Zusammenbruchs ist das Erlöschen der Herz- und Atemtätigkeit.
Grundsätzlich kann der Verlust der Funktionsfähigkeit jedes einzelnen lebenswichtigen Organs zum Tod führen. Dazu gehören Herz, Lunge, Leber, Niere und Gehirn. Alle Prozesse, die zum Tod führen, tun dies durch die direkte oder indirekte Schädigung eines oder mehrerer dieser Organe. Man könnte also sagen, dass es fünf physiologische Haupttodesarten gibt: den Herz-Kreislauf-, den Lungen-, den Leber-, den Nieren- und den Gehirntod.
Herz-Kreislauf-Tod: Fragt man Menschen, wie sie sterben möchten, sagen die meisten: schnell und schmerzlos, am liebsten den «Sekundentod» durch Herzstillstand. Ganz abgesehen davon, dass diese Art zu sterben durchaus auch ihre Nachteile hat (davon später mehr), ist nur ein Bruchteil der Herz-Kreislauf-Todesfälle unter der Rubrik «Sekundentod» einzuordnen. Die weitaus meisten Sterbevorgänge aufgrund von Herz-Kreislauf-Versagen haben ihre Ursache in einer chronischen Herzinsuffizienz, die unter anderem durch Rauchen und Zuckerkrankheit begünstigt wird.
Über diese Art zu sterben wissen wir erstaunlich wenig; neueste Untersuchungen zeigen allerdings, dass die Symptome sterbender Herzpatienten in vielem denen von Krebspatienten ähneln. Insbesondere spielen Schmerzen und vor allem Atemnot die grösste Rolle, zusammen mit der durch die Herzschwäche bedingten extremen Abgeschlagenheit. Diese wird von den Patienten nicht selten als das am meisten belastende Symptom angegeben und ist nicht einfach zu lindern.
Lungentod: Hier steht das Symptom der Atemnot eindeutig im Vordergrund, und die Geschwindigkeit der Verschlechterung der Lungenfunktion ist für das Ausmass der Symptombelastung entscheidend. Bei einer rasch auftretenden Atemnot sind hohe Dosen von Medikamenten notwendig, und die gleichzeitig entstehende Angst kann extrem belastend sein. Bei einer chronischen Atemschwäche kommt es meistens zu einem friedlichen Tod im Schlaf, da sich der Körper an hohe Kohlendioxid-(CO2-)Spiegel im Blut gewöhnt und irgendwann friedlich in eine sogenannte CO2-Narkose gleitet.
Lebertod: Wenn die Leber, zum Beispiel aufgrund von Tumormetastasen, ihre Funktion als Entgiftungszentrale des Körpers nicht mehr wahrnehmen kann, sammeln sich giftige Stoffwechselprodukte im Blut an, etwa Ammoniak und Bilirubin (das die charakteristische Gelbfärbung der Haut und Augen von Leberpatienten verursacht). Diese Stoffe haben eine dämpfende Wirkung auf das Gehirn, so dass die Patienten in einen Dämmerzustand und schliesslich ins sogenannte Leberkoma fallen, in welchem sie in der Regel friedlich sterben. Allerdings kann es vor dem Leberkoma auch zu Phasen von Verwirrtheit und Unruhe kommen, die einer speziellen Therapie bedürfen (siehe Kapitel 4b).
Nierentod: Auch die Niere hat eine wichtige Entgiftungsfunktion für den Körper und ist ausserdem für die lebensnotwendige Aufrechterhaltung der korrekten Ionenkonzentrationen (Natrium, Kalium, Kalzium usw.) im Organismus verantwortlich. Eine Störung des Ionengleichgewichts kann zu Verwirrtheit und Krampfanfällen, aber auch zu Herzrhythmusstörungen bis hin zum Herzstillstand führen. Ansonsten ist der Sterbeverlauf mit finalem Koma ähnlich wie beim Lebertod.
Gehirntod: Es wird hier bewusst nicht der Begriff «Hirntod» verwendet, da mit diesem Begriff in der Öffentlichkeit vor allem die Diskussion um die Organtransplantation verbunden wird (siehe nachfolgenden Abschnitt). Zunächst soll von dem Tod durch Gehirnschädigung die Rede sein. Hier gibt es wiederum zwei Gruppen: zum einen die Fälle, in denen es zu einer Steigerung des Drucks im Gehirn kommt (z.B. durch Blutung, Gewebeschwellung nach Schlaganfall, Metastasen), wodurch Teile des Gehirns im engen Raum des Schädels zusammengequetscht werden, was die Hirnfunktionen erlöschen lässt und damit zum Tod führt (sogenannte «Einklemmung»). Diese Todesart verläuft relativ schnell und führt rasch zur Bewusstlosigkeit, kann allerdings von Krampfanfällen und Schmerzen begleitet sein. Die zweite, zunehmend häufige Gruppe ist die der Patienten mit Demenzen und anderen neurodegenerativen Krankheiten, deren fortschreitender Hirnabbauprozess über einen Zeitraum von Jahren schliesslich dazu führt, dass das Hirn nicht mehr in der Lage ist, lebenswichtige Funktionen wie zuletzt das Essen und Schlucken korrekt zu steuern. Das hat wegen der Langsamkeit des Prozesses in der Regel einen friedlichen Tod zur Folge, wenn der Sterbeprozess nicht durch unnötige ärztliche Eingriffe gestört wird (siehe Kapitel 6).
Viele Todesfälle sind eine Kombination zweier oder mehrerer der eben beschriebenen Todesformen, wie zum Beispiel der Tod durch Lungenentzündung bei weit fortgeschrittener Demenz. Es kann aber hilfreich sein, sich daran zu erinnern, dass alle Sterbeverläufe grundsätzlich auf der Schädigung eines oder mehrerer lebenswichtiger Organe beruhen müssen.
Ist der Hirntod der Tod des Menschen?
Die Diskussion über den Hirntod ist ein gutes Beispiel für teilweise irrationale Ängste in der Gesellschaft in Bezug auf das Lebensende. Ärzten und Wissenschaftlern gelingt es leider nicht immer, die zum Teil schwierigen Sachverhalte so zu erklären, dass diese Ängste abgebaut werden können.
Das Konzept des Hirntodes dient heute vor allem dem Zweck der Organentnahme für Transplantationen. Dazu ist es zum einen notwendig, dass ein menschlicher Organismus sich in einem Zustand befindet, der es ethisch und juristisch möglich macht, lebenswichtige Organe zu entnehmen, um sie in den Körper anderer Menschen einzusetzen. Zum anderen muss es dieser Zustand im Idealfall erlauben, die Organe durch künstliche Aufrechterhaltung der basalen Körperfunktionen (Atmung und Kreislauf) so lange intakt zu erhalten, bis das Explantationsteam vor Ort ist (sonst wären sie innerhalb von Minuten nicht mehr brauchbar).
Diese Voraussetzungen erfüllt das Kriterium des Hirntodes. Er stellt nicht den Zeitpunkt dar, an welchem alle Körperfunktionen unwiederbringlich erloschen sind: Mit Hilfe der modernen Intensivmedizin lassen sich die basalen Körperfunktionen hirntoter Patienten unter Umständen über Wochen aufrechterhalten. Der Hirntod stellt aber den Zeitpunkt dar, ab welchem die Integrität des Organismus unwiederbringlich verloren ist, die zumindest eine intakte Hirnstammfunktion erfordert. Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt zwar unterschiedliche Organe mit künstlicher Unterstützung noch unterschiedlich lange «Lebens»spannen vor sich haben können – der Tod des Gesamtorganismus als integrierte biologische Einheit ist aber zu diesem Zeitpunkt schon unumkehrbar vollzogen. Anders als zum Beispiel bei Patienten im Wachkoma brechen bei hirntoten Patienten mit Beendigung der Beatmung und Kreislaufunterstützung sämtliche lebenswichtigen Funktionen aufgrund der fehlenden Steuerung durch das Gehirn sofort zusammen.
Wie in vielen Situationen, die mit dem Lebensende zu tun haben, liegen die Probleme, die manche Menschen mit dem Hirntod haben, nicht auf einer rationalen, sondern auf einer (nicht zu unterschätzenden) intuitiv-psychologischen Ebene. Es fällt einfach schwer, einen Menschen mit rosiger Haut, warmer Körpertemperatur und dem Aussehen eines Schlafenden existentiell als «tot» zu akzeptieren. Dieser psychologischen Barriere ist nicht ohne Weiteres mit rationalen Argumenten beizukommen, wie jeder Arzt weiss, der Erfahrung mit Transplantationsgesprächen hat. Es gilt erst einmal, die dahinterliegende Trauer und Verzweiflung der Angehörigen zu akzeptieren und zu würdigen. Dann kann man sie vorsichtig darauf hinweisen, dass es um den mutmasslichen Willen des Patienten in einer solchen Situation geht: Würde er einer Organentnahme zustimmen, wenn man ihn in dieser Situation fragen könnte? Dass der Patient juristisch wie medizinisch zu diesem Zeitpunkt bereits tot ist, bedeutet nicht, dass sein Wille unerheblich ist, sonst bräuchte niemand ein Testament zu verfassen oder einen Organspendeausweis auszufüllen. Die Zurückführung der Diskussion auf die Ermittlung des Patientenwillens ist für die Angehörigen sehr entlastend, was übrigens für alle Stellvertreterentscheidungen am Lebensende gilt (siehe Kapitel 8).
Geburt und Sterben als Parallelvorgänge
Es gibt erstaunlich viele Parallelen zwischen Geburt- und Sterbevorgang. Es sind die einzigen Ereignisse, die allen Menschen, ja allen Lebewesen gemeinsam sind. Es sind beides physiologische Vorgänge, für welche die Natur Vorkehrungen getroffen hat, damit sie möglichst gut verlaufen. Beide laufen in den meisten Fällen am besten ab, wenn sie durch ärztliche Eingriffe möglichst wenig gestört werden. Und in beiden Vorgängen greift die moderne Medizin zunehmend häufiger, zunehmend invasiver und teilweise zunehmend unnötiger ein.
Geburt
Dass bei Schwangerschaft und Geburt komplizierte biologische Programme mehr oder weniger automatisch ablaufen, ist seit langem bekannt. In den letzten Jahren sind immer mehr molekularbiologische Details über die Embryonalentwicklung erforscht worden. Die faszinierenden biologischen Prozesse, die aus einer mikroskopisch kleinen Eizelle einen hochkomplexen menschlichen Organismus hervorbringen, werden genauestens studiert. Über die Vorgänge bei der Geburt wissen wir ebenfalls sehr viel: Sie wird über bestimmte Hormone gesteuert, die man auch künstlich zuführen kann, um eine überfällige Geburt «einzuleiten». Im Regelfall verläuft eine Geburt nach einem exakt von der Natur vorbereiteten Schema ab, das die Überlebenschancen für Mutter und Kind maximiert. Geübte Hebammen wissen, dass sie in der Regel möglichst wenig eingreifen müssen, damit die Geburt gut verläuft. Ärztliche Eingriffe sind nur in der Minderheit der Fälle nötig. In den Niederlanden, wo über die Hälfte der Geburten zu Hause ohne ärztliche Beteiligung stattfindet, ist die Säuglingssterblichkeit niedriger als in Italien, dem Land mit der höchsten Kaiserschnittrate Europas.
Bei einigen Geburten ist eine ärztliche Beteiligung ohne Frage zwingend erforderlich, wie beispielsweise bei Fehlstellung des Kindes, Vorerkrankungen der Mutter usw. Und in einer glücklicherweise sehr geringen Anzahl von Fällen (z.B. Früh- und Mehrlingsgeburten – Letztere entstehen heutzutage wiederum hauptsächlich durch künstliche Befruchtung) ist das ganze Hightech-Instrumentarium der Frühgeborenen- und Intensivmedizin notwendig, um das Überleben und die Gesundheit von Mutter und Kind zu ermöglichen. Hier sind in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht worden, die auch Kindern unter 500g Geburtsgewicht in vielen Fällen ein Überleben ohne schwere Behinderung ermöglichen.
Leider hat sich in den letzten Jahrzehnten des 20.Jahrhunderts ein gewisses Misstrauen gegenüber dem natürlichen Geburtsvorgang entwickelt, das zu einer zunehmenden Medikalisierung von Schwangerschaft und Geburt geführt hat. Der Nutzen von Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft ist zwar grundsätzlich unbestritten. Ob sie allerdings wirklich so häufig sein müssen wie in Deutschland und teilweise in der Schweiz üblich, ist schon umstrittener. Nicht selten verunsichern Zufallsbefunde die werdenden Eltern. Die von Gynäkologen häufig empfohlene Kaiserschnittentbindung (in der Schweiz kommt jedes dritte Kind per Kaiserschnitt zur Welt) hat zu einer zunehmenden Verdrängung der natürlichen Geburt geführt. Deren Wert wurde erst in den letzten Jahren wiederentdeckt, wie unter anderem der Erfolg der immer häufiger anzutreffenden, von Hebammen geführten Geburtshäuser zeigt.
Sterben
Beim Sterben laufen ebenfalls biologische Programme ab, die wir allerdings erst allmählich beginnen, zu verstehen bzw. wiederzuentdecken. Es ist bezeichnend, dass in der internationalen Klassifizierung der Diagnosen (ICD-10) der natürliche Tod nicht vorkommt. Wenn ein Mensch stirbt, muss dies offensichtlich Folge irgendeiner Krankheit sein. Der Tod aus «Altersschwäche», wie es früher hiess, ist in der modernen Medizin gar nicht mehr vorgesehen. Kein Wunder, dass Ärzte sich bemüssigt fühlen, permanent in die Sterbevorgänge ihrer Patienten einzugreifen: Sie wissen nicht – und haben es in ihrer Ausbildung nie gelernt –, dass es so etwas wie einen natürlichen Sterbeprozess gibt, den man vorbereiten, erkennen und begleiten kann, vor allem aber nicht unnötig stören sollte (siehe Kapitel 6 und 7).
Die allermeisten Sterbevorgänge (die Schätzungen gehen bis zu 90%) könnten mit Begleitung von geschulten Hausärzten und gegebenenfalls Freiwilligendiensten problemlos zu Hause stattfinden. Bei etwa 10% der Todesfälle ist, wie wir sehen werden, spezialisiertes palliativmedizinisches Wissen notwendig, das in den meisten Fällen ebenfalls im häuslichen Bereich angewendet werden kann (durch die sogenannten mobilen Palliativdienste, siehe Kapitel 3). Und bei lediglich 1–2% der Sterbenden sind die Probleme so gravierend, dass sie nur auf einer spezialisierten Palliativstation behandelt werden können, wenn nötig unter Einsatz aller Mittel der modernen Medizin, aber mit dem ausschliesslichen Ziel der Beschwerdelinderung.
Leider hat auch beim Sterben in der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts ein zunehmender Medikalisierungsprozess eingesetzt. Durch die atemberaubenden Erfolge der operativen Medizin und der Intensivmedizin hat sich so etwas wie ein Allmachtsgefühl in der Medizin breitgemacht. Dies führte dazu, dass der Tod als Feind und sein Eintreten als Versagen, wenn nicht gar als narzisstische Kränkung empfunden wurde – und teilweise noch wird. Ein Interview mit Deutschlands wohl berühmtestem Herzchirurgen, Professor Bruno Reichart von der Universität München, trug im Jahr 2007 den vielsagenden Titel «Ich hasse den Tod».2 Die Folgen dieser Einstellung waren und sind unnötiges Leiden für Patienten und ihre Familien sowie Frustration und Burnout bei Ärzten und Pflegenden.
Ähnlich wie bei der Geburt hat auch beim Sterben als Reaktion auf diese Fehlentwicklung ein Prozess des Umdenkens eingesetzt, der zur «Wiederentdeckung» des natürlichen Todes und der urärztlichen Aufgabe der Sterbebegleitung geführt hat («Heilen manchmal, lindern oft, trösten immer», lautet eine alte Definition des Arztberufs).3 Ist auf der einen Seite von der «sanften Geburt» die Rede, so wünschen sich fast alle Menschen einen «sanften Tod». Was damit gemeint sein kann, welche Hilfsmöglichkeiten es gibt und wie man sich darauf vorbereiten kann, davon wird in den folgenden Kapiteln die Rede sein.