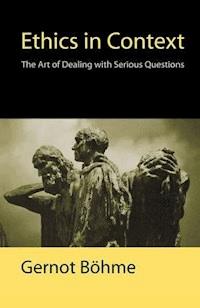15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Wir leben in ständig wachsendem Wohlstand und seit über 70 Jahren in demokratischem Frieden. Doch statt Zufriedenheit macht sich bei vielen ein Unbehagen breit. Die Leistungsansprüche der Arbeitswelt kolonialisieren die Freizeit, Klagen über Schlafstörungen und Depressionen sind in allen Gesellschaftsschichten zu hören. Wie kommt es dazu?
In interdisziplinärer Zusammenarbeit untersuchen Gernot und Rebecca Böhme Quellen des Unbehagens in unserer Lebenswelt. Eigentlich müsste sich im Großen etwas ändern, doch darauf kann der Einzelne nicht warten. Gemeinsam schlagen der Philosoph und die Neurowissenschaftlerin Strategien vor, wie wir Stress und Überforderung entgegenwirken können. Ihr ebenso kritischer wie optimistischer Essay postuliert: »Es gibt doch ein richtiges Leben im Falschen.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Ähnliche
Titel
Gernot Böhme/Rebecca Böhme
Über das Unbehagen im Wohlstand
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Vorwort Nach Corona? Exit?
Dieses Buch ist eine Kritik des Gegenwartsbewusstseins, die unter dem Titel »Unbehagen im Wohlstand« steht. Es unterstellt, dass dieses Bewusstsein vom Gefühl, im Wohlstand zu leben, fundiert ist, wenngleich es gewissermaßen angekränkelt ist, prekär, besorgt oder sagen wir es mit Hegel: »unglücklich«. Wenn wir es als »Unbehagen« qualifizieren müssen, so wird das erst richtig deutlich, wenn man es mit Goethe'schen Texten, also etwa mit den Gesprächen der Bürger während des Osterspazierganges im Faust oder mit den nachbarlichen Gesprächen in Hermann und Dorothea, vergleicht. Was uns da als bürgerliches Selbstbewusstsein entgegentritt, ist ein sicheres Selbstbewusstsein, die Erfahrung des Wohlstandes als Sicherheit und Situiertheit, als Legitimität eines Wohlstandes, der ererbt und erarbeitet ist und den man nun in Ruhe genießen kann. Nichts von alledem ist vergleichbar mit der psychischen Lage, in der sich unser Wohlstandsbürger, in der wir uns vorfinden: gestresst, besorgt, verunsichert und kein Genuss, der nicht durch schlechtes Gewissen getrübt ist.
Und nun Corona. In einem Zustand, in dem fast alle Selbstverständlichkeiten ausgehebelt sind, würde kaum jemand noch sagen »Uns geht es doch gut«. Nicht nur, dass viele Unternehmen Insolvenz beantragen mussten und viele Menschen arbeitslos geworden sind. Vielmehr sind auch diejenigen, die freigesetzt worden sind durch Streichung aller Termine, durch Kurzarbeit oder Homeoffice in einem Nebel von Ungewissheit gefangen, so dass eine nur einigermaßen sichere Zukunftserwartung, wie sie letztlich zum Gefühl der Behaglichkeit gehört, nicht zu erwarten ist. Gleichwohl ist die Grundierung des Gegenwartsbewusstseins, nämlich, dass wir im Wohlstand leben, nicht verschwunden; und das ist der Entschiedenheit, mit der Bund und Länder als Krisenmanager auftreten, und dem ihnen antwortenden Zutrauen zu verdanken: Der Staat wird's schon richten. Hier hat die Entschiedenheit staatlichen Handelns ein neues Zutrauen zum Staat geschaffen. Zum »Vater Staat«, auf dessen Fürsorge man sich verlassen kann beziehungsweise die man legitimerweise einfordern kann. Zwar haben staatliche Stellen immer wieder darauf hingewiesen, dass wir dank unserer vernünftigen und sparsamen Politik in den letzten Jahren uns die großzügige Hilfe auch leisten könnten. Freilich wird dabei verdeckt, dass viele Maßnahmen der bisherigen radikalen Sparpolitik – schwarze Null – dafür verantwortlich waren, dass ein Behagen im Wohlstand nicht aufkommen konnte, dass die auf Effizienz gerichtete Wohlstands- und Technologiepolitik uns die Lebensumstände als »stählernes Gehäuse« (Max Weber) empfinden ließ.
Und nun steht der Exit an, die schrittweise Rückkehr zur Normalität. Dabei stellt sich die Frage, ob »nach Corona« überhaupt bedeuten kann, dass wir zu Zuständen zurückkehren, die vor Corona normal waren, und vor allem – das ist ja unsere Grundfrage unter dem Stichwort eines »Unbehagens im Wohlstand« –, ob diese Rückkehr überhaupt wünschenswert ist. Die Kritik, die in unserem bisherigen gebrochenen Wohlstandsbewusstsein sich schon anbahnte, muss in einer Zeit, in der sehr viele unserer Lebensgewohnheiten suspendiert sind, explizit werden. Was sagte uns denn das Unbehagen, mit dem wir unsere Situation im Wohlstand wahrnahmen, über dessen Legitimität und Stimmigkeit? Inzwischen haben sich die außerordentlichen Aufwendungen des Staates zur Abwendung oder auch nur Milderung der Folgen der Pandemie zu einer Politik der Wirtschaftsförderung gewandelt. Natürlich muss man den Ministern, die für Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik verantwortlich sind, zugestehen, dass sie tun, was ihres Amtes ist. Und wenn unser Wohlstand auf einer gut funktionierenden Wirtschaft und einer stabilen Finanzlage beruht, so ist natürlich auch in diesem Sinne ein Konjunkturprogramm, mit dem Wirtschaft, aber auch Konsum wieder angekurbelt werden sollen, fast selbstverständlich. Nur darf man nicht vergessen, dass diese Wirtschafts- und Finanzpolitik den Maximen des Kapitalismus folgt. Danach ist eine Wirtschaft nur gut, wenn sie wächst, und das Wachstum wird am Bruttoinlandsprodukt gemessen. Die Borniertheit, die in diesem Denken liegt, werden wir später in diesem Buch analysieren. Hier muss nur festgehalten werden, dass »Rückkehr zur Normalität« nicht verstanden wird als Rückkehr zu einem stabilen Zustand, sondern als Wiederanknüpfen an eine dynamische Entwicklung, die »Wachstum« hieß. Es soll ja keineswegs bloß das Niveau des bisherigen Bruttoinlandsproduktes wieder erreicht werden, sondern eine vorübergehende Krise durch ein verschärftes Wachstum in den nächsten Jahren ausgeglichen werden. Da Deutschland eine Exportnation ist, heißt das ferner, dass die staatliche Konjunkturpolitik darauf zielt, für Deutschland wieder eine »Spitzenstellung« im internationalen Konkurrenzkampf zu erreichen. Das heißt aber, dass die staatlichen Maßnahmen zur Förderung von Wirtschaft und Konsum, die allerdings für die Reparatur der Schäden, durch die unser Wohlstand zurückgegangen war, nötig sind, darüber hinaus jedoch als »Normalität« zugleich auf die Wiederherstellung von Strukturen abzielen, die dafür verantwortlich sind, dass der Wohlstand eben mit Unbehagen wahrgenommen wurde.
Und überhaupt: Was heißt »Exit«? Dieser Ausdruck, der als politisches Schlagwort in unbedachter Weise dem Ausdruck »Brexit« (für den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union) nachgebildet wurde, unterstellt, dass irgendwann einmal – oder gar bald – mit der Corona-Zeit Schluss ist, so wie man einen Raum verlässt und die Tür hinter sich zuschlägt. Vor allem aber implizierte diese Perspektive auf ein definitives baldiges Ende der Pandemie eine tiefliegende – sogar auf die Bibel gestützte – Illusion, nämlich, dass man die Natur beherrschen könne. Im Zusammenhang von Krankheit und Gesundheit implizierte diese Illusion die Hoffnung auf »Ausrottung« bestimmter Erreger oder gar die Abschaffung von Krankheit überhaupt. Dabei fällt die Erfahrung unter den Tisch, dass auch große Erfolge in der Krankheitsbekämpfung – nehmen wir als Beispiel die Tuberkulose (TBC) oder die Malaria – nicht durchschlagend waren: Im Falle von TBC und ihrer Bekämpfung durch Antibiotika führte gerade der Erfolg der Bekämpfung zur Entstehung resistenter Bakterienstämme. Im Falle von Malaria, dass einerseits gerade das wirksamste Mittel gegen die Malaria übertragenden Mücken, nämlich DDT, wegen seiner verheerenden Nebenwirkungen verboten werden musste und dass andererseits die Erreichbarkeit von betroffenen Bevölkerungsschichten beschränkt war und ist. Für den Kenner: Beides sind typische Beispiele für die Dialektik der Aufklärung.
Ferner wurde der Bevölkerung suggeriert, dass durch Erreichung von Herdenimmunität – nämlich, dass dann, wenn zwei Drittel der Bevölkerung eine Covid-19-Erkrankung hinter sich haben (und das würde für Deutschland bedeuten, mindestens fünfzig Millionen Personen) – die Verbreitung der Erkrankung zum Stillstand kommen werde. Das stimmt zwar, bedeutet aber nur, dass sie von diesem Zeitpunkt an von selbst nicht mehr exponentiell wachsen werde – aber das heißt umgekehrt gerade: endemisch geworden ist, also schlicht zum Alltagsrisiko gehören wird. Dieser Zustand – also mit einer Reproduktionsrate von 1 (auf jeden Geheilten kommt nur eine Neuansteckung) – kann, wie wir gesehen haben, durch massive Schutzmaßnahmen »simuliert« werden, die aber so aufwändig und vor allem kostspielig sind, dass sie nicht auf Dauer durchgehalten werden können. So oder so: Wir müssen lernen, mit Corona zu leben.
Doch wenn die massiven Restriktionen für Wirtschaft, Verkehr und Konsum, also die Maßnahmen, die man unter dem Schlagwort »Shutdown« zusammenfasst, nicht durchgehalten werden können, so gewinnen die Vorschriften für das individuelle Verhalten aller Bevölkerungsteile, also strikte Hygiene, körperlicher Abstand und Schutzmasken, den Charakter von bürgerlichem Wohlverhalten – mit unabsehbaren Folgen für den psychosozialen Bereich.
Was heißt unter diesen Perspektiven »Rückkehr zu Normalität«? Viele sprechen heute unter den genannten Perspektiven vorsichtshalber von einer neuen Normalität, und das heißt genau genommen, dass es eben keine Rückkehr ist. Vielmehr würde sogar der Begriff »Normalität« seinen Sinn verändern: Er wird nicht einfach das durchschnittlich Erwartbare bezeichnen, sondern die Erwartung bereits moralisieren. Und sei es auch nur durch Einführung neuer Üblichkeiten. Damit gibt es ja im Zusammenhang der Aids-Pandemie Erfahrungen. Hier wurde mit einigem Erfolg unter dem Schlagwort »Safer Sex« eine neue Üblichkeit in das sexuale Verhalten eingeführt, die nicht mehr nur das traditionelle, schon moralisierte Verhütungsproblem betrifft, sondern bereits die mögliche mit Sexualverkehr verbundene Ansteckung.
Ein weiterer Grund, weshalb die neue Normalität keine Rückkehr zum Bisherigen sein kann, ist zu erwarten, weil eine ganze Reihe von Problemen an die Wirtschaftsförderungsmaßnahmen angehängt wurden, die durch die verdrängende Wahrnehmung der Corona-Krise in den Hintergrund geraten sind: Es handelt sich vor allem um das Thema Klimaschutz, aber eben auch um den sogenannten ökologischen Fußabdruck. Unter der Forderung des Klimaschutzes wurden bei den coronabedingten Wirtschaftsförderungsmaßnahmen nur solche Technologien gefördert und für nur solche Konsumgüter Zuschüsse bewilligt, die zumindest »klimaneutral« sind oder eben sogar den CO2-Ausstoß verringern. Der Problembereich, der häufig unter dem Stichwort »ökologischer Fußabdruck« zusammengefasst wird, wurde in den öffentlichen Debatten wegen der Anschaulichkeit meist nur als Problem des Plastikmülls genannt. Tatsächlich handelt es sich sogar bei dem Plastikmüll gerade um Mikroplastik, also feinste Teilchen, die man nicht sieht, die aber in allen Umweltmedien inzwischen enthalten sind. Aber eben viel allgemeiner um die Verteilung feinster Partikel – von Antibiotika angefangen bis hin zu Nano-Teilchen –, die für alle möglichen Krankheiten, für Krebs und sich immer weiter ausbreitende Allergien mitverantwortlich sein könnten. Schließlich darf man, wenn es um den ökologischen Fußabdruck geht, nicht das Problem des radioaktiven Abfalls unerwähnt lassen. Diese vorübergehend zumindest verdrängten Hauptprobleme der Menschheitsentwicklung wurden durch die beabsichtigten Maßnahmen der Wirtschaftsförderung quasi im Huckepackverfahren berücksichtigt. Und das ist gut so. Gleichwohl ist zu befürchten, dass diese beschwichtigende Methode hier das Problembewusstsein abschwächt, das schon bisher nicht ausgereicht hat, wirklich durchschlagende Maßnahmen politisch durchzusetzen.
Was haben wir in »Quarantäne« gelernt?
Wir haben uns in unserem Buch auch das Ziel gesetzt, Verhaltensweisen anzuraten, durch die das Unbehagen in gewisser Weise überwunden wird, beziehungsweise Verhaltensweisen, die wie Schleichwege, auch unter den Bedingungen von Leistungsgesellschaft, Konsumgesellschaft und technische Zivilisation ein »richtiges Leben im falschen« ermöglichen. Adornos Diktum »es gibt kein richtiges Leben im falschen« artikulierte ja eine Resignation gegenüber der Hoffnung, durch individuelle Verhaltensänderung einen Wandel des Ganzen zu bewirken. Diese Resignation könnte auch der Kern des Gefühls sein, mit dem die Wohltaten des Lebens im Wohlstand »genossen« werden: Im Unbehagen meldet sich intuitiv eine Kritik an Verhältnissen, aus deren wohltuender Verstrickung man sich nicht befreien kann oder will. Hier nun könnte die Corona-Krise sich als heilsame Lehre erweisen. Die erzwungene Quarantäne, die, wenn nicht jedermann, doch so ein großer Teil der Bevölkerung erlitten hat, könnte uns gelehrt haben, was uns eigentlich wichtig ist. Beziehungsweise sie könnte sich als ein Verhalten erweisen, das zunächst nur durch Verordnungen erzwungen war, aber wert wäre, auf Dauer gestellt zu werden. Diese beiden Satzhälften scheinen sich zu widersprechen, sie sind aber nur die Pole, zwischen denen unsere Corona-Erfahrungen sich abspielten. Natürlich wäre es schrecklich, wenn das erzwungene Abstandsverhalten zwischen den Menschen auf Dauer gestellt würde, weil die Versagungen in der Corona-Quarantäne uns gerade gelehrt haben, wie wichtig uns leibliche Nähe ist.
Letzteres zeigte sich darin, dass Ereignisse des zivilen Ungehorsams – also Abweichungen vom verordneten Hygieneverhalten – besonders in Bereichen sich ereigneten, in denen es um leibliche Nähe ging. Allerdings auch hier erst, nachdem die Wirkungen der angeordneten Versagungen spürbar oder publik wurden. Zunächst wirkten sich Reste von deutscher Untertanenmentalität aus, nämlich als vorlaufender Gehorsam beziehungsweise Übererfüllung von Normen. Mancherorts wurden die Abstandsregeln auch innerhalb einer Familie eingeführt und die »Empfehlung«, Großeltern zu meiden, wurde als Gebot ausgelegt. In den Kirchen nahm man sang- und klanglos die Versagung von Verhaltensweisen hin, die als essentials christlich religiöser Praxis anzusehen sind – von der liturgischen Gemeinschaft der Gottesdienste bis hin zur Eucharistie. Und mancherorts wurde Kranken und Sterbenden die seelsorgerische und persönliche Nähe von Freunden und Verwandten verwehrt, die gerade aufgrund des Infektionsschutzgesetzes als Ausnahmen zugelassen sind.[1] In dieser prekären Situation – das wollen wir hier feststellen – haben wir gelernt, was in Science-Fiction-Romanen von George Orwells 1984 bis zu Dave Eggers' The Circle schon zu lesen war, nämlich dass Liebe eine subversive Kraft ist. Und wir haben gelernt, dass leibliche Nähe etwas ist, das wir pflegen müssen, dass sie einer Kultur bedarf angesichts einer Gesellschaft, die »nach Corona« auch weiterhin durch Hygiene und Abstandsregeln bestimmt sein wird.
Die Versagung von Reisen, insbesondere von Fern- und Auslandsreisen, nicht nur durch staatliche Regelungen, sondern auch durch den Zusammenbruch des Systems ziviler Luftfahrt, hat uns – oder sagen wir vorsichtiger: viele von uns – gelehrt, die Region, in der wir leben, kennenzulernen. Es ist schon erstaunlich, wie viele Leute, die sich beruflich und touristisch überall in der Welt tummeln, die Gegend nicht kennen, die sie noch immer Heimat nennen. Manchem wird der längst vergessene Werbespruch eingefallen sein: »Warum in die Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt so nah.« Im Zuge der neuen Regionalität hat man nicht nur die Schönheit deutscher Landschaften und Städte wieder schätzen gelernt, sondern auch deren historische Tiefe. Das Interesse an geschichtlicher Tiefe, das bisher touristischen Hot Spots zugeordnet wurde, ließ in der mageren Corona-Zeit schließlich auch die Zeit-Dimension der eigenen Region entdecken. Ganz analog das Verhältnis zu den räumlich nahen anderen Menschen, der Nachbarschaft: Was bisher nur flüchtige Gruß-Beziehungen waren, wurde aufgrund staatlichen Anratens mit einem Male zur vielfach ungewohnten nachbarschaftlichen Solidarität. Wir lernten, in welchem Maße doch Nachbarschaften zu bloßem Nebeneinander verkommen waren und in welchem Ausmaß wir unsere Erwartungen an Solidarität an allgemeine Einrichtungen, von der Caritas über die Versicherungen bis hin zum Staat, delegiert hatten und dabei die Ausbildung nachbarschaftlicher Gemeinschaft versäumten. Es ist wahr, dass diese Delegation von Solidaritätserwartungen sich in der Corona-Zeit noch erheblich verstärkt hat, zumal der Wohlfahrtsstaat diesen Erwartungen auch durchaus entsprochen hat. Umso mehr wurde deutlich, dass wir Gemeinschaften eigens entwickeln und pflegen müssen, das heißt uns um ein Leben nicht bloß unter, sondern auch mit Menschen kümmern müssen.
Die Corona-Krise hat im Bereich von Bildung und Erziehung wie auch im Bereich von Kulturkonsum einen ungeheuren Digitalisierungsschub bewirkt. Die erstaunlich schnelle Substitution von Vorlesungen, Seminaren und schulischem Unterricht, von Museums- und Konzertbesuchen durch digitale Veranstaltungen und Handlungen hatte zunächst den Eindruck erzeugt: Es geht ja auch so. Und einiges davon wird bleiben, weil die digitale Vermittlung von Lernstoffen eine – zumindest partielle – Abhilfe angesichts des fatalen Lehrermangels zu sein scheint und weil angesichts der touristischen Übernutzung von Kulturdenkmälern sich die digitale Kenntnisnahme zu einer bevorzugten Methode kultureller Bildung entwickeln könnte. Doch es regen sich Widerstände: Die digitale Vermittlung schulischer Lehre hat eigentlich nur dort funktioniert, wo neben der technischen Ausrüstung im Hause auch die elterliche Unterstützung wirksam war, also bei den ohnehin sozial und kulturell privilegierten Familien. Aufgrund dieser Tatsache breitet sich in der Lehrerschaft die Einsicht aus, dass schulischer Unterricht nicht nur Informations- und Kompetenzvermittlung ist, sondern den Auftrag hat, soziale Ungleichheiten abzumildern und in der Schülerschaft soziales Verhalten einzuüben.[2] Was die Corona-Zeit hier gelehrt hat, könnte die Einsicht sein, dass gerade Letzteres, also die Verringerung sozialer Ungleichheit und die Einübung sozialer Kompetenzen in der Schülerschaft, das Zentrum schulischer Bildung ausmacht. Daran gemessen wird die Ausbildung von Lehrern, die mehr und mehr zu einer wissenschaftlichen degeneriert ist, im Sinne einer allgemeinen Pädagogik wörtlich verstanden – der Pädagoge ist der Begleiter der Kinder – transformiert werden müssen. Das Pisa-Ranking, das Schule, Lehrer, aber auch Schüler und Schülerinnen unter einen disziplinären Leistungsdruck gesetzt hat, sollte damit obsolet werden. Doch diese Einsichten artikulieren nur das Unbehagen, das von der Schule über die Universität bis in den Wissenschaftsbetrieb durch Benotung, Bewertung und Ranking einen Grauschleier über dieses ganze System, das doch eigentlich der Bildungsfreiheit, dem Wissen-Wollen und der Wahrheitssuche dienen sollte, geworfen hat. Auch hier wird es großer Anstrengungen bedürfen, um das in Corona-Zeiten Gelernte nicht wieder von technikbedingten Trends überspülen zu lassen.
Das gilt in analoger Weise auch für den Bereich, der hier schon in kritischer Weise als »Kulturkonsum« bezeichnet wurde: Was Adorno seinerzeit als Kulturindustrie kritisiert hatte, nämlich Ökonomisierung und Technisierung der Teilnahme des Einzelnen am »kulturellen Kapital«, also den kollektiven Kulturgütern, wurde am Anfang der Corona-Krise freudig als Modernisierungsschub der Kulturvermittlung begrüßt. Gleichzeitig wurde aber der Charakter solcher Kulturvermittlung als eines bloßen Substituts deutlich, dass man nämlich durch die technische Vermittlung eigentlich nicht mit den kulturellen Werken selbst, sondern mit ihren Repräsentanten, genau genommen mit Datensätzen, zu tun hat. Das Unbehagen im Kulturbetrieb, bei dem etwa in überfüllten Museen Besucher mit ihrem Smartphone, das ihnen als Audioguide diente, vor Bildern standen, dieses Unbehagen könnte dazu führen, den Besuch von Konzerten, an Stelle ihrer telekommunikativen Vermittlung, und die Begegnung mit den Kunstwerken selbst wieder neu zu schätzen und zu pflegen. Der Aura-Verlust, den Walter Benjamin in seinem Aufsatz über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit konstatiert hat, wurde in Corona-Zeiten auf die Spitze getrieben.[3] Allerdings ist die Digitalisierung der Kunstvermittlung auch eine Demokratisierung, sofern sie eine Teilnahme von jedermann an unseren kulturellen Gütern ermöglicht. Umso mehr wäre dem eine intensive individuelle Bemühung um Originale entgegenzusetzen, um nämlich diese Teilnahme beim Einzelnen in kulturelle Bildung zu verwandeln.
Das Unbehagen im Wohlstand war und ist durch die Erfahrung bestimmt, dass Konsum in der Regel nicht zur Befriedigung führt. Das liegt nicht etwa an Übersättigung, dass man also im Wohlstand lebend mehr hat, als man eigentlich braucht, sondern vielmehr daran, dass ein Großteil der Waren, um nicht zu sagen fast alle, nicht eigentlich ein Bedürfnis befriedigen, sondern darüber hinaus den Appetit anregen. In jedem technischen Gerät, das man erwirbt, ist bereits das Bedürfnis nach der nächsten Version angelegt. Das modische Kleidungsstück ist nur der ephemere Vorgeschmack auf die nächste Mode. Jede Reise in die Ferne legt nahe, den Horizont noch weiter auszudehnen. Jede Tüte Chips macht Appetit auf die nächste. Das hat bei vielen Menschen dazu geführt, dass die Konsumbefriedigung sich vom Glück, etwas zu haben, auf das freudige Erlebnis des Kaufens verschoben hat. Doch die Gründe liegen tiefer, nämlich darin, dass Konsum nicht eigentlich oder nur noch nebenher der Reproduktion des Lebens dient – wie noch Karl Marx glaubte. Heute dient Konsum vor allem der Steigerung des Lebens. Konsum dient der Ausstattung und der Selbstinszenierung des Konsumenten. Dem Unbehagen, mit dem solcherart Konsumverhalten einhergeht, wird auch nicht abgeholfen durch eine Konsumkritik, in der Waren nach Zusammensetzung, Herkunft, Produktionsweisen und Transportwegen akribisch analysiert werden, weil Kritik das Unbehagen noch vermehrt oder gar ein schlechtes Gewissen beim Konsumieren erzeugt. Die vorübergehende Konsumeinschränkung in der Corona-Krise wurde schnell überwunden, indem auch der letzte Datenmuffel die Möglichkeit einer Allround-Versorgung über den Onlinehandel für sich entdeckte. Und doch ist vielen Menschen die Weisheit aufgegangen, die der Philosoph Immanuel Kant am Ende seines Buches über die Träume eines Geistersehers formuliert: »Wie viele Dinge gibt es doch, die ich alle nicht brauche!« Wie sehr war uns, die wir im Wohlstand leben, das Bewusstsein davon abhandengekommen, was wir eigentlich wirklich brauchen. Die Besinnung darauf könnte das wichtigste Mittel sein, das Unbehagen in unserem Konsumverhalten zu überwinden.
Das Unbehagen in unserer gut funktionierenden Wohlstandsgesellschaft wurde spürbar nicht nur als Stress- und Leistungsdruck, sondern spezifischer noch durch die dichte Abfolge von Terminen. Dass unser gesellschaftliches Leben so eingerichtet war und ist, wird jedoch vielfach geradezu als Voraussetzung für unseren Wohlstand angesehen. Dieser verlangt, dass alles pünktlich funktioniert und in seinem Ablauf zuverlässig und effektiv eingerichtet ist. Das stählerne Gehäuse, das Max Weber als Charakteristikum unserer Zivilisation benannt hat, besteht wesentlich in der engen Zeittaktung, die kein entspanntes Lebensgefühl, kein Ausschweifen zulässt. Eine Gesellschaft, die ein hoch organisiertes Funktionieren verlangt, die die Möglichkeit langfristigen Planens erfordert, lässt für den einzelnen Menschen keine Zukunft mehr zu. Der Blick auf die Zukunft ist – soll man sagen: »wohlweislich«? – immer schon abgeschnitten. Der Blick reicht jeweils bis zum nächsten Donnerstag oder Montag, innerhalb des Tages bis zu dem Termin, den ich um 16 Uhr habe. Wenn man für den modernen Menschen Entwurf (Martin Heidegger) und Lebensplanung (eine Forderung der Frauenemanzipation) postulierte, so ist das in unserer Leistungs- und Konsumgesellschaft und der zeitlichen Taktung des Zusammenlebens gar nicht möglich. Deshalb brachte die Corona-Pandemie oder, besser gesagt, brachten die staatlich verordneten Gegenmaßnahmen, brachte insbesondere der sogenannte Shutdown für viele Menschen trotz der allgemeinen Bedrohung ein Aufatmen – nämlich durch die Freiheit von Terminen. Freilich, da ist zugleich die Einsicht, dass das Leben in der Terminzeit keineswegs bloß einer wirtschaftlichen und verkehrten politischen Strategie entsprang, sondern sich ebenso sehr einer Bereitschaft der Teilnehmer am gesellschaftlichen Leben zur Terminierung ebendieses Lebens verdankt.
Es wird häufig von einem Gegensatz der Werte Freiheit und Sicherheit gesprochen. Gewiss ist das Leben nach Terminen eine Einschränkung von Freiheit, eine Beengung des Lebensgefühls und eine Dämpfung kreativer Impulse. Doch hat nicht schon Kierkegaard von einer »Angst vor der Freiheit« gesprochen? Wird das Wegbrechen von Terminen wirklich von jedermann als Befreiung erfahren? Nicht viel mehr als eine Verunsicherung, gar als Langeweile? Die Restriktionen, die dem gesellschaftlichen Leben zur Eindämmung der Corona-Pandemie auferlegt wurden, haben vielfach zu Protesten geführt, vom sozialen Ungehorsam im Kleinen bis zu Demonstrationen und einer Parteigründung (Widerstand 2020 – die sich jedoch innerhalb kurzer Zeit wieder auflöste). Doch ging es dabei mehr um Widerstand als solchen. Kann man mit Freiheit wirklich etwas anfangen, ist es einem nicht viel wichtiger, dass man weiß, was man zu erwarten hat?
Freiheit ist ein Grundwert unseres Zusammenlebens. Doch eine Kultur der Freiheit ist nicht ausgebildet worden. Stattdessen ist unser Zusammenleben eher darauf angelegt, dass es in erwartbaren Bahnen verläuft und einem möglichst »nichts geschieht«. Daher die ungeheure Anzahl von Versicherungen in unserer Gesellschaft – in Deutschland hat jeder Bürger durchschnittlich fünf Versicherungen. Das Verschließen der Zukunft durch Termine gehört auch hierher: Es entspringt der Angst vor der Freiheit.
Dagegen hatte das Wegbrechen von Terminen, das von vielen als ein Aufatmen empfunden wurde, die Zukunft zumindest zwischenzeitlich wieder geöffnet (für viele war es mit der Öffnung durch die Verlagerung von Meetings in den Onlinebereich wieder vorbei). Wenn in den medialen Diskussionen darüber, was uns Corona gelehrt hat, die Vulnerabilität des Menschen als Einsicht genannt wurde, so ist das recht erstaunlich. Als ob uns erst vom Bundestagspräsidenten gesagt werden müsste, dass wir sterblich sind. Viel tiefer liegt die Einsicht, dass das menschliche Leben, das Leben jedes Einzelnen, ein Prozess mit offenem Ausgang ist. Diese Einsicht wurde durch das Zeitregime der Terminzeit und durch alle möglichen Versicherungsstrategien und Möglichkeiten der Planbarkeit des Lebens verdeckt. Wurde deshalb unser wohl organisiertes Leben als Beengung erfahren und die Öffnung der Zeit ins Unbestimmte als Befreiung? Doch: Um in den sich abzeichnenden Möglichkeiten zu leben, bedarf es einer Kultur der Freiheit.
Also, eine einfache Rückkehr zur Normalität wird es nicht geben. Doch die These dieses Buches ist, dass es sie auch gar nicht geben soll, weil, was sich bisher als normal gerierte, keineswegs wünschenswert ist. Diese Kritik des Bisherigen deutete sich, wie wir zeigen wollen, bereits in der paradoxen Mentalität eines Unbehagens im Wohlstand an. Die Frage, wie es »nach Corona« weitergehen soll, zwingt uns dazu, das Unbehagen in eine explizite Kritik des Bisherigen zu transformieren.
I. Das Unbehagen im Wohlstand
»Wenn ich durch das, was früher Straßen waren, jetzt zu Ihnen komme und unterwegs die bösartigen, verkniffenen und dabei leeren Gesichter, diese hässlichen Gesichter sehe, denke ich immer: verwandtschaftlich gesehen traurig, aber innerhalb der geschichtlichen Welt wie folgerichtig und wahr!«
Diese Zeilen stammen von Gottfried Benn und geben Eindrücke aus dem Berlin der Jahre nach 1945 wieder. Die Straßen haben längst wieder Form angenommen. Doch haben sich die Gesichter, die uns begegnen, aufgehellt? Die Bundesrepublik im Boom des Wiederaufbaus, dann Wirtschaftswunderland, und heute Deutschland in einer weltweit bewunderten Phase der Prosperität: Lebt es sich hier nicht besser als anderswo, sind die Menschen hier glücklicher als anderswo?
Wenn man sich umsieht, in diese Gesichter blickt, wenn man bei Freunden, Verwandten, Arbeitskollegen sich umhört: überall Klagen. Stress, Terminprobleme, auch wenn es nur um ein gemeinsames Abendessen geht, Erschöpfung am Rande des Burn-outs. Ist das Gejammer? Wer wird schon zugeben, dass es ihm gut geht? Einerseits belegt Deutschland bei weltweiten Umfragen zu Glück und Wohlergehen regelmäßig vordere Plätze, andererseits erreichen uns Nachrichten von steigenden Depressions- und Burn-out-Raten und von zunehmendem Arbeitsausfall aufgrund psychischer Erkrankungen. Wie diese gegensätzlichen Fakten zusammenpassen, darauf gehen wir später noch ausführlich ein.
Direkt gefragt: »Wie geht's dir?«, antwortet jeder: »Gut.« Doch das klingt eher wie: »Frag lieber nicht weiter.« Denn dann müsste man sich Klagen bezüglich der aktuellen Befindlichkeit anhören, nicht nur Krankheits- und Arztprobleme – auch das –, sondern: Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Allergien, Depression, Probleme mit Übergewicht. Ferner Unsicherheiten im Beruf, Stress, Termin- und Zeitdruck, die tägliche, die wöchentliche, die stündliche To-do-Liste.
Der Philosoph Martin Heidegger hat als Grundstimmung des menschlichen Daseins die Sorge ausgemacht – in seinem Buch Sein und Zeit aus dem Jahre 1927. Das trifft wohl auch heute noch zu: Sorge als Grundbefindlichkeit des menschlichen Daseins – jedenfalls des unsrigen. Doch hier – im Wohlstand?
Ein geflügeltes Wort, das man dem Philosophen Friedrich Nietzsche zuschreibt, lautet: »Die Christen müssten erlöster aussehen« – weil sie doch an eine Erlösung glauben, auf sie fest vertrauen.[4] Es müsste ihnen also eigentlich besser gehen. Den Satz könnte man analog auf unsere Zeitgenossen in der Wohlstandsgesellschaft anwenden. Uns geht es doch gut, denkt man, was haben denn die Leute? Sind das wohlmöglich nur subjektive Eindrücke, nach denen man das Befinden seiner Mitmenschen einschätzt, täuschen sie sich gar selbst über ihren Zustand? Sind die »verkniffenen und dabei leeren Gesichter« Zeugnis ihrer prekären Lage in beziehungsweise am Rande der Wohlstandsgesellschaft?
Es lohnt sich, die objektiven Kriterien anzusehen, nach denen unsere Gesellschaft als Wohlstandsgesellschaft eingestuft wird. Gemeint ist vor allem das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Es misst die Produktion von Waren und Dienstleistungen im Inland nach Abzug aller Vorleistungen. Schon an der Definition sieht man, dass diese Größe zunächst einmal gar nichts mit dem Wohlergehen der Bevölkerung zu tun haben muss. Warum sollte es uns besser gehen, wenn wir mehr leisten?
Gleichwohl ist es diese Größe, an der sich die Wirtschaftspolitik orientiert. Die Schlussfolgerung verläuft meistens über die Zahl der Arbeitsplätze: Wirtschaftswachstum erzeugt Arbeitsplätze – und wenn man Arbeit hat, geht es einem gut. An dieser Schlussfolgerung haben wir erhebliche Zweifel. Und auch hier lohnt es sich, Gottfried Benn zu zitieren: »dumm sein und Arbeit haben: das ist das Glück.«[5]
Zweifel daran, dass das BIP eine Aussage über das Wohlergehen einer Bevölkerung zulässt, haben schon vor geraumer Zeit dazu geführt, dass man andere Kenngrößen zur Bestimmung des Wohlergehens konstruiert hat, zum Beispiel den Genuine Progress Indicator (GPI; zu Deutsch: Indikator echten Fortschritts).[6] Dieser Indikator umfasst außer den Größen, die das BIP bemisst, weitere Größen wie »Verlust von Freizeit, Einkommensverteilung, Kosten eines Familienzusammenbruchs, Arbeitslosigkeit und andere negative Ereignisse wie Kriminalität, Verschmutzung, Erschöpfung natürlicher Ressourcen, Verlust von Böden, Wäldern und Ozon sowie langfristige Schäden wie Klimawandel«.[7]
Das BIP hängt dabei nun keineswegs – wie die Wirtschaftspolitik unterstellt – eindeutig mit dem GPI, mit dem das Wohlergehen einer Bevölkerung ermittelt werden soll, zusammen. In einer Studie von 17 Ländern (darunter Deutschland), die immerhin 53 Prozent der Weltbevölkerung umfassen, konnte gezeigt werden, dass ab etwa dem Jahr 1978 das Wohlergehen nach GPI stagniert oder gar abnimmt, obgleich das BIP für diese Länder im selben Zeitraum erheblich gewachsen ist.[8]
Eine weitere Kenngröße, die man heranziehen kann, um das Wohlergehen der Menschen, die in einem Wohlstandsstaat leben, zu quantifizieren, ist die Lebenserwartung. Dabei handelt es sich um ein sehr grobes Maß, aber eben doch um eine Annäherung an das tatsächliche Wohlergehen, denn die Lebenserwartung hängt von psychischer und physiologischer Gesundheit ab. Es ist weithin bekannt, dass die Lebenserwartung in den Industrienationen beständig zunimmt. Allerdings gab es vor einiger Zeit die aufsehenerregende Beobachtung, dass die Lebenserwartung in den USA über mehrere Jahre hinweg abgenommen hatte.[9] Unter den häufigsten Todesursachen: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Alzheimer, Diabetes und Suizid. Die genannten Erkrankungen werden häufig auch als Zivilisationskrankheiten bezeichnet – Erkrankungen, die mit unserem Lebensstil zusammenhängen. Dass Suizid über Jahre hinweg eine der häufigeren Todesursachen ist, legt die Schlussfolgerung nahe, dass es den Menschen psychisch nicht gut geht. Man kann argumentieren, dass die Lage in Deutschland anders sei, und das ist sie in Bezug auf das Krankenversicherungssystem und den Zugang zu verschreibungspflichtigen Medikamenten und Waffen auch. Tatsächlich zeigt sich in Deutschland auch noch keine Abnahme der Lebenserwartung – jedoch gibt es Zeichen zur Beunruhigung diesbezüglich: Die Lebenserwartung hängt stark von der sozioökonomischen Lage ab (mit ganzen acht Jahren Unterschied zwischen der sozioökomisch stärksten und schwächsten Gruppe bei Männern)[10] – und die verschlechtert sich, zumindest für große Teile der Gesellschaft. Auch in Deutschland gehören die Zivilisationserkrankungen zu den häufigsten Todesursachen – und psychische Belastungen, die zu Burn-outs, Angststörungen, Suchtmittelkonsum oder Depression führen, sind weit verbreitet.[11] Auf weitere Untersuchungen zum Thema »Glück« gehen wir noch ein. Hier geht es zunächst einmal darum, anhand grober Maße wie dem BIP aufzuzeigen, dass Wohlstand nicht zwangsläufig Wohlergehen bedeutet.
Doch was ist eigentlich Unbehagen?
Wir gehen also davon aus, dass das Unbehagen im Wohlstand keineswegs bloß eine abwertende, gar undankbare Haltung gegenüber Wirtschaft und Politik ist, sondern eine intuitive Reaktion auf objektive, das heißt messbare Mängel unserer Lebenslage. Wir spielen mit dem Titel des vorliegenden Buches auf Sigmund Freuds 1930 erschienene Arbeit über Das Unbehagen in der Kultur an.[12] Er geht dort der Vermutung nach, dass der Mensch sich unbehaglich fühlt – gar neurotisch wird –, »weil er das Maß an Versagung nicht ertragen kann, das ihm die Gesellschaft im Dienste ihrer kulturellen Ideale auferlegt«.[13] Das ist zwar nicht unser Thema, doch es gibt Analogien: Auch bei Freud geht es darum, dass sich der Mensch bei gewissen gesellschaftlichen Segnungen nicht wohlfühlt, obgleich er sie anerkennt und gern von ihnen Gebrauch macht. Bei Freud geht es um die zivilisatorische Sicherheit, die mit Triebverzicht bezahlt wird; bei uns um das ökonomische Wohlergehen (welfare), das nicht mit Wohlbefinden (well-being) einhergeht: Uns geht es gut, doch wir fühlen uns nicht gut.
Der Ausdruck »Un-Behagen« transportiert erstaunlicherweise bereits die Mehrdeutigkeit beziehungsweise die etwas unangenehme Ambivalenz, die wir dadurch eigens hervorheben, dass wir Befindlichkeit und objektive Lage je für sich thematisieren. Denn Unbehagen ist nicht der ausschließende Gegensatz zu Behagen, Unbehagen ist ja nicht Schmerz oder Leid. Unbehagen ist misslingendes, immer wieder missglückendes Behagen. Eigentlich sollte es uns angesichts unserer objektiven Lage gut gehen, doch es gelingt uns nicht. Unbehagen ist ein gestörtes, ein zweifelndes, ein schuldbewusstes, ein angestrengtes Behagen – also zwar Behagen, während »weit, in der Türkei, / Die Völker aufeinander schlagen«.[14] Unsere Grundbedürfnisse können mühelos befriedigt werden. Doch die Lebensmittel haben einen bitteren Beigeschmack, die soziale Lage der meisten unserer Mitbürger ist prekär – und ist die Türkei nicht ein Nato-Staat?
Von außen betrachtet mag Deutschland wie ein Paradies erscheinen. Doch wie lebt es sich in diesem Paradies? Wie kommt das Unbehagen in diesem Paradies zustande? Und letztlich, was kann der oder die Einzelne dafür tun, dass es ihm oder ihr besser geht? Das sind die Fragen, denen wir in diesem Buch nachgehen möchten.