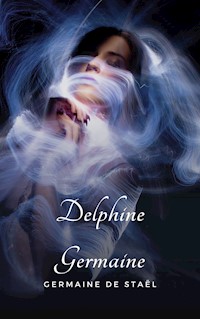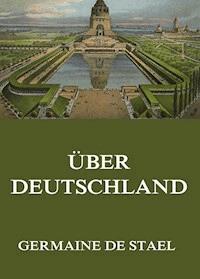
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
"Über Deutschland" wurde 1810 fertiggestellt, jedoch sofort nach dem Druck von der napoleonischen Zensur verboten, samt Manuskript konfisziert und eingestampft. Denn es zeigte den Franzosen ein (stark idealisiertes) Deutschland als Kontrast und teilweise auch als Vorbild für ihr militaristisches und zentralistisches, von Napoleon diktatorisch regiertes und mundtot gemachtes eigenes Land jener Jahre. Das Bild eines regionalistisch vielfältigen, musik-, philosophie- und literaturbegeisterten, gefühls- und phantasiebetonten, mittelalterlich-pittoresken, allerdings auch etwas rückständigen und harmlosen Deutschlands, das Madame de Staël so entwarf, sollte nach 1815 jahrzehntelang die Sicht der französischen Eliten prägen. Die Bezeichnung Deutschlands als "Land der Dichter und Denker" ist auf dieses Werk zurückzuführen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1066
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über Deutschland
Germaine de Staël
Inhalt:
Germaine von Staël-Holstein – Biografie und Bibliografie
Über Deutschland
Vorrede.
Allgemeine Bemerkungen.
Erster Theil.
I. Abtheilung. Deutschland und die Sitten der Deutschen.
Erstes Capitel. Ansicht von Deutschland.
Zweites Capitel. Sitten und Character der Deutschen.
Drittes Capitel. Die Frauen.
Viertes Capitel. Vom Einfluß des Rittergeistes auf Liebe und Ehre.
Fünftes Capitel. Das südliche Deutschland.
Sechstes Capitel. Oestreich.
Siebentes Capitel. Wien.
Achtes Capitel. Geselliger Umgang in Wien.
Neuntes Capitel. Nachahmung des französischen Geistes.
Zehntes Kapitel. Von der hochfahrenden Albernheit und der gutmüthigen Mittelmäßigkeit.
Eilftes Capitel. Von dem Geist der Unterhaltung.
Zwölftes Capitel. Von der deutschen Sprache in ihren Beziehungen mit dem Geiste der Unterhaltung.
Dreizehntes Capitel. Vom nördlichen Deutschland.
Vierzehntes Capitel. Sachsen.
Fünfzehntes Capitel. Weimar.
Sechszehntes Capitel. Preussen.
Siebzehntes Capitel. Berlin.
Achtzehntes Capitel. Die deutschen Universitäten.
Neunzehntes Capitel. Von den besonderen Erziehungs- und Wohlthätigkeits-Anstalten.
Zwanzigstes Capitel. Das Fest zu Interlaken.
II. Abtheilung. Literatur und Kunst.
Vorrede.
Erstes Capitel. Warum lassen die Franzosen der deutschen Literatur nicht Gerechtigkeit widerfahren?
Zweites Capitel. Wie man in England über deutsche Literatur urtheilt.
Drittes Capitel. Von den Haupt-Epochen der deutschen Literatur.
Viertes Capitel. Wieland.
Fünftes Capitel. Klopstock.
Sechstes Capitel. Lessing und Winkelmann.
Siebentes Capitel. Goethe.
Achtes Capitel. Schiller.
Neuntes Capitel. Vom Stil und der Verskunst in der deutschen Sprache.
Zehntes Capitel. Von der Poesie.
Eilftes Capitel. Von der classischen und der romantischen Poesie.
Zwölftes Capitel. Von den deutschen Gedichten.
Dreizehntes Capitel. Von der deutschen Poesie.
Vierzehntes Capitel. Vom Geschmack.
Zweiter Theil.
I. Abtheilung. Literatur und Kunst (Fortsetzung.)
Fünfzehntes Capitel. Dramatische Kunst.
Sechszehntes Capitel. Lessings Schauspiele.
Siebenzehntes Capitel. Die Räuber und Don Carlos, von Schiller.
Achtzehntes Capitel. Wallenstein und Maria Stuart.
Neunzehntes Capitel. Die Jungfrau von Orleans. Die Braut von Messina.
Zwanzigstes Capitel. Wilhelm Tell.
Ein und zwanzigstes Capitel. Götz von Berlichingen und Egmont.
Zwei und zwanzigstes Capitel. Iphigenia in Tauris. Torquato Tasso.
Drei und zwanzigstes Capitel. Faust.
II. Abtheilung. Literatur und Kunst (Fortsetzung.)
Fünf und zwanzigstes Capitel. Einzelne Werke der Teutschen und Dänischen Bühne.
Sechs und zwanzigstes Capitel. Das Lustspiel.
Sieben und zwanzigstes Capitel. Von der Declamation.
Acht und zwanzigstes Capitel. Von den Romanen.
Neun und zwanzigstes Capitel. Von den deutschen Geschichtschreibern und von Johannes von Müller insbesondere.
Dreißigstes Capitel. Herder.
Ein und Dreißigstes Capitel. Von den literarischen Reichthümern Deutschlands und von seinen berühmtesten Kunstrichtern, Aug. Wilh. und Friedrich Schlegel.
Zwei und dreißigstes Capitel. Von den schönen Künsten in Deutschland.
Dritter Theil.
I. Abtheilung. Die Philosophie und die Moral.
Erstes Capitel. Von der Philosophie.
Zweites Capitel. Von der englischen Philosophie.
Drittes Kapitel. Von der französischen Philosophie.
Viertes Capitel. Von der Spötterei, die eine gewisse Art von Philosophie eingeführt hat.
Fünftes Capitel. Allgemeine Bemerkungen über die deutsche Philosophie.
Sechstes Capitel. Kant.
Siebentes Capitel. Von den berühmtesten Philosophen Deutschlands vor und nach Kant.
Achtes Capitel. Einfluß der neuen deutschen Philosophie auf die Entwickelung des Geistes.
Neuntes Capitel. Einfluß der neuen deutschen Philosophie auf die Literatur und die Künste.
Zehntes Capitel. Einfluß der neuen Philosophie auf die Wissenschaften.
Eilftes Capitel. Von dem Einfluß der neuen Philosophie auf den Charakter der Deutschen.
Zwölftes Capitel. Von der auf persönlichen Vortheil gegründeten Moral.
Dreizehntes Capitel. Von der auf das National-Interesse gegründeten Moral.
Vierzehntes Capitel. Von dem Moralprincip in der neuen deutschen Philosophie.
Fünfzehntes Capitel. Von der wissenschaftlichen Moral.
Sechszehntes Capitel. Jacobi.
Siebzehntes Capitel. Ueber den Woldemar.
Achtzehntes Capitel. Von der romanhaften Stimmung in den Zuneigungen des Herzens.
Neunzehntes Capitel. Von der Liebe in der Ehe.
Zwanzigstes Capitel. Von den Moralisten der alten Schule in Deutschland.
Ein und zwanzigstes Capitel. Von der Unwissenheit und von der Leichtfertigkeit des Geistes in ihren Verhältnissen zur Moral.
Zweite Abtheilung: Die Religion und der Enthusiasmus.
Erstes Capitel. Allgemeine Betrachtungen über die Religion in Deutschland.
Zweites Capitel. Von dem Protestantismus.
Drittes Capitel. Von dem Cultus der mährischen Brüdergemeinde.
Viertes Capitel. Vom Katholizismus.
Fünftes Capitel. Von der religiösen Anlage, die man Mysticismus nennt.
Sechstes Capitel. Von dem Schmerze.
Siebentes Capitel. Von den religiösen Philosophen, die man Theosophen nennt.
Achtes Capitel. Von dem Sectengeist in Deutschland.
Neuntes Capitel. Von der Betrachtung der Natur.
Zehntes Capitel. Von dem Enthusiasmus.
Eilftes Capitel. Von dem Einfluß des Enthusiasmus auf die Aufklärung.
Zwölftes und letztes Capitel. Einfluß des Enthusiasmus auf das Wohlseyn.
Über Deutschland, Germaine de Stael
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849609627
www.jazzybee-verlag.de
Germaine von Staël-Holstein – Biografie und Bibliografie
Berühmte franz. Schriftstellerin, geb. 22. April 1766 in Paris, gest. daselbst 14. Juli 1817, Tochter des Finanzministers Necker, entwickelte sich frühzeitig unter dem Einfluss einer streng protestantischen Mutter und der philosophischen Anschauungen, denen man im Hause ihres Vaters huldigte, verfasste mit 15 Jahren juristische und politische Abhandlungen und verheiratete sich 1786 auf den Wunsch ihrer Mutter mit dem schwedischen Gesandten, Baron von S. Doch war diese Ehe nicht glücklich; 1796 trennte sie sich von ihrem geistig tief unter ihr stehenden Gemahl, näherte sich ihm aber 1798 wieder, als er krank wurde, um ihn zu pflegen, und blieb bei ihm bis zu seinem Tode (1802). Seit dem ersten Jahre ihrer Ehe entwickelte sie eine eifrige literarische Tätigkeit. 1786 war ihr Schauspiel »Sophie, ou les sentiments secrets« erschienen, dem als letzter Versuch dieser Art 1790 die Tragödie »Jane Gray« folgte; sie sah ein, dass sie für Bühnendichtung nicht geschaffen war. Besser gelangen ihr die überschwänglich lobenden »Lettres sur les écrits et le caractère de J. J. Rousseau« (1788); doch fehlt die Kritik fast ganz. Das immer reichlicher fließende Blut ließ ihre anfängliche Begeisterung für die Revolution bald schwinden; ein Plan zur Flucht, den sie der königlichen Familie unterbreitete, wurde nicht angenommen; am 2. Sept. 1792 musste sie selbst flüchten. Auch ihre beredte Schrift zugunsten der Königin: »Réflexions sur le procès de la reine« (1793), hatte, keine Wirkung. Dagegen erregte sie Aufsehen durch ihre Schriften: »Réflexions sur la paix, adressées à M. Pitt et aux Français« (Genf 1795) und besonders durch »De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations« (Lauf. 1796), ein Werk voll tiefer und lichtvoller Gedanken. In Coppet lernte sie 1794 Benjamin Constant kennen. Ihr schriftstellerischer Ruf hatte sich inzwischen in weitern Kreisen verbreitet durch ihre Schrift »De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales« (1799, 2 Bde., hierin zuerst die Ausdrücke »klassisch« und »romantisch« in dem seither üblichen Sinne gegenübergestellt) und durch den Roman »Delphine« (1802, 4 Bde., u. ö.; hrsg. von Sainte-Beuve, 1868; deutsch, Leipz. 1847, 3 Bde.). eine Schilderung ihrer eignen Jugend in Briefform. In Paris, wohin sie 1797 zurückgekehrt war, lernte sie Bonaparte kennen, der sie, weil sie mit den Gästen ihres Salons gegen ihn und für eine konstitutionelle Verfassung agitierte, 1803 aus Paris und 40 Meilen in der Runde verbannte. Sie reiste nach Deutschland, wo sie längere Zeit in Weimar und Berlin verweilte; 1805 bereiste sie Italien. Seit dieser Zeit war A. W. v. Schlegel, den sie in Berlin kennen gelernt hatte, ihr Begleiter, und sein Umgang ist nicht ohne Einfluss auf ihre Ansichten, besonders über Kunst und deutsche Literatur, geblieben. Die Frucht ihrer Reise nach Italien war der Roman »Corinne, ou l'Italie« (1807, 2 Bde., u. ö.; deutsch von Fr. Schlegel, Berl. 1807; von Bock, Hildburgh. 1868), eine begeisterte Schilderung Italiens und das glänzendste ihrer Werke. 1810 ging sie nach Wien, um Stoff zu ihrem schon lange geplanten Werk »De l'Allemagne« zu sammeln, einem Gemälde Deutschlands in Beziehung auf Sitten, Literatur und Philosophie; doch wurde die ganze Auflage auf Befehl des damaligen Polizeiministers Savary sogleich vernichtet und gegen die Verfasserin von Napoleon I. ein neues Verbannungsdekret erlassen,. das sich auf ganz Frankreich erstreckte. Erst zu Ende 1813 erschien das Werk (3 Bde.) in London, darauf 1814 auch in Paris. So reich es an geistvollen Gedanken ist und so achtenswert durch die Wärme, womit es den Franzosen deutsche Art und Kunst empfiehlt, so enthält es doch auch viele schiefe Ansichten und erhebliche Unrichtigkeiten. Jedenfalls aber hat es den größten und dauerndsten Eindruck gemacht und muss darum als ihr Hauptwerk gelten. S. lebte in der nächsten Zeit wieder zu Coppet, wo sie sich insgeheim mit einem jungen Husarenoffizier, de Rocca, verheiratete. Von der französischen Polizei fort und fort verfolgt, begab sie sich im Frühjahr 1812 nach Moskau und St. Petersburg und von da nach Stockholm, wo ihr jüngster Sohn, Albert, im Duell blieb. Im Anfang des folgenden Jahres ging sie nach England; erst nach Napoleons Sturz kehrte sie nach langer Verbannung, deren Ereignisse sie zum Teil in »Dix années d'exil« (1821; beste Ausg. von P. Gautier, 1904; deutsch, Leipz. 1822) erzählt, nach Paris zurück. Nach Bonapartes Rückkehr von Elba zog sie sich nach Coppet zurück. Nach der zweiten Restauration erhielt sie Vergütung für die alte Schuld von 2 Mill. Frank, die ihr Vater bei seinem Abschied im öffentlichen Schatze zurückgelassen hatte, und lebte fortan in einem glücklichen häuslichen Kreis und im engen Verkehr mit literarischen und politischen Freunden in Paris, bis zu ihrer letzten Krankheit mit Ausarbeitung der trefflichen »Considérations sur les principaux événements de la Révolution française« (1818, 3 Bde.; neue Ausg. 1861; deutsch von A. W. v. Schlegel, Heidelb. 1818, 6 Bde.) beschäftigt. Zu erwähnen sind noch die Werke: »Vie privée de M. Necker«, an der Spitze der Ausgabe der Manuskripte ihres Vaters (1804); »Réflexions sur le suicide« (1813); »Zulma et trois nouvelles« (1813); »Essais dramatiques« (1821), eine Sammlung von sieben Stücken in Prosa, darunter das Drama »Sapho«. Neuerlich erschienen noch: »Un ouvrage inédit de Mme. de Stael« (politischen Inhalts vom Jahre 1799, hrsg. von Herriot, Par. 1904) und »Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution, etc.« (hrsg. von Viénot, das. 1906). Eine Ausgabe ihrer Werke (Par. 1820 bis 1821, 17 Bde.) veranstaltete ihr ältester Sohn, Auguste, Baron von S. (geb. 1790), der sich selbst als Schriftsteller bekannt machte und 1827 starb (seine »Œuvres diverses« gab seine Schwester, die Herzogin von Broglie, heraus, 1829, 3 Bde.); ihre »Œuvres complètes« erschienen auch 1871, 3 Bde. Vgl. Baudrillart, Éloge de Mad. de S. (1850); Norris, Life and times of Mad. de S. (Lond. 1853); Gérando, Lettres inédites et souvenirs biographiques de Mad. Récamier et de Mad. S. (Par. 1868); Amiel, Études sur Mad. de S. (1878); A. Stevens, Mad. de S. (Lond. 1881, 2 Bde.); Lady Blennerhassett, Frau von S. und ihre Freunde (Berl. 1887–89, 3 Bde.); Sorel, Mad. de S. (3. Aufl., Par. 1901); ferner »Correspondance diplomatique du baron de S., documents inédits« (hrsg. von Léouzon le Duc, das. 1881); E. Ritter, Notes sur Mme. de Staël (Genf 1899); »Lettres inédites de Mme. de S. à Henri Meister« (2. Aufl. 1904); Paul Gautier, Mme. de S. et Napoléon (Par. 1903).
Über Deutschland
Vorrede.
Den 1sten Oktober 1813.
Im Jahre 1810 übergab ich die Handschrift dieses Werks über Deutschland dem Verleger meiner Corinna. Da ich darin die nämlichen Meinungen aufstellte und gleiches Stillschweigen über die gegenwärtige Regierung Frankreichs beobachtete, als in meinen früheren Schriften, so schmeichelte ich mir, sie, wie jene, bekannt machen zu dürfen; aber einige Tage nach Einsendung der Handschrift erschien ein Dekret sehr sonderbarer Gattung über die Preßfreiheit, in welchem es hieß: „daß kein Werk ohne vorhergängige Prüfung von Censoren gedruckt werden solle.“ Das mochte hingehen, man war in Frankreich auch unter der alten Regierung gewohnt, sich der Censur zu unterwerfen; der öffentliche Geist neigte, sich damals zur Freiheit hin, und machte jenes Zwangmittel eben nicht furchtbar; aber ein kleiner Artikel am Ende des neuen Reglements setzte fest, „daß, wenn die Censoren ein Werk geprüft und seine Bekanntmachung erlaubt hatten, die Verleger zwar autorisirt seyn sollten, es drucken zu lassen; jedoch unbeschadet des Rechts des Polizeiministers, es ganz zu unterdrücken, wenn ihm dies angemessen schiene.“ Das will so viel sagen, diese und jene neue Formen sollten so lange bestehen, bis man es zweckmäßiger finden würde, sich nicht mehr in sie zu fügen: es war wahrlich kein Gesetz nöthig, um eine Abwesenheit des Gesetzes zu decretiren, man hätte sich ganz einfach an die unbedingte Gewaltsamkeit halten dürfen.
Demungeachtet übernahm mein Verleger die Verantwortlichkeit der Herausgabe meines Werkes, indem er es der Censurbehörde vorlegte, und unser Vertrag wurde in Gemäßheit dessen abgeschlossen. Ich kam bis auf vierzig Stunden weit von Paris, um den Druck zu besorgen – dort athmete ich zum letztenmal Frankreichs Luft. Ich hatte mir in meinem Buche, wie man später finden wird, jede Betrachtung über den politischen Zustand Deutschlands versagt; ich versetzte mich fünfzig Jahre hinaus von der Gegenwart, aber diese Gegenwart will nicht vergessen seyn. Mehrere Censoren prüften meine Handschrift, sie unterdrückten verschiedene Stellen, die ich in dieser Ausgabe wieder hergestellt, und in den Noten bezeichnet habe: bis auf diese Stellen aber erlaubten sie den Druck des Buches, wie ich es hier gebe, denn ich glaubte, nichts darin verändern zu dürfen. Es scheint mir merkwürdig, zu zeigen, wie ein Werk gestaltet seyn muß, um im jetzigen Frankreich die grausamste Verfolgung auf das Haupt seines Verfassers herabzuziehen.
Im Augenblick der Erscheinung desselben, und als die 10000 Exemplare der ersten Auflage bereits abgezogen waren, schickte der unter dem Namen General Savary bekannte Polizeiminister seine Gensd'armes zu meinem Verleger, mit dem Befehl, den ganzen Vorrath von Exemplaren zu zerstören, und die verschiedenen Ausgänge seines Gewölbes mit Schildwachen zu besetzen, aus Besorgniß, daß auch nicht ein einziges von einem so gefährlichen Werke entkomme. Ein Polizei-Commissair war zur Ober-Aufsicht über diese Expedition bestellt, in welcher der General Savary leicht Sieger bleiben konnte, und dieser arme Commissair sagt man, ist an der großen Anstrengung gestorben, die nöthig war, um mit der übertriebensten Kleinlichkeit eine so ungeheure Menge von Bänden zu zerstören oder vielmehr sie in eine Masse völlig weißer Pappen zu verwandeln, auf welchen keine Spur menschlicher Vernunft mehr sichtbar war. Der innere Werth dieser Pappen, der auf zwanzig Louisd'or abgeschätzt wurde, ist die einzige Entschädigung, die mein Verleger von dem General-Minister erhalten hat.
In dem nämlichen Augenblick, wo man mein Buch in Paris vernichtete, empfing ich auf meinem Landsitze einen Befehl, die Abschrift auszuhändigen, nach welcher der Abdruck erfolgt war und Frankreich binnen 24 Stunden zu verlassen. Man muß ein Conscribirter seyn, um sich in 24 Stunden reisefertig machen zu können, ich schrieb deshalb an den Polizeiminister, daß ich 8 Tage brauche, um Geld und meinen Wagen kommen zu lassen. Hier seine Antwort.
Allgemeine Polizei. Cabinet des Ministers.
Paris den 3ten Oktober 1810.
„Madame! Ich habe den Brief erhalten, den Sie mir die Ehre erzeigt, an mich zu richten. Ihr Herr Sohn wird Ihnen angezeigt haben, daß ich kein Bedenken dabei finde, Ihnen einen Aufschub Ihrer Reise auf 7 – 8 Tage zu bewilligen; ich wünsche, daß er zu den Einrichtungen, die Sie noch zu treffen haben, hinreichen möge, denn, ihn weiter auszudehnen, bin ich außer Stande.
Es wäre ein Irrthum. wenn Sie den Grund des Befehls, den ich Ihnen ertheilt habe, in dem Stillschweigen, mit welchem Sie in Ihrem letzten Werke den Kaiser übergangen haben, suchen wollten; für ihn ist kein würdiger Platz darin; Ihr Exil ist nur die natürliche Folge der Richtung, die Sie seit einigen Jahren genommen und ausdauernd verfolgt haben. Es ist mir vorgekommen, als ob Ihnen die Luft unsers Landes nicht mehr bekäme; mit uns ist es aber noch nicht so weit gekommen, daß wir Vorbilder unter den Völkern suchen sollten, die Sie bewundern.
Ihr letztes Werk ist kein Französisches, ich habe dessen Druck verhindert. Ich bedaure den dadurch für den Verleger entspringenden Verlust, aber mir ist es nicht möglich, es erscheinen zu lassen.
Sie wissen, Madame, daß es Ihnen nur erlaubt wurde, Coppet zu verlassen, weil sie den Wunsch äußerten, nach Amerika zu gehen. Wenn mein Vorgänger Ihnen verstattet hat, im Departement Loir et Cher zu wohnen, so durften Sie aus dieser Duldung keine Veranlassung nehmen, die früher Ihretwegen gemachten Festsetzungen als aufgehoben zu betrachten. Jetzt aber nöthigen Sie mich, sie strenge in Ausübung zu bringen, und Sie können die Schuld deshalb nur sich allein beimessen.
Ich befehle Herrn Corbigny [Präfekt von Loir und Cher.] genau auf Vollziehung der ihm ertheilten Ordre zu halten, wenn der Ihnen bewilligte Aufschub abgelaufen seyn wird.
Sehr bedaure ich, Madame, daß Sie mich in die Nothwendigkeit gesetzt haben, meinen Briefwechsel mit Ihnen durch eine Maaßregel der Strenge zu eröffnen; es wäre mir viel angenehmer gewesen, wenn ich Ihnen nur Beweise der hohen Achtung hätte geben dürfen, mit welcher ich die Ehre habe zu seyn,
Madame, Ihr ergebenster und gehorsamster Diener, gez. der Herzog v. Rovigo.“
An Frau v. Stael.
N. S. „Ich habe meine Gründe, Madame, Ihnen die Häfen von L'Orient, La Rochelle, Bordeaux und Rochefort als die einzigen zu bezeichnen, in welchen Sie sich einschiffen dürfen, und fordere Sie auf, mir denjenigen von ihnen anzuzeigen, den Sie gewählt haben“. [Der Zweck dieser Nachschrift war, mir die Häfen des Canals zu untersagen.]
————————
Ich werde diesem, wie es mir scheint, schon an und für sich hinlänglich merkwürdigen, Briefe noch einige Bemerkungen hinzufügen.
Es hat mir geschienen, sagt der General Savary, als ob die Luft dieses Landes Ihnen nicht mehr bekäme; welche zarte Weise, einer Frau, damals ach! noch Mutter von drei Kindern, der Tochter eines Mannes, der Frankreich mit solcher Treue gedient, anzuzeigen, daß man sie auf immer aus ihrem Vaterlande verbanne, ohne ihr zu gestatten, auf irgend eine Art gegen eine Strafe Einwendungen zu machen, die jeder nach der Todesstrafe die härteste nennt. Es giebt ein französisches Vaudeville, in welchem ein Gerichtsdiener seine Höflichkeit gegen die, welche er ins Gefängniß führt, mit den Worten herausstreicht:
Mich liebet jedermann, den zum Verhaft ich bringe,
– ich weiß nicht, ob der General Savary Aehnliches beabsichtigt hat.
Er sagt ferner: dahin ist es noch nicht mit uns gekommen, daß wir die Völker zu Vorbildern wählen sollten, die ich bewundere; diese Völker sind zunächst die Engländer und dann, in mehrerer Hinsicht, die Deutschen. Bei alle dem glaube ich, daß man mir eben nicht Schuld geben kann, Frankreich nicht zu lieben. Nur zu sehr habe ich gezeigt, wie sehnsuchtsvoll ich an einem Aufenthalte hänge, wo ich noch so viel Gegenstände meiner Neigung zähle, und die so liebenswürdig finde, die ich liebe. Aber folgt denn aus dieser vielleicht zu lebendigen Anhänglichkeit an ein so glanzreiches Land und seine geistvollen Bewohner, daß es mir nicht gestattet seyn solle, auch England zu bewundern? Wir sah'n es, ritterlich gewappnet zur Vertheidigung des geselligen Zustandes, Europa zehn Jahre hindurch gegen Anarchie, zehn andre gegen Despotismus schützen. Seine glückliche Verfassung war, beim Beginn der Revolution, das Ziel des Hoffens und Strebens der Franzosen – mein Sinn ist auf dem Punkte stehen geblieben, wo ihrer damals stand.
Bei meiner Rückkehr in die Besitzung meines Vaters [Coppet in der Nähe von Genf. A. d. Uebers.] untersagte mir der Präfekt, mich weiter als vier Stunden im Umkreise von dort zu entfernen. Ich erlaubte mir eines Tages bei einer einfachen Spazierfahrt zehn Stunden zurückzulegen; augenblicklich waren die Gensd'armes hinter mir her, den Postmeistern wurde anbefohlen, mir keine Pferde zu geben, man hätte denken sollen, das Wohl des Staates hänge von einer so gebrechlichen Existenz, als die mir verstattete, ab. Ich suchte mich jedoch auch in diese Gefangenschaft in ihrer ganzen Härte zu schicken, aber der letzte Schlag, der mich traf, machte mir sie vollends unerträglich. Einige meiner Freunde wurden ins Exil geschickt, weil sie die Großmuth gehabt hatten, mich zu besuchen; das war zu viel – die Pest des Unglücks an sich tragen, denen nicht nahe treten zu dürfen, die man liebt, fürchten zu müssen, ihnen zu schreiben, ihren Namen auszusprechen, bald sich als Gegenstand der zärtlichen Anhänglichkeit von Personen zu sehn, für die man darum zittern muß, und bald gekränkt mit den gesuchtesten Gemeinheiten, die nur Sklavenfurcht veranlassen kann, das war eine Lage, der man sich entziehen mußte, wollte man noch leben.
Man sagte mir, um meinen Kummer zu mindern, daß diese unaufhörlichen Verfolgungen ein Beweis des Gewichts wären, das man auf meine Person legte; ich hätte wohl erwiedern können:
Nicht dieser Ehre bin ich werth, nicht der Entwürdigung, aber ich gab diesen Tröstungen meiner Eigenliebe kein Gehör, denn ich wußte zu gut, daß, vom Größten bis zum Niedrigsten, es jetzt in Frankreich keinen giebt, der nicht gewürdigt werden könnte, elend gemacht zu werden. Man quälte mich in allen Verhältnissen meines Lebens, bei allen empfindlichen Seiten meines Charakters, selbst die Gewalt gab sich herablassend die Mühe, mich genauer kennen zu lernen, um mir gründlicheres Leiden zu bereiten. Da ich diese Gewalt nicht gradehin durch das Opfer meines Talents befriedigen konnte, und entschlossen war, es ihr nicht dienstbar zu machen, so glaubte ich, tief im Innern zu fühlen, was in dieser Lage mein Vater mir gerathen haben würde, und reißte ab.
Es ist, glaube ich, von Wichtigkeit für mich, das Publikum mit diesem verleumdeten, mit diesem Buch bekannt zu machen, das so vieler Leiden Quelle für mich wurde, und obgleich General Savary mir in seinem Briefe erklärt hat, daß dies Werk kein Französisches sey, so will ich, mit eben der Ueberzeugung, mit welcher ich ihn nicht als Repräsentanten von Frankreich anerkenne, den Franzosen, wie ich sie sonst gekannt habe, eine Schrift vertrauensvoll überreichen, in welcher ich, nach den mir verliehenen Kräften, gesucht habe, den Ruhm der Arbeiten des menschlichen Geistes zu erheben.
Deutschland kann, seiner geographischen Lage nach, für das Herz von Europa gelten, und der große Bund des Continents allein durch dieses Landes Unabhängigkeit die eigne wiedererlangen. Verschiedenheit der Sprachen, natürliche Gränzen, gemeinschaftliche Erinnerungen aus der Geschichte der Vorzeit, alles dies trägt dazu bei, um unter den Menschen die großen Individuen zu bilden, die man Nationen nennt; gewisse Verhältnisse sind nöthig zu ihrer Existenz, gewisse Eigenschaften, sie von einander zu unterscheiden; würde Deutschland mit Frankreich vereinigt, so folgte daraus auch die Vereinigung Frankreichs mit Deutschland; die Franzosen von Hamburg und die von Rom würden stufenweise den Charakter der Zeitgenossen Heinrichs des Vierten entstellen, die Besiegten auf die Länge die Sieger umbilden, und am Ende alle gleich dabei verlieren.
Ich habe in meinem Werke behauptet, die Deutschen seyen keine Nation, aber warlich, vor den Augen aller Welt strafen sie als Helden diese Besorgniß Lügen.
Die Spanier, auf die man Southeys Vers anwenden kann:
Die tapfern Dulder sind es, die die Menschheit retten,
hatten alles bis auf Cadix verloren, und würden sich doch eben so wenig unter das fremde Joch geschmiegt haben, als jetzt, wo sie an der Gränze der Pyrenäen stehn, im Schutze Wellingtons, mit dem Charakter des Alterthums, dem Geist der neuen Zeit. Zur Erreichung dieser großen Zwecke gehört aber auch eine Ausdauer, erhaben über jedes Ereigniß. Die Deutschen trifft oft der Vorwurf, daß sie vom Unglück erst sich Ueberzeugungen haben geben lassen. Individuen müssen sich dem Schicksal fügen lernen, Nationen niemals; denn sie sind es allein, die diesem Schicksal zu gebieten vermögen - ein fester Wille mehr, und das Elend wäre gebändigt.
Die Unterwerfung eines Volkes unter ein andres läuft gegen die Natur. Wer würde jetzt noch an die Möglichkeit denken, Spanien, Rußland, England und Frankreich zu zerstückeln? Warum sollte dies nicht mit Deutschland der nämliche Fall seyn! Könnten die Deutschen sich nochmals unterjochen lassen, so würde ihr Unglück das Herz zerreißen, aber man würde immer in Versuchung seyn, ihnen zu sagen, wie Fräulein von Mancini zu Ludwig dem Vierzehnten: Sie sind König, Sire, und Sie weinen: – Ihr seyd ein Volk und weinet!!
Das Gemälde einer Literatur und Philosophie scheint dem gegenwärtigen Augenblick wohl fremd zu seyn; doch ist es vielleicht dem armen, edlen Deutschland tröstlich, sich inmitten der Verwüstungen des Krieges an seine Geistesschätze zu erinnern. Vor drei Jahren nannte ich Preußen und die nordischen Länder, die es umgeben, das Vaterland des Denkens, in wie viel herrliche Thaten hat sich dies Denken nicht seitdem gestaltet; was die Philosophen in Systeme brachten, geht in Erfüllung, und der Seele Unabhängigkeit wird die der Staaten gründen!
————————
Allgemeine Bemerkungen.
Der Ursprung der vornehmsten Völker Europa's läßt sich auf drei verschiedene Hauptstämme zurückbringen: auf den lateinischen, den deutschen und den slavischen Stamm. Von den Römern erhielten ihre Ausbildung und ihre Sprache die Italiener, Franzosen, Spanier und Portugiesen; die Deutschen, Schweizer, Engländer, Schweden, Dänen und Niederländer sind teutonischen Ursprungs; unter den slavischen Stammvölkern nehmen die Polen und Russen die ersten Stellen ein. Die Völkerschaften, deren Geistesentwickelung lateinischen Ursprungs ist, erhielten dadurch einen Vorsprung vor den übrigen, und haben im Ganzen von ihren Ahnherren, den Römern, eine scharfsinnige Gewandtheit in Führung der Welthändel geerbt. Der Gründung des Christenthums gingen bei ihnen bürgerliche Einrichtungen voraus, die sich aus der heidnischen Religion herschrieben; und als späterhin die nordischen Völker sie unterjocht hatten, nahmen eben diese Völker, in mancherlei Hinsicht, die Sitten der eroberten Länder an.
Allerdings wurde diese allgemeine Bemerkung durch Clima, Regierungsart und Geschichtfolge jeder dieser Länder bestimmt und beschränkt. So hat z. B. die geistliche Gewalt in Italien unvertilgbare Spuren zurückgelassen; so sind die kriegerischen Gewohnheiten, der unternehmende Geist der Spanier, Folgen der langen Kriege dieses Volks mit den Arabern. Gleichwohl trägt, im Allgemeinen, derjenige Theil von Europa, dessen Sprachen von der lateinischen abstammen, und welcher frühzeitig in die römische Politik eingeweiht wurde, die Spur einer ältern, ursprünglich heidnischen Ausbildung. Man sieht ihm weniger, als den germanischen Stammvölkern, die Neigung zu abstracten Ideen an; er giebt sich williger irdischen Vortheilen, irdischen Vergnügungen hin; und vor allen verstehen sich diese Völker, wie ihre Vorbilder, die Römer, ausschließlich auf die Herrschkunst.
Von jeher widerstanden die germanischen Völkerschaften dem Joche der Römer; sie erhielten ihre Ausbildung in spätern Zeiten, und allein vom Christenthum; gingen unmittelbar von einer Art von Wildheit zur christlichen Geselligkeit über; in die Ritterzeiten, in den Geist des Mittelalters fallen ihre lebendigsten Erinnerungen; und haben gleich die Gelehrten dieser Länder, mehr noch als die von Rom abstammenden Völker, sich die griechischen und römischen Schriftsteller eigen gemacht, so athmet doch in den deutschen Werken mehr ein natürlich-alter Urgeist, als der Geist des Alterthums. Ihre Einbildungskraft verweilt gern in alten Schlössern und Thürmen, mitten unter Kriegern, Hexen und Gespenstern; tiefe, einsame Träumereien sind die Grundfarbe, der Hauptreiz ihrer Dichtungen.
Die Analogie unter den teutonischen Völkerstämmen ist unverkennbar. Zwar verdanken die Engländer ihrer Constitution eine gesellschaftliche Würde, die sie über ihre Mitnationen erhebt; gleichwohl finden sich bei sämmtlichen Völkern germanischen Ursprungs die nämlichen Grundzüge wieder. Von jeher zeichneten sie sich durch Unabhängigkeit und Rechtlichkeit aus; von jeher waren sie bieder und treu; und vielleicht sind es gerade diese Eigenschaften, die ihren Schriften einen Anstrich von Schwermüthigkeit mittheilen; denn ist es nicht das Schicksal ganzer Nationen, wie einzelner Menschen, für ihre Tugenden zu büßen?
Die Ausbildung der slavischen Stämme mußte, da sie später und eilfertiger erfolgte, als die der übrigen Völker, zur Folge haben, was man bis jetzt an derselben bemerkt: mehr Nachahmung als Originalität. Das Europäische dieser Völker ist französisch; das Asiatische zu wenig entwickelt, als daß ihre Schriftsteller den wahren, ihnen angestammten Character zur Schau tragen könnten.
Folglich giebt es im literarischen Europa nur zwei sehr deutliche Hauptabtheilungen, nämlich: die den Alten nachgeahmte Literatur, und die, welche dem Geiste des Mittelalters ihr Entstehen verdankt; jene, die ihre ursprüngliche Farbe, ihren ursprünglichen Reiz vom Heidenthume herleitet, und diese, deren Impuls und Entwickelung einer wesentlich-spiritualistischen Religion angehören.
Man könnte mit Recht behaupten, daß die Franzosen und die Deutschen an den beiden äußersten Enden der moralischen Kette stehen, da jene die äußeren Gegenstände als den Hebel aller Ideen annehmen, und diese die Ideen für den Hebel aller Eindrücke halten. Denn obschon beide Nationen in den gesellschaftlichen Verhältnissen ziemlich nachbarlich übereinstimmen, so giebt es doch einen himmelweiten Unterschied zwischen ihnen, sobald es auf literarische und philosophische Systeme ankommt. Das intellectuelle Deutschland kennt man in Frankreich beinahe gar nicht; nur wenig dortige Gelehrte haben sich dieser Forschung unterzogen, obschon derer, die das gelehrte Deutschland beurtheilen, weit mehr sind. Jener leichte unterhaltende Ton, mit welchem man über das abspricht, was man nicht weiß, kann seine Eleganz haben, so lange man spricht, verliert sie aber, sobald man schreibt. Die Deutschen begehen oft den Fehler, was in die Bücher gehört, zum Gegenstand der Unterhaltung zu machen; die Franzosen verfallen nicht selten in den entgegengesetzten Fehler; sie geben uns zu lesen, was bloß zum Hören sich eignete. Sie haben, mit einem Worte, dergestalt alles Oberflächliche erschöpft, daß sie, dünkt mich, der Unterhaltung, und vor allem, der Abwechselung wegen, es einmal mit der Tiefe versuchen sollten.
Ich habe es daher für nicht unvortheilhaft gehalten, dasjenige Land Europa's, wo Studium und Nachdenken so weit gediehen sind, daß man es als das Vaterland des Denkens ansehen kann, allgemein bekannter zu machen. Die Bemerkungen, worauf mich sowohl das Land selbst, als dessen Literatur gebracht, machen vier Abtheilungen aus. In der ersten wird Deutschland und seine Sitten abgehandelt; in der zweiten, Literatur und Kunst; in der dritten, Philosophie und Moral; in der vierten, Religion und Enthusiasmus. Nothwendigerweise gehen diese Gegenstände oft einer in den andern über. Der Nationalcharacter hat Einfluß auf die Literatur, Literatur und Philosophie auf die Religion. Das Ganze allein kann jeden Theil ganz darstellen; nur mußte man sich einer Scheineintheilung unterziehen, um zuletzt alle Strahlen in einen gemeinschaftlichen Brennpunkt auffangen zu können.
Ich habe es mir keineswegs Hehl, daß ich, in der Literatur sowohl als in der Philosophie, Meinungen aufstellen werde, die mit den bisher in Frankreich herrschenden im Gegensatz stehen. Immerhin! mögen diese Meinungen richtig oder unrichtig scheinen; mag man sie annehmen oder bestreiten; genug, sie geben Anlaß zum Denken. »Denn dahin, will ich hoffen, ist es bei uns nicht gekommen, daß man um das literarische Frankreich die große Mauer von China ziehen wolle, um allen Ideen von aussen den Eingang zu verwehren.«
[Das hier und an andern Stellen mit Häkchen »« Bezeichnete zeigt die von den Pariser Censoren gestrichenen Stellen an. Im zweiten Bande haben sie kein verwerfliches Wort gefunden. Im dritten fanden die Capitel über den Enthusiasmus, und vorzüglich der Schluß des Werks, nicht Gnade vor ihren Augen. Ich war erbötig, mich ihrem Richterstuhl auf eine negative Art zu unterwerfen, d.h. alles auszustreichen, ohne etwas an die Stelle zu setzen; aber die Gendarmerie, die mir der Polizeiminister über den Hals schickte, censirte mein Werk auf eine etwas handgreiflichere Art: sie zerstörte es.]
Läßt es sich als möglich denken, daß die deutschen Schriftsteller, die gelehrtesten Männer, die denkendsten Köpfe Europa's, es nicht verdienen sollten, daß man ihrer Literatur und ihrer Philosophie einige Aufmerksamkeit schenke? Man wirft der ersten den Mangel an Geschmack, der zweiten den Ueberfluß an Unsinn vor. Gleichwohl könnte man darauf antworten: eine Literatur, die von unserem Gesetzbuche des guten Geschmacks nicht gebilligt werde, enthalte vielleicht neue Ideen, mit welchen wir, wenn wir sie auf unsere Weise ummodelten, die unsrige bereichern könnten. So danken wir den Griechen den Racine; so dankt Voltaire Shakespear'n mehrere seiner Trauerspiele. Die Dürre, die das Feld unserer Literatur bedroht, leitet zum Glauben, daß die Pflanze des französischen Geistes gegenwärtig eines stärkeren Nahrungssaftes bedürfe; und da die Feinheit des guten Welttons uns jederzeit vor gewissen Fehlern sicher stellen wird, so liegt uns allerdings viel daran, die Quelle großer Schönheiten wieder aufzufinden.
Nachdem man, im Namen des guten Geschmacks, die deutsche Literatur von sich abgewehrt, glaubt man ebenfalls befugt zu seyn, im Namen der Vernunft ihre Philosophie von sich zu weisen. Geschmack und Vernunft sind Redensarten, die sich gut im Munde führen lassen, sey's auch nicht immer an der rechten Stelle: ist es aber (ehrlich gesprochen!) denkbar, daß Männer von unermeßlicher Gelehrsamkeit, und denen die französischen Werke nicht weniger bekannt sind, als uns, sich seit zwanzig Jahren mit nichts, als mit baarem Unsinn, befaßt haben sollten?
In Jahrhunderten des Aberglaubens heißt leicht jede neue Meinung Ketzerei; so wie Jahrhunderte des Unglaubens sie eben so leicht mit dem Namen des Wahnsinns belegen. Im sechszehnten Jahrhundert wurde Galilei der Inquisition überantwortet, weil er behauptet hatte, die Erde drehe sich um ihre Achse; im achtzehnten hat es Männer gegeben, in deren Augen J. J. Rousseau ein schwärmerischer Andächtler war. Meinungen, die sich von dem herrschenden Zeitgeiste (welcher es sey,) entfernen, sind der Menge ein Aergerniß; Forschung und Prüfung führen allein zu der Liberalität des Urtheils, ohne welche es unmöglich ist, zu neuen Kenntnissen zu gelangen, oder nur die schon erreichten zu bewahren. Denn man unterwirft sich gewissen angenommenen Ideen nicht, wie man sich der Wahrheit, sondern wie man sich der Gewalt unterwirft; und so gewöhnt sich die menschliche Vernunft zur Knechtschaft, selbst in den Gefilden der Literatur und der Philosophie.
————————
Erster Theil.
I. Abtheilung. Deutschland und die Sitten der Deutschen.
Erstes Capitel. Ansicht von Deutschland.
Große häufige Waldstücken deuten auf einen spätern Länderanbau; der langbewohnte südliche Boden trägt wenig Bäume, kein Schatten schützt gegen die senkrechten Strahlen der Sonne dieses durch Menschenhand nackte Erdreich. Deutschland trägt noch hier und da Spuren einer unbewohnten Natur. Von den Alpen bis zum Meer, zwischen dem Rhein und der Donau, findet man ein mit Eichen und Fichten bewachsenes Land, von majestätisch-schönen Flüssen durchschnitten, von Bergen mahlerischer Ansicht durchkreuzt. Aber unabsehbare Heiden, Sandschollen, oft vernachläßigte Wege, ein starres Clima erfüllen im ersten Augenblicke die Seele mit Traurigkeit; nur allmählig entdeckt man, und späterhin, was an diesen Aufenthalt fesseln kann.
Das südliche Deutschland ist sehr gut angebaut; dennoch stößt man auch in den schönsten Gegenden dieser Landes auf etwas Ernstes, welches eher an Arbeit als an Vergnügen, mehr an die Verdienste der Einwohner, als an die Reize der Natur erinnert.
Die Trümmer alter Schlösser auf Berggipfeln, die Lehmhütten, die kleinen engen Fenster, der Schnee, der im Winter die unabsehbaren Ebenen bedeckt, machen einen peinlichen Eindruck. Eine Art von Schweigen in der Natur und in den Menschen, preßt das Herz des Reisenden zusammen. Es kommt ihm vor, als schleiche die Zeit hier langsamer als an andern Orten vorüber, als übereile sich der Wachsthum der Pflanzen eben so wenig wie die Bildung der Gedanken in den Köpfen, als zögen sich die geraden regelmäßigen Furchen des Landmanns auf schwerfälligem Boden dahin.
Gleichwohl, sobald man nur diese unwillkührlichen Empfindungen zerstreut hat, findet sichs, daß Land und Einwohner sich dem Beobachter in einer interessanten, dichterischen Gestalt zeigen, und man fängt an zu fühlen, daß sanfte Seelen und sanfte Phantasieen diese Gefilde verschönerten. Die Landstraßen sind mit Reihen von Obstbäumen besetzt, deren Früchte den Reisenden laben sollen. Die Landschaften längs dem Rheine sind beinahe durchaus herrlich; man sollte sagen, dieser Fluß sey Deutschlands waltender Schutzgeist; seine Gewässer sind rein, schnell, majestätisch, wie das Leben eines Helden im Alterthum. Die Donau zertheilt sich in mehrere Arme; die Fluthen der Elbe und der Spree trüben sich leicht, wenn der Sturm sie aufwühlt; der Rhein allein ist beinahe unveränderlich. Die Gegenden, durch welche er fließt, sind zugleich so ernst und so mannigfaltig, so fruchtbar und einsam, daß man geneigt ist, zu glauben, er selbst habe sie angebaut, ohne alles Zuthun der heutigen Anwohner. Dieser Strom erzählt, im Vorüberfließen, die Großthaten der ehemaligen Zeit, und Herrmann's Schatten scheint noch längs den steilen Ufern einher zu schreiten.
Die gothischen Denkmäler sind die einzig merkwürdigen in Deutschland. Diese Denkmäler erinnern an die Jahrhunderte des Ritterthums; beinahe in allen deutschen Städten stehen in öffentlichen Kunstsälen Ueberbleibsel jener Zeiten aufgestellt. Man sollte glauben, die Bewohner des Nordens, die Welteroberer, hätten, ehe sie Germanien verließen, ihr Andenken unter verschiedenen Gestalten zurückgelassen, und das ganze Land gliche dem Aufenthalte eines großen Volks, das seit langer Zeit weggezogen. In den mehrsten Zeughäusern deutscher Städte findet man gemahlte Rittergestalten von Holz, in völliger Rüstung; Helm, Schild, Schienen, Sporen, alles ist nach alter Weise, und man geht unter diesen stehenden Todten einher, deren aufgehobener Arm den Nachbar zu treffen scheint, der dem Streich mit eingelegter Lanze begegnet. Dieses unbewegliche Bild ehedem so lebhafter Handlungen macht einen peinlichen Eindruck. Eben so hat man nach großen Erderschütterungen verschüttete Menschen ausgegraben, an denen man noch immer den letzten Ausdruck ihres letzten Gedankens deutlich bemerken konnte.
Die neuere Baukunst in Deutschland liefert nichts, der Anführung Würdiges; im Ganzen aber sind die Städte wohl gebaut, und die Eigenthümer verzieren ihre Häuser mit einer Sorgfalt, die an gutmüthige Spielerei gränzt. In manchen Städten sind die Häuser von aussen bunt angemahlt; man stößt auf Heiligenbilder, auf Zierrathe aller Gattung, nicht eben vom besten Geschmack, wodurch aber die Einförmigkeit der Wohnungen unterbrochen und der Wunsch angedeutet wird, bei seinen Mitbürgern und den Fremden sich gefällig zu machen. Der Glanz und die äußere Pracht eines Pallastes verräth die Eigenliebe des Eigenthümers; die sorgsame Verzierung, die Ausschmückung, der gute Wille der kleinen Wohnungen haben etwas Gastfreundliches.
Die Gärten sind in einigen Theilen von Deutschland fast eben so schön als in England. Immer setzt der Luxus der Gärten die Liebe zur Natur zum Voraus. In England stehen einfach gebaute Häuser mitten in den prächtigsten Parks; der Eigenthümer vernachläßigt seine Wohnung und schmückt mit Sorgfalt das Feld. Dieser Verein von Einfachheit und Pracht findet sich, obschon nicht in demselben Grade, in Deutschland wieder; gleichwohl leuchtet bei dem Mangel an großem Reichthum, verknüpft mit dem alten Adelstolz, eine gewisse Vorliebe zum Schönen hervor, welche, später oder früher, Geschmack und Grazie hervorbringen muß, weil sie die wahre Quelle beider ist. Oft stellt man in den prächtigen Gärten deutscher Fürsten, neben mit Blumen umpflanzten Grotten, Aeolsharfen auf, damit der Wind zugleich Töne und Düfte durch die Lüfte herbeiführe. Also sucht die Phantasie der Bewohner des Nordens sich eine italienische Natur nachzubilden; und an einigen glänzenden Tagen des schnell vorübergehenden Sommers gelingt es ihnen wirklich, Täuschung hervorzubringen.
————————
Zweites Capitel. Sitten und Character der Deutschen.
Nur einige Hauptzüge können der deutschen Nation gemein seyn; denn die Abweichungen dieses Landes sind so groß, daß man nicht weiß, wie man so verschiedenartige Religionen, Regierungsformen, Clima's, ja Völker unter einen und denselben Gesichtspunct bringen soll. Das südliche Deutschland ist, in vieler Hinsicht, von dem nördlichen durchaus verschieden; die Handelsstädte haben nicht die geringste Aehnlichkeit mit denen, welche als Universitäten berühmt sind. Die kleineren Staaten sind von den beiden großen Monarchieen, Preußen und Oestreich, wesentlich abweichend.
Deutschland war ein aristocratischer Bundesstaat. Dem Reiche fehlte es an einem gemeinschaftlichen Mittelpunct der Aufklärung und des Gemeingeistes. Es bildete keine zusammenhängende Nation; dem Bündel fehlte das Band. So nachtheilig diese Verschiedenheit Deutschlands seiner politischen Kraft war, so vortheilhaft war sie den Versuchen aller Gattung, denen sich Genie und Einbildungskraft überlassen mochten. Es herrschte eine Art sanfter friedlicher Anarchie darin, im Fach literarischer und metaphysischer Meinungen, wobei es jedermann frei stand, seine individuelle Ansicht der Dinge ganz nach Gefallen zu entwickeln.
Da es keine Hauptstadt giebt, die der Sammelplatz der guten Gesellschaft von ganz Deutschland ist. so kann der gesellige Geist seine Gewalt nur wenig geltend machen, so fehlt es dem herrschenden Geschmack an Einfluß, und den Waffen des Spotts am Stachel. Der große Theil der Schriftsteller arbeitet in der Einsamkeit, oder in dem engen Kreise kleiner Umgebungen, über die sie die Herrschaft führen. Sie geben sich, jeder besonders, allem hin, was eine ungezügelte Einbildungskraft ihnen eingiebt; und wenn sich in Deutschland eine Spur der Modegewalt blicken läßt, so besteht sie bloß darin, daß sich jeder etwas damit weiß, sich von allen andern zu unterscheiden. In Frankreich ist es gerade das Gegentheil; da strebt alles nach dem Lobe, das Montesquieu Voltairen ertheilt, wenn er sagt: „Er hat mehr als irgend jemand, den Verstand, den jedermann hat.“ [Mutterwitz.] Die deutschen Schriftsteller würden sich eher noch entschließen, die Ausländer, als ihre Landsleute nachzuahmen.
In der Literatur, wie in der Politik, haben überhaupt die Deutschen zu viel Achtung für das Ausland, und nicht genug Nationalvorurtheile. Bei Einzelnen ist die Verläugnung seiner selbst und die Achtung des Andern eine Tugend; nicht so beim Patriotismus der Nationen: dieser muß egoistisch seyn. Der Stolz der Engländer trägt zu ihrer politischen Existenz mächtig bei; die gute Meinung der Franzosen von sich hat von jeher ihr Uebergewicht in Europa verstärken helfen; der edle Stolz der Spanier machte sie einst zu Herren eines Theils des Erdkreises. Die Deutschen sind Sachsen, Preußen, Baiern, Oestreicher; aber der germanische Character, welcher die Stärke aller übrigen begründen sollte, ist zerstückelt, wie das Land selbst, was so verschiedene Herren zählt.
Ich werde das südliche Deutschland besonders untersuchen, und das nördliche wieder besonders; für jetzt aber mich mit Bemerkungen begnügen, die der gesammten Nation gemein sind. Die Deutschen sind im Allgemeinen aufrichtig und treu; fast immer ist ihr Wort ihnen heilig, und der Betrug ihnen fremd. Sollte sich je die Falschheit in Deutschland einschleichen, so könnte es nur geschehen, um sich den Ausländern nachzubilden; um zu zeigen, daß sie eben so gewandt seyn können als jene; vor allem, um sich nicht von ihnen hinter's Licht führen zu lassen; bald aber würde der gesunde Verstand und das gute Herz die Deutschen auf die Ueberzeugung zurückbringen, daß man nur durch seine eigene Natur stark sey, und daß die Gewohnheit des Rechtlichen uns ganz und gar unfähig zur Arglist mache, selbst dann, wenn wir sie gebrauchen möchten. Um aus der Immoralität Vortheil zu ziehen, muß man in jeder Hinsicht leicht bewaffnet seyn, nicht aber ein Gewissen im Herzen, und Bedenklichkeiten im Kopfe führen, die uns auf halbem Wege aufhalten, und es uns um so mehr bereuen lassen, vom alten Wege abgewichen zu seyn, da es uns unmöglich wird, in der neuen Straße leicht vorzuschreiten.
Es wäre, dünkt mich, leicht zu beweisen, daß, ohne Moral, alles in der Welt Ohngefähr und Finsterniß ist. Gleichwohl hat man oft bei den Völkern lateinischen Ursprungs eine Politik angetroffen, die mit seltener Gewandtheit die Kunst besaß und ausübte, sich von allen Pflichten loszumachen. Der deutschen Nation hingegen darf man es zum Ruhme nachsagen, daß es ihr beinahe an der Fähigkeit fehlt, die geschmeidig-dreist es versteht, jede Wahrheit jedem Vortheil zu Gunsten zu beugen, und die heiligen Verbindlichkeiten der kalten Berechnung aufzuopfern. Ihre Mängel sowohl, als ihre Eigenschaften, unterwerfen diese Nation der ehrenvollen Notwendigkeit, gerecht zu seyn.
Der Machttrieb zur Arbeit und zum Nachdenken ist ebenfalls ein Unterscheidungszeichen im Character der Deutschen. Die Nation ist von Natur literarisch und philosophisch; nur daß der Unterschied der Klassen, welche in Deutschland hervorstechender als irgendwo ist, weil die Nation hierin die Schatzungen nicht versüßt, in mancher Hinsicht dem, was man eigentlich unter Geist (Esprit) [So oft Geist gesperrt (hier: fett) seyn wird, soll es das französische Wort esprit, im französischen Sinn, bedeuten.] versteht, in den Weg tritt. Der Adel hat zu wenig Ideen, die Gelehrten zu wenig Kenntniß der Geschäfte. Der Geist ist ein Gemisch von der Kenntniß der Dinge und der Menschen; und die Gesellschaft, wo man ohne Zweck, und dabei doch mit Theilnahme handelt, ist gerade das, was die am meisten entgegenstehenden Fähigkeiten am besten entwickelt. Was die Deutschen characterisirt, ist mehr die Einbildungskraft als der Geist. J.P. Richter, einer ihrer ausgezeichnetsten Schriftsteller, sagt irgendwo: „Das Gebiet des Meeres gehört den Engländern; das Gebiet der Erde den Franzosen; das Gebiet der Luft den Deutschen.“ Und in der That thäte es Noth, in Deutschland, Mittelpunct und Gränzen, jener hervorstechenden Denkkraft anzuweisen, die sich in den leeren Raum versteigt und verliert, in die Tiefe eindringt und verschwindet, vor gar zu großer Unparteilichkeit zu Nichts, vor gar zu feiner Analyse zum Chaos wird, mit einem Wort, der es an gewissen Fehlern mangelt, die ihrer Vollkommenheit zum Aussenwerk dienen könnten.
Man hat viel Mühe, wenn man so eben aus Frankreich kam, sich an die Langsamkeit, an den Ruhestand des deutschen Volks zu gewöhnen; es hat nie Eile, findet allenthalben Hindernisse. Das Wort unmöglich hört man hundertmal in Deutschland aussprechen, gegen einmal in Frankreich. Muß gehandelt werden, so weiß der Deutsche nicht, was es heißt, den Hindernissen entgegen streben; und seine Achtung vor der Gewalt rührt mehr davon, daß sie in seinen Augen dem Schicksale gleicht, als von irgend einem eigennützigen Grunde her.
Der gemeine Mann hat in Deutschland eine ziemlich rauhe Aussenseite, zumal wenn man seiner gewöhnlichen Art zu seyn in den Weg tritt; dies hat zur natürlichen Folge, daß er länger als der Adel jene heilige Antipathie gegen die Sitten, Gebräuche und Sprachen des Auslandes beibehalten möchte, welche in allen Ländern das Nationalband schließt. Bietet man ihm Geld an, so bringt dies in seiner Handlungsweise keine Veränderung hervor; die Furcht führt ihn nicht von seinem Wege ab; er hat, mit einem Worte, jene Beharrlichkeit in allen Dingen, welche ein herrlicher Vorschritt zur Moralität ist; denn der Mensch, den die Furcht, und noch mehr die Hoffnung, in beständiger Bewegung erhält, geht leicht von einer Meinung zur andern über, wenn es sein Vortheil befiehlt.
Sobald man sich nur etwas über die letzte Volksklasse in Deutschland erhoben hat, bemerkt man bald das innere Leben, die Seelenpoesie, die den Deutschen bezeichnet. Die Bewohner der Städte und Dörfer, Soldaten und Landleute, verstehen fast alle Musik. Es ist mir sehr oft begegnet, in kleine vom Tabaksdampf durchräucherte Hütten zu treten, und nicht allein die Hausfrau, sondern auch ihren Mann, auf dem Klavier phantasiren zu hören, wie man in Italien improvisirt. Allenthalben ist die Einrichtung getroffen, daß an Markttagen auf dem Altan des Rathhauses mitten auf dem Platze Spielleute mit blasenden Instrumenten sich versammeln; so daß die Bauern der benachbarten Dörfer ihren freudigen Antheil an der ersten aller Künste nehmen können. Sonntags singen Chorschüler auf den Straßen geistliche Lieder. Wie man erzählt, war Luther, in seiner Jugend, ein solcher Chorknabe. Ich befand mich einst zu Eisenach, einem Städtchen im Herzogthum Sachsen-Weimar, an einem überaus kalten Wintertage; es lag auf den Straßen tiefer Schnee. Ich sah einen langen Zug von jungen Leuten in schwarzen Mänteln durch die Stadt ziehen, und hörte sie mit lauter Stimme Lieder zum Lobe Gottes anstimmen. Außer ihnen befand sich Niemand auf der Straße, so streng war die Kälte; und diese Stimmen, beinahe so harmonisch wie die südlichen, rührten um desto mehr, da sie mitten aus der erstarrten Natur hervortönten. Bei der bittern Kälte durften die Einwohner ihre Fenster nicht öffnen; doch erblickte man hinter den Scheiben traurige und heitere Gesichter, alte und junge, welche mit Freuden die Tröstungen der Religion auffaßten, die ihnen der sanfte Gesang zuhauchte.
Die armen Zigeuner auf ihren Reisen mit Weib und Kind, tragen alte Harfen mit sich auf dem Rücken umher; sie sind von schlechtem Holze, aber ihr Ton ist harmonisch. Sie spielen darauf, wenn sie unter einem Baume auf der Landstraße ausruhen, oder vor den Posthäusern durch das wandernde Familienconcert die Milde der Reisenden rege machen wollen. In Oestreich spielen die Hirten auf einfachen aber wohlklingenden Instrumenten, angenehme Weisen. Diese Weisen und Lieder stimmen vollkommen mit dem sanften träumerischen Eindruck zusammen, den das Feld hervorbringt.
Die Instrumentalmusik ist in Deutschland eben so allgemein eingeführt, als die Vocalmusik in Italien. Die Natur hat freilich in dieser Hinsicht, wie in so mancher andern, mehr für Italien als für Deutschland gethan. Es kostet Mühe und Anstrengung, um es in der Instrumentalmusik etwas weit zu bringen, während der südliche Himmel allein hinreicht, schöne Stimmen zu bilden; gleichwohl würden nie Männer aus den arbeitenden Classen auf die Erlernung der Musik die nothwendige Zeit verwenden können, wenn sie nicht natürliche Anlage dazu hätten. Die von Natur musikalischen Völker erhalten durch die Harmonie Gefühle und Ideen, zu welchen ihre beschränkte Lage und ihre alltäglichen Beschäftigungen ihnen nicht verstatten würden, auf andere Art zu gelangen.
Die Bäuerinnen und Dienstmägde, die nicht Geld genug zu einem vollständigen Sonntagsstaat haben, schmücken gleichwohl Kopf und Arme mit Blumen aus. damit doch wenigstens die Einbildungskraft bei ihrem Anzuge ihr Spiel treiben möge; andere, die es weiter bringen können, tragen an Sonn- und Festtagen eine Mütze von Goldstoff, ziemlich geschmacklos, und gegen den übrigen schlichten Anzug sonderbar abstechend, auf dem Kopfe; aber diese Mütze, die schon ihre Mütter trugen, erinnert an die alten Sitten; und der feierliche Staat, mit welchem die Frauen aus der niedrigen Volksklasse den Sonntag ehren, hat etwas Ernstes, und spricht für sie.
Man sollte den Deutschen ebenfalls für ihren guten Willen Dank wissen, anstatt sie zu belächeln, wenn sie uns durch ihre ehrerbietige Verneigungen und ihre förmliche Höflichkeit zu ehren gedenken. Sie hätten ja so leicht durch Gleichgültigkeit und Kälte jene Artigkeit und Grazie ersetzen können, die zu erreichen wir Ausländer sie für unfähig halten. Durch Verachtung gebietet man jederzeit dem Spotte Stillschweigen, denn dieser läßt sich meistentheils nur da aus, wo ihm zwecklose Anstrengungen, ihn zu entwaffnen, auffallen; aber wohlwollende Gemüther geben sich lieber dem Lachen preis, als daß sie es durch ein hohes, kaltes Wesen, welches man so leicht annehmen kann, zurückstießen.
In Deutschland ist nichts so auffallend, als der Gegensatz zwischen den Empfindungen und den Gewohnheiten, zwischen den Talenten und dem Geschmack. Ausbildung und Natur scheinen hier noch nicht gehörig zusammengeschmolzen zu seyn. Wahrheitliebende Männer erscheinen nicht selten im Ausdruck und im Anstande gezwungen, als hätten, sie etwas zu verbergen; nicht minder oft zeigt sich die sanfte Seele unter einer rauhen Aussenseite; ja man geht noch weiter, und die Schwäche des Characters blickt hinter harten Worten und harten Formen hervor. Mit dem Enthusiasmus für Dichtkunst und schöne Künste, verbinden sich vielfältig gemeine gesellschaftliche Sitten und Gewohnheiten. Es giebt kein Land, wo die Gelehrten oder junge Studierende auf hohen Schulen es weiter in den alten Sprachen und in der Kenntniß des Alterthums gebracht hätten; und von einer andern Seite kein Land, wo altväterische Sitten und Gebräuche einheimischer wären, als in Deutschland. Die Erinnerungen aus Griechenland, der Geschmack an der Kunst, scheinen durch Correspondenz dahin gelangt zu seyn; indes die Feudaleinrichtungen, die alten germanischen Gebräuche, noch immer in großen Ehren stehen, obschon sie, zum Nachtheil der militärischen Landesgewalt, viel von ihrer vorigen Kraft verloren.
Es giebt kein wunderlicheres Gemisch, als die militärische Ansicht von Deutschland; hier Soldaten, auf welche man mit jedem Schritte stößt; dort das eingezogene Leben, das geführt wird. Man scheuet sich vor den Beschwerden, vor der rauhen Luft, als bestände die Nation blos aus Handelsleuten und Gelehrten; während alle Anstalten dahin abzielen und abzielen sollen, der Nation militärische Gewohnheiten mitzutheilen. Die Völker des Nordens, die der Strenge ihres Clima Trotz bieten, gelangen zu einer vorzüglichen Abhärtung gegen alle Gattungen physischer Uebel, wie dies der russische Soldat beweiset; wo aber das Clima nur halbstreng ist, wo es noch möglich wird, sich der herben Luft durch häusliche Vorkehrungen zu entziehen, da machen eben diese Vorkehrungen die Menschen desto empfindlicher gegen die physischen Leiden des Krieges.
Die Oefen, das Bier, der Tabaksrauch umgeben den gemeinen Mann in Deutschland mit einer Art von schweren heißen Atmosphäre, aus welcher er nicht gern hervorgeht. Dieser Dunstkreis ist der Thätigkeit nachtheilig, die dem Krieger mindestens eben so nothwendig ist, als der Muth; Entschlüsse reifen dabei nur langsam; Muthlosigkeit tritt ein, weil eine für die meisten ziemlich dürftige Existenz eben nicht geschickt ist, Zutrauen auf das Glück einzuflößen; die Gewohnheit einer ruhigen, friedlichen Lebensart ist nicht die beste Vorbereitung auf die mannigfaltigen Zufälligkeiten des Lebens, so daß man sich lieber dem Tode unterwirft, der auf der geraden Straße uns entgegenkommt, als den Schicksalen eines Abenteurers.
Die Abscheidung der Classen, in Deutschland weit schärfer gezeichnet, als sie es in Frankreich war, mußte den Soldatengeist im Bürger ersticken. Diese Abscheidung hat, an sich, nichts Beleidigendes; denn, ich wiederhole es, die Gutmüthigkeit scheint überall in Deutschland, selbst in dem Aristokratenstolz, durch, und die Verschiedenheit der Stände beschränkt sich auf einigen Vorrang bei Hofe, auf einige geschlossene Zirkel, welche zu wenig Vergnügen gewähren, um in denen, die sie entbehren müssen, Neid zu erregen; denn nichts ist empfindlich, in welcher Hinsicht es sey, wo die Gesellschaft und durch sie die Waffe des Lächerlichen, nur wenig Gewalt hat. Die Menschen können dem Gemüth nur durch Falschheit oder Spott wehe thun; und in einem Lande voller Ernst und Wahrheit giebt es immer Gerechtigkeit und Glück. Aber die Scheidewand, die in Deutschland den Adel von dem Bürgerstand trennte, hatte zur nothwendigen Folge, daß die Nation im Ganzen minder kriegerisch ward.
Die Einbildungskraft, des kunstübenden und literarischen Deutschlands herrschende Eigenschaft, flößt Furcht vor der Gefahr ein, wenn man diese natürliche Bewegung nicht mit Hülfe der überwiegenden Meinung und des exaltierten Ehrgefühls bekämpft. In Frankreich war, schon ehedem, der Geschmack am Kriege allgemein; der gemeine Mann wagte gern sein Leben, um nur ein Mittel zu haben, es in Bewegung zu setzen, und an der Last desselben minder schwer zu tragen. Es ist eine große Frage, ob häusliche Neigungen, die Gewohnheit des Nachdenkens, ja die Sanftmuth des Gemüths selbst, nicht dahin führen, den Tod zu fürchten; wenn aber, wie in Deutschland, die ganze Kraft eines Staats auf seinem militärischen Geiste beruht, so wird die Untersuchung der Ursachen wichtig, die in der deutschen Nation diesen Geist geschwächt haben mögen.
Gewöhnlich führen drei Hauptbeweggründe die Menschen in den Krieg: Liebe zum Vaterlande und zur Freiheit, Ruhmbegierde und religiöser Fanatismus. Es giebt keine große Vaterlandsliebe in einem seit mehreren Jahrhunderten getheilten Reiche, wo Deutsche gegen Deutsche zu Felde zogen, mehrentheils um einem Antriebe von aussen Folge zu leisten; der Ruhmbegierde mangelt es an Lebhaftigkeit, wo es an einem Mittelpunkt, an einer Hauptstadt, an Geselligkeit fehlt. Die Art von Unparteilichkeit, die ich den Luxus der Gerechtigkeit nennen möchte, und die den Deutschen characterisirt, macht ihn weit fähiger, sich für abstracte Ideen, als für das Interesse des Lebens zu entflammen. Ein deutscher General, der eine Schlacht verliert, ist sicherer, Nachsicht zu erhalten, als einer, der sie gewinnt, glänzendes Lob einzuernten; überhaupt ist, bei einem solchen Volke, zwischen glücklichen und unglücklichen Erfolgen der Unterschied nicht groß genug, um den Ehrgeiz lebhaft anzuspornen.
Die Religion hat, in Deutschland, ihren Sitz im Innersten des Herzens; zugleich aber trägt sie gegenwärtig ein Gepräge der Träumerei und der Unabhängigkeit, welches ausschließlichen Empfindungen nicht den gehörigen Nachdruck beilegt. Dieses Einzelnstehen von Meinungen, Individuen und Staaten, der Macht des deutschen Reichs so überaus nachtheilig, findet sich auch in der Religion wieder; eine große Anzahl verschiedener Secten theilt sich in Deutschland, und die katholische Religion selbst, die durch ihre innere Beschaffenheit einförmige strenge Zucht hält, wird von den Deutschen, nach eines jeden Weise und Gutdünken, erklärt. Das politische und gesellschaftliche Gut der Völker, eine gleiche Regierung, ein gleicher Gottesdienst, gleiche Gesetze, gleiches Interesse, eine classische Literatur, eine vorherrschende Meinung; nichts von allem diesem findet sich bei den Deutschen. Dadurch wird freilich jeder einzelne Staat unabhängiger, jede Wissenschaft besser angebaut; aber die Nation im Ganzen zerfällt in solche Unterabtheilungen, daß man nicht weiß, welchem Theile des Reichs man den Namen Nation beilegen soll.
Die Freiheitsliebe ist bei den Deutschen nicht entwickelt; sie haben weder durch Genuß, noch durch Entbehrung, den Werth kennen gelernt, den man in diesem höchsten Gute finden kann. Es giebt mehrere Beispiele von Föderativ-Staaten, die dem Gemeingeist eben so viel Kraft als Einheit in der Regierung zutheilen; aber jene Staaten sind einander gleich, jene Bürger sind frei. Der deutsche Bund bestand aus Starken und Schwachen, aus Bürgern und Knechten, aus Nebenbuhlern und sogar aus Feinden; aus alten Elementen, durch die Umstände zusammentreffend, und von den Menschen in Würde gehalten.
Die deutsche Nation ist ausharrend und gerecht; ihr Gefühl für Billigkeit und Rechtlichkeit verhindert, daß eine, sogar fehlerhafte, Einrichtung zum Bösen führen könne. Als Ludwig der Baier in den Krieg zog, überließ er die Verwaltung seiner Staaten Friedrich dem Schönen, seinem Gefangenen; und dieses Vertrauen, welches damals für Niemand befremdend war, betrog ihn nicht. Mit solchen Tugenden hatte man von den Mängeln der Schwachheit, oder von der Verwickelung der Gesetze nichts zu befürchten; die Rechtschaffenheit der Menschen ersetzte alles.
Die Unabhängigkeit selbst, die man beinahe in jeder Hinsicht in Deutschland genoß, machte die Deutschen gleichgültig gegen die Freiheit: die Unabhängigkeit ist ein Gut, die Freiheit eine Bürgschaft; und eben weil niemand in Deutschland weder in seinen Rechten, noch in seinen Genüssen gekränkt wurde, fühlte man nicht das Bedürfniß einer Ordnung der Dinge, durch die dieses Gut behauptet würde. Die Reichsgerichtshöfe verschaften eine sichere, obschon langsame Gerechtigkeit gegen jede Handlung der Willkühr; die Mäßigung der Fürsten und die Weisheit der Völker gaben fast niemals Anlaß zu Vorstellungen; man glaubte, keines constitutionellen Bollwerkes zu bedürfen, weil man keinen Eingriff vor sich sah.
Es muß Wunder nehmen, daß das Feudalrecht beinahe ohne alle Abänderung unter so aufgeklärten Menschen fortgedauert habe; da aber in der Ausübung dieser an sich mangelhaften Gesetze nie Ungerechtigkeiten vorfielen, so tröstete die Gleichheit in der Anwendung über die Ungleichheit in dem Grundsatz. Die alten Urkunden, die alten Privilegien der Städte, jene große Familiengeschichte, die das Glück und den Ruhm der kleinen Staaten ausmacht, war den Deutschen über alles theuer; sie vernachlässigten darüber die große Nationalmacht, die es vor allen Dingen wichtig war, mitten unter den europäischen Colossen zu begründen.
Dem Deutschen fehlt es, mit wenigen Ausnahmen, an Fähigkeit zu allem, wozu Gewandtheit und Geschicklichkeit erfordert wird. Alles beunruhigt ihn, macht ihn verlegen; er bedarf eben so sehr der Methode im Handeln, als der Unabhängigkeit im Denken. Der Franzose hingegen betrachtet die Handlungen mit der Freiheit der Kunst, und die Ideen mit der Knechtschaft der Gewohnheit. Die Deutschen, die sich dem Joche der Regeln in der Literatur nicht unterwerfen können, möchten, daß im Leben ihnen alles vorgezeichnet würde. Sie verstehen sich nicht darauf, mit den Menschen zu verhandeln, und je weniger man ihnen Gelegenheit giebt, sich bei sich selbst Raths zu erholen, desto mehr ist man ihnen willkommen.
Politische Einsetzungen können allein den Charakter einer Nation begründen. Nun stand die Natur der Regierung in Deutschland mit der philosophischen Aufklärung der Deutschen beinahe im Gegensatz; daher kommt es, daß sie die größte Kühnheit im Denken mit dem folgsamsten Charakter verbinden. Der Vorzug, den der Soldatenstand hat, und die Verschiedenheit der Stände überhaupt haben sie in allen Verhältnissen des geselligen Lebens an die genaueste Unterwürfigkeit gewöhnt; der Gehorsam ist bei ihnen nicht Knechtschaft, er ist Regelmäßigkeit; sie sind in Erfüllung der an sie ergehenden Befehle eben so pünktlich, als ob jeder Befehl eine Pflicht wäre.
Die aufgeklärten Köpfe in Deutschland streiten lebhaft mit einander um die Herrschaft im Gebiet der Speculation; hier leiden sie keinen Widerspruch; überlassen übrigens gern den Mächtigen der Erden alles Reelle im Leben. »Gleichwohl findet das von ihnen verschmähte Reelle seine Abnehmer, welche nachher Verwirrung und Zwang selbst in den Reiz der Einbildungskraft übertragen.« [Von den Censoren gestrichen.]
Der Geist der Deutschen scheint mit ihrem Charakter in keiner Verbindung zu stehen; jener leidet keine Schranken, dieser unterwirft sich jedem Joche; jener ist unternehmend, dieser blöde; die Aufklärung des ersten giebt selten dem zweiten Kraft: und dieses erklärt sich gar leicht. Die Vermehrung unserer Kenntnisse in neueren Zeiten dient nur dazu, den Charakter zu schwächen, wenn er nicht durch die Gewohnheit der Geschäfte und die Ausübung des Willens gestärkt wird. Alles einsehen und begreifen, ist ein erheblicher Grund zur Ungewißheit; die Kraft zu handeln entwickelt sich nur in freien und mächtigen Gegenden, wo patriotische Empfindungen ihren Sitz in der Seele haben, wie das Blut in den Adern, und nur zugleich mit dem Leben erkalten. [Ich darf nicht erst dem Leser sagen, daß ich hier England im Sinne hatte; wenn aber nur die Namen nicht ausgeschrieben sind, macht sichs der größte Theil der Censoren, der aus aufgeklärten Männern besteht, zum Vergnügen, nicht zu verstehen. Nicht so die Polizei: sie besitzt eine wirklich auffallende Art von feindlichem Instinkt gegen alle liberale Ideen, unter welcher Form sie ihr aufstoßen mögen; in diesem Felde stöbert sie, wie die abgerichteten Spürhunde, alles auf, was in dem Gemüth der Franzosen ihre alte Liebe zur Aufklärung und zur Freiheit wieder rege machen könnte.]
————————
Drittes Capitel. Die Frauen.
Natur und Geselligkeit sind für die Frauen eine große Schule, wo sie leiden lernen; und es darf, dünkt mich, nicht geläugnet werden, daß sie in unsern Tagen, in der Regel, besser sind, als die Männer. Zu einer Zeit, wo der Egoismus das allgemeine Uebel ist, müssen die Männer, im Besitz aller positiven Vortheile weniger Edelmuth, weniger Gefühl besitzen, als die Frauen. Diese hängen nur durch die Bande des Herzens mit dem Leben zusammen; und selbst, wenn sie sich auf Abwege verirren, sind diese Verirrungen eine Folge des Gefühls, das sie fortzieht. Ihre Persönlichkeit zählt immer zwei, während die des Mannes nur ihn zum Ziel hat. Man huldigt ihnen nur durch die Zuneigungen, die sie einflößen; die zuerst in ihnen entstanden, sind mehrentheils dargebrachte Opfer. Die schönste aller Tugenden, die Hingebung, ist ihr Genuß und ihre Bestimmung; es kann kein Glück für sie geben, das nicht der Wiederschein des Ruhms und des Wohls eines Andern wäre; mit einem Worte, außer sich leben, sey's durch die Ideen, sey's durch Empfindung, sey's vor allem durch die Moralität, ist, was der Seele ein Gewohnheitsgefühl von Größe und Erhabenheit giebt.