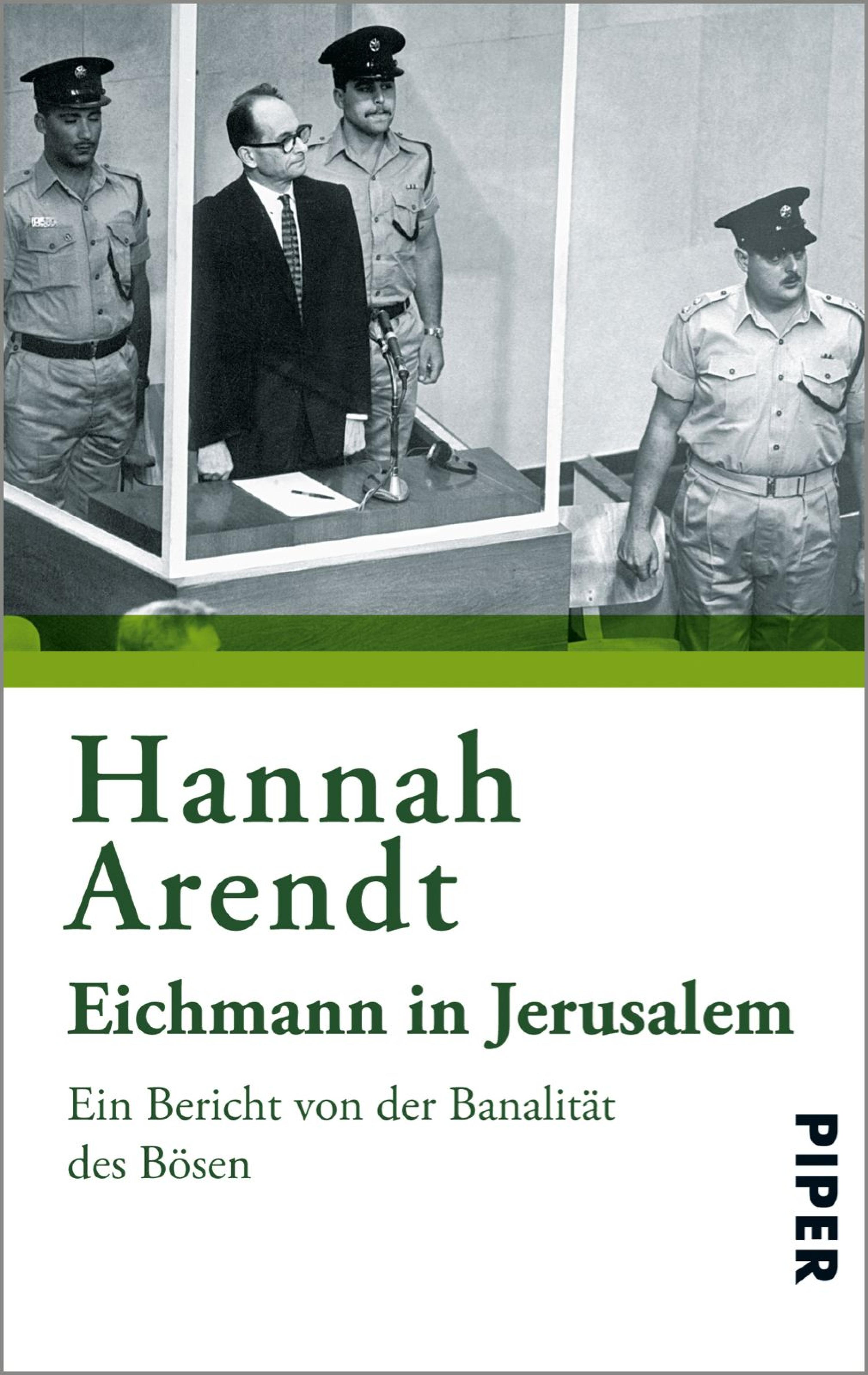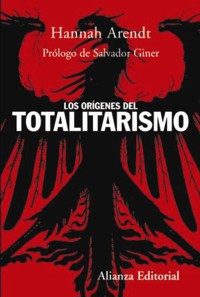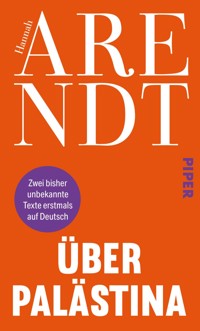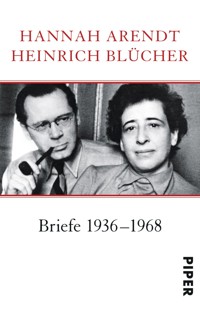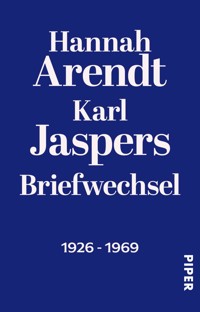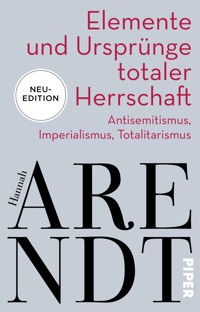13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die globalen Veränderungen der letzten Jahrzehnte und das Ende des Kalten Krieges werfen ein neues Licht auf Hannah Arendts Schrift »Über die Revolution«. Arendt analysiert in dieser brillanten Studie eines der erstaunlichsten Phänomene des 20. Jahrhunderts: Ausgehend von der amerikanischen und der Französischen Revolution, untersucht sie die Ablösung des Krieges als Mittel der gewaltsamen Veränderung durch die Revolution.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Herausgegeben von Thomas Meyer
Mit einem Nachwort von Jürgen Förster
Erweiterte Neuausgabe© 1963 Hannah Arendt, published by special arrangement with Harcourt Brace Jovanovich, Inc. New YorkTitel der amerikanischen Originalausgabe:»On Revolution«, The Viking Press, New York 1963© der deutschsprachigen Ausgabe:Piper Verlag GmbH, München 1965Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Anlässlich der Studienausgabe von Hannah Arendts Schriften
Widmung
Einleitung KRIEG UND REVOLUTION
Erstes Kapitel: Der geschichtliche Hintergrund
I
II
III
IV
V
Zweites Kapitel: Die soziale Frage
I
II
III
IV
V
VI
Drittes Kapitel: Der »Verfolg des Glücks«
Viertes Kapitel: Die Gründung: Constitutio Libertatis
I
II
III
Fünftes Kapitel: Novus Ordo Saeclorum
I
II
III
Sechstes Kapitel: Tradition und Geist der Revolution
I
II
III
IV
V
Literaturverzeichnis
Revolution als institutionelle Gründung der Freiheit – Nachwort
I.
II.
III.
IV.
V.
Siglenverzeichnis
Literaturverzeichnis Nachwort
Anmerkungen
Anlässlich der Studienausgabe von Hannah Arendts Schriften
Was Hannah Arendt dazu bewegte, der politischen Wirklichkeit so genau ins Gesicht zu sehen, waren die Kraft der Vernunft und die Verachtung der Illusion. Anderen schlüssig und verständlich zu machen, was sie sah, war ein großer geistiger Triumph – für sie persönlich, aber auch für die Tradition des offenen politischen Diskurses.
Judith Shklar (1975)
Die Studienausgabe in Einzelbänden von Hannah Arendts Schriften möchte dazu einladen, eine der bedeutenden Denkerinnen des 20. Jahrhunderts kennenzulernen oder erneut zu lesen. Ausgewiesene Experten untersuchen in ihren exklusiv für die Edition verfassten Nachworten die jeweiligen Werke. Die Autoren werden darin je eigene Schwerpunkte setzen, die Interessierten Hannah Arendts Gedankenwelt erschließen helfen, während sich die Spezialisten mit markanten Positionen auseinandersetzen können. Bewusst wurde darauf verzichtet, eine wie auch immer geartete Einheitlichkeit vorzugeben. Die Offenheit und die Vielfalt von Arendts Überlegungen werden sich folglich in den verschiedenen Positionen der Beiträger spiegeln, die innerhalb der Studienausgabe zu Wort kommen.
Die Ausgabe kann und will keine Konkurrenz zur kritischen, im Göttinger Wallstein Verlag erscheinenden Edition von Arendts Schriften sein. Die in Arendts Münchner Stammverlag Piper vorgelegten Bände bieten Texte, die auf der jeweils letzten, von ihr selbst noch überprüften Fassung beruhen. Druckfehler und andere offensichtliche Versehen sind korrigiert, die Zitate wurden überprüft, die bibliografischen Angaben und Register durchgesehen. Für all das trägt der Herausgeber die Verantwortung. Ziel war es, zitierfähige Ausgaben zu schaffen, die sowohl eine breite Leserschaft ansprechen als auch für Wissenschaftler eine verlässliche Textgrundlage bieten.
Die erste Lieferung der Edition wird jene Werke umfassen, die Arendts Ruf in Deutschland zu ihren Lebzeiten begründeten. In chronologischer Reihenfolge sind dies folgende Schriften: Die 1929 veröffentlichte Dissertation Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer philosophischen Interpretation, die erstmals 1955 vorgelegte Studie Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus und der zwei Jahre später veröffentlichte Band Fragwürdige Traditionsbestände im politischen Denken der Gegenwart. Vier Essays. Ebenso enthalten sind die 1959 publizierte Biografie Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik und die im Jahr darauf erschienene Monografie Vita activa oder Vom tätigen Leben. Es folgen die Reportage Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht über die Banalität des Bösen von 1964 und schließlich die ein Jahr später zugänglich gemachte Abhandlung Über die Revolution. Damit liegen im Piper Verlag erstmals die Augustin-Studie und die in dieser Form und unter dem Titel nie wieder aufgelegte, dem engen Freund Walter Benjamin gewidmete Aufsatzsammlung Fragwürdige Traditionsbestände vor.
Zu einem späteren Zeitpunkt werden unter anderem die zu Lebzeiten in deutscher Sprache veröffentlichten Zeitungsartikel, Aufsätze und Essays Arendts in chronologischer Reihenfolge neu herausgegeben werden. Das unvollendete Nachlass-Werk Life of the Mind, in der deutschen Übersetzung unter dem Titel Vom Leben des Geistes erstmals 1979 in zwei Bänden erschienen, wird die Ausgabe ergänzen, sobald eine verlässliche Textgrundlage verfügbar ist.
Hannah Arendts Werke sprechen für sich und die beigefügten Nachworte benötigen keinerlei Rechtfertigungen. Bleibt also der aufrichtige Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die sich der Aufgabe unterzogen haben, mit ihren Beiträgen die Schriften Hannah Arendts für hoffentlich viele Leserinnen und Leser zu öffnen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Piper Verlag gilt der Dank für die Zusammenarbeit und die Courage, das Werk Hannah Arendts in der vorliegenden Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Berlin, im Oktober 2020
Thomas Meyer
FÜR GERTRUD UND KARL JASPERS
in Verehrung – in Freundschaft – in Liebe
Einleitung KRIEG UND REVOLUTION
Kriege und Revolutionen, so meinte Lenin vor etwa fünfzig Jahren, würden das Gesicht des zwanzigsten Jahrhunderts bestimmen. Seither ist es, als hätten die Ereignisse nichts Eiligeres zu tun gehabt, als diese Voraussage zu bestätigen. Und im Unterschied zu den Ideologien des neunzehnten Jahrhunderts – Nationalismus und Internationalismus, Kapitalismus und Imperialismus oder Sozialismus und Kommunismus, die nur noch im rechtfertigenden Gerede eine Rolle spielen, aber ihre einstige substantielle Bezogenheit zu politischer Wirklichkeit verloren haben – stehen Krieg und Revolution immer noch im Zentrum politischen Geschehens. Sie haben alle ideologischen Rechtfertigungen überlebt. Politisch stehen wir in einer Konstellation, in der wir auf der einen Seite von einer totalen Vernichtung durch einen etwa ausbrechenden Krieg bedroht sind und in der wir doch andererseits beinahe täglich erfahren, wie sich die Hoffnung auf eine Emanzipation der gesamten Menschheit durch Revolution erfüllt. Was die Amerikanische Revolution in der Unabhängigkeitserklärung vor bald zweihundert Jahren proklamierte, daß ein Volk nach dem anderen »unter den Mächten der Erde den unabhängigen und gleichen Rang erlangen würde, auf den ein jedes gemäß den Gesetzen der Natur und ihres Gottes Anspruch habe«, ist mit einer manchmal fast beängstigenden Geschwindigkeit wahr geworden. Und in einer solchen sich über die ganze Erde erstreckenden Situation gibt es nichts mehr, wofür es sich zu kämpfen lohnte, als das, was das Älteste ist und von allem Anfang an, jedenfalls im Abendland, das eigentliche Wesen von Politik bestimmt hat – nämlich die Sache der Freiheit gegen das Unheil der Zwangsherrschaft jeglicher Art.
Dieser Tatbestand ist bemerkenswert und versteht sich keineswegs von selbst. Unter dem Kreuzfeuer jener Zweige der Psychologie und der Gesellschaftswissenschaften, deren Sinn und Ziel die Entlarvung ist, konnte es wohl scheinen, als sei dem Begriff der Freiheit nun wirklich der Garaus gemacht worden. Selbst die Revolutionäre, von denen man doch eigentlich hätte annehmen dürfen, daß sie unausrottbar in einer Tradition verwurzelt sind, von der man noch nicht einmal sprechen kann, ohne das Wort Freiheit in den Mund zu nehmen, sind bekanntlich nur zu bereit, Freiheit zu den »kleinbürgerlichen Vorurteilen« zu rechnen; gerade sie haben vergessen, daß das Ziel der Revolution heute wie seit eh und je nichts anderes sein kann als eben Freiheit. Aber nicht weniger verblüffend als dies Verschwinden der Freiheit aus dem revolutionären Vokabular dürfte wirken, daß Wort und Begriff plötzlich wieder aufgetaucht sind, um die ernsteste aller gegenwärtigen politischen Diskussionen zu ordnen und zu artikulieren, nämlich die Debatte über die Kriegsfrage, d. h. über die Berechtigung der Gewalt in der Politik. Geschichtlich gesehen, gehört der Krieg zu den ältesten Phänomenen der aufgezeichneten Vergangenheit, während es Revolutionen im eigentlichen Sinne vor der Neuzeit nicht gibt, die Revolution als politisches Phänomen also zu den modernsten Gegebenheiten gehört.
Für die Modernität der Revolution ist vermutlich nichts so charakteristisch, als daß sie von vornherein beanspruchte, die Sache der Menschheit zu vertreten, und zwar gerade weil die Menschheit im achtzehnten Jahrhundert nicht mehr als eine »Idee« war. Es handelte sich nicht nur um Freiheit, sondern um Freiheit für alle, und dies mag der Grund sein, warum die Revolution selbst, im Unterschied zu den revolutionären Ideologien, um so moderner und zeitgemäßer geworden ist, je mehr die »Idee« der Menschheit sich durch die moderne Technik zu einer handgreiflichen Realität entwickelt hat. Will man dies auf eine Formel bringen, so kann man auch heute noch auf Thomas Paine zurückgreifen, der auf Grund seiner Erfahrungen in der Amerikanischen und Französischen Revolution meinte: »The Revolutions which formerly took place in the world had nothing in them that interested the bulk of mankind. They extended only to a change of persons and measures, but not of principles, and rose or fell among the common transactions of the moment.«[1] Was aber nun den Freiheitsbegriff anlangt, so ist er zwar mit dem Wesen der Revolution von Anfang an verbunden, hat aber ursprünglich mit Krieg und Kriegszielen kaum etwas zu tun. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß Befreiungskriege in der historischen Erinnerung der Völker oft mit einem besonderen Nimbus umgeben worden sind oder daß in der Kriegspropaganda, die von den »heiligsten Gütern der Nation« spricht, die Freiheit als Schlagwort immer wieder auftaucht. Denn all dies besagt keineswegs, daß darum die Befreiungskriege in Theorie und Praxis als die einzigen »gerechten Kriege« galten.
Rechtfertigungen des Krieges auch auf dem Niveau politischer Theorie sind sehr alt, wiewohl natürlich nicht so alt wie die organisierte Kriegsführung. Sie setzen offenbar voraus, daß politische Beziehungen normalerweise nicht im Zeichen der Gewalt stehen, und diese Überzeugung von der wesentlichen Gewaltlosigkeit der Politik finden wir zum erstenmal im griechischen Altertum. Die griechische Polis verstand sich ausdrücklich als eine Staats- und Gesellschaftsverfassung, die nicht auf der Gewalt, sondern auf dem gegenseitigen Sich-Überzeugen, dem πείειν, beruht. Daß es sich bei diesem Selbstverständnis keineswegs um leeres Gerede oder Selbsttäuschung handelte, die man heute »entlarven« könnte, zeigt sich vielleicht am sinnfälligsten in dem athenischen Brauch, die zum Tode Verurteilten nicht hinzurichten, sondern sie zu »überreden«, den Schierlingsbecher selbst an die Lippen zu setzen; physische Gewaltanwendung war unter allen Umständen mit der Würde eines athenischen Bürgers unvereinbar. Da aber für die Griechen das Politische, nämlich die Polis, schon dem Wortsinn nach sich unter keinen Umständen über die Grenzen der Stadtmauer erstrecken konnte, bedurfte die Gewalt in dem Bereich, den wir heute Außenpolitik oder internationale Beziehungen nennen, auch gar keiner Rechtfertigung; obwohl griechische Außenpolitik (abgesehen von den Perserkriegen, in denen ganz Hellas vereint war) sich nur zwischen griechischen Stadtstaaten abspielte, galt sie nicht als eigentlich politisch. Außerhalb der Stadtmauern, nämlich außerhalb des Bereichs des Politischen im griechischen Sinne, galt das Wort des Thukydides: »Die Mächtigen tun, was sie können, und die Schwachen leiden, was sie müssen.«
Die ersten Rechtfertigungen des Krieges und damit den ersten Unterschied zwischen gerechten und ungerechten Kriegen kennen wir aus dem römischen Altertum. Aber diese römischen Unterscheidungen und Rechtfertigungen handeln nicht von Freiheit, und wir finden in ihnen nirgends den Unterschied zwischen Angriffs- und Verteidigungskrieg. »Denn gerecht ist ein Krieg für diejenigen, für die er notwendig ist, und heilig sind die Waffen, wo nur in den Waffen noch Hoffnung ist«, meint Livius. (Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma ubi nulla nisi in armis spes est.[2]) Seit den Tagen Livius’ und durch die Jahrhunderte hat man die Notwendigkeit für vieles angerufen, das uns heute sehr viel mehr für einen ungerechten als für einen gerechten Krieg zu sprechen scheint. Der Drang nach Eroberung und Expansion, die Verteidigung bestimmter Interessensphären, die Erhaltung der Macht gegen neuen, bedrohlichen Machtzuwachs eines Nachbarn oder die Aufrechterhaltung eines bestimmten Mächtegleichgewichts – all diese nur zu bekannten Inventarstücke der Machtpolitik sind ja nicht nur die Ursachen der meisten uns bekannten Kriege in der Geschichte, sie wurden vor allem auch immer als »Notwendigkeiten« empfunden, welche den Ausbruch eines Krieges voll rechtfertigten. Die Vorstellung, daß der Angriffskrieg ein Verbrechen ist und daß Kriege nur als Verteidigungs- oder Präventivkriege gerechtfertigt werden können, hat eine praktische und selbst theoretische Bedeutung überhaupt erst nach dem Ersten Weltkrieg gewonnen, als das furchtbare Vernichtungspotential moderner Waffen zum erstenmal voll in Erscheinung getreten war.
Vielleicht hängt damit, daß nicht Freiheit, sondern Notwendigkeit der Rechtfertigung des Krieges in unserer Überlieferung diente, zusammen, daß uns unabweisbar ein Gefühl des Unbehagens überkommt, wenn das Argument der Freiheit heute in die Debatte der Kriegsfrage geworfen wird. Sich angesichts des unvergleichlichen und unvorstellbaren Vernichtungspotentials eines Atomkrieges frisch-fröhlich, als sei nichts geschehen, auf das uralte »lieber tot als Sklave« zu berufen, ist nicht nur gefährlich, es ist auch grotesk. Daß es einen erheblichen Unterschied bedeutet, ob man sein eigenes Leben für Leben und Freiheit des Vaterlandes und der Nachkommen aufs Spiel setzt oder ob man die Existenz des Menschengeschlechts im ganzen für die gleichen Zwecke riskiert, ist so offenbar, daß es schwer hält, den Verfechtern des Lieber-tot-als-rot auch nur den guten Glauben zuzubilligen. Was natürlich nicht besagt, daß die Umkehrung, das Lieber-rot-als-tot, weniger lächerlich wäre. Wenn eine alte Lebensweisheit den faktischen Verhältnissen nicht mehr entspricht, wird sie nicht dadurch wahrer, daß man sie kurzerhand auf den Kopf stellt. In Wirklichkeit ist es doch so, daß man unschwer beiden Seiten in dieser Diskussion einen geheimen Vorbehalt nachweisen kann. Diejenigen, die sagen: lieber tot als rot, meinen in Wahrheit: es wird schon nicht so schlimm sein, und die Verluste, die man heute theoretisch errechnet, sind vermutlich übertrieben; während diejenigen, die sagen: lieber rot als tot, in Wahrheit der Meinung sind, daß man die Unterdrückung des Menschen in den modernen Gewaltherrschaften sehr übertrieben hat, daß der Mensch seine Natur nicht ändern werde und daß Freiheit nicht für immer aus der Menschenwelt verschwinden könne. Dies aber besagt, daß beide Seiten sich schließlich vor den Konsequenzen der Alternative drücken, die sie doch selbst vorgeschlagen haben.[3]
Nun darf man nicht vergessen, daß der Freiheitsbegriff sich in der Debatte der Kriegsfrage überhaupt erst gemeldet hat, nachdem ganz offenbar ein Stadium in der technischen Entwicklung erreicht war, in welchem ein zweckmäßiger Einsatz der Gewalt- und Vernichtungsmittel nicht mehr möglich ist. Dadurch ist es, als habe man das Freiheitsargument wie einen deus ex machina in die Kriegsdebatte geworfen, um zu rechtfertigen, was rational nicht mehr zu rechtfertigen ist. Vielleicht ist es nicht zu gewagt, in der derzeitigen hoffnungslosen Verwirrung der Fragen und Argumente ein erstes Anzeichen dafür zu erblicken, daß sich eine außerordentlich tiefgreifende, prinzipielle Veränderung aller Außenpolitik vorbereitet, nämlich das allmähliche Verschwinden des Krieges überhaupt von der Bühne der Politik, und zwar ohne eine zwangsläufige radikale Wandlung im internationalen Verhalten der Mächte zueinander oder eine innere Wandlung des Menschen überhaupt. Könnte es nicht sein, daß unsere gegenwärtige Unfähigkeit, mit der Kriegsfrage fertig zu werden, nur besagt, daß wir auf Grund unserer Überlieferung noch schlechterdings außerstande sind, außenpolitisch auch nur zu denken, ohne das Hilfsmittel einer »Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln« als die ultima ratio allen Handelns in Betracht zu ziehen?
Ganz abgesehen von der Gefahr totaler Vernichtung, die sich prinzipiell auch wieder ändern könnte durch neue technische Erfindungen wie die »saubere« Bombe oder eine Verteidigung gegen Raketenbeschuß, lassen sich dafür immerhin einige Anzeichen geltend machen. Da ist erstens die Tatsache, daß die totale Kriegsführung praktisch mit dem Ersten Weltkrieg begann, insofern damals bereits die Unterscheidung von Militär und Zivilbevölkerung nicht mehr respektiert wurde, und zwar nur aus technischen, nicht aus ideologischen Gründen. Nun ist dieser Unterschied selbst relativ modern, und seine Aufhebung besagt nicht mehr, aber auch nicht weniger, als daß wir nun glücklich wieder da angelangt sind, wo Rom Karthago dem Erdboden gleichmachte. Aber unter modernen Verhältnissen kommt dieser Wiederkehr des totalen Krieges, wie wir ihn aus dem Altertum kennen, doch eine erhebliche politische Bedeutung zu; sie steht nämlich in offenbarem Widerspruch zu der Grundannahme, auf der in allen modernen Staaten das Verhältnis von Armee und zivilem Staatsapparat beruht: daß es nämlich die Aufgabe der Armee sei, die Zivilbevölkerung zu schützen und zu verteidigen. Innenpolitisch gesehen, könnte man durchaus die Geschichte des Krieges in unserm Jahrhundert als die immer deutlicher in Erscheinung tretende Unfähigkeit der Armee darstellen, diese ihr ursprünglich zukommende Funktion zu erfüllen. Jedermann weiß, daß in einem künftigen Kriege die Wehrmacht vermutlich weniger Verluste erleiden wird als die Bevölkerung, und die Strategie der Abschreckung setzt ganz offen voraus, daß das Militär nicht so sehr die Aufgabe hat, das Land gegen den Feind zu schützen, als sich an ihm für die bereits stattgehabte Vernichtung zu rächen.
Eng verwandt mit dieser Perversion im Verhältnis von Zivil und Militär ist zweitens die kaum beachtete, aber sehr bemerkenswerte Tatsache, daß wir es eigentlich bereits seit Ende des Ersten Weltkrieges für selbstverständlich halten, daß keine Regierung und keine Staatsform stark genug sind, eine Niederlage im Kriege zu überleben. Man könnte diese Entwicklung bis ins neunzehnte Jahrhundert zurückverfolgen, bis zu dem Augenblick jedenfalls, als der Deutsch-Französische Krieg in Frankreich die Transformation des Zweiten Kaiserreiches in die Dritte Republik erzwang; und die Russische Revolution von 1905, die unmittelbar auf die Niederlage im Russisch-Japanischen Krieg folgte, war sicher nicht geeignet, die Staaten in der Zuversicht in die eigene Lebensfähigkeit im Falle einer Niederlage zu stärken. Jedenfalls dürfte heute feststehen, daß revolutionäre Umwälzungen, sei es von innen wie nach dem Ersten Weltkrieg, sei es von außen wie nach dem Zweiten Weltkrieg, nebst Forderungen nach bedingungsloser Kapitulation und der Errichtung von Kriegsgerichten durch den Sieger die sicherste Konsequenz jeder militärischen Niederlage sind, die nicht mit völliger Zerstörung geendet hat. Dabei dürfen wir hier die Frage außer Betracht lassen, ob dieser unheimliche Tatbestand einer so entscheidenden Schwächung des Staates dem allgemeinen Autoritätsverlust der Neuzeit zuzuschreiben ist oder ob es eben keinen Staat und keine Regierung geben kann, und seien sie noch so fest verankert in dem Vertrauen der Bürger, die dem furchtbaren Gewaltstrom einer modernen Kriegsführung standzuhalten vermögen. Auf jeden Fall lohnt sich festzuhalten, daß es in Kriegen politisch bereits um die nackte Existenz ging, als noch niemand etwas von den neuen entsetzlichen Entwicklungen des Atomkrieges ahnte, die auch das biologische Leben in Frage stellen. Dies aber heißt, daß der Krieg überhaupt die Existenz aller Staaten und aller Regierungen in Frage stellt.
Ein dritter Punkt betrifft die radikale Veränderung im Wesen des Krieges selbst, die sich daraus ergibt, daß das Prinzip der Abschreckung maßgebend für das Wettrüsten geworden ist. Denn es ist in der Tat richtig, daß die Abschreckungsstrategie »aims in effect at avoiding rather than winning the war it pretends to be preparing. It tends to achieve its goals by a menace which is never put into execution rather than by the act itself.«[4] Und dies ist keineswegs eine Konsequenz, die sich nur dem Theoretiker aufdrängt, sondern eine Einsicht, der sich die militärischen Instanzen voll bewußt sind. So meinte etwa ein höherer Offizier der amerikanischen Luftwaffe angesichts der großen Anzahl von Soldaten im aktiven Dienst, daß »ein jeder von ihnen seine eigentliche Aufgabe nur erfüllen kann, wenn er niemals wirklich tut, wozu man ihn ausgebildet hat«.[5] Zwar ist die Einsicht, daß der Friede das dem Kriege inhärente Ziel ist und daß daher jeder Krieg der Vorbereitung des Friedens dient, zum mindesten so alt wie Aristoteles, und die Vorgabe, daß im Wettrüsten die beste Garantie des Friedens liege, ist vermutlich sogar älter, nämlich so alt wie die Propagandalüge. Aber hier liegt die Sache doch anders. Heute nämlich ist die Vermeidung des Krieges nicht nur das ehrliche oder lügenhaft behauptete Ziel einer gesamtpolitischen Konzeption, sondern das maßgebliche Prinzip der militärischen Veranstaltungen und Vorbereitungen selbst. Das Militär bereitet sich nicht mehr auf einen Krieg vor, von dem eine staatsmännisch geleitete Regierung hofft, daß er nie ausbrechen wird: Ihr eigenes Ziel ist vielmehr die Entwicklung von Waffen, die den Krieg unmöglich machen sollen. Sie selber arbeiten unter dem Motto: »Peace is our profession.«[6]
Es steht fernerhin ganz im Einklang mit diesen gleichsam paradoxen Kriegsvorbereitungen, daß sich am Horizont internationaler Politik eine ernsthafte Möglichkeit abzeichnet, »heiße« Kriege durch »kalte« zu ersetzen. Natürlich handelt es sich bei dem Wettrüsten der großen Mächte im wesentlichen vor allem um die Erfindung neuer technischer »Verbesserungen« des Waffenarsenals, während nur die Herstellung von Atombomben in Ländern, die nicht oder noch nicht zu den Großmächten zählen, primär politisch motiviert ist. Dennoch scheint es mir nahezu unleugbar, daß sich in dem Rüstungswettrennen der Großmächte neuerdings eine ausgesprochen politische Tendenz geltend gemacht hat; es ist, als handele es sich hier um eine ganz neue Art von Friedensmanövern, deren Abhaltung nicht das vorgebliche Feindespaar normaler Manöver in Friedenszeiten involviert, sondern diejenigen, zwischen denen der Krieg möglicherweise wirklich ausbrechen kann. Hierfür spricht auch, daß die alte Politik der Geheimhaltung aller militärischen Entwicklungen sich in den letzten Jahren wesentlich geändert hat. »Indem wir unsere militärische Stärke konkret darlegen, können wir nach Ansicht unserer Politiker dazu beitragen, einen möglichen Gegner von einem unüberlegten Angriff zurückzuhalten. ›Es handelt sich hier um einen neuen Sicherheitsbegriff […] Sicherheit und Geheimhaltung pflegten synonyme Begriffe zu sein, während heute umgekehrt die Sicherheit in Formen offener Kommunikation gesucht wird‹.«[7] Es ist, als ob das atomare Wettrüsten in eine Art hypothetischer Kriegsführung führt, in der die Gegner einander das Zerstörungspotential ihrer Waffen vorführen; und wiewohl es natürlich immer möglich ist, daß dies tödlich gefährliche Spiel im Hypothetischen plötzlich in die Wirklichkeit einbricht, so ist es doch auch durchaus denkbar, daß ein »kalter« Krieg, nämlich ein Krieg, der de facto niemals ausgebrochen ist, eines Tages durch den Sieg des einen und die Niederlage des andern beendet wird. Sind dies Phantasien? Dagegen spricht, daß wir mit dieser Möglichkeit hypothetischer Kriegsführung eigentlich bereits konfrontiert waren, als die erste atomare Bombe auf dem Kriegsschauplatz erschien. Damals meinten viele, was heute erwiesen ist, daß es, um die japanische Regierung zur bedingungslosen Kapitulation zu veranlassen, völlig genügt hätte, die neue Waffe vor einer ausgewählten Gruppe japanischer Wissenschaftler zu demonstrieren; denn für diejenigen, die Bescheid wußten, hätte die bloße Demonstration eine absolute Überlegenheit jenseits des Kriegsglücks zwingend erwiesen.[8] Zwanzig Jahre nach Hiroschima hat die technische Entwicklung gerade auf dem Gebiet der Zerstörung eine Meisterschaft erreicht, bei der alle nicht-technischen Faktoren in der Kriegsführung, wie Truppenmoral, Strategie, Tüchtigkeit und selbst das Schlachtenglück, so sehr in den Hintergrund treten, daß die Endresultate im vorhinein mit nahezu perfekter Präzision errechnet werden können. Ist der Punkt perfekter Kalkulation erst einmal erreicht, so dürften die Resultate von Versuchen und Demonstrationen für die Sachkundigen Sieg und Niederlage mit gleicher endgültiger Evidenz beweisen, wie ehedem das Schlachtfeld, die Eroberung und Besetzung von Gebieten, der Zusammenbruch des Nachrichten- und Versorgungsapparats und was sonst für die militärischen Experten ausschlaggebend war.
Es bleibt schließlich noch die Tatsache, die in unserem Zusammenhang besonders bemerkenswert ist, daß die innere Beziehung von Krieg und Revolution, ihre gegenseitige Abhängigkeit und die Wechselwirkung zwischen ihnen, ständig gewachsen ist und daß der Schwerpunkt in diesem Verhältnis sich mehr und mehr vom Kriege auf die Revolution verlagert hat. Zwar ist diese Wechselwirkung an sich kein neues Phänomen, sie ist sogar genauso alt wie die Revolutionen selbst, denen entweder ein Befreiungskrieg voranging und sie dann begleitete wie in der Amerikanischen Revolution oder die in Verteidigungs- und Angriffskriegen endeten wie die Französische Revolution. Aber zu diesen Beispielen hat sich in unserem Jahrhundert ein ganz und gar anders gearteter Ereignistypus gesellt, bei dem es ist, als sei selbst die Kriegswut nur ein Vorspiel, ein vorbereitendes Stadium für den Terror und den Schrecken, den die Revolution auslöst (so jedenfalls hat Pasternak den Zusammenhang von Krieg und Revolution im Doktor Schiwago interpretiert), wobei diese Beziehung sich auch umdrehen kann und dann ein Weltkrieg wie die Folge einer Revolution erscheint, als sei er ein Bürgerkrieg, der die ganze Welt in Mitleidenschaft zieht; so ist bekanntlich der Zweite Weltkrieg von einem nicht unbeträchtlichen Teil der öffentlichen Meinung in aller Welt verstanden worden, und keineswegs zu Unrecht. Heute, zwanzig Jahre später, ist es uns schon beinahe selbstverständlich, daß ein Krieg unweigerlich in einer Revolution endet und daß die einzige überhaupt nur denkbare Rechtfertigung eines solchen Krieges die Sache der Freiheit ist. So scheint es mehr als wahrscheinlich, daß, was immer die Zukunft bringen mag, Revolutionen im Gegensatz zu Kriegen nicht so bald von der Bildfläche des politischen Geschehens verschwinden werden, es sei denn, der Atomkrieg bringe den Untergang der gesamten Menschenwelt oder doch zumindest der gesamten uns bekannten Zivilisation. Auch wenn es uns gelänge, das Gesicht dieses Jahrhunderts so entscheidend zu verändern, daß man es nicht mehr ein Jahrhundert der furchtbaren Kriege und Weltkriege nennen könnte, so wird es wohl doch bis zu seinem Ende ein Jahrhundert der Revolutionen bleiben.
Sollte sich diese Voraussage bewahrheiten, sollte im Sinne Kants, »was guter Wille hätte tun sollen, aber nicht tat, endlich die Ohnmacht bewirken«,[9] so würde daraus folgen, daß in dem gegenwärtigen Konflikt, der die Welt in zwei feindliche Parteien aufzuspalten droht, diejenigen schließlich die Oberhand behalten werden, die verstehen, was eine Revolution ist, was sie vermag und was sie nicht vermag, während alle die, welche auf die Karte der reinen Machtpolitik setzen und daher auf der Fortexistenz des Krieges als der ultima ratio aller Außenpolitik bestehen, in einer nicht zu entfernten Zukunft entdecken dürften, daß ihr Handwerk veraltet ist und daß mit ihrer Meisterschaft niemand mehr etwas Rechtes anzufangen weiß. Und ein solches artikuliertes Verständnis um das, worum es in einer Revolution eigentlich geht, kann weder ersetzt noch widerlegt werden durch vermeintliche Sachverständige der Konterrevolution; denn die Konterrevolution – ein Wort, das Condorcet im Verlauf der Französischen Revolution prägte – ist von der Revolution so abhängig und vorbestimmt wie die Reaktion von der Aktion. De Maistres berühmtes Wort: »La contre-révolution ne sera point une révolution contraire, mais le contraire de la révolution«, ist heute wie zur Zeit seiner Formulierung im Jahre 1796 nicht mehr als ein geistreicher Einfall.[10]
Die hier namhaft gemachten Unterschiede zwischen Krieg und Revolution – daß der Krieg sich auf die Notwendigkeit und die Revolution sich auf die Freiheit beruft, daß der Akzent des Weltgeschehens sich mehr und mehr von dem Ereignis des Krieges auf das der Revolution zu verlagern scheint – dürfen doch nicht verschleiern, daß wir es mit Phänomenen zu tun haben, die historisch in einem sehr engen Zusammenhang stehen. Das sie verbindende Glied ist die Gewalt, und diese Rolle der Gewalt darf um so weniger gering geachtet werden, als sie Krieg und Revolution gleichermaßen gerade als politische Phänomene zu disqualifizieren scheint. »Ce qui produit le bien général est toujours terrible«, meinte Saint-Just. Wer wollte leugnen, daß Kriege auch darum so leicht in Revolutionen umschlagen und daß Revolutionen auch darum eine so verhängnisvolle Neigung zeigen, Kriege zu entfesseln, weil die Gewalt ihr gemeinsamer Nenner ist? So könnte man wohl meinen, der Erste Weltkrieg habe eine so ungeheure Gewalt entfesselt, daß Revolutionen in seinem Gefolge auch dann ausgebrochen wären, wenn es vordem noch nie eine Revolution gegeben hätte und keine mit ihr verbundene revolutionäre Tradition.
Dies soll natürlich nicht heißen, daß Kriege, von Revolutionen ganz zu schweigen, je ausschließlich von Gewalt bestimmt wären. Wo die Gewalt absolut herrscht, wie z. B. in den Konzentrationslagern der totalen Herrschaft, da schweigen nicht nur die Gesetze – »les lois se taisent«, hieß es in der Französischen Revolution –, sondern alles und alle. Um dieses Schweigens willen ist die Gewalt im politischen Bereich ein Grenzphänomen, denn der Mensch, sofern er ein politisches Wesen ist, existiert in dem Miteinandersprechen. Die beiden berühmten aristotelischen Definitionen des Menschen, daß er ein politisches und ein mit Sprache begabtes Wesen sei, ergänzen sich gegenseitig und beruhen beide gleichermaßen auf den Erfahrungen des griechischen Lebens in der Polis. Hier handelt es sich nicht einfach darum, daß die Sprache hilflos ist, wenn ihr die Gewalt gegenübertritt (es ist in der Tat wahr, daß man der »geschwätzigen Demokratie« nur den Revolver auf die Brust zu setzen braucht, um sie verstummen zu machen, nur hat man damit eben auch allem politischen Leben den Garaus gemacht), sondern vielmehr darum, daß die Gewalt selbst stumm ist, unfähig nämlich, sich im Wort wirklich adäquat zu äußern. Weil die Gewalt ihrem Wesen nach stumm ist, kann auch die politische Theorie wenig über sie aussagen, und eine Diskussion der Gewaltmittel überläßt sie besser den technischen Experten. Denn das politische Denken ist darauf angewiesen, daß die Phänomene seines Bereichs sich selbst kund tun; es bleibt dem, was von sich her in dem Bereich menschlicher Angelegenheiten erscheint und sich ausspricht, verbunden. Und diese politischen Phänomene, im Unterschied zu den reinen Naturerscheinungen, bedürfen der Sprache und der sprachlichen Artikulation, um überhaupt in Erscheinung zu treten; sie sind als politische überhaupt erst existent, wenn sie den Bereich des nur sinnfällig Sichtbaren und Hörbaren überschritten haben. Kriegs- oder Revolutionstheorien können es daher nur mit den Rechtfertigungen von Gewalt, aber nicht mit dieser selbst zu tun haben; erst in der Rechtfertigung wird die Gewalt ein eigentlich politisches Phänomen. Sollte aber eine solche Theorie, statt in der Gewalt eine ultima ratio der Politik zu sehen, eine Rechtfertigung von Gewalt überhaupt oder ihre Glorifizierung anbieten, so ist sie nicht mehr eine politische, sondern eine im Wesen antipolitische Theorie.
Die Gewalt kann nie mehr, als die Grenzen des politischen Bereichs schützen. Wo die Gewalt in die Politik selbst eindringt, ist es um die Politik geschehen. Unter dem Aspekt des reinen Gewaltprozesses stehen Kriege wie Revolutionen außerhalb des politischen Raumes, und dies trotz der ja ungeheuer großen Rolle, welche solche Prozesse in der Geschichte gespielt haben. Diese Tatsache hatte das siebzehnte Jahrhundert, das sich ja gerade in Kriegen und Revolutionen besonders gut auskannte, im Auge, wenn es den sogenannten Naturzustand (»state of nature«) als einen präpolitischen Zeitraum hypothetisch ansetzte, der natürlich niemals als ein historisch nachweisbarer Tatbestand gemeint war. Diese Hypothese hat auch heute noch ihre Relevanz, insofern sie die Einsicht ausdrückt, daß es keineswegs immer und überall, wo Menschen zusammenleben, einen politischen Bereich gibt und daß wir von vielen Ereignissen wissen, die prinzipiell nicht-politischer Natur sind, ja nicht einmal in irgendeinem Zusammenhang mit dem Politischen im eigentlichen Sinne stehen, obwohl sie in einem geschichtlichen und historisch bekannten Verlauf auftreten. Der Begriff des Naturzustandes weist zumindest auf Realitäten hin, welche der Entwicklungsbegriff des neunzehnten Jahrhunderts auf keine Weise begreifen kann, ob er nun den historischen Prozeß in der Kategorie der Kausalität oder der Aktualisierung von Möglichkeiten oder als eine dialektische Bewegung oder auch nur als einen in sich stimmigen Folgezusammenhang denkt. Denn die Hypothese eines Naturzustandes impliziert, daß es so etwas gibt wie einen Anfang, der als solcher von allem, was nach ihm kommt, wie durch einen Abgrund getrennt ist.
Daß das Problem des Anfangs oder Ursprungs für das Phänomen der Revolution von ausschlaggebender Bedeutung ist, ist offenbar. Daß ein enger Zusammenhang zwischen einem solchen Anfang und der Gewalt besteht, scheint durch die Ursprungslegenden der biblischen wie der klassischen Tradition bezeugt: Kain erschlug Abel, Romulus erschlug Remus; Gewalt stand am Anfang, woraus zu folgen scheint, daß kein Anfang ohne Gewaltsamkeit möglich ist, daß jeder Neubeginn etwas vergewaltigt. Diese ersten Taten unserer Geschichte, die mit Legenden anhebt, haben unzählige Jahrhunderte im Gedächtnis der Menschen überlebt mit jener Kraft, die dem menschlichen Denken in den seltenen Augenblicken eignet, wenn es ihm gelingt, in zwingend überzeugenden Metaphern zu sprechen oder in weithin anwendbaren Geschichten. Die Legende sprach es klar aus: Am Anfang aller Brüderlichkeit steht der Brudermord, am Anfang aller politischen Ordnung steht das Verbrechen. Für diese uralte, durch die Jahrhunderte getragene Überzeugung von dem Beginn aller menschlichen Angelegenheiten ist die Annahme eines Naturzustandes nur eine letzte, theoretisch gereinigte Paraphrase, und sie klingt noch deutlich nach in Marx’ berühmtem Ausspruch von der Gewalt als der mächtigen Geburtshelferin der Geschichte.
Erstes Kapitel Der geschichtliche Hintergrund
I
In unserm Zusammenhang muß die Kriegsfrage außer Betracht bleiben. Die von mir als Metaphern erwähnten Ursprungslegenden und die Theorie von einem prähistorischen Naturzustand, in der diese Legenden ihre begriffliche Formulierung fanden, sind zwar oft zur Rechtfertigung von Krieg und Gewalt als einem der menschlichen Natur inhärenten Erbübel benutzt worden, als könne der Geschichtsprozeß des Menschengeschlechts, da er durch ein Verbrechen in Gang gekommen ist, auch nur durch Verbrechen weiter in Gang gehalten werden. Da aber Revolutionen, und nicht Kriege, die einzigen politischen Ereignisse sind, die uns inmitten der Geschichte direkt und unausweichlich mit einem Neubeginn konfrontieren, ist ihre Bedeutung für die Frage nach dem Sinn von Revolution im Bereich der menschlichen Angelegenheiten noch entscheidender. Denn wie immer man das Ereignis der Revolution definieren und beschreiben mag, es handelt sich bei ihm niemals um einen noch so radikalen Regierungswechsel oder einen Umschwung innerhalb eines historischen Kontinuums. Moderne Revolutionen haben kaum etwas gemein mit der mutatio rerum römischer Geschichte oder dem Bürgerzwist, den wir als στάσις aus den griechischen Stadtstaaten kennen. Sie lassen sich nicht mit den platonischen Umschwüngen, den in den jeweiligen Staatsformen selbst angelegten μεταβολαί, gleichsetzen noch mit Polybius’ Kreislauf der Staatsformen, der πολιτειῶν ἀνακύκλωσις, in die alle menschlichen Angelegenheiten gebannt bleiben kraft der ihnen innewohnenden Tendenz, im Extrem ihren eigenen Umbruch zu provozieren.[11] Mit politischen Umschwüngen dieser Art und mit der Gewalt, die in ihnen zum Ausbruch kam, war das klassische Altertum nur zu vertraut; was ihm aber ganz fremd war, ist, was uns nahezu selbstverständlich ist, nämlich daß sich in solchen Umschwüngen jeweils etwas ganz Neues zeigt oder daß eine neue Geschichte mit ihnen anhebt. Der Umschwung unterbrach nicht den Lauf der Welt, er brachte nur ihren Kreislauf in ein anderes Stadium. Der Kreislauf war die Art und Weise, in der dieser ganze Bereich des Lebens sich bewegte und fortbewegte und wieder in sich zurückschlug. Wie veränderlich auch immer menschliche Angelegenheiten sein mochten, der Lauf der Welt im ganzen war unveränderlich. Etwas eigentlich Neues konnte sich hier so wenig ereignen wie in der umgreifenden Sphäre des Kosmos oder des Seins im ganzen.
Nun kann man aber die modernen Revolutionen unter einem anderen, geläufigeren Aspekt sehen, der scheinbar für Vergleiche mit früheren, vormodernen Zeiten ergiebiger ist. Was sich als erstes aufdrängt, wenn wir an Revolution denken, ist die soziale Frage, und diese ist anscheinend bereits von Aristoteles in ihrer revolutionären Bedeutung entdeckt worden, da Aristoteles bekanntlich Platos Umschwünge ökonomisch erklärte und die Oligarchie als die Herrschaft der Besitzenden, die Demokratie dagegen als die Herrschaft der Besitzlosen interpretierte. Daß ein Tyrann zumeist die Herrschaft durch das einfache Volk gewinnt und daß nichts diese vorgebliche Volksherrschaft besser befestigt als das Verlangen der Armen nach Gleichheit der Lebensumstände, war im Altertum keineswegs unbekannt oder unbemerkt geblieben. Daß Besitzverhältnisse und Staatsformen etwas miteinander zu tun haben, daß Reichtum von großem politischen Gewicht sein kann, sowie der aus diesen Zusammenhängen sich ergebende Verdacht, daß politische Macht nur die Folge ökonomischer Machtstellung sein könne, aus der sich schließlich die generalisierende Folgerung ergab, daß die Bewegkraft aller politischen Kämpfe das Interesse, und zwar damals bereits durchaus ein »Klasseninteresse«, sei – all dies ist natürlich nicht eine Erfindung von Karl Marx und auch nicht der Neuzeit, wiewohl wir so zugespitzte Formulierungen wie Harringtons »Herrschaft ist Besitz« (dominion is property, real or personal) oder Rohans »Die Fürsten kommandieren den Völkern, und das Interesse kommandiert den Fürsten« schwerlich vor dem sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert finden. Will man schon für die sogenannte materialistische Geschichtsauffassung einen einzigen Autor verantwortlich machen, so dürfte es sich empfehlen, bis auf Aristoteles zurückzugehen, weil er der erste war, der meinte, das Interesse, nämlich τò σύμφερον bzw. das einer Person oder einer Gruppe Nützliche, sei im politischen Bereich von ausschlaggebender Bedeutung.
Wie gewalttätig sich aber nun auch diese durch das Interesse veranlaßten Umstürze vollziehen mochten, bis eine neue Ordnung etabliert war, der Unterschied zwischen Arm und Reich als solcher hat bis zum Anbruch der Neuzeit und bis zum Ausbruch der Revolutionen des achtzehnten Jahrhunderts als ebenso natürlich für das Leben des politischen Organismus gegolten wie der Unterschied zwischen Krank und Gesund für das Leben des menschlichen Organismus. Erst als man im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert daran zu zweifeln begann, daß Armut zu den Bedingungen gehört, unter denen den Menschen das Leben auf der Erde gegeben ist, daß es nur wenigen gelingen kann, sich von den Fesseln des Elends durch ungewöhnliche persönliche Kraft oder außerordentliche Umstände oder auch einfach durch Betrug zu befreien, konnte die soziale Frage wirklich revolutionäre Bedeutung erhalten. Der Zweifel selbst bzw. die damals noch verwegene Hoffnung auf ein irdisches Leben im Zeichen der Fülle statt unter dem Fluch der Notdurft war vermutlich amerikanischen Ursprungs. Symbolisch gesprochen, möchte man meinen, daß gerade für die soziale Revolution alles bereit stand, als John Adams mehr als zehn Jahre vor dem Ausbruch der Amerikanischen Revolution sagen konnte: »I always consider the settlement of America as the opening of a grand scheme and design in Providence for the illumination of the ignorant and the emancipation of the slavish part of mankind all over the earth.«[12] Theoretisch aber war über die kommende revolutionäre Rolle der sozialen Frage bereits sehr viel früher entschieden, nämlich als erst Locke (vermutlich unter dem Eindruck des allgemeinen Wohlstandes in den Kolonien der Neuen Welt) und dann Adam Smith entdeckten, daß Mühe und Arbeit kein bloßes Zubehör der Armut sind, gleichsam die Tätigkeit, die dem Armsein entspricht, sondern im Gegenteil die eigentliche Quelle allen Reichtums. Nur unter diesen Voraussetzungen war es denkbar, daß eine Rebellion der Armut, »des versklavten Teils der Menschheit«, mehr erreichen konnte, als daß die einen auf Kosten der anderen befreit wurden.
Lange bevor die Neuzeit die technischen Mittel auch nur zu finden begonnen hatte, um des doppelten Elends von Mühe und Notdurft Herr zu werden, war Amerika bereits zum Symbol einer Gesellschaftsordnung geworden, in der es wirkliche Verelendung nicht gab. Und erst als die Kunde von dieser verblüffenden Neuigkeit nach Europa gelangt war und sich auch unter den Völkern gehörig verbreitet hatte, wurden die soziale Frage und der Aufruhr der Armen zu einem revolutionären Faktor allerersten Ranges. Im Grunde hat nichts, weder theoretische Erwägungen noch unmittelbar geschichtliche Entwicklungen, so viel dazu beigetragen, die klassische Vorstellung von einem ewigen Kreislauf aller menschlichen Angelegenheiten zu brechen, wie die faktische Entstehung der amerikanischen Gesellschaft vor der Amerikanischen Revolution. Erst als die Prosperität Amerikas den Kreis einer ewigen Wiederkehr gebrochen hatte, stellte sich heraus, in welchem Ausmaß seine angebliche Notwendigkeit auf der scheinbar »natürlichen« Unterscheidung zwischen Arm und Reich beruht hatte.[13] Es gibt eine große gelehrte Literatur über den Einfluß der Amerikanischen auf die Französische Revolution, wie natürlich auch über den großen Einfluß europäischer Denker auf den Gang der Amerikanischen Revolution. Aber keiner der nachweisbaren literarischen und dokumentarischen Einflüsse der Neuen Welt auf den Gang der Dinge in der Alten kann es an wirklicher Relevanz mit der einfachen Tatsache des »verblüffenden Wohlstandes« aufnehmen, von dem uns die Amerikareisenden des achtzehnten Jahrhunderts einstimmig berichten[14] – weder die Tatsache, daß die Französische Revolution dem Vorbild der Amerikanischen folgte, als sie mit einer konstituierenden Versammlung begann, noch daß die Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dem Beispiel der Bill of Rights in Virginia folgte, noch daß »der Gedanke einer Trennung der gesetzgebenden und der verfassungsgebenden Gewalt […]« aus der amerikanischen Verfassung übernommen wurde.
Die eigentümliche Folgenlosigkeit der Amerikanischen Revolution für den Gang der modernen Revolutionen kann vorerst nur angedeutet werden. Daß weder der Geist dieser Revolution noch die immer wirklich gedachten und oft erstaunlich gelehrten Theorien der »gründenden Väter« einen wesentlichen Widerhall in Europa fanden, ist eine unbezweifelbare Tatsache, aus der man leider geschlossen hat, daß in Amerika eben niemals eine »richtige« Revolution stattgefunden habe. Daran ist immerhin so viel richtig, daß das, was die Männer der Amerikanischen Revolution für die größte Errungenschaft ihrer neuen republikanischen Staatsform hielten, nämlich die Ausarbeitung und Anwendung der Montesquieuschen Lehre von der Teilung der Gewalten, niemals von irgendwelcher Bedeutung für das revolutionäre Denken Europas und damit der übrigen Welt geworden ist. Die eigentlich »konterrevolutionären« Argumente, mit denen Turgot noch vor Ausbruch der Französischen Revolution sich gegen die amerikanischen Revolutionäre wandte und behauptete, die Majestät der Staatssouveränität verlange eine absolute Zentralisierung der Macht (das Wort »Souveränität« ist ursprünglich die französische Übersetzung des lateinischen majestas und wurde zuerst von Jean Bodin gebraucht), haben sich praktisch und theoretisch in allen anderen Revolutionen durchgesetzt.[15] Nur Mirabeaus berühmte Verteidigung der konstitutionellen Monarchie als der besten aller Staatsformen tritt für eine Teilung der Gewalten ein, der gesetzgebenden und der ausführenden; und die Argumente, die er vorbringt (in der berühmten Rede Über das Vetorecht des Königs aus dem Jahre 1789), gründen sich nicht auf ein Verständnis des Wesens der Macht, sondern auf eine hier ganz unangemessene und unüberzeugende Unterscheidung zwischen Wollen und Handeln; auch Mirabeau hielt den Willen des Volkes für die einzige legitime Quelle der Gesetze und hätte sich daher, wenn er länger gelebt hätte, in die gleichen Aporien verstrickt wie seine weniger gemäßigten Kollegen. (Auf diese Aporien werden wir ausführlich im vierten Kapitel zurückkommen.) Mit anderen Worten, die Argumente des Nationalstaats haben die Argumente der Republik von vornherein überspielt und in den Hintergrund gedrängt. Andererseits hat das für alle anderen Revolutionen vordringlichste und politisch unlösbarste Problem der furchtbaren Massenarmut, an dem faktisch die französische Republik dann scheiterte und vielleicht scheitern mußte, in der Amerikanischen Revolution so gut wie keine Rolle gespielt. Es war nicht die Amerikanische Revolution, sondern die Existenz der Neuen Welt ohne Armut und Elend, wie sie sich lange vor der Unabhängigkeitserklärung herausgebildet hatte, welche einen wirklich revolutionären Willen in Europa auslöste.
Der neue Kontinent war zu einer Zufluchtsstätte, zu einem »Asyl« und einem Versammlungsplatz der Armen nicht nur Englands, sondern ansatzweise ganz Europas geworden. In die Mutterländer berichtete man von einem »neuen Geschlecht von Menschen«, die von »den sanften Banden einer milden Regierung geeint« seien, unter Bedingungen »einer wohltuenden Einförmigkeit« lebten und »absolutes Elend, das schlimmer ist als der Tod«, nicht kennten. Jedoch Crèvecœur, den ich soeben zitierte, war charakteristischerweise ein erbitterter Gegner der Amerikanischen Revolution, die seiner Meinung nach eine Art Verschwörung der Aristokraten gegen den gemeinen Mann darstellte.[16] Er wirkt heute wie der erste Wortführer des gemeinen Mannes, den das leidenschaftliche Anliegen der Amerikanischen Revolution, einen neuen politischen Körper zu gründen und eine neue Staatsform einzurichten, nicht kümmerte, sondern den nur interessierte, daß dort ein »neuer Kontinent«, ein angeblich »neuer Mensch«, eine neue Gesellschaft entstanden war, in der einem Wort Jeffersons zufolge »die Armen und die Reichen sich einer höchst angenehmen Gleichheit erfreuten«. Jeffersons lovely equalityhat in der Tat revolutionierend gewirkt, erst in Europa und dann auf der ganzen von Menschen bewohnten Erde, mit dem Resultat, daß von der Französischen Revolution bis zu den Revolutionen unseres Jahrhunderts sich alle Revolutionäre darüber einig waren, daß es erheblich wichtiger sei, die Gesellschaftsordnung so zu verändern, wie sie in Amerika bereits vor dem Ausbruch der Revolution verändert war, als zu versuchen, die Gesamtstruktur des politischen Bereiches neu zu gründen. Stände bei den Revolutionen der Neuzeit wirklich nicht mehr und nichts anderes auf dem Spiel als die Veränderung der Gesellschaftsstruktur, dann könnte man in der Tat behaupten, daß die Entdeckung Amerikas und die Kolonisierung des neuen Kontinents ihren wahren Ursprung bildeten; man müßte dann annehmen, daß Jeffersons lovely equality, die in der Neuen Welt natürlich entstanden, ja gleichsam organisch herangewachsen war, eben gewaltsam und sehr blutig auch in die Alte Welt, nachdem sie die Kunde von der neuen Hoffnung der Menschheit vernommen hatte, gebracht werden müßte. Und diese Meinung, in mannigfacher und oft recht differenzierter Form, teilen denn auch vor allem diejenigen unter den modernen Historikern, die ohnehin annehmen, es habe in Amerika selbst eigentlich gar keine Revolution stattgefunden. Für diese Auffassung könnten sie sich zudem noch auf Marx berufen, der offenbar auch nicht geglaubt hat, daß seine Prophezeiungen der Entwicklung des Kapitalismus und der kommenden proletarischen Revolution für die gesellschaftliche Entwicklung in den Vereinigten Staaten gültig sein werden. So interessant diese Einschränkungen, die Marx an der eigenen Theorie vollzog, sind und sosehr sie für einen Realitätssinn zeugen, den man seinen Schülern und Nachfolgern wirklich nicht nachsagen kann, all diese Theorien selbst werden eigentlich durch die einfache Tatsache der Amerikanischen Revolution selbst widerlegt. Und Tatsachen sind hartnäckig, sie verschwinden nicht einfach von der Bildfläche der Geschichte, nur weil Historiker und Soziologen sich weigern, sie zur Kenntnis zu nehmen, sondern erst wenn jedermann, vor allem also auch der »gemeine Mann«, sie vergessen hat. Wenn aber ein solches Vergessen eintritt, handelt es sich nicht mehr um eine akademische Angelegenheit. In unserem speziellen Falle würde es wortwörtlich bedeuten, daß die amerikanische Republik, die aus der Amerikanischen Revolution hervorging und in ihr ihre eigentlichen Wurzeln hat, zum Untergang verurteilt ist.
Bevor wir uns der Frage zuwenden, wie es nun eigentlich mit dem Aufkommen von Revolutionen in der Neuzeit bestellt ist, müssen wir noch kurz der nicht seltenen Ansicht gedenken, derzufolge die moderne Revolution ihrem Wesen nach christlichen Ursprungs sei, und dies auch dann, wenn sie prinzipiell atheistisch auftritt. Diese These stützt sich natürlich auf die rebellische Natur der frühchristlichen Sekten, ihre offene Verachtung der weltlichen Mächte und des öffentlichen Lebens, auf die Gleichheit der Gläubigen vor Gott, die in den frühchristlichen Gemeinden auch noch eine irdische Verwirklichung fand, und vor allem natürlich auf die Verheißung des Himmelreichs, wobei dann angenommen wird, alle diese Gedanken und Hoffnungen seien schließlich in säkularisierter Form in den Revolutionen voll wirksam geworden. Leider fragt man sich bei diesen ideengeschichtlichen Konstruktionen niemals, ob und bis zu welchem Grad spezifisch religiöse, transzendent gebundene und im Gottesglauben verankerte Vorstellungen und Ideen denn überhaupt einer Verweltlichung fähig sind, ob nicht vielleicht jede Säkularisierung bewirkt, daß sie ihren eigentlichen Gehalt verlieren. Aber davon abgesehen, ist natürlich erst einmal zuzugeben, daß die Säkularisierung im Sinne einer Trennung von Religion und Politik und das Entstehen eines eigenständigen weltlichen Bereichs für das Phänomen der Revolution von großer Bedeutung sind. Es mag sich sogar schließlich herausstellen, daß das, was wir »Revolution« in der Neuzeit nennen, eben jene Übergangsphase ist, in welcher ein neuer, säkularer Bereich zum Vorschein kommt. Wenn dies aber zutrifft, so sind es nicht die christlichen Gehalte, sondern ist es offenbar die Säkularisierung selbst, welche am Ursprung der Revolutionen liegt. Das erste Stadium dieses Säkularisierungsprozesses bildet weit eher das Zeitalter des Absolutismus als die Reformation; denn jene »Revolution«, die einem Wort Luthers zufolge die Welt erschüttert, wenn das Wort Gottes von der überlieferten Autorität der Kirche wieder befreit ist, gilt allen Formen des weltlichen Regiments und hält die Welt in einer ständigen Erschütterung; sie errichtet keine neue weltliche Ordnung, sondern rüttelt ständig und unablässig an den Grundlagen aller weltlichen Ordnungen.[17] Zwar kann man Luther, der ja schließlich eine neue Kirche gründete, unter die großen Gründergestalten der Geschichte zählen, aber seine Gründung hat so wenig mit einem novus ordo saeclorum gemein, daß sie im Gegenteil nur dazu gedient hat und dazu hat dienen sollen, ein wahrhaft christliches Leben radikaler von allen weltlichen Sorgen und Erwägungen zu befreien. Dabei ist nicht zu leugnen, daß die protestantische Trennung von Autorität und Tradition, nämlich die Loslösung der Autorität von aller Tradition und ihre erneute Rückführung auf das Wort Gottes, das Ihrige zu dem neuzeitlichen Autoritätsverlust beigetragen hat. Aber selbst dies würde ohne die Gründung einer neuen Kirche weltlich so wirkungslos geblieben sein wie die Endzeitspekulationen des späten Mittelalters von Joachim di Fiore bis zur Reformatio Sigismundi. Ob man nun in diesen Spekulationen, wie neuerlich vorgeschlagen wird, die auf jeden Fall recht harmlosen Vorgänger der modernen Ideologien sehen kann, mag dahingestellt bleiben; mit gleichem Recht kann man in den eschatologischen Bewegungen des Mittelalters die Vorgänger der modernen Massenhysterien sehen.[18] Aber all das bringt uns einem Verständnis der Revolutionen um keinen Schritt näher; denn selbst eine Rebellion ist erheblich mehr als eine Massenhysterie, von Revolutionen ganz zu schweigen. So hat ja auch der in gewissen, ausgesprochen religiösen Bewegungen ganz offenkundig rebellische Geist immer in irgendeinem great awakening oder einem revivalism geendet, also in jenen halb hysterischen Glaubenserweckungen vor allem puritanischer Prägung, die weder politische noch eigentlich geschichtliche Folgen gehabt haben. Schließlich gerät die These, daß die Revolutionen letztlich christlichen Ursprungs seien, im Grunde nicht weniger in Konflikt mit den Tatbeständen, die sie erklären will, als die Ansicht, welche die Amerikanische Revolution aus der Geschichte herausdisputieren möchte. Denn Tatsache ist, daß keine Revolution je im Namen des Christentums gemacht wurde oder sich auf das Christentum berufen hat. So könnte man sich höchstens noch entschließen zu behaupten, daß es eben der Moderne bedurft hätte, um die revolutionären Keime des Christentums freizulegen und sie wirksam werden zu lassen – wobei wir ja dann offenbar wieder bei der alten Frage stehen, wie es kommt, daß Revolutionen sich in der Neuzeit überhaupt ereignen.
Nun gibt es aber in diesem Zusammenhang noch eine andere Interpretationsmöglichkeit, welche in der Tat dem Kern der Sache erheblich näher kommt. Ich erwähnte bereits das dem Phänomen der Revolution innewohnende Element des Neu-Beginns, und es ist theoretisch einleuchtend, daß es nur unter der Bedingung eines gradlinig ablaufenden Zeitprozesses so etwas geben kann wie Neuheit, Einmaligkeit, Beginn und wie die Charaktere dessen, was wir historische Zeit nennen, noch lauten mögen. Natürlich ist unbestreitbar, daß der christliche Glaube, der ja an die Geburt Christi als ein einmaliges, unwiederholbares Ereignis gebunden war, den antiken Zeitbegriff durchbrechen mußte; daraus hat man gefolgert, daß unser Geschichtsbegriff ebenfalls christlichen Ursprungs sei, und wenn dies richtig ist, müßte man auch zu dem Schluß kommen, daß es so etwas wie eine Revolution, in der das Bewußtsein eines absoluten Novums lebendig ist, nur innerhalb einer christlichen Zeitauffassung geben könne. Nun kennt aber der christliche Geschichtsbegriff, wie er von Augustin maßgeblich formuliert wurde, einen Neuanfang nur als ein außerweltliches Ereignis, das einmal in den Gang der Welt und ihre Geschichte eingebrochen ist, um aus ihr sofort wieder zu verschwinden. Augustin selbst betont ausdrücklich, daß solch ein Ereignis sich nur einmal ereignen könne und nie wieder, jedenfalls nicht vor dem Ende aller weltlichen Zeiten. Ein Einmaliges und einmalig Neues also hat sich nur einmal ereignet. Was die weltliche Geschichte hingegen betrifft, so blieb die christliche Zeitauffassung durchaus der Antike verpflichtet: Die Reiche der Welt kommen und gehen, entstehen und vergehen in kreisläufigem Wechsel wie seit eh und je; daran hat das Ereignis von Christi Geburt nichts geändert. Nur ist der Christ, weil ihm durch Christus ein ewiges Leben garantiert ist, nun imstande, den Kreislauf weltlicher Zeit zu durchbrechen und sich dem Schauspiel, das die Welt jeweils den gerade Lebenden bietet, zu entziehen.
Daß alles vergänglich ist, daß die Welt dem ewigen Wechsel anheimgegeben ist, daß alles, was Menschen tun und lassen, nicht von Bestand ist und also vielleicht vergeblich – all dies hat natürlich nichts mit spezifisch christlichen Vorstellungen zu tun, sondern ist die allgemeine Stimmung, die sich durch die Jahrhunderte des ausgehenden Altertums zieht. Diese Stimmung war dabei der klassischen griechischen Philosophie und vor allem dem vorphilosophischen griechischen Selbstverständnis, für das die Menschen ausdrücklich die »Sterblichen« sind, erheblich verwandter als dem Geist der römischen Republik in ihrer klassischen Zeit. Im Unterschied zu den Römern waren die Griechen überzeugt, daß Wechsel und Vergänglichkeit, wie sie den Bereich der Sterblichen bestimmen, selbst unabänderbar sind, und zwar darum, weil sie sich nicht nur aus der Sterblichkeit der Sterblichen, sondern gewissermaßen aus ihrer Gebürtlichkeit ergeben, daraus nämlich, daß der Bereich menschlich-weltlicher Angelegenheit dauernd dadurch erschüttert wird, daß die Jungen, die im griechischen Sprachgebrauch auch einfach νέοι, die Neuen, hießen, in ihn eindringen. Polybius, der vielleicht als erster auf die Bedeutung und die Problematik des Generationenwechsels ausdrücklich hingewiesen hat, dürfte sich der politischen Relevanz dieses Phänomens wohl gerade darum bewußt geworden sein, weil ihm als Griechen die römische und so ganz ungriechische Lösung dieses Problems auffallen mußte, die darin bestand, daß man durch Erziehung die »Neuen« an das Alte band und dadurch die Welt in einer außerordentlichen Stabilität halten und erhalten konnte.[19]
Die politische Stabilität und historische Kontinuität Roms haben die Griechen der Spätzeit sehr bewundert, gerade weil sie ihnen selbst so fremd gewesen sein muß. Die unmittelbare, von Trost und Hoffnung unbeirrbare Erfahrung der Flüchtigkeit alles dessen, was sich im Bereich rein menschlicher Angelegenheiten überhaupt ereignen kann, hat nun zwar dazu geführt, daß griechische Philosophie die Tendenz hatte, sich von diesem Bereich überhaupt abzuwenden, so wie später eine weniger unmittelbare und weniger unbeirrbare Erfahrung im ausgehenden Altertum dazu führte, daß man sich von allen möglichen Jenseitsversprechungen ein Heil zu erwarten begann. Aber in wie verschiedenen und immer differenzierteren Formen auch diese Erfahrungen gemacht und formuliert wurden, sie haben niemals dazu geführt, sich von einem Neuanfang in der Welt selbst etwas zu versprechen. Menschliche Angelegenheiten waren einem dauernden Wechsel unterworfen, ohne je etwas ganz und gar Neues hervorzubringen. Wenn es etwas Neues unter der Sonne gab, so höchstens die Menschen selbst, die als »Neue« in die Welt geboren werden. Aber wie neu auch die »Neuen« und Jungen in der Welt sein mochten, sie waren hineingeboren in ein Schauspiel von Natur und Geschichte, das im wesentlichen immer dasselbe zur Schau stellte.
II
Vor den beiden großen Revolutionen am Ende des achtzehnten Jahrhunderts gab es einen eigentlichen Revolutionsbegriff nicht. Denn dieser ist unlösbar der Vorstellung verhaftet, daß sich innerhalb der weltlichen Geschichte etwas ganz und gar Neues ereignet, daß eine neue Geschichte anhebt. Dabei läßt sich nachweisen, daß keiner der Männer, die in den Ereigniszusammenhang eingriffen, der sich schließlich eben als eine Revolution enthüllte, die leiseste Vorahnung von diesem absolut Neuen hatte. Erst als die Revolutionen bereits wirklich zum Ausbruch gekommen waren, und lange bevor die Beteiligten die Chancen von Sieg oder Niederlage wirklich abschätzen konnten, wurde Handelnden wie Zuschauern gleichermaßen das Neue des Unternehmens und der eigentliche Sinn der Handlung selbst offenbar. Was die Handlung anlangt, so stellte sich heraus, daß sie die Geburt der Freiheit betraf. Vier Jahre nach dem offiziellen Ausbruch der Französischen Revolution, also im Jahre 1793 – zu einem Zeitpunkt, an dem Robespierre seine Gewaltherrschaft als einen »Despotismus der Freiheit« definieren konnte, ohne daß diese Definition als unverständliches Paradox empfunden worden wäre –, hat Condorcet ausgesprochen, was jedermann bereits wußte: »Das Wort ›revolutionär‹ darf nur angewendet werden auf Revolutionen, deren Ziel die Freiheit ist.«[20] Das Bewußtsein, einem Ereignis beizuwohnen, das eine radikal neue Geschichtsperiode einleiten würde, hatte sich bereits ein Jahr früher geäußert, nämlich bei der Einführung des revolutionären Kalenders, in dem das Jahr der Hinrichtung des Königs und der Ausrufung der Republik als Jahr 1 gezählt wurde.
Daß die Idee der Freiheit und die Erfahrung eines Neuanfangs miteinander verkoppelt sind in dem Ereignis selbst, ist für ein Verständnis der modernen Revolutionen entscheidend. Und da wir innerhalb der freien Teile der Welt nachgerade der Meinung sind, daß für die Beurteilung politischer Verfassungen und Gemeinwesen weder Gerechtigkeit noch Größe, sondern einzig und allein das Kriterium der Freiheit den Ausschlag gibt, hängt nicht nur unser Verständnis des Phänomens der Revolution, sondern die Präzision und Tiefe unseres politischen Freiheitsbegriffs, der zweifellos revolutionären Ursprungs ist, und damit überhaupt das Ausmaß unseres politischen Selbstverständnisses davon ab, wieweit wir bereit und fähig sind, dieses Zusammenfallen von Anfang und Freiheit zu akzeptieren und zu artikulieren. Daher mag es gerechtfertigt sein, wenn wir hier bereits, wo es noch um das rein Historische geht, einen Augenblick innehalten und versuchen, gewisse gängige Mißverständnisse dadurch zu vermeiden, daß wir uns wenigstens einen Aspekt vergegenwärtigen, unter dem die neue Freiheit sich manifestierte, wobei wir denn auch Gelegenheit haben, einen ersten Blick auf das spezifisch Moderne des Phänomens der Revolution überhaupt zu werfen.
Daß Befreiung und Freiheit nicht dasselbe sind, daß Freiheit zwar ohne Befreitsein nicht möglich, aber niemals das selbstverständliche Resultat der Befreiung ist, daß der Freiheitsbegriff, der der Befreiung eigen ist, notwendigerweise nur negativ ist, und daß also die Sehnsucht nach Befreiung keineswegs identisch ist mit dem Willen zur Freiheit – all das sind natürlich Binsenwahrheiten. Und wenn solche Selbstverständlichkeiten so leicht übersehen werden, so deshalb, weil es in der Geschichte viele Befreiungskämpfe gibt, über die wir sehr gut unterrichtet sind, und sehr wenig wirkliche Versuche, die Freiheit zu gründen, von denen wir zudem meist nur in Form von Legenden überhaupt etwas wissen. Hinzu kommt, daß der abendländische Freiheitsbegriff entscheidend durch eine lange und schwer zu überblickende Geschichte religiösen und philosophischen Denkens vorgeformt ist, und zwar gerade in jenen langen Jahrhunderten zwischen dem Untergang der antiken und der Geburt der neuzeitlichen Welt, in denen es politische Freiheit nicht gab und Menschen aus Gründen, die uns hier nichts angehen, sich für eine solche Freiheit auch nicht interessierten. So versteht man selbst in politischer Theorie gemeinhin unter politischer Freiheit überhaupt kein primär politisches Phänomen, sondern im Gegenteil die mehr oder minder ungehinderte Ausübung nicht-politischer Betätigungen, die jeweils von einem Staat erlaubt und garantiert ist.
Freiheit als ein politisches Phänomen datiert von dem Entstehen der griechischen Polis. Seit Herodot galt als Polis jede griechische Stadt, in der die Bürger in ihr Zusammenleben nicht den Begriff der Herrschaft eingeführt hatten, in der es also eine Scheidung in Herrscher und Beherrschte nicht gab.[21] Die Verfassung, die diesem politischen Körper entsprach, hieß Isonomie, und das Wesentliche an dieser Staatsform kommt bereits in ihrem Namen zum Ausdruck. Im Gegensatz nämlich zu anderen den Griechen bekannten Staatsformen – der Monarchie und der Oligarchie, der Aristokratie und der Demokratie – drückt sich in ihr kein ἄρχειν und kein ϰρατεῖν, kein Element des Herrschens aus. (Dies teilt die Isonomie mit dem Königtum, der βασιλεία, was wichtig genug ist, worauf wir aber hier nicht eingehen können.) Es ist ein Irrtum zu meinen, daß die Polis sich selbst als Demokratie verstand; sie verstand sich als Isonomie. Das Wort »Demokratie« oder »Volksherrschaft« bzw. »Herrschaft der Vielen« war ursprünglich von Feinden der Isonomie als Schimpfwort erfunden worden; das Schimpfwort war geprägt, um der Polis zu sagen, daß sie sich nur einbilde, in einer Verfassung der Isonomie zu leben, daß sie in Wahrheit ebenfalls unter einer Herrschaft stehe, und zwar unter der anerkannt schlechtesten – der Volksherrschaft.[22]
Hiervon ist vor allem festzuhalten, daß die Gleichheit, die wir im Gefolge Tocquevilles ja eher als eine Gefahr für die Freiheit zu bewerten geneigt sind, ursprünglich beinahe mit Freiheit identisch war. Nun bedeutet allerdings diese Gleichheit der Isonomie, also die Gleichheit im Rahmen des Gesetzes, nicht die Gleichheit der Lebensumstände – wiewohl bis zu einem gewissen Grade auch diese Gleichheit gerade die Bedingung für alle politische Betätigung in der Antike war, sofern diese ja an den Besitz von Sklaven und Eigentum geknüpft war –, sondern die Gleichheit der Ebenbürtigen. Die Isonomie garantierte ἰσότης, Gleichheit, aber nicht weil alle Menschen als Gleiche geboren oder von Gott geschaffen sind, sondern im Gegenteil, weil die Menschen von Natur her (φύσει) nicht gleich sind und daher einer von Menschen errichteten Einrichtung bedürfen, nämlich der Polis, um kraft des Gesetzes (νόμῳ) einander ebenbürtig zu werden. Gleichheit existierte nur in diesem spezifisch politischen Bereich, wo die Einwohner der Polis als Bürger und nicht als Privatpersonen zusammenkamen. Auf die Kluft zwischen diesem antiken Gleichheitsbegriff und den modernen Vorstellungen, denen zufolge die Menschen gleich geboren oder als Gleiche erschaffen sind und erst durch gesellschaftliche oder politische, also jedenfalls »künstliche« Einrichtungen ungleich werden, kann gar nicht nachdrücklich genug hingewiesen werden. Die Gleichheit in dem griechischen Stadtstaat war eine Eigentümlichkeit der Polis und nicht der Menschen, die ihre Gleichheit, nämlich das Vorrecht, sich unter ihresgleichen zu bewegen, ausschließlich dem Politischen und seiner Verfassung verdankten. Von Natur waren Menschen weder frei noch gleich; sie wurden es erst durch das Gesetz, also gemäß dem Denken des achtzehnten Jahrhunderts durch künstliche Konventionen. Freiheit und Gleichheit waren keine Attribute einer wie immer gearteten menschlichen Natur, sondern Qualitäten einer von Menschen errichteten Welt.
Den Griechen war selbstverständlich, daß man nur unter seinesgleichen frei sein kann; daher konnte weder der Tyrann, der doch tun und lassen konnte, was er wollte, noch der Despot, der über Menschenmassen herrschte, die noch nicht einmal wußten, was Freiheit ist, noch schließlich der Haushaltsvorstand, den doch seine Sklaven von allen Lebensnotwendigkeiten befreiten und der keinem Herrn unterstand, frei genannt werden. Nur wer sich unter Freien bewegte, war frei. Und entscheidend für Herodots Gleichsetzung von Freiheit mit Herrschaftslosigkeit war die Erfahrung, daß der Herrscher selbst gerade nicht frei ist; indem er die Herrschaft über andere ausübt, beraubt er sich der Gesellschaft von seinesgleichen, in der er hätte frei sein können. Herrschaft zerstört mit anderen Worten den politischen Raum, und das Resultat dieser Zerstörung ist die Vernichtung der Freiheit für Herrscher wie Beherrschte. Entscheidend für dieses Zusammensehen von Freiheit und Gleichheit ist, daß Freiheit sich griechischer Auffassung zufolge nur in gewissen, keineswegs allen menschlichen Betätigungen manifestiert, und zwar solchen, die überhaupt nur möglich und realisierbar sind, wenn andere zugegen sind, um sie zu sehen, zu beurteilen und sich ihrer schließlich zu erinnern. Daher bedurfte die Freiheit immer eines eigens für sie erstellten Raumes, in dem Menschen zusammenkommen konnten, des Versammlungsplatzes, der Agora, um den die Polis politisch zentriert war.