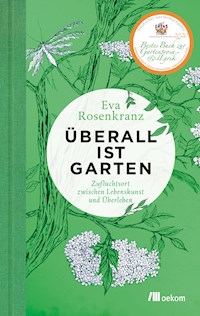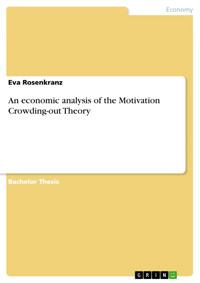EINLEITUNG
Der Weg führt ins Offene
»Wenn ich mit intellektuellen Freunden spreche,festigt sich in mir die Überzeugung,vollkommenes Glück sei ein unerreichbarer Wunschtraum.Spreche ich dagegen mit meinem Gärtner,bin ich vom Gegenteil überzeugt.«
Bertrand Russel
Gärtnern ist der neue Sex.« Nun ja, wird angesichts dieses Slogans so mancher Gärtner mit einem angelegentlichen Blick auf Gummistiefel und Dreckränder unter den Fingernägeln gedacht haben. Und doch hat die Behauptung etwas für sich. Der Garten hat Konjunktur: vom Balkonkasten über landesweite Tage der offenen Gartentür, Reiki für Rosen, Bibel-, Duft-, Klostergärten, Gartenpiraten, Gartenkunst bis zu Urban Gardening, Schrebergärten und – immer wichtiger in den bedrohlich ausgeräumten Landschaften – als Refugium für bedrohte Pflanzen- und Tierarten. Allenthalben ist Gartenlust spürbar.
Eigentlich ist die Lust am Gärtnern alt. Man hat andere Worte dafür verwendet. Sex gehörte sicher nicht dazu. Und wenn diese Verbindung denn heute schon sein muss, so kommen mir eher jene Gartencenter mit ihrer schnell vergänglichen Ware in den Sinn. Sucht man nach Erklärungen für die Gartenträume auch junger Leute, böten sich wohl eher Sinnlichkeit, Glück oder Selbstbestimmung als Synonyme für gärtnerische Sehnsucht an.
Aber Vorsicht! Hier lauern Sentimentalität, Überhöhung und Romantik. Gärtnern ist zuerst handfest, ist Arbeit – und auch Geschäft. In Deutschland gibt es etwa 20 Millionen Gärten (Balkongärten inklusive); Ausgaben von 10 Milliarden Euro signalisieren einen riesigen Markt mit ungebrochenem Wachstumspotenzial. (Auch Gartenbücher gehören nicht gerade zu den bedrohten Spezies.)
Der Garten meiner Kindheit war ein alter, etwas vernachlässigter Großstadtgarten hinter einem Mehrfamilienhaus mit alten Obstbäumen, die wir nur allzu gern gegen alle Verbote zum Klettern benutzten, mit schwer durchdringlichem Gebüsch, das uns vor den Blicken der Mütter schützte. Gleich angrenzend (lange Zeit ohne Zaun) lag ein verwahrlostes Grundstück (die Erwachsenen nannten es »Trümmergrundstück«), wo wir, sobald wir uns unbeobachtet fühlten, spielten – und dort die eine oder andere Blessur davontrugen. Doch auch der eigentliche Garten beflügelte unsere Phantasie. Bis heute sehe ich uns in einem winzigen Sandkasten nach Grundwasser graben – leider vergeblich. Mit lustvollem Gruseln identifizierten wir Beetumrandungen als Grabsteine; auf der Rückseite, die wir in tagelanger Arbeit freilegten, standen tatsächlich Namen. Wie lange habe ich geglaubt, dass ein Toter in unserem Garten liegt!
Als ich zwölf wurde, zogen wir in ein anderes Haus mit Hof, ohne Garten. Das Trümmergrundstück wurde zur ordentlichen Grünfläche mit Bänken, auf die sich nie jemand setzte. Viele Jahre hatte ich keinen Garten. Später nacheinander einen pflegeleichten Übernahmegarten und einen badetuchgroßen Reihenhausgarten. Heute einen ländlichen Garten im Alpenvorland. Gärtnerisch bin ich Dilettantin geblieben. Die Faszination, die Gärten auf mich ausüben, fußt in jenem unspektakulären, kein bisschen gestylten Garten meiner Kinderzeit. Sein Zauber ist in heutigem Empfinden verbunden mit Begriffen wie Selbstbestimmtheit, Neugier, Sich-ins-Offene-Wagen. Angst erinnere ich kaum.
Die Avantgarde sitzt im Schrebergarten
»Ich bin dann mal im Garten« – könnte man heute, in Anlehnung an ein erfolgreiches Buch über Selbstfindung und Innehalten, als Motto ausgeben. Unverkennbar hat sich an der Hinwendung zum Garten etwas verändert, und sei es nur in der Bewertung des Gartens als besonderem Ort und des Gärtnerns nicht nur als Tätigkeit, sondern auch als Haltung. Solange es Gärten gibt, spiegeln sich in ihnen Befindlichkeit und Weltsicht jener, die sie anlegen und hegen. In der Wertschätzung des Gärtnerns finden sich Spuren von Ersehntem, Erlittenem, für möglich Gehaltenem. In diesem Sinne kann der »Garten als Zauberschlüssel« (wie der in Gärtnerkreisen berühmte Staudenzüchter Karl Foerster schrieb) funktionieren oder, profaner gesagt, als Indikator für Verluste ebenso wie als eine Art Experimentierfeld des Möglichen. Gärtnern als Ideenreservoir und Arche für die Welt von morgen – mit Glücksvorrat?
Was dem einen seine Pilgerreise, dem anderen sein Klosteraufenthalt oder sein Himalaja-Trip, ist anderen der Garten. In einer Gesellschaft mit Nomaden, virtuellen Zeitreisenden und Globalisten entwickelt das Gärtnern im Empfinden vieler Menschen eine neue (weil eigentlich alte) Dimension. Es changiert zwischen kleinen Fluchten und Freiheitssehnsucht, zwischen Müßiggang und Eigensinn. Man könnte es als eine Art Bremse bei an Beliebigkeit grenzender Flexibilität begreifen, Widersetzlichkeit gegen allgegenwärtige Gängelei und Funktionalisierung. Schaut man genau hin, erwachsen dem Gärtner allenthalben Brüder und Schwestern. Sei es die Renaissance der Kleingartenanlagen bei den 25- bis 40-Jährigen, die Trendforscher zu der These verleiten, »die Avantgarde sitze im Schrebergarten«. Das Glück um die Ecke hat durch sich verändernde Wertvorstellungen Konjunktur.
Hierzu passen Bewegungen des Selbermachens, der Trend zu Nachhaltigkeit und Wiederverwertung. »Globalisierungs- und Kapitalismuskritik, Boykott von Großkonzernen, Fair-Trade-Ideen und ein neuer Feminismus vermischen sich hier auf wundersame Weise zu einem Modell der Gegenökonomie« (Thomas Kniebe). Auch in Theorie und Praxis einer anderen Stadtkultur spielen das Nachhaltige und das Sich-handelnd-Einmischen eine wesentliche Rolle.
Natur ist in. Natur ist brisant. Natur ist hochpolitisch. Natur ist in die Philosophie, in die Gesellschaftstheorie und in die Schlagzeilen zurückgekehrt. Das hat viel mehr mit Realismus als mit Romantik zu tun. Denn viele haben begriffen, dass es um alles geht. Dieses Buch heißt deshalb: »Überall ist Garten«.
Es wäre zu einfach, solche Phänomene allein mit rückwärtsgewandter Nostalgie abzutun. Beobachter sozialer und individueller Befindlichkeiten entdecken Zeichen eines starken Bedürfnisses nach Materialität in einer Epoche radikaler Verflüchtigung. Die innere Abhängigkeit von undurchsichtigen Sachzwängen oder kafkaesk anmutenden Institutionen ist auf Dauer persönlich zerstörerisch und gefährlich für ein lebendiges Gemeinwesen. Welche Dimensionen diese Gefährdung durch eine Ökonomie des Irrealen hat, zeigten die internationalen Bankenkrisen. Eine Welt, in der mit nicht vorhandenem Geld und Gut gehandelt wird, überfordert auf Dauer Menschen und Gesellschaft. Gärtnern ist in einer solchen Welt mehr als Mode, mehr als Marktstrategie, mehr als How-to-do oder Step-by-step. Gärtnern ist Finden, nicht Suchen. Es ist Lebenshaltung, Rettungsanker und Modell einer Ökonomie des Materialen. Be the change you want to see. Diese Aufforderung setzt das Gärtnern beherzt und selbstbewusst in Tun um.
Gärtnern in diesem Sinne verstanden, könnte also konstruktiven Widerstand signalisieren gegen das Diktat von Timern und Handys in einer Welt voller Zumutungen und Überforderung. Gärtnern kann, wie die Philosophie, »die Welt geräumiger machen« (Rüdiger Safranski).
Refugium für müde Seelen
Doch bevor wir in allzu viel Emphase untertauchen, sei an die andere, die dunkle Seite des Gärtnerns erinnert: Der Garten ist, wenn überhaupt, nur in Teilen ein Paradies; er ist auch ein bisschen Hölle und ein Lehrmeister in Illusionslosigkeit. Hier haben uns ›die Alten‹ etwas zu sagen. Unsentimental bearbeiteten sie die urbar gemachte Natur. Manchmal erschien es mir unbegreiflich herzlos, wenn Großmutter dem Huhn nach einem, für heutige Maßstäbe, glücklichen Leben selbstverständlich und mit respektvoller Präzision den Kopf abschlug.
So wird im schönsten Garten gestorben, gemordet, findet unter Rosenduft härteste Auslese statt. Der Gärtner bemerkt es nur manchmal, will oft nicht hinschauen. Es schmerzt ihn, wenn an einem schönen Junimorgen die ständig nach Fressen rufenden Meisenkinder verstummt sind und nur noch Federn am Nistkasten von der nächtlichen Tragödie erzählen. Wenn die Elster unterm Kirschbaum mit weit ausholenden Schnabelhieben eine Ringelnatter für ihre Brut tötet, weiß ich, dass mein Garten, umgeben von einer weitgehend ausgeräumten Flur, Refugium dieser Schlangen ist. Ich bin nicht ermächtigt, in den Kreislauf von Fressen und Gefressenwerden einzugreifen. Unsere Gefühle, bei denen wir nur allzu gern das eigene Tun ausblenden, lassen die Natur kalt.
Und doch baut jeder Gärtner unermüdlich weiter an seinem Stück Schönheit und Schutzraum, an seinem Refugium für müde Seelen, übt sich in Respekt und Schweigen, im Ausharren, in Geduld und manchmal auch im Nichtstun. Gutes Gärtnern ist sperrig, folgt keinem Mainstream und bewährt sich als Widerlager der Gesellschaft. Im Garten lässt sich nichts erkaufen und nur scheinbar etwas beschleunigen. Je schneller wir etwas erzwingen wollen, desto eher welkt es dahin – und umso langsamer nähern wir uns unserem Gartentraum.
Virtuelle Welten haben keine Erde zu bieten, in der sich lustvoll wühlen lässt. Was Highpotentials heute in teuren Workshops mühsam lernen wollen, ist dem Gärtner selbstverständlich. Ohne groß darüber zu reden, entschleunigt er, ist kühn in seinen Entscheidungen, setzt Struktur gegen Kontrolle, ist eigensinnig, teamfähig und – in aller Illusionslosigkeit – immer wieder glücklich.
So verbindet sich in der Realität des Gärtnerns Leidenschaft mit Demut, Stärke mit Schwäche und mit der ständigen Möglichkeit des Scheiterns. Hier kommt der Gärtner jenem Wesentlichen nahe, das seinem Tun zugrunde liegt: Gärtnern ist Widerspruch, Gegensatz und der permanente Versuch, Balance zu halten. Gärtnern changiert zwischen Nüchternheit, jenseits allen Wehklagens, und Vision, zwischen Vergänglichkeit und Hoffnung auf Wiederkehr, zwischen Unbezähmbarkeit und Glück. Diese Gegensätzlichkeit auszuhalten, muss ein Gärtner immer wieder lernen – und dass der Kampf um Vorherrschaft nicht endgültig zu gewinnen ist. In der Schlacht gegen die Schnecken wird auch der Gärtner zum Opfer. Dies zu sehen, bietet die Chance, gegen Absolutheitsansprüche immun zu werden, gegen jedwede Behauptung vom einzig Richtigen und Machbaren.
Beim Gärtnern geht es um Verstehen, Staunen, Annehmen und Immer-wieder-neu-Beginnen. Ein guter Garten ist wie ein spannungsreicher Dialog. Reden wir also angesichts aller Garten-Hypes nicht von der Rückkehr zur Natur; die Blaue Blume der Romantik kann schon morgen Schneckenfraß sein. Der Stachel der Vergänglichkeit ist allen Hochglanzversprechen zum Trotz nicht auszureißen. »Natur! Wir sind von ihr umgeben und umschlungen – unvermögend, aus ihr herauszutreten, und unvermögend, tiefer in sie hineinzukommen. Ungebeten und ungewarnt nimmt sie uns in den Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet sind und ihren Armen entfallen.« Diesem Wissen Goethes ist auch heute wenig hinzuzufügen.
Eigensinn in Gummistiefeln
Bei aller illusionslosen Nüchternheit, die das Gärtnern lehrt, lebt jeder Gärtner auch im Bann des Versprechens von Zauber, Geheimnis und Schönheit, das in jedem Garten aufgehoben ist. Das Glück beginnt mit winterlichen Eisblumen-Träumen und endet noch lange nicht mit dem frechen Gruß des ersten Laubfroschs. Angesichts von Katastrophenszenarien, die den Mehltau an der spröden Constance Spry nur scheinbar nebensächlich erscheinen lassen, bleibt der Gärtner nüchtern-visionär: Er findet, umgeben von gesellschaftlicher Rat- und Trostlosigkeit, immer wieder Wege zwischen Rose und Klimawandel, zwischen Arnika und Feuerbrand. Beharrlich bildet er sich ein, aus dem Erkennen der Zaunkönigstimme erwachse mehr als persönliches Glück.
Garten – »das sind Bilder des Paradiesgartens in dieser Welt, physische Formen, die uns helfen, uns eine Vorstellung vom wahren Paradies zu machen. Gärten ermöglichen dieses Dasein, weil sie nützlich und fruchtbar, wirklich und nüchtern sind, sie sind Nahrung und Ernährer, aber gleichzeitig Überfluss und Luxus, Schönheit und Schmuck, Entzücken und Rausch; Brot und Spiel, Mühe und Erholung, Existenz und Freiheit in einem« (Dževad Karahasan).
Zwischen solchem Wissen bewegt sich dieses Buch als Melange aus Lebenskunst und grünem Daumen. Es wandert umher zwischen Sinnlichkeit und Mehltau, Sehnsucht und Hexenschuss. Es erzählt Geschichten vom Dachs im Sandkasten und von einer Königin aus dem Nichts, vom geheimnisvollen Minikolibri und von der Holundersuppe im Winter. Es lädt ein zum Flanieren in kleinen und großen Gärten, in Phantasiegärten, in Wunderwerken genialer Gärtner quer durch die Kulturgeschichte. Es präsentiert Geschichten über Eroberer und Besiegte, unglückliche Gartenlieben, den Frauendreißiger im August, waghalsige Pflanzenjäger und eigensinnige Zuversicht in Gummistiefeln.
Der Garten soll sichtbar werden als kulturgeschichtliches Phänomen und als Sehnsuchtsort in einer Welt voller Zeitnot, Lärm und Fremdbestimmung. Der Garten als Ort der Kommunikation, der Begegnung mit sich und mit der Natur. Der Garten als Hort der Selbstbestimmung, Phantasie und schöpferischen Energie, der Lebensrettung (manchmal), Muße und Visionen. Der Garten als Lehrmeister und Freund, als Therapeut und Wegweiser, als Spiegel und Versprechen. Und der Garten als Refugium von Langsamkeit, Geduld, Zuhören, Sinnlichkeit und Mut, als eine Schatzkammer voller Geschichten, Abenteuer, Poesie und Kultur. Es geht um Sichtbares, Riechbares, Fühlbares, Hörbares, um vergessene Pflanzenschätze, um Lebensqualität und Gartenzauber. Eingeteilt in zwölf Kapitel – eines für jeden Monat des Jahres.
Jedes Kapitel bekommt eine Pflanze und ein Tier als Leitmedium im gärtnerischen wie im gesellschafts- und umweltpolitischen Sinn. In Charakter und Geschichte der Pflanze spiegeln sich gleichzeitig Jahreslauf, Botanik und Kulturgeschichte. Im Wechselspiel beider Lebewesen entpuppt sich Garten- und Lebensrealität. Jeder Monat steht damit auch für ein übergreifendes Phänomen, wie etwa den Verlust der Nacht, das Artensterben oder das Überlebensprinzip Vielfalt, und hat einen Paten aus Literatur oder Philosophie. Dabei beharre ich in Auswahl und Zuordnung auf meinem persönlichen Eigensinn, lasse manch gärtnerische Ordnung außer Acht und gebe Krisenzeichen Raum. Und ich gestatte mir das Vergnügen, hier und da querfeldein zu denken. Etwa wenn die Amsel nicht als Künderin des Frühlings erscheint, die sie in Zeiten des Klimawandels im Übrigen vielfach nicht mehr ist, sondern meinen Dezember begleitet und sich dort auf den zweiten Blick doch wieder als Botschafterin des Anfangs erweist.
Es gibt keinen Garten ohne Träume und ohne Dreck, ohne Sehnsucht und ohne Sterben – auch in Zeiten von Instant Gardening und Fast-Food-Pflanzen, in denen sich unsere innere Überdüngung spiegelt.
Ein duftendes Trotzdem
Dieses Buch will Augen öffnen. Es erzählt von Gefahr und Glücksfähigkeit. Es will verzaubern, mit Sprache, mit Bildern, mit Geschichten. Es ist ein gärtnerischer Mutmacher voll nüchterner Zuversicht und ungebremster Lust an der Erkenntnis. Es ruft dazu auf, der Sehnsucht zu folgen und der Realität ins Auge zu sehen, im Sinne gelassener Risikobereitschaft. Es ist überzeugt, dass Schönheit heilt und Denken hilft – und dass immer alles möglich ist. Es ist begeistert subversiv, spielt auf unbespielbaren Klavieren und träumt von Sommerwind an nackten Beinen.
Dieses Buch sammelt magische Momente und furchterregende Zerstörung. Es ist eine kühle Analyse und eine emotional journey. Es legt Zeugnis ab von jenem unbesiegbaren Sommer in jedem von uns.
Es speist sich aus der Überzeugung, dass überall Garten ist. Es erzählt auf der Ebene der Gartenerfahrung vom Charme der kalten Sophie, von Hungerkünstlern und Mimosen, vom frechen Ruf des Laubfrosches oder von verlorener Dunkelheit, von Sehnsucht nach Stille und Muße. Es birgt Zauber und berichtet doch aus der Gefahrenzone.
Doch in aller Illusionslosigkeit möchte ich mich zu einer Prise Empathie bekennen: »ein Mensch, der seine Empathie bewahrt und versucht, sich nicht blenden zu lassen. Von gar nichts« (Henning Ahrens).
Gedacht ist an ein Buch für Gärtner, die schon alle Gartenbücher haben, für Nichtgärtner, die von Gärten träumen – und für all jene, die hin und wieder den Zumutungen unserer Gegenwart die Zunge herausstrecken.
Nicht zuletzt will dieses Buch einen kleinen Beitrag zur ›Bezauberung‹ unserer Welt leisten. Denn die Gewissheiten sind dahin. Der Weg führt ins Offene, und von den Rändern unserer Gärten öffnet sich der Blick.
JANUAR
Torwächter schützt Unbekümmerte
Buchsbaum und Spatz
»Ein einziger Vogel genügt,damit der Himmel nicht stürzt.«
Faraj Bayrakdar
Der Januar ist eine Enttäuschung. Fraglos ist das ein gewagter Einstieg in ein Buch zum Garten. Aber bleiben Sie bei mir! Enttäuschung wird Erstaunliches zum Vorschein bringen.
Enttäuschung schafft Klarheit, auch Enttäuschungen haben ihren Reiz. Denn der Januar lehrt, sich künftig kein X mehr für ein U vormachen zu lassen. Er verspricht Durchblick. Lassen Sie sich also nicht abschrecken.
Bleiben wir zunächst bei meiner Enttäuschung.
Ja, ich kann den Januar nicht leiden – eigentlich. Er fühlt sich jedes Jahr länger an als 31 Tage, viel länger. Warum?
Nichts los nach all der Dezember-Aufregung, dunkel, alles offen, kein Aufbruch, zu viel wegräumen, Kerzen abgebrannt, Weihnachtsbaum wird grau und lässt Zweige hängen; melancholisch, weil Weihnachten so schön, so gemeinschaftlich, so still war; unwirsch, weil das Getriebe wieder anläuft; Sehnsucht, dass die sanfte Zeit von Weihnachten bis zum Jahreswechsel, hier in Bayern bis Dreikönig, noch ein wenig bleiben möge …
Das Gegenteil ist der Fall. Sobald der erste Tag nach Ferienende heraufzieht, bricht hektische Betriebsamkeit aus. Als müsse sofort alles nachgeholt, nachgelebt werden. Nur ja nicht den Eindruck erwecken, es sei gut gewesen in der Ruhe und Stille (die ungeduldigen Weihnachtsurlauber haben sowieso nur die eine Hektik mit der anderen vertauscht). Den Müßiggang und die lange Weile, in Bayern gibt es hierfür das wunderbare Wort Zeitlang, gilt es vergessen zu machen. Nur nicht zeigen, dass ein anderes Leben denkbar, sogar schön wäre, dass wir gern ein wenig vom Nachsinnen, Langsamsein, heute sagt man Entschleunigung, bewahren würden. Es könnte anders sein, ist eine so verlockende wie beklemmende Botschaft.
Enttäuschung setzt Erwartungen voraus. Der Kalender verspricht Neues, zwölf Monate liegen vor uns, Vorsätze haben Konjunktur. Doch der Blick in den Garten ist ernüchternd. Von wegen »allem Anfang wohnt ein Zauber inne«. So predigen denn die meisten Gartenbücher zum Jahresbeginn, wenn der Winter gerade ein wenig ernst macht, Pseudoaktivitäten. Schnell wieder in den Arbeitsmodus schalten.
Im Garten passiert – nichts. Und deshalb versuchen viele Gartenbücher, die dem Monatsrhythmus folgen, die Januar-Langeweile heftig zu übermalen. Mit dem Hinweis auf neue Kataloge und neue Züchtungen, mit Traumbildern von Frühlings- und Sommergärten. Oder wenigstens mit schön ausgeleuchteten Winterbildern. Die Botschaft heißt: Einkaufslisten machen. Enttäuschung in Käuflichkeit umdeuten.
Das ist verständlich. Aber der Blick aus dem Fenster zeigt in meinem Garten Graubraun als Trendfarbe. Melancholischer geht es kaum. Der Garten widersetzt sich, wie die gesamte Natur draußen, jedem Anflug von Beschaulichkeit, ist beharrlich still, spröde, abweisend. Als sei alle Kraft nach innen gerichtet, aufs Überleben konzentriert.
Der Januar-Garten mutet ungastlich, unversöhnlich, kompromisslos an. Keine Beschönigung. Kein Trost.
Gemeinsam sind wir stark
Da wird gefiederter Widerspruch laut. Spatzen – erst einer, dann zwei, dann … 17, 18, 19. Mag sein, dass ich mich hier schon verzählt habe. Sie können einfach nicht still sitzen. Schon gar nicht, wenn es um Futter geht. Und das übrigens nicht nur im Winter. Aber jetzt lassen sie sich an den Futterstellen auf der Terrasse aus relativer Nähe beobachten. Und ich kann sie im Vergleich mit anderen hungrigen Gästen studieren. Nein, Wintervogel ist nicht gleich Wintervogel. Natürlich wollen sie alle nur eines: fressen. Damit haben sich die Gemeinsamkeiten auch schon. Die Hochlagen des Futters sind Lieblingsplätze der Meisen, der etwas behäbig wirkenden Kohlmeisen wie der feingliedrigen Blaumeisen. Wenn es nicht anders geht, klemmen sich auch Spatzen auf den Rand des mit Glas überdachten Futterrondells. Und wie üblich, nicht nur einer, sondern möglichst alle – was notgedrungen zu Abstürzen führt. Was soll’s, scheint der eine oder andere zu signalisieren. Schauen wir mal, was auf dem Holzdeck so rumliegt. Die Meisen haben etwas indigniert (das ist natürlich eine Vermutung, die ich mit großem Vergnügen nicht nur im Januar anstelle) im angrenzenden Winterschneeball Platz genommen und beobachten das Gedränge. Während die meisten Spatzen also am Boden picken – für die oben verbliebenen ist es auch bald langweilig, und sie schauen mal bei denen unten vorbei –, kommen einige Meisen zurück.
Was nun folgt, ist mir bis heute unklar. Die Meisen kehren das Futter von unterst zu oberst, werfen so einiges runter zu den Spatzen. Die nehmen den Futterregen fressend zur Kenntnis, ohne jedoch alle Brosamen zu akzeptieren. Vor allem sind ihnen Sonnenblumenkerne augenscheinlich zu mühsam. Die bleiben oft wochenlang liegen, bis ich sie durch Ritzen und über die Ränder der Terrasse fege. Im Frühjahr sprießen dann aus Zwischenräumen, in Blumenkästen, an Holzkanten Sonnenblumen. So fällt für die menschlichen Mitbewohner etwas ab.
Die Hilfe aus den oberen Etagen nehmen auch Rotkehlchen, Erlenzeisig, Zaunkönig oder Amsel gerne in Anspruch. Letztere versuchen erst gar nicht, sich in die aufragende Futterstelle zu klemmen. Eine Amsel hat es mal versucht, mit vorhersehbarem Ausgang. Rotkehlchen und Zaunkönig sind ausschließlich hüpfende Bodenfresser. Eine Strategie, die sicher einen guten Grund hat – strenge Zuordnung der Gartenetagen vielleicht –, aber in jedem Fall riskant erscheint. Nachbars Kater ist nie weit.
Highlights bei der Wintergesellschaft sind die Fettbälle, die ich in Metallkörbchen an langen Stielen unterbringe, dort, wo einst Kerzen vorgesehen waren. Auf der überschaubaren Oberfläche dieser Kugeln finden bis zu drei Spatzen Platz, wobei Tumulte, Geflatter und paarweises Auffliegen mit kurzem Lufttänzchen unvermeidlich zu sein scheinen. Um die Futterbälle herum wird jeder halbwegs taugliche Zweig, trockene Stängel oder vergessene Stützstab als Sitz genutzt, um den Abflug der zuerst Fressenden ja nicht zu verpassen. Wildes Geschaukel inklusive. Ich habe den Eindruck, dass Geduld nicht die stärkste Qualität von Spatzenpersönlichkeiten ist.
Wenn ich die Spatzenschar auf der Terrasse einfallen sehe, erinnere ich mich an ein Frühsommerbild: das Spatzenbad. Einer vorne weg in die Matschpfütze mit ausreichendem Wasserstand, bestimmt der Kundschafter; dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 hinterher. Ein spritziges Geplansche, halbe Tauchversuche. Ein wenig wie im Nichtschwimmerbecken für die Kleinsten. Schließlich fliegen alle auf, bis auf den Ersten. Seine Begeisterung scheint grenzenlos. Immer wieder streckt er den Kopf vor ins Wasser und lässt es in einer schnellen wellenartigen Bewegung über den Körper laufen. Erst als er komplett nass wirkt, fliegt er tropfend und zerzaust in die nahe Weide, wo die anderen bereits ihr Gefieder sortieren.
Ich bin verliebt in die Unbekümmertheit der Spatzengesellschaft und könnte ihnen ewig zuschauen. Sie setzen unverbrüchlich auf Gemeinschaft. Wie stark ihr Zusammenhalt und wie gefährdet dieser ehemalige Allerweltsvogel heute ist, lässt sich überall auf dem ›Planet der Spatzen‹ studieren.
Übrigens ist Spatz ein Kosename für die Sperlinge (Feld- und Haussperling), von denen etwa 500 Millionen weltweit leben; beide Namen werden auf sprachliche Bedeutungen von ›zappeln‹ zurückgeführt. Was meinem Eindruck von den unentwegt hüpfenden, auffliegenden, drängelnden Lebenskünstlern entspricht. Lebenskünstler? Welch großes Wort für diese kleinen Vögel, die es nicht einmal zu einem auffälligen Gewand gebracht haben. In Tausenden von Jahren haben sie sich in Braungrau den Menschen und ihren Behausungen angepasst, suchen ihre Nähe, bleiben aber wachsam. Nimmt man eine Notiz von Alfred Brehm ernst, so scheint eine gewisse Vorsicht der Spatzen gegenüber Menschen durchaus ratsam: »Er ist ein schrecklicher Schwätzer und ein erbärmlicher Sänger. Trotzdem schreit, lärmt und singt er, als ob er mit der Stimme einer Nachtigall begabt wäre.« Auch die Beschreibung ›Dreckspatz‹ ist wohl nur mit Wohlwollen als zärtlich einzustufen, verweist aber auf ihre Vorliebe für Staubbäder, um die Federn von Parasiten frei zu halten. Kaum jemand weiß, dass China unter Mao Krieg gegen die Spatzen führte. Man wollte ihnen die Schuld an den Hungersnöten unter die Federn schieben. Landesweit wurden die Spatzen durch Lärm und Verjagen für drei Tage in der Luft gehalten. Zwei Milliarden Vögel starben. Die Folge: Die Schädlinge nahmen überhand, und Feldsperlinge wurden wieder importiert. Menschliche Dummheit vom Schlimmsten.
Aus Zuneigung zu der graubraunen Gesellschaft in meinem Garten, deren Gepflogenheiten mir so wenig vertraut waren wie ihre Allgegenwart selbstverständlich, habe ich einige Informationen eingeholt. Sie leben, wenn es gut geht, etwa vier Jahre, führen eine Dauerehe mit Seitensprüngen, in der das Weibchen entscheidet, wessen Nestangebot ihren hohen Ansprüchen genügt. Sie brüten bis zu viermal pro Jahr, versorgen auch Küken, die verwaist sind, und haben den höchsten Anteil an Verkehrstoten. In allen Großstädten sind sie zu Hause. Die weltweit größte Spatzenkolonie lebt in Paris an der Kirche Notre-Dame; ihr Flugballett gehört dort zu den Attraktionen. Gehörte muss man nach dem Brand der berühmten Kathedrale wohl sagen. Über die Verluste der Spatzen ist bisher nichts bekannt. Doch die Verluste dort fallen angesichts der gesamten Notlage wohl kaum ins Gewicht. Und dabei ist der Spatz uns Menschen so selbstverständlich, dass wir fast übersehen hätten, wie stark die Bestände zurückgehen (in Europa fast halbiert). Ursachen sind industrialisierte Landwirtschaft mit hohem Gifteinsatz und weitreichender Verödung der Landschaften sowie Futtermangel insbesondere durch das Insektensterben, außerdem die Vernichtung von Hecken als Schutzgehölze sowie gedämmte Häuser und fugenfreie Dächer. Daraus resultiert massive Wohnungsnot. Aus einigen Städten sind die Spatzen verschwunden.
Geheimniskrämer und Freigeist
Von Gefährdungen und Verlusten wird übers Jahr immer wieder zu berichten sein, denn sie lauern auch um mich herum an jeder Ecke.
Hier ist es an der Zeit, meinen Garten, der mich zu diesem Buch bewogen hat, ein wenig vorzustellen. Er liegt in der oberbayerischen Moränenlandschaft, einem ›gletschergeborenen Land‹, am Rand eines Dorfes mit 1500 Einwohnern. Bis vor 25 Jahren war er eine fette Wiese; bis heute grenzt er an landwirtschaftlich genutzte Flächen. Er misst etwa 900 Quadratmeter und hat eine überwiegende Südausrichtung. Das Haus bildet einen lang gestreckten Schutzwall gegen Norden. Für mich strahlte er von Beginn an Gleichmäßigkeit aus, die ich heute Gleichmut zu nennen wage. Auf mich wirkt er unaufgeregt und schön.
Er ist kein Paradiesgarten, kein ›Mein schöner Garten‹, keine Wildnis. Im Laufe der Geschichten um ihn herum wird er Kontur gewinnen. Mit seinen wunderbaren Plätzen und schwierigen Ecken, die aber andere Gartenbewohner für ein gelungenes Leben schätzen. Mit seinen Zuwanderern und Geflüchteten, den Widerborstigen und Anhänglichen. Er hält Überraschendes, Wildwuchs, Geplantes und Ungeplantes bereit – mein Sinn und des Gartens Eigensinn kollidieren hin und wieder.
Schaue ich in beliebte landlustige oder in eher streng kultivierte Zeitschriften zum Garten, beschleichen mich Zweifel, ob jemand außer mir die innere Struktur meines Gartens erkennt. Werde ich den Ansprüchen an einen ›guten‹ Garten gerecht? Sogleich beginne ich im Kopf zu planen, wegzunehmen, neu zu pflanzen. Manches setze ich in die Tat um, vieles nicht, noch nicht, möchte ich hinzusetzen, um die Hoffnung nicht aufzugeben, es doch noch zu realisieren – irgendwann.
Heute prägen ihn einige große Bäume; darunter meine Lebenstrostbuche, deren Vollendung ich trotz ihres beachtlichen Alters von 50 Jahren nicht erleben werde, außerdem der Hüter meines Apfelbaumbüros, zwei Süßkirschen und eine Ulme ganz am Rand (zu dicht an der Ackergrenze …), die dem Ulmensterben trotzt – noch. Anderes kommt hinzu, das im Laufe des Gartenjahres hier und da eine Rolle spielen wird. Die Baum-Mitbewohner mögen den Eindruck erwecken, es müsse schattig sein in diesem (für bayerische Landverhältnisse) mittelgroßen Garten. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt eine angenehme Verteilung von Licht und Schatten, die im Tageslauf durch den Garten wandern und einladen, immer neue Plätze zu erkunden. Nach ernüchternden Versuchen gibt es keinen Gemüsegarten, dafür mehr und mehr wilde Wiese für die Insekten (unsere gemeinsame Geschichte werde ich im Juni erzählen), eine Vielzahl von Stauden und noch mehr Rosen (eine kleine Bestandsaufnahme verspricht ebenfalls der Rosenmonat). Klingt unspektakulär und ist es wohl auch. Manchmal erscheint mir der Garten riesig mit seinen sichtbaren und unsichtbaren Bewohnern, mit all dem, was sich beobachten lässt. Er ist ein Geheimniskrämer (ein Wort, das meine Großmutter gern benutzte), der mir lächelnd die kühle Schulter zeigt, gleichwohl voller Angebote steckt, zu sehen, zu riechen, zu staunen. Unerwartet berührt er – und sei es nur mit einer Brennnessel, die ich, unbedarft umhergehend, übersah.
Er ist offen, aber wir würden uns nie an Vorzeige-Aktionen beteiligen. Manche werden ihn als wild empfinden (der Freund meiner Tochter fragte augenzwinkernd, ob die Bienen nicht eine Machete benötigen). Obgleich ich erst in den Weiten Kanadas gelernt habe, was wild bedeutet. Nein, wild ist er wohl nicht. Wäre er ein Mensch, würde ich ihn als Freigeist bezeichnen, der mich jeden Tag etwas lehrt. Vielleicht könnte ich ihn auch einen Lehrer im Querfeldein-Denken nennen. Er zieht stets eine andere Möglichkeit in Betracht, denn die oft vorgegaukelte eine Antwort gibt es nicht.
Natur eben. »Sie ist klug, sensibel, erfinderisch und genügt sich selbst« (David Boyd). Damit ist Wesentliches über meinen Garten gesagt.
Der Janusköpfige und die Magie
Aber jetzt ist Januar, und der Garten lehrt mich nichts – jedenfalls auf den ersten, zweiten und dritten Blick.
Für die alten Gartenbeobachter war er der härteste Monat des Jahres. Die Energie der Natur ist dick zugedeckt, tief versteckt, geschützt. Das Samenkorn liegt unsichtbar in der Erde, Eier und Puppen warten in Altholz oder welken Pflanzenresten, Bäume und Sträucher wirken wie tot. Ernüchternd jeder Blick nach draußen. Der kälteste, dunkelste, abweisendste Monat und Höhepunkt des Wenig im Jahreslauf. Fast alles draußen ist nun ungeschmückt, pur und nackt. Die Bäume stehen entkleidet da. Ein wenig erstaunt und verschämt muten sie an. Nackte Schönheit? Nur meine Buche trägt weiter ihr noch an die rotgoldene Herbstfärbung erinnerndes Gewand, wie die kleinen Hainbuchen (botanisch übrigens nicht ihre Schwestern) in der Südhecke, die nach dem großen Kahlschlag, von dem noch zu erzählen sein wird, gepflanzt wurde. Erst die Frühjahrsstürme werden die alten Blätter hinwegfegen.
Die längste Nacht der Wintersonnenwende ist kalendarisch im späten Dezember; doch wird sie erhellt vom Lichterfest Weihnachten. Erst der Januar lässt uns den Mangel an natürlichem Licht spüren. Er liegt zwischen dem Einstieg ins Dunkel und dem Ausstieg zu Lichtmess Anfang Februar. Januar und Februar empfinde ich daher als Winterzwillinge mit voneinander abgewandten Gesichtern: Der eine schaut ins Dunkel, der andere ins Licht.
Und in der Tat verdankt dieser Monat seinen Namen dem antiken Gott Janus; der mit den zwei Gesichtern. Eines blickte in die Vergangenheit, eines in die Zukunft. Er war der Hüter des Tores, des Ein- und Ausgangs. Der 1. Januar war ihm geweiht. Den kalendarischen Jahresbeginn markiert der Januar aber erst seit dem 2. Jahrhundert vor Christus.
Als Hüter der Schwelle stehen an der Nordseite zu unserer kleinen Straßen zwei Buchsbäume. Übermannshoch weisen sie den Weg zum Haus und entlassen mich in die Welt. Als Schutzbaum, dessen magische Kraft bis in antike Kulturen zurückreicht, begleitet er die Menschen, galt als Sinnbild des Lebenszyklus, der Liebe und der Unsterblichkeit. Später spielte er als gärtnerisches Gestaltungselement zum Beispiel in den Gärten der französischen Könige eine wesentliche Rolle. Bis heute wird der Buchs in rituellen Gebräuchen eingesetzt, etwa für die vorösterlichen Palmbuschen. Im Garten wird er vielfach als pflegeleichte Einfassung verwendet, wobei ihm seit einiger Zeit der Buchsbaumzünsler an die immergrünen Blätter rückt. Ein zartweißer Schmetterling, der aus Ostasien eingeschleppt, in Wahrheit für den hiesigen Buchsbaum-Hunger als ungebetener Gast mitimportiert wurde.
Mir gefällt die Idee des Schutzbaums, auch wenn ich erst lange nach dem Pflanzen davon erfahren habe. Dass die Magie von Pflanzen mir im Januar in den Sinn kommt, ist auch Teil seiner Janusköpfigkeit. Über Jahrtausende haben Dunkelheit und Kälte die Menschen geängstigt; ihre Tage waren kurz und die langen Nächte bedrohlich mit Traumgestalten und Geistern bevölkert. Die im Alpenraum verbreiteten Raunächte zeugen von dem Bedürfnis, sich für die härtesten Zeiten im Jahr Schutzgeister zu wünschen.
Die Magie von Pflanzen ist aber keineswegs auf winterliche Ängste beschränkt. Der Seidelbast, den ich in diesem Winter geschenkt bekam und der nicht weit von den Buchsbäumen einen Platz gefunden hat, strahlt mit seinen oft schon im Januar erscheinenden lilafarbenen Blüten etwas Magisches aus. Vielfach geht solche Anmutung mit stark giftiger Wirkung einher und mit dem Einsatz in der Heilkunde. Der Buchsbaum enthält 70 bekannte Giftsubstanzen, die übrigens die Raupen des Buchsbaumzünslers speichern und damit selbst für mögliche Fressfeinde ziemlich schwere Kost werden. Allerdings wurde hin und wieder beobachtet, dass Meisen die Raupen an ihre Brut verfüttern. Vielleicht bahnt sich ein Anpassungsprozess bei hiesigen Vögeln an, um diese üppige Nahrungsquelle ausschöpfen zu können.
Im vielfältigen Potpourri der Zauberpflanzen ragt die Alraune (wohlklingend auch Mandragora) heraus; sie beschäftigt die Phantasie bis heute. In meiner Diele hängt die Zeichnung eines Freundes – eine Alraunenwurzel, die sich bei konzentriertem Schauen in ein Liebespaar verwandelt. Um diese heiligste Pflanze, deren Wurzel alte Zeichnungen oft in Menschengestalt zeigen, ranken sich eine Vielzahl von Mythen, und damit hat sie es sogar in die Harry-Potter-Filme geschafft. Dort wird die Legende aufgegriffen, dass die Alraune beim Ausgraben zu schreien beginnt und Menschen um den Verstand bringt. Ich selbst habe vor einigen Jahren eine Alraunenpflanze erworben, sie vorsichtig, ohne ihre Wurzel freizulegen, in einen Topf gepflanzt. Dort machte sie nichts. Regungslos war sie weder bereit zu wachsen noch zu blühen. Eines Nachts verschwanden alle Blätter. Nach langem Zögern – eigentlich glaube ich nicht an Zauber – habe ich die Wurzel ausgegraben. Geschrien hat sie nicht.
Anmut des Winters
Trotz Spatzenglück und Pflanzenmagie holt mich der Januar-Blues wieder ein. Der Garten im Monat eins des Jahres ist eine Kampfansage an unser Schönheitsempfinden. Erst recht an jenes laute Blühdiktat, das Gartencenter und Baumärkte propagieren. Doch ich widersetze mich dieser Versuchung, den kleinen Fluchten in schnelles Ersatzglück – und schaue hin.
Besser wird mein Eindruck allerdings nicht. Es sei denn, man möchte die Erfindungsgabe der Farbe Braun besingen. Denn der Garten ergeht sich in immer neuen Variationen dazu. Dunkelbraun Faulendes, aschbrauner Matsch, beigebraun Absterbendes, tückisch schwarzbraun schillerndes Totes. Klingt ein wenig nach botanischer Leichenfledderei. Man könnte hier ein Loblied der Vergänglichkeit auf die Geheimnisse von Verwelken, pflanzlichem Recycling und natürlicher Müllvermeidung anstimmen, was ich aber zunächst auf den November verschiebe. Immerhin halten manche Storchschnäbel mit fein rötlichem Schimmer dagegen, ebenso wie eine einsame weiße Rosenblüte. Der Gesamteindruck ist jedoch – braun.
Doch wie immer im Garten ist die Vorherrschaft des Augenfälligen, hier des wenig Zauberhaften, nur ein Teil der Wahrheit. Denn da ist auch dieser betörend schöne Wintermorgen. Schnee, Kälte. Schimmernder Nebel liegt wie feine Spitze auf der Landschaft, darüber spannt sich ein intensiv blauer Himmel. Die noch tief stehende Sonne verwandelt den Schnee auf Bäumen und Büschen in diamantene Schnüre.
Oder: die Traumtage im Januar. Durchscheinend; manchmal schieben sich Schneewolken langsam ins Blau, silberkristallglitzernde Schneeplättchen sinken vom Himmel und werden im Schwebflug von schräg einfallenden Sonnenstrahlen zu Lichtflocken veredelt. Als fiele reines Licht zur Erde.
Oder: Froststarre Schönheit im frühen Sonnenschein verführt mich, mit nackten Füßen langsam die glitzernde Oberfläche des Schnees zu erkunden. Wie lange halte ich die Kälte aus?
Oder: geliebte Eiszapfen – altmodische Überbleibsel einer anderen Welt. Es muss etwas tropfen, die Dachrinne zum Beispiel. Aber welcher Hausbesitzer lässt schon seine Dachrinne tropfen? Ich. Über dem alten Rosenstock an der Nordseite, wo sich ein bizarres Eiskunstwerk bildet. Je nach Tropfendauer immer anders. Und ich höre schon die Warnungen. Eiszapfen sind wie Dachlawinen gefährlich – schön.
Und: als wir mit den Kindern ausgelassen Schneemann und Schneefrau bauen, selbst im Alpenvorland eine Rarität in Zeiten des Klimawandels.
Der Januar kann eben auch das: Winter vom Feinsten.
Der Morgen etwa, als alles in Glas gegossen scheint. Büsche bis in die feinsten Verästelungen mit glitzernder Eisschicht umhüllt, die Buche mit ihren trockenen Blättern, die nun mit feinen Eisrändern verziert sind, der große Apfelbaum mit seiner Schirmkrone, der still verharrt, als könne nichts ihn aus der Winterruhe holen. Welche Grazie.
Der kleine Apfelbaum wirkt dagegen etwas zauselig; ich habe im Laufe der Jahre wohl zu unentschlossen geschnitten. So mutet sein Astwerk an wie eine wilde Mähne, die jetzt fast weiß wirkt. Gleichwohl ist er der Empfindsamere; denn die Sorte Cox Orange zeichnet sich durch ein fein zwischen Süße und Säuerlichkeit abgestimmtes Aroma aus, ist dabei frostempfindlich und auch sonst für allerlei Unbill empfänglich. Das wissend, habe ich mich für diesen Apfel entschieden, weil er als guter Befruchter für die große Renette gilt und weil ich mich von all den wohlmeinenden Ratschlägen, die mir als Gartendilettantin auch nach Jahren noch begegnen, eher herausfordern lasse. Auf 650 Höhenmetern ein Cox? Ja, klar. Einen Versuch ist es wert. Heute belohnt er mich – manchmal – mit kleinen Kostbarkeiten. Und was mindestens genauso zählt, unter seiner Krone herrscht noch an heißesten Sommertagen frische Kühle. An diesem Januartag ist allerdings nur Kälte geboten.
Überhaupt, die reine Architektur von Bäumen und Büschen, die sich unverdeckt zeigt. Der sparrige Holunder, die phantasievoll gemusterte Rinde der Walnuss, die streng aufragende Ulme mit der klaren Linienführung, der knorrige alte Weinstock, die wie eine Wabe gebauten Samenstände des Brandkrauts. Die Phantasie von Samen oder Knospen wird mich in den kommenden Monaten immer wieder überraschen.
Verzweifelt mutig überleben
Der große Schnee-Einbruch mit Sturm. Ein Rotkehlchen sitzt wie ratlos im tief verschneiten Busch. In solchen Augenblicken bewundere ich die evolutionäre Klugheit und den Mut, solch winzige Geschöpfe in diesen Winter zu schicken. Welch Vertrauen in die (Über-)Lebenskräfte. Mit seiner leuchtend orangeroten Brust erinnert mich das winzige Rotkehlchen mit der Farbe des Sommers auch daran, dass leichtere Zeiten kommen werden. Später beobachte ich den bunten Gesellen, wie er eine neue Futterstelle unter dem Tisch, etwas vor dem Schnee geschützt, erkundet. Mut, dem die Spatzenschar im nahen Busch zunächst abwartend zuschaut.
Täglich werden die hungrigen Gäste zahlreicher. Bergfinken tauchen auf, der winzige Zaunkönig sucht Genießbares im Eck hinter einem leeren Blumentopf, ein Eichelhäher und eine Elster wagen sich in ungewohnte Hausnähe, erstmals in über 20 Jahren finden sich Stieglitze ein, die akrobatisch an den Nachtkerzen turnen und sich die feinen schwarzen Samen aus den Samenkapseln klauben. Bei ihnen beobachte ich eine klare Absage an Fast Food, sprich Fettbälle. Es wäre um ein Vielfaches leichter, diese Nahrungsquelle zu nutzen. Doch sie verschmähen das menschengemachte Futter meist zugunsten jener Pflanzen, an die sie angepasst sind. Dazu gehören Nacht- und Königskerzen sowie Disteln. Mit ihrem Fressverhalten erinnern sie mich nachdrücklich daran, dass es in der Debatte um Artenschutz, die ich im Juni führen werde, vor allem um die Erhaltung von Lebensräumen geht. Der Stieglitz überlebt vielleicht auch ohne Disteln und Nachtkerzen, weil Menschen ihn zufüttern. Doch den verpuppten Wildbienen zum Beispiel, die vielleicht im verholzten Stängel der Königskerze auf den Sommer warten, können wir kein Surrogat anbieten. Sie gehen mit ihrem Lebensraum verloren.
Die überwinternden Vögel trotzen mit verblüffender Kraft und genialem Körperbau widrigen Umständen. Und befinden sich damit in bester Gesellschaft. Phantasie und Mut sind bei den Überlebensstrategien im Garten angesagt. Und sie verdeutlichen einmal mehr, wie das hochkomplexe System funktioniert, das wir Natur nennen und aus dem wir uns selbstgefällig gern heraushalten wollen, ohne zu begreifen, dass wir uns nur um den Preis des Nichtüberlebens endgültig herauskatapultieren können. Von ein paar wenigen Strategien aus meinem Garten sei hier die Rede.
Oft habe ich mich gefragt, woher bereits im Februar Zitronenfalter oder Tagpfauenaugen kommen. Der Prozess vom Ei zum Falter konnte sich doch nicht über den Winter vollziehen. Die Strategie heißt ›natürliches Frostschutzmittel‹, das die Falter im Körper haben. Sie lassen sich an geschützten Plätzen, gut getarnt, einfrieren und tauen in wärmenden Sonnenstrahlen auf.
Marienkäfer kuscheln sich über- und untereinander zusammen und fallen in eine Art Winterschlaf. Ein solches Häufchen der Punktekäfer entdeckte ich zufällig unter einer Moosdecke am Schuppen; leise habe ich den Schlafplatz wieder verlassen. Der sommerliche Appetit der kleinen Schläfer auf Blattläuse leistet einen wichtigen Beitrag zur Balance in meinem Garten. Denn trotz vieler Rosen werden die Läuse nie zum Ärgernis. Der Winterschlaf wird uns übrigens im November zusammen mit dem Siebenschläfer noch einmal begegnen.
Hummeln gehören zu den Frühaufstehern im noch winterlichen Garten. Bei mildem Wetter brummt es unvermittelt, wenn ich an der Weide oder der Kornelkirsche vorbeigehe. Ein Ton, der in der Stille des Januar besonders laut wirkt. Hummelköniginnen überwintern in lockerem Boden, in einem Schlafzimmer möglichst im Halbschatten. Ihr Pelz erlaubt es ihnen, bereits bei niedrigen Plusgraden zu fliegen. Und so geht ihr Lebenszyklus mit dem der besonderen Spezies Winterblüher Hand in Hand, wie noch zu sehen sein wird.
Auch die nachtaktiven Ohrwürmer suchen ein behagliches Winterquartier in Ritzen von altem Holz etwa. Wenn ich ihnen im Sommer, versteckt in Rosenblüten, zufällig begegne, denke ich an unsere Furcht in Kinderjahren. Bei uns hießen sie Ohrkneifer, und ihre zangenartige Ausformung am Hinterleib flößte uns Respekt ein. Bis heute, trotz besseren Wissens, berühre ich sie vorsichtig. Erst kürzlich las ich, dass sie ihren Namen einem heilkundlichen Irrtum verdanken: Man trocknete sie und verabreichte sie Schwerhörigen – ich vermute, mit mäßigem Erfolg.
Von den Überlebenskünsten im Reich der Insekten gewinne ich in meinem Garten lediglich eine Ahnung. Lese ich etwa in der Wildbienen-Bibel von Paul Westrich, scheint mir der Einfallsreichtum der Evolution wie eine geheimnisvolle Welt, in die ich trotz langer Beobachtung erst einen Wimpernschlag kurz geblickt habe. Und dann sind da ja auch noch die Spinnen, die Amphibien und nicht zu vergessen die Mäuse mit ihrer winterlichen Sehnsucht nach meiner Küchenschublade.
Viele überleben nicht. Meist sterben sie einen leisen Tod, und ich habe keine Vorstellung, wie viele Opfer der Winter gleich nebenan fordert. Auch hier bewahrt der Garten seine Geheimnisse. Nur Einzelne bekommen ein Gesicht. Den Erlenzeisig fand ich tot im verwaisten Blumenkasten, die Haut des Igels und den Amselflügel später im Jahr.
Nach einer eisigen Nacht liegen Hinterläufe eines Hasen oder Kaninchens auf der Straße vor dem Haus, die wohl als Reste nächtlicher, für mich unsichtbarer Kämpfe um Leben und Tod ins Helle hinübergeraten sind. Und die Bäuerin berichtet, dass der Fuchs sich nicht scheut, im Tageslicht nach den Hühnern zu suchen. Winterhunger macht verzweifelt mutig.
Immer mehr Schnee. Bäume und Büsche tragen schwer, manche brechen. Wachsende Not. Wo ist ›mein‹ Turmfalke? Gehört er zu jenen, die schon verloren haben? Schließlich erkenne ich ihn suchend im Schneesturm trudeln. Ein Rütteln lässt der Wind wohl nicht zu. Wie froh bin ich, ihn zu sehen. Doch wird er überleben? Mich beschäftigen die Greifvögel im Januar, weil ich die hier überwinternden bei Schnee auf erhöhten Ansitzen oder auch am Boden sehe – unter erschwerten Bedingungen nach Beute Ausschau haltend. Oft schon habe ich darüber nachgedacht, dass ich die kalten sonnigen Tage mit hohem Schnee so sehr herbeisehne und genieße, diese Vögel aber bedroht sind, wenn Mäuse und Co. durch den Schnee gut geschützt bleiben und die Greife in der Regel nicht in den Genuss menschlicher Fütterung kommen wie Amseln, Meisen oder Spatzen. Ich erinnere mich, dass Falken und Bussarde selbst unter Schnee Urinspuren von Mäusen orten können. Hilft ihnen das? Ich spüre Unbehagen. Einerseits ist es berauschend, durch die Winterlandschaft zu laufen. Gleichwohl fürchte ich all die Tragödien, die sich unsichtbar um mich herum vollziehen. Oder ist Tragödie nur ein Menschenwort und ein Menschengefühl? Ist auch das Sterben in der zärtlichen Gleichgültigkeit der Natur aufgehoben – über die ich im März, dem Monat des Versprechens, nachdenken werde? Und ist Natur in all ihrer Vielfalt dabei nicht eigentlich ›humaner‹ als wir Menschen?
Am selben Tag folge ich einer kaum erträglichen Todesspur von Greifvögeln auf der Autobahn. Immer wieder zerrissene Tiere zwischen Leitplanken oder auf dem Seitenstreifen. Hier hat der Hunger verzweifelt leichtsinnig gemacht.
Hunger nach Schönheit: die frühen Mahner
›Mein‹ Falke löst Erinnerungen aus, denen ich ein wenig folgen will, weil sie meine Enttäuschung im Januar aus anderer Warte beleuchten. Natürlich ist es nicht ›mein‹ Falke; er gehört nur sich selbst. Aber ich begegne ihm so oft an einem seiner Sitzplätze, einem großen Verkehrsschild an der Landstraße. Im Rücken ein Wäldchen, im Vordergrund Wiesen. Im Sonnenlicht schimmert er rosa. Da ich ihn immer wieder rüttelnd über den Wiesen stehen sehe, konnte ich ihn leicht identifizieren: ein Turmfalke, der eben nicht nur auf Türmen wohnt. Er gehört durch seinen Rüttelflug zu den auffälligen Greifvögeln unserer Landschaft. Dass ich ihn besonders im Winter auf seinem Lieblingsstraßenschild verharren sehe, hat einen einleuchtenden Grund: Energie sparen. Das Ansitzen ist bei Nahrungs-, sprich Mäusemangel Überlebenshilfe. Vom Wanderfalken unterscheidet ihn vor allem dessen spektakulärer Flug, der ihn zum schnellsten Tier der Erde macht. Seit Jahrtausenden wird er zur Beizjagd eingesetzt und stand bei Herrschern in höchstem Ansehen. Erwähnen will ich nur einbalsamierte Falken in ägyptischen Königsgräbern und die enge Beziehung des Stauferkaisers Friedrich II. zu diesen besonderen Vögeln, denen er im 13. Jahrhundert sein bis heute herausragendes Falkenbuch widmete, einen »Urknall ornithologischen Wissens« (Michael Menzel). Darin verglich Friedrich einen idealen Falkner mit einem idealen Herrscher.
Mich verbindet mit ›meinem‹ Falken, dessen Auftauchen mich in diesen Schneetagen so sehr freut, eine bedeutsame Erfahrung, meine Begegnung mit der Umweltschutzlegende Horst Stern. Am 17. Januar 2019 starb er. Fast vergessen wie viele der frühen Warner vor Naturzerstörung. Mit ihm will ich an einige der Rufer in einer vor einem halben Jahrhundert noch umweltpolitischen Wüste erinnern.
Horst Stern sah – wie viele von ihnen – im Rückblick desillusioniert sein Engagement von Jahrzehnten als folgenlos an. Liest man die aktuellen Aussagen des Weltdiversitätsrates, scheint auch heute kaum ein anderes Fazit möglich. Wenn wir so weitermachen, wird die Erde unbewohnbar für uns Menschen. Und doch rebelliert etwas in mir gegen den Stern’schen Pessimismus. Denn angesichts einer neuen gesellschaftlichen Bewegung für die Bewahrung unseres Planeten würde ich ihn als einen der entscheidenden Wegbereiter für Umwelt- und Naturschutz sehen, dessen kompromissloses Engagement gerade heute Früchte trägt – auch wenn sein Namen vielen nichts mehr sagt. »In einer Zeit, in der ökologische Fragen noch nicht salonfähig waren, hat er dem Naturschutz publizistische Aufmerksamkeit verschafft. Seine Intimgegner waren Jäger, Intensivlandwirte, Wirtschaftsfunktionäre und ignorante Politiker« (Hubert Weinzierl). »Ein Leben lang hat Horst Stern sich für einen besseren Umgang mit Tier und Natur eingesetzt«, hieß es in der Todesanzeige. »In Zeitschriften, Büchern und seiner legendären Fernsehreihe ›Sterns Stunde‹ las er Millionen Menschen klar und geschliffen die Leviten.« Bestattet wurde er im Nationalpark Bayerischer Wald, zu dessen Initiatoren er gehört hat.
Als junge Redakteurin habe ich mit ihm mein erstes großes Interview geführt. Nicht über seine Fernsehreihe ›Sterns Stunde‹, die lange zurücklag, sondern über seinen Roman Mann ausApulien, den er ebenjenem Stauferkaiser Friedrich II. gewidmet hatte. Mir ist ein warmherziger Mann in Erinnerung geblieben, der mit viel Entgegenkommen der aufgeregten Journalistin Rede und Antwort stand. Damals hatte er sich bereits aus der Öffentlichkeit nach Irland zurückgezogen.
Nie werde ich die Stelle zu Beginn des Romans vergessen, als der Lieblingsfalke des Stauferkaisers einen Jungadler schlägt. »Der König der Vögel in den Staub getreten von einem Geringeren. Und ich der Kaiser des Erdkreises, aufgerufen zu einem Urteil, das die verletzte Ordnung der Welt wiederherstellen soll.« Und Friedrich gibt den Befehl, dem Falken den Kopf abzuschneiden. Mit weitreichenden Folgen, die ihre Parallelen in der heutigen Naturschutzpolitik hat. »Wieder einmal hatte mein Amt mich genötigt, vor der Wahrheit der Natur die Fassade des Staates aufzurichten.« Welch eine schmerzliche Erkenntnis dieses Weltenherrschers – und des Kämpfers Horst Stern.
Er war der Erste, der sich Zutritt zu Ställen mit Massentierhaltung verschaffte und die unerträglichen Bedingungen schonungslos offenlegte, der falsch verstandene Tierliebe anprangerte und Jägern attestierte, dass ihnen das Jagen wichtiger sei als der Wald. Er gründete die erste Zeitschrift für Natur- und Umweltschutz (Natur) und den BUND sowie die Deutsche Umweltstiftung mit. Und doch war sein Fazit ernüchternd: »Ich habe eigentlich immer nur in den Köpfen und Herzen der Ohnmächtigen etwas bewirkt, in den Köpfen der Mächtigen so gut wie nichts.«
Natürlich gehört auch Rachel Carsons Der stumme Frühling zu den warnenden Stimmen, die unsere Umweltwahrnehmung entscheidend verändert haben und in Zeiten des großen Artensterbens geradezu prophetisch wirken. Meine Rückblicke auf die frühen Gewährsleute heutigen Widerstands gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen fielen in die Zeit des bayerischen Volksbegehrens zur Artenvielfalt. In meinem Dorf haben sich dazu viele Menschen engagiert, haben nachgedacht und debattiert. Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund haben begriffen, wie ernst die Lage in der scheinbaren bayerischen Idylle ist, und haben eine Welle der Veränderung ausgelöst.
Erwähnt sei hier eine Ikone des Biogartens, die Hunderttausenden von Gärtnern Mut gemacht hat, auf chemische Kampfmittel im Garten zu verzichten und den natürlichen Abfolgen zu vertrauen. Entgegen dem Mainstream ihrer Zeit machte Marie-Luise Kreuter darauf aufmerksam, dass Erde, Pflanzen und Tiere durch Kunstdünger und Pestizide Schaden nehmen und die Umwelt bereits gefährlich aus dem Gleichgewicht geraten sei. Fern jeglicher Romantisiererei beharrte sie auf dem Zusammenhang aller Lebewesen: »Ein biologischer Gärtner handelt nicht als Herrscher in seinem Garten. Alles Leben auf der Welt ist in komplizierten Kreisläufen miteinander verbunden. Das am höchsten entwickelte Wesen ist deshalb abhängig, dass die einfachsten Lebensformen funktionieren.«
Geradezu ungläubig habe ich nach vielen Jahren wieder den Vorsorglichen Nachruf auf die Natur von Barbara von Wulffen zur Hand genommen und dort eine Passage über die Sommerwiese entdeckt, die meiner Sommerbegegnung fast 50 Jahre später gleicht: »Autos waren stehen geblieben, Frauen und Kinder pflückten Mohn und Kornblumen, hingebungsvoll, hastig, mit einer Art Heißhunger – Hunger nach Schönheit: Blumenschönheit.« Nur mit dem Unterschied, dass wir uns heute noch nicht wieder trauen, Mohn und andere Wiesenblumen zu pflücken. In ausgeräumten Landschaften sind sie weiterhin Raritäten.
Auch Barbara von Wulffen legt den Finger in die Wunden, die ungebremster Fortschrittsglaube und Naturferne fortwährend schlagen. Erschöpfte Meere, schmutzige Luft, der man zu ihrer Zeit noch mit höheren Schornsteinen zu entkommen glaubte, oder siechende Wälder und verlorene Sommerwiesen – alles bedrückend gegenwärtig. Und die Ursachen? »Dieser Leichtsinn, mit dem wir in einer ausdrücklich für endlich erklärten Welt ständig an die Unendlichkeit der Umwelt glaubten, fordert nun unerbittlich seinen Preis.« Dies lesend, sehe ich die dreieinhalb Planeten vor mir, die wir in Deutschland (theoretisch hochgerechnet) jedes Jahr verbrauchen – im 21. Jahrhundert und in einer »für endlich erklärten Welt«. Abhilfe schaffen, und auch das ist ein so alter wie aktueller Gedanke, kann nur die Wiederkehr des Staunens über das, was ist. Erkennen also und damit die Chance zu lieben ergreifen – wie die alte Bedeutung von »erkennen« besagt.
Heute sprechen wir in diesem Zusammenhang von Shifting Baselines, was vor einem halben Jahrhundert so klang: »Um in der Welt daheim sein zu können, muss man sie kennen, lieben, beweinen lernen. Später wird ein in diesem Sinne erzogenes Kind auch fähig, für diese Welt Verantwortung zu übernehmen, sie zu verteidigen, um sie zu leiden, für sie Opfer zu bringen.« Denn »wenn der Sonnentau aus unserer Welt verschwände, brauchten wir wenig Aufhebens zu machen. Festzustellen, er habe bezaubernd ausgesehen und absonderlich gelebt, kommt seiner Besonderheit weitaus am nächsten. Er ist in seiner Art einmalig und unwiederbringlich. Er enthüllt das Wesen der Schöpfung als Vielfalt.« Und ich füge meine Überzeugung hinzu, dass es mehr als persönliches Glück bedeutet, die Stimme des Zaunkönigs zu erkennen.
Und damit bin ich bei meinem wichtigsten gärtnerischen Begleiter und Lehrer Jürgen Dahl, dem ich im Mai mit dem Federgeistchen eine persönliche Hommage widme. Seine Glossen und Bücher haben mich Ökologie anders denken, haben mich Garten anders sehen gelehrt. Jenseits betulicher Beetkultur und steriler Rosenrabatten, nicht zu reden von den heutigen Herrschaftsgebieten von Rasenrobotern oder Steinen. Wie kein anderer Autor seiner Zeit nahm er Gärtnern ernst und konnte ebenso begeistert über das sanfte Wesen von Malven schreiben wie unwirsch über den allgegenwärtigen Verfügbarkeitswahn. Gleichzeitig sezierte er unnachgiebig das Missverhältnis von Verschwendung und individuellem Widerstand: »In einer Welt, in der zur Herstellung eines Autos nicht weniger als 400 000 Liter Wasser gebraucht werden, ist es lächerlich, die Leute zu ermahnen, sie sollten das Eierwasser zum Blumengießen verwenden, um Wasser zu sparen.« Er hat über seinen Garten geschrieben und dabei in die Welt geschaut. Das eine hat ihm geholfen, das andere klar zu sehen und Widerlager zu bauen gegen die persönliche Verzweiflung. Am schönsten aber hat er über die Unbegreiflichkeit des Gartens nachgedacht: »Der Garten ist verwüstet, die Wege sind zertrampelt, die Reste des Inventars werden gerade verheizt – aber das Rätsel des Gartens bleibt ein Rätsel. Ob noch einmal ein Garten daraus wird oder ob sein Ende schon begonnen hat, hängt von nichts anderem ab als davon: dass wieder Gärtner kommen, die den Garten unbegreiflich finden.«
In Zeiten von Wohlstandsbesoffenheit und Herrschaftsgebaren haben diese Männer und Frauen »der Empörung Worte gegeben. Prophetische, skeptische, ironische. Trauernde und aggressive. Laut oder leise haben sie gekämpft gegen die Verwüstung der Welt und der Seelen. Pioniere einer anderen Zukunft, hatten sie die Gabe, Gedanken und Leiber in Bewegung zu bringen, Horizonte zu öffnen, Lebensläufe zu verändern« (Mathias Greffrath).
Wenn ich an diese Frauen und Männer erinnere, sehe ich das Fundament, auf dem meine Gedanken fußen. Ich sehe allerdings auch, wie unübersehbar seit mehr als einem halben Jahrhundert die Verluste im Garten und darüber hinaus sind. Und ich begreife einmal mehr, wie schmal der Grat der Zuversicht geworden ist.
Schwanzmeisen oder: danke für nichts
Am Tag nachdem ich über die frühen Mahner nachgedacht habe, begegnen sich Schwanzmeisen, Greta Thunberg und Brechts Nachgeborene. In meinem Kopf.
Es beginnt mit den Schwanzmeisen. Erstmals sind die hübschen Sperlingsvögel im Garten zu Besuch. Immer zu dritt turnen sie an den Fettkugeln herum. Wie schwarz-weiße Wattebausche mit langem Schwanz. Kein Wunder, dass man sie scherzhaft Pfannenstiel nennt. Ihre lustige Schönheit passt zu Zaunkönig und Rotkehlchen. Ein Blick zu den Vogelkundigen verrät mir, dass der lange Schwanz mehr als die Hälfte ihrer Körperlänge ausmacht. Diese Balancierstange ermöglicht ihnen bemerkenswerte Kunststücke. Sie sind fähig, kopfüber an feinsten Zweigen entlangzuhüpfen oder auf einem Bein zu stehen und mit dem anderen bereits nach einem weiteren Zweig zu hangeln. Das alles ist kein vergnüglicher Selbstzweck. Sie gelangen durch ihre Gleichgewichtstechnik bis zu den feinsten Ästchen, können dort nach Raupen und Knospen suchen und haben damit einen Lebensraum erschlossen, den andere Vögel nicht erreichen können.
Angesichts der ahnungslos turnenden Schwanzmeisen beschleichen mich Trauer, Verzweiflung und Zorn. Wir zerstören in jeder Minute Wunderwerke der Natur, oft bevor wir sie recht verstehen. Selbstgefällig, ignorant, uneinsichtig. Als seien wir die Herrscher der Welt. Welche Verrohung, die nur mühsam mit Zierrat und bunten Massenpflanzen übertüncht wird. Für Augenblicke gebe ich all jenen recht, die Bauern, Tierfabriken, Großschlachtereien, Saatgutkonzernen, gierigen Lobbyisten die Verfügung über unser aller Boden, Wasser, Lebensgrundlage entziehen wollen. Was erdreisten sich diese geldgierigen Zerstörer?! Und warum unterstützen wir sie mit unserer Geiz-ist-geil-Mentalität?
Es ist auch mein Verlust, wenn der Lebensraum der Schwanzmeise zerstört wird. Ich entwerfe damit kein pessimistisches Zukunftsszenarium, sondern beschreibe eine Realität, die sich immer weniger ausblenden lässt. In meiner Umgebung werden Schutzflächen zerstört, zugepflastert, was geht, und Engagement für Natur wird belächelt. Zorn und Resignation liegen manchmal nah beieinander.
Das Enttäuschungsmotiv des Januar ist also mehr als meine persönliche Missstimmung. Enttäuschung liegt über Lebensläufen, damals wie heute. In ihr spiegeln sich eine gefährdete Gemeinschaft und die Frage nach dem Fortbestand der Erde. Denn diese Enttäuschung macht den Schritt schwer. Und hier erinnern mich die fedrig-leichten Schwanzmeisen an die berühmten ›Nachgeborenen‹ von Bert Brecht, ein Gedicht, das er im Exil der 1930er-Jahre schrieb und das für mich eine neue Bedeutung gewinnt:
Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut
In der wir untergegangen sind
Gedenkt
Wenn ihr von unseren Schwächen sprecht
Auch der finsteren Zeit
Der ihr entronnen seid.
…
Ihr aber, wenn es so weit sein wird
Dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist
Gedenkt unsrer
Mit Nachsicht.
Ja, es waren finstere Zeiten, Kriege, Massenmord, unmenschliches Unrecht. Weit weg. Weit weg?
Inzwischen sind wir es, die Nachgeborenen, die um Nachsicht bitten müssen. Nur, werden die Jungen von Fridays for Future um Greta Thunberg sie uns gewähren? Haben wir Nachsicht verdient? Heute, wo ein Gespräch über Bienen ungemütlich werden kann, wie beim bayerischen Volksbegehren erlebt. Selbstgerechtigkeit darf nicht auf Nachsicht hoffen.
Einige Monate nach dem Besuch der Schwanzmeisen, als ich dieses Buch zu Ende schreibe, erinnert der zornige Beitrag eines von Brechts Nachgeborenen an ein Titelbild des britischen Observer