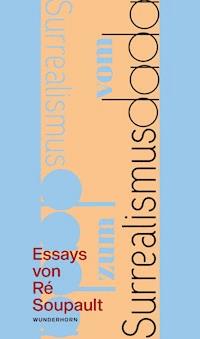Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Das Wunderhorn
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ré Soupault, geboren 1901 als Erna Niemeyer in Pommern, arbeitete bereits während ihres Studiums 1921-1925 am Bauhaus in Weimar. Über ihren Mann, dem Dadaisten und Filmkünstler Hans Richter lernte sie u.a. Man Ray und Sergeij Eisenstein kennen. 1931 gründete sie in Paris ihr erstes eigenes Modestudio »Ré Sport«. Im Kreis der Pariser künstlerischen Avantgarde traf sie ihren späteren Ehemann Phillipe Soupault. Mit ihm unternahm sie ab Mitte der dreißiger Jahre zahlreiche Reisen durch Europa und Amerika, wo sie seine Reportagen fotografisch begleitete. Seit 1948 wieder in Europa, arbeitete sie als Übersetzerin und Rundfunkautorin. Sie starb 1996 in Paris.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2022 Nachlass Ré Soupault/Manfred Metzner
© 2022 Verlag Das Wunderhorn GmbH
Rohrbacher Straße 18
D-69115 Heidelberg
www.wunderhorn.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Titelabbildung: © René Blättler
Gestaltung & Satz: philotypen, Dortmund
eISBN: 978-3-88423-665-9
Ré Soupault
Überall Verwüstung. Abends Kino.
Reisetagebuch8.9.1951–15.10.1951
Herausgegeben von Manfred Metzner
Vorwort
Mittellos kehrt Ré Soupault nach Ende des 2. Weltkriegs aus dem Exil in den USA nach Europa zurück, lebt und arbeitet von 1948 bis 1958 in Basel, danach wieder in Paris. Ihr Mann Philippe Soupault, mit dem sie Anfang der 1970er Jahre in Paris in der Résidence d’Auteuil wieder zusammenziehen wird, hatte sich 1945 von ihr getrennt und war vor ihr aus den USA nach Paris zurückgekehrt. Die Rückkehr nach Europa bedeutet für sie die Suche nach Arbeit. An ihre Vergangenheit als Experimentalfilmerin, Modemacherin und Fotografin (bis auf eine Foto reportage 1950) wird sie nicht mehr anknüpfen. Sie muß sich neu erfinden. Von der Büchergilde Gutenberg in Zürich bekommt sie 1948 ihren ersten Übersetzungsvertrag für die Memoiren von Romain Rolland (1866–1944), damit beginnt ihr Leben als Übersetzerin aus dem Französischen.
Am 30. April 1951 reist sie mit der Bahn nach Avignon, um ihre Freundin, die Schriftstellerin und Journalistin Ilse Langner (1899–1987) zu besuchen. Beide hatten in den 1920er Jahren in Berlin beim Scherl-Verlag gearbeitet und waren seither miteinander befreundet.
Am 6. Mai kauft sich Ré Soupault in Avignon das erste Modell eines Vélosolex, ein Fahrrad mit Hilfsmotor, das 0,4 PS leistete und ca. 1,2 Liter einer Zweitaktmischung auf 100 Km verbrauchte. Am 8. Mai – als sie nach Orange fuhr – notierte sie in ihr Reisetagebuch: Die heutige Spazierfahrt ist mir besser bekommen als die gestrige. Vielleicht Gewöhnung. Und dann war die gestrige vielleicht auch zu weit und zu anstrengend für die erste Ausfahrt. Sie erkundet die Côte d’Azur und deren Hinterland.
Am 3. Juni notierte sie: Zugleich sollte diese Reise eine Generalprobe der geplanten langen Reise nach Basel sein. Ich tat in die Netze nur das Allernotwendigste. … Bis jetzt kann ich feststellen, dass dieses geringe Gepäck völlig ausreichend ist. Zwar ist es immer noch zu schwer, aber es ist tatsächlich kein Gegenstand, den ich nicht brauche. (Außer Mantel, Rock und Pullover.) Notwendig wird aber wahrscheinlich der Ankauf von 2 Radfahrtaschen sein, denn die Netze sind mir doch nicht sicher genug. Sie können bei längerem Gebrauch zerreissen, ohne dass ichs bemerke …
Am 11. Juni – nach zwei heftigen Regentagen – kaufte sie sich in Grenoble zwei Radtaschen und einen Regenumhang. Sie traf nach 749 Km Reisestrecke am 15. Juni in Basel ein. Sie schrieb: Meine Reise ist also beendet. Phantastischste Reise meines Lebens, glaube ich. Nach innen, nicht nach aussen. … Dieses Fahrrad verändert mein Leben.
Am 8. September 1951, eineinhalb Monate vor ihrem 50. Geburtstag, bricht sie mit dem Vélosolex von Basel zu ihrer Reise durch das zerstörte Süddeutschland auf. Ihr wichtigstes Gepäckstück ist ihre Reiseschreibmaschine, eine Olivetti Lettera 22, die 1950 auf den Markt gekommen war.
Der Text des Tagebuchs dieser Reise wird originalgetreu wiedergegeben. Nur offensichtliche Tipp- und Zeichenfehler wurden stillschweigend korrigiert.
Manfred Metzner
Das Vélosolex auf dem Buchtitel ist dieses erste Modell, das 1946 auf den Markt kam. Es steht im Vélosolex-Museum in Waldenburg in der Schweiz: www.leuewaldenburg.ch
Herzlichen Dank an René Blättler für das Foto.
Samstag, 8. 9. 1951Abreise aus Basel gegen 10 Uhr 20.
Schlechtes Reisewetter. Bewölkt. Jedoch komme ich ohne Regen davon, obwohl es an mehreren Stellen zu heftigen Niederschlägen gekommen ist, wie die nassen Strassen bewiesen. Von Sélestat an ist die Luft so feucht, dass ich es bis auf die Haut spüre und zeitweise im linken Arm rheumatische Schmerzen hatte. Vor Colmar taucht die Vision einer Landschaft auf, die an die Wolkenkratzersilhouette von New York erinnert: riesige Pappelgruppen heben sich steil von wellenförmig niedrigen Baumkronen ab, das Ganze mit einem leichten Nebel überzogen. Colmar selbst ist eine alte, schöne Stadt, klein und heimelig … und geheimnisvoll. Ich sah nicht viel. Vor allem die Madonna im Rosenhag. Das Ganze hat mich enttäuscht. Herrlich schön ist der Ausdruck der Madonna, der ganz vergeistigt ist – sie hat das Leid ins vergeistigt Menschliche sublimiert. Auch das Kind hat schon diesen wunderbaren Ausdruck. Und die Hände. Sie sind ganz unirdisch. Der Rosenhag ist wahrscheinlich symbolisch – die Rose: das Symbol Christi. Alles, was nicht direkt wirkt in der Kunst, verfehlt seine Aufgabe, obwohl hier dieses Symbol als Hintergrund ganz richtig und schön ist. Über dem Haupt der Madonna schweben zwei Engel in blauen Gewändern, die die Krone tragen. Die Gewänder schmiegen sich in herrlichen Falten um die Gestalten. Der kostbare Rahmen und die mit vergoldeten Reliefs verzierten Flügeltüren lenken viel zu sehr von der Madonna selbst ab. Übrigens musste man in der Sakristei um die Erlaubnis bitten, das Kunstwerk besichtigen zu dürfen. Jemand öffnete die beiden schützenden Flügeltüren und zündete einen Scheinwerfer an, der aber doch nicht ausreicht, um das Bild genügend zu studieren, denn man steht nicht ganz nahe davor. Unangenehm ist auch das Warten der Führerin. Man hat den Eindruck, sie möchte so schnell wie möglich wieder schliessen. Danach verlangt sie 10 Franken – lässt aber durchblicken, dass der Wohltätigkeit keine Grenzen gesetzt sind. Immer wieder unerträglicher Trinkgeldgeist in Frankreich. Es ist furchtbar. Neulich, im Marigny, sagte die Garderobenfrau zu Jeanne B.: Ihren Schirm, Madame, 15 Franken, Trinkgeld nicht einbegriffen. Und der Kellner in einem Kaffee, wo wir einen Lindenblütentee tranken, bediente sich selbst mit 15 % Trinkgeld, nachdem ich ihm 10 % zugebilligt hatte. Man verzichtet, wegen der 5 Franken zu diskutieren und geht angeekelt fort. Und so ist es überall. Der Ausländer, der diese Art nicht gewöhnt ist, empfindet sie doppelt. So etwas schadet Frankreich mehr als es nützt.
Gegen 7 Uhr kam ich in Saverne an, wo gerade ein internationaler Studentenkongress stattfindet. Fast hätte ich kein Zimmer gefunden, aber der Hotelbesitzer nahm mich nach einigem Nachdenken auf und trieb seine Freundlichkeit so weit, dass er sich nach dem Abendessen zu mir an den Tisch setzte und sich lange mit mir unterhielt. Er hat vor einigen Wochen einen Autounfall gehabt und den Arm und das Bein verletzt. 1926 war er Soldat in Syrien. Das waren schlimme Zeiten, kein Wasser, kein Brot und Nahkampf gegen die Drusen, wobei er einen Messerstich ins Kinn und einen Schuss in die Brust bekommen hat. Basel mag er nicht, wie er mir sagte. Die Stadt sei ihm zu »deutsch«. Das erinnerte mich an einen Besuch im Elsass mit Philippe (1), als wir Europa mit dem alten Renault durchstreiften und bei einer Tankstelle von einem Elsässer, der mit einem furchtbar markierten deutschen Akzent sprach, zu hören bekamen: »Je préfère la France à l’Allemagne, car – qui voudrait être Boche.«1
Es scheint, dass die Saarlandgrenze gesperrt ist wegen der Kinderlähmung-Epidemie. Muss morgen genau die Karte studieren, damit ich keinen unnötigen Umweg mache. Von Ph. heute morgen einen Brief, zu dem ich aber vorläufig nicht Stellung nehmen werde. Je mehr ich darüber nachdenke, umso unmöglicher scheint mir die ganze Lage. Die Kirchenglocken in diesem Dorf sind noch viel schlimmer als die der Pauluskirche. In der Nachbarschaft der Kirche ist es einfach nicht auszuhalten. Selbst hier, etwa einen halben Kilometer entfernt, stören sie. Diese Priester sind wirklich zu lärmend.
1Ü. d. Hrsg.: »Ich ziehe Frankreich Deutschland vor, denn – wer will schon Boche sein.« Boche ist eine diffamierende Bezeichnung für Deutsche.
Sonntag, 9. September 1951
Von Saverne nach Trier. Das tausendfache Gesicht der Landstrasse: Nebel, Regen, Wind, Sonne, schlechte oder gute Strasse, holperiges Steinpflaster oder Asphalt, Scherben und manchmal sogar eine Schlange, die einem unter die Räder kommt, von den Autos und Radfahrern, die einen dauernd bedrohen, gar nicht zu sprechen. Aber dann gibt es Momente, um derentwillen sich alle Unannehmlichkeiten lohnen: blauer Himmel, grüne Wiesen, auf denen man schlafen kann. Herrliche Wälder, Gärten und überraschende Ausblicke, Begegnungen mit Menschen und Tieren … das Leben mit all seinen Schönheiten und unerwarteten Gesichtern.
Der dicke Wirt in Saverne gab mir zum ersten Frühstück zwei grosse Schnitten Kugelhopf. Gegen 10.30 brach ich auf, bei grauem, regenschwangerem Himmel. Ich legte meinen Regenmantel bereit, denn der Regen schien unausbleiblich. Umso grösser war die Freude, als der feuchte Nebel allmählich, ganz wunderbar allmählich, von der Sonne durchbrochen wurde, die schliesslich endgültig die Oberhand gewann, und der ganze Nachmittag war strahlend, warm und sommerlich. Eine halbe Stunde von Saverne entfernt, fast auf der Spitze der Passhöhe von Saverne, gibt es einen Botanischen Garten. Ein freundlicher Botaniker nahm sich meiner an und zeigte mir die seltensten Exemplare des Gartens: hauptsächlich indische und chinesische Bäume und Pflanzen. Wieder überraschte mich der Eindruck eines mir verschlossenen Geheimnisses, des Geheimnisses der Pflanzen. Was ist anders in dem Leben dieser Pflanzen, die aus einem so fernen Lande stammen als bei dieser oder jener der einheimischen Pflanzen. Es müssen gewaltige Unterschiede bestehen, denn das Äussere dieser Gewächse ist so verschieden von den europäischen Arten. Manch ein Zweig schien den Holzschnitten japanischer Meister entstiegen. Solch ein Garten ist eine mystische Welt. Ich dachte an den Garten in Brissago, den ich einmal im Frühling erlebte und dessen Leben mit einer solchen Heftigkeit auf mich eindrang, dass ich in eine Art von Traumzustand geriet. Später las ich das »Leben der Pflanzen« von Maeterlinck. Aber ich begreife noch gar nicht.
In Sarre-Union war das Benzin zuende, und ich musste wohl oder übel in einer Garage tanken, in der ich erbärmlich betrogen wurde. Auch habe ich den Mann im Verdacht, mir schlechtes – wenn überhaupt – Öl in die Mischung getan zu haben, denn ich sah ihn nur hineingehen und schnell wieder herauskommen. Für einen Liter nahm er mir 100 Franken ab, worauf ich protestierte. Der Mann war nicht nur von tierischer Dummheit, sondern auch von tierischer Schlechtigkeit. Da blieb mir nichts weiter übrig, als ihm 100 Franken zu zahlen, wenn ich mich nicht Gewalttätigkeiten aussetzen wollte, denn er stürzte sich auf das arme kleine Rad und wollte mir mit Gewalt das Benzin wieder fortnehmen. Ich darf nicht vergessen, die Sache dem Touring Club zu melden. Später, in Sarreguemines, wo ich zwei Liter kaufte, um nicht wieder in die gleiche Lage zu kommen, zahlte ich für 2 Liter 130 Franken.
An der Saarlandgrenze war nur Passkontrolle. Saarbrücken, das ich streifte, schien mir furchtbar traurig, wie überhaupt das ganze Saarland von unerträglicher Missstimmung scheint. Bestätigt wurde mir dieser Eindruck später, nach der Panne, die mich in Schmelz-Bettingen, etwa 55 Km von Trier, überraschte. Plötzlich hörte ich ein furchtbar klapperndes Geräusch und bemerkte, dass der Deckel der Zündung links sich loslöste. Ich schraubte ihn fest, und danach ging das Rad nicht mehr, d. h. wenn ich einschalte, höre ich nur ein furchtbar kreischendes Geräusch, das aus der Zündungstrommel kommt. Was tun. Ich fragte zunächst nach einem Automechaniker. Es gab auch einen im Dorf, aber da es Sonntag war, war der Vogel ausgeflogen, auch zweifle ich, nach dem Platz zu urteilen, dass der Mann grosse Fähigkeiten gehabt hätte. Ich überlegte, dass das vernünftigste sei, den Zug bis Trier zu nehmen, wo doch grössere Chancen sind, eine Reparaturwerkstatt zu finden. Also auf zum Bahnhof, wo ich erfuhr, dass es am günstigsten wäre, den direkten Zug von Dillingen aus zu erreichen, der in 2 Stunden, also um 8 Uhr von D. abfuhr. 18 km bis dorthin, aber flache Strasse. Ich erreichte das Ziel in etwa einer Stunde. Vielleicht hätte ich in Dillingen – einer ziemlich grossen Stadt – bleiben sollen, um die Reparatur machen zu lassen oder es wenigstens zu versuchen. Denn wie ich nachher erfuhr, gab es dort eine Garage, die Tag und Nacht geöffnet war. Aber ich hatte gleich mein Billet nach Trier gelöst, ass etwas zu Abend in einem Bahnhofsrestaurant und wurde von zwei freundlichen Beamten in den Zug gesetzt, die für mein Rad Sorge trugen. Ich konnte sogar im Gepäckwagen mitfahren. In etwa einer halben Stunde war französische Kontrolle. Ich wandte mich an einen der Beamten, um ihn nach einer Reparaturwerkstatt für Vélosolex zu fragen. Er warnte mich vor deutschen Reparaturwerkstätten. »Ils vont vous mettre votre moteur en pieces«, sagte er mir. »Pourquoi ça«, fragte ich. »Mais enfin, Mademoiselle«, erwiderte er, «venez vous de la lune?« »A peu près«, sagte ich, »ich bin soeben angekommen.«2 Kurz und gut, er gab mir zu verstehen, dass man die Franzosen hasst und ihnen alles gegen den Strich tut. Im Zug merkte ich dann die Bestätigung, die Art wie ich von den Beamten behandelt wurde. Erst als ich deutsch mit ihnen sprach – und vor allem, wie ich mit ihnen sprach, dass ich mich interessierte für ihr Leben und ihre Arbeit, liess sie zutraulicher werden. Der eine, noch ziemlich jung, 38 Jahre alt, hat 6 Jahre in Russland gekämpft und war einer, der Stalingrad überlebt hat. Er verdient 240 Mark und hat 4 Kinder und eine Frau. Kleider können sie sich nie kaufen. Ich hatte allerdings den Eindruck, dass er in einem Köfferchen ein wenig Schmuggel treibt, mit Kaffee aus dem Saargebiet hauptsächlich. Nun, es bleibt ja solchen Leuten gar nichts anderes übrig. Aber die Verbitterung ist ganz gewaltig. Gegen die Besatzungsmächte fast noch stärker als gegen die eigene Regierung. Der eine der Beamten, schon älter, war sehr pessimistisch, dass ich in Trier eine Unterkunft finden würde. Trier ist zu zwei Drittel zerstört, erklärte er mir. Die Hotels sind von den Franzosen requisitioniert. Es bleibt für Touristen nichts übrig. Womit er Unrecht hatte, denn ich habe hier im Viktoria Hotel ein sehr hübsches Zimmer mit allem Komfort. Es wird allerdings ein wenig teuer sein, 6,50 plus 15 % Bedienung, dazu obligatorisch das kleine Frühstück und erwünscht, eine Mahlzeit im Hotel zu nehmen. Ein freundlicher Beamter führte mein Rad bis hierher und zeigte mir den Weg. Er war glücklich über eine Mark Trinkgeld, die ich ihm dafür anbot. Gott, sind die Menschen hier arm. Besonders nach der Schweiz ist das erschreckend. Der Lebensstandard ist hier unheimlich niedrig. Noch eine Überraschung: an der deutschen Zollgrenze haben sie mir doch tatsächlich 4,25 Mark für ein halbes Pfund Kaffee Zoll abgenommen. Grausig. Worauf der Eisenbahnbeamte sagte, warum haben Sie mir nicht den Kaffee gegeben. Ich hätte ihn versteckt. Ja, schade. Warum hat er’s mir nicht gesagt. Die Schreibmaschine dagegen liess sie ganz kalt. Ich glaubte, nun hätte ich alle Tricks gelernt, seit man mir in St. Louis diese Misere gemacht hatte, aber dem ist nicht so, denn man muss täglich zulernen. Was nun morgen werden wird mit dem Motor, das wissen die Götter. Ich habe den Eindruck, es ist eine seriöse Sache. Jedenfalls – so oder so – werde ich morgen nach Wittlich fahren. Gleich morgen früh ein Telegramm senden, dass ich auf dem Wege bin. Es gibt allerdings einige Steigungen, die ich schlimmstenfalls zu Fuss machen muss.
Nachtrag zum 2. Tag. – Der Eisenbahnbeamte, der 6 Jahre den Krieg in Russland mitgemacht hat – und vor allem in Stalingrad – erzählte ganz interessant über Russland. Es fehle völlig ein Mittelstand. Die breite Masse des Volkes sei unvorstellbar arm, einige, ganz wenige aber, unermesslich reich. Er meinte, sie leben wie ganz Reiche und darauf kommt es ja in Wirklichkeit an, nicht, ob einer ein grosses Kapital hat, sondern ob er gut lebt. Eigentlich ist dieser sogenannte Kommunismus der bis auf die äusserste Spitze getriebene Kapitalismus, in dem Sinne, dass die Ausbeutung bis zum Höchstpunkt getrieben wird. Ich habe es immer schon gesagt: ein solches Regime kann nur zur Versklavung im Sinne der Antike führen, denn die Volksmassen haben nicht einmal die Möglichkeit zu protestieren. In ihrem eigenen Namen werden sie ausgebeutet. Der Mann sagte, dass die russische Jugend fanatisch sei und die Unkenntnis der Verhältnisse ausserhalb Russlands sei einfach kolossal. Der einzelne Mensch des russischen Volkes sei sehr gastfreundlich und hilfsbereit. Das habe ich schon des öfteren gehört. Dieser Beamte fügte sogar hinzu, dass das Volk, der Mensch in Russland, dem Amerikaner bei weitem überlegen sei, was Menschlichkeit und Gastfreundschaft anbetrifft. Dies erinnert mich an die Erzählungen des jungen Arztes bei Dr. Hess in Hannover.
Noch eins, was mich amüsiert hat. Da ich meine Landsleute kenne, spielte ich die Französin, die die Sprache nicht gut spricht. Ich imitierte Philippe. Dies brachte mir ein, dass man sich in der rührendsten Weise für mich einsetzte, mir das Fahrrad schob und hinauf- und hinunterhob usw. Hätte ich mich gewandt und mit fliessendem Deutsch an diese Leute gewandt, dann hätte ich sehen können, wie ich fertig wurde. Eigentlich fährt eine Frau immer besser, wenn sie dem Mann – ganz gleich welchem Mann – das Gefühl gibt, sehr hilfsbedürftig zu sein. Dies soll mir zur Lehre dienen. Ich habe mich wirklich ausgeruht bei diesem Spiel.
2Ü. d. Hrsg.: »Sie werden Ihren Motor zu Kleinholz machen.« »Warum das?« »Aber Fräulein, kommen Sie vom Mond?« »So ungefähr.«