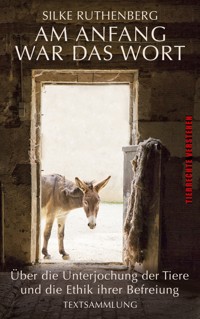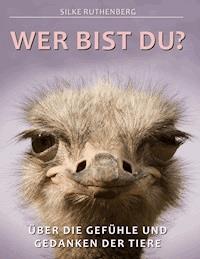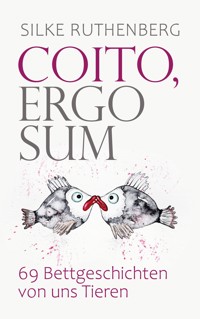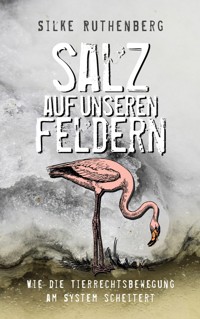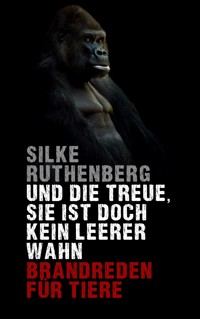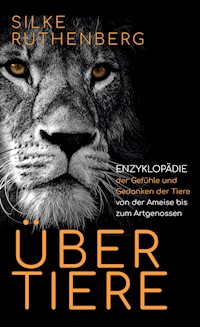
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Über ein Jahrhundert hinweg wurde uns von der Wissenschaft die Vorstellung von Tieren als Reiz-Reaktions-Automaten vermittelt, die unbewusst, instinktgesteuert und ihren Trieben unterworfen durchs Leben laufen, fliegen, schwimmen. Nur ist dies alles einfach nicht wahr. Die moderne Verhaltensforschung hat in wenigen Jahren mit einer Flut an Erkenntnissen über das geistige und seelische Innenleben der anderen Tiere aufgedeckt, dass die sorgfältig konstruierte Grenze zwischen Menschen und allen anderen Tierarten ein Hirngespinst ist. Von der Mücke bis zum Menschenaffen verbindet uns eine gemeinsame Struktur, die uns durch das Leben leitet: die der Gefühle und Gedanken. Dieses Buch bringt dafür eine Fülle an Belegen: Ameisen können zählen, Krabben berechnen Wege und Guppy kann lesen. Hühner führen inhaltliche Gespräche, Mäuse empfinden Mitleid und der Rhesusaffenmann schaut sich gerne Pin-ups an. Wir begegnen Seelenverwandten, in denen wir uns wiedererkennen können. Das Fundament für ein neues Wir-Gefühl.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIN ICH DENN NICHT EINE FLIEGE GLEICH DIR?
WILLIAM BLAKE
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
WIRBELLOSE TIERE
NESSELTIERE, WEICHTIERE, URMÜNDER
SPINNEN UND KREBSTIERE
INSEKTEN
WIRBELTIERE
FISCHE
AMPHIBIEN UND REPTILIEN
VÖGEL
SÄUGETIERE
QUELLENVERZEICHNIS
VORWORT
Am Anfang war die Lüge: Tiere seien dumm, stumpf und unbewusste Schlafwandler des Lebens. Sie hätten keine Kultur, keine Sprache, keine Moral, kein Selbstbewusstsein, keine Selbstkontrolle. Sie könnten weder denken noch mitfühlen. Ihnen fehle die Vernunft, sie hätten im Gegensatz zu den Menschen keinen freien Willen. Die Blick des Menschen auf die Vertreter der anderen Tierarten geht seit Jahrtausenden durch einen Filter an vermessenen Vorurteilen und grotesken ideologischen Interpretationen. So sehr sich die Weltanschauungen in den einzelnen Epochen der Menschheitsgeschichte auch unterscheiden, in einem war man sich immer einig: Die Tiere sind grundsätzlich anders und vor allem seien sie schlechter als wir Menschen.
Daran hat auch die mittlerweile etablierte Erkenntnis nichts geändert, dass wir Menschen biologisch auch Tiere sind. Unsere Sprache verrät es. Bis heute steht das unsinnige Begriffspaar „Mensch und Tier“ eisern im alltäglichen Sprachgebrauch. Bis heute erfassen wir unser spezielles Sein mit dem Verweis auf unsere geglaubte grundsätzliche Andersartigkeit. Der Satz „Im Gegensatz zu Tieren kann/ ist der Mensch...“ leitet als ewiges Mantra gefühlt je zweite philosophische, psychologische und soziologische Ausführung in die Tiefen des menschlichen Seins ein – von den religiösen Vorstellungen ganz zu schweigen. Hartnäckig hält sich die Realität vom dummen und unbewussten und völlig andersartigen Tier im kollektiven Bewusstsein. Nachgerade verzweifelt präsentieren die Geisteswissenschaften bis heute immer wieder neue angebliche Alleinstellungsmerkmale des Menschen, die ihn von allen Arten abgrenzt, – wohlgemerkt über behauptete exklusive Fähigkeiten und nicht über seine Makel. Kein ideologischer Überbau sitzt fester in den Köpfen als die Hybris, wir seien anders, wir seien besser.
Mit diesem Buch weise ich auf der Grundlage wissenschaftlicher Studien nach, dass die erniedrigenden Klischees über die (anderen) Tiere schlichtweg falsch sind. Dieses Buch könnte doppelt und dreimal so dick sein und würde immer noch nur einen Bruchteil erfassen, was mittlerweile an Wissen über das geistige und seelische Innenleben unserer nahen und fernen Verwandten angesammelt wurde. Dass die Vorurteile über Tiere falsch sind, macht sie aber noch nicht zu einer Lüge. Sie könnten schlichtweg nur Irrtümer sein, die nun mit wachsendem Wissen langsam aufgeklärt werden. Schließlich glaubt der Mensch nur allzu bereitwillig alles, was ihm schmeichelt und interpretiert sich die Welt gern so, dass er darin gut und klug dasteht. Warum also sollte er einen inneren Antrieb haben, der Behauptung vom edlen Menschen und primitivem Tier widersprechen? Er kommt bei der Story ja bestmöglich weg. Dies erklärt zumindest, warum die Behauptung auf fruchtbaren Boden gefallen ist.
Ich behaupte aber, dass es eine grandiose Lügengeschichte ist, die nicht irrtümlich, sondern mit Vorsatz in die Welt gesetzt wurde, weil sie den eigenen Zielen zupass kommt. Sie bildet nämlich den philosophischen Überbau für den jahrtausendealten, verheerenden Vernichtungsfeldzug unserer Art gegen alle anderen Arten, der in seiner Grausamkeit qualitativ und in der Menge seiner Opfer alle anderen Pogrome übertrifft und der mit der behaupteten Minderwertigkeit der Tiere gerechtfertigt wird.
Der amerikanische Sozialpsychologe Gordon Alport hat in seinem in seinem Grundlagenwerk The Nature of Prejudice (Die Natur des Vorurteils)analysiert, wie Lynchjustiz, Pogrome, Massenmorde und Völkermord systematisch eingeleitet werden durch eine Diskriminierung nach Stufen, die mit der Verleumdung des anvisierten Opfers beginnt. Diese bildet die Grundlage, auf der zur Tat geschritten werden kann mittels Vermeidung und Ausgrenzung, Diskriminierung und schließlich physischer Gewaltanwendung und Vernichtung. Und diese Gesetzmäßigkeit gilt eben nicht nur innerhalb unserer eigenen Spezies, sondern natürlich auch gegenüber den anderen Arten: Niemanden sonst haben Wir Menschen je so gründlich diskriminiert wie die anderen Tiere. Bis heute sind sie Die Anderen und es gibt keinen Lebensbereich, indem sie das nicht zu spüren bekommen – zum Vorteil des Menschen.
Am fehlendem Interesse an den anderen Tieren kann die fulminante Fehleinschätzung nicht liegen. Die Beschäftigung mit dem Wesen der anderen Tiere reicht weit in die Vergangenheit zurück. Belege finden sich seit dem klassischen Altertum. Hier sei an erster Stelle Aristoteles genannt, der nicht nur in der Philosophiegeschichte, sondern auch in der Geschichte der Naturwissenschaften einen bedeutenden Platz einnimmt. In seiner zoologischen Schrift Historia animalium sinnierte er über die Frage, ob das Verhalten durch innere Antriebe gesteuert sei und wie man dessen Ursachen interpretieren könne. Nach seiner Auffassung gehöre der Mensch zu den Tieren, unterscheide sich aber von diesen durch seine Vernunftbegabung, durch die er sich besonders auszeichnet: „Von den Tieren/Lebewesen hat allein der Mensch Logos.“ Nach seiner Vorstellung existieren Pflanzen um der Tiere willen und Tiere um des Menschen willen (Aristoteles, Politik I, 1256b). Bereits hier ist die enge Verknüpfung der Diskriminierung der Tiere mit dem Willen zur schambefreiten Ausbeutung deutlich erkennbar.
Wohlhabende „Naturbeobachter“ haben nicht nur im antiken Griechenland ihre Erkenntnisse über das Verhalten von Tieren und insbesondere von Vögeln aufgezeichnet, wobei die Frage nach dem Sein der Tiere weniger interessierte, sondern vielmehr die nach deren Nutzbarmachung. Im Hochmittelalter verfasste Kaiser Friedrich II. De arte venandi cum avibus – ein Lehrbuch über die „Kunst“, mit Vögeln zu jagen. Der österreichische Adelige und Freiherr von Coburg, Ferdinand Adam von Pernau, veröffentlichte im frühen 18. Jahrhundert einen Ratgeber für „Vogelfreunde“, der sich vor allem mit dem Fang, der Haltung und Abrichtung von Vögeln beschäftigte. Auch der römisch-katholische Priester Bernard Altum, der in den 1870er Jahren drei forstzoologische Bände über Säugetiere, Vögel und Insekten publizierte, konzentrierte sich vor allem auf die Frage der Nützlichkeit oder Schädlichkeit. Zwei seiner bis heute bekannten Zeitgenossen läuteten allerdings einen ersten Paradigmenwechsel ein: Alfred Brehm und Charles Darwin. Der 1829 geborene Pfarrerssohn Alfred Brehm hatte sein Architekturstudium abgebrochen, um den damals bekannten Vogelkundler Baron Johann Wilhelm von Müller auf eine Afrika-Expedition zu begleiten, die ihn nach Ägypten, in den Sudan und auf die Sinai-Halbinsel führte. Trotz widrigen Bedingungen führte Brehm dort umfangreiche Tierstudien durch, jagte Tiere und brachte sie – lebendig und tot – mit nach Europa. Zwischen 1863 und 1869 verfasste Brehm sein Illustrirtes Thierleben, das unter dem Titel Brehms Tierleben bis heute allgemein bekannt ist. Die moralisch bewertende Interpretation des darin beschriebenen Verhaltens der Tiere diente über lange Zeit Ideologen als Argument, jede Form von „Vermenschlichung“ der Tiere verächtlich zu machen. Man solle sich um jeden Preis die Tiere emotional und geistig vom Leibe halten.
Als Brehm geboren wurde, studierte in England der Arztsohn Charles Darwin bereits auf Anraten des Vaters Theologie, obwohl sein eigentliches Interesse den Naturwissenschaften galt. Seine These, dass gemeinsame Vorfahren uns Menschen mit den anderen Tieren verbinden, erschütterte das cartesianische Weltbild, das Tiere als Schlafwandler des Lebens begriff. Für Darwin war der Unterschied zwischen unserem geistigen Potential und dem der anderen Tiere nicht grundsätzlicher, sondern nur gradueller Natur. Sensibilität und Intuition, Gefühle und Gaben wie Liebe, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Neugier, Nachahmung, Vernunft, deren der Mensch sich rühmt, fänden sich, so Darwin, auch bei (den anderen) Tieren.
Die im heutigen Sinn wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Verhalten von Tieren begann – inspiriert durch Charles Darwins Hauptwerk Über die Entstehung der Arten – mit der Frage nach der Ontogenese der Verhaltensweisen; Darwin hatte mit Selektionsexperimenten an Haustauben den Weg dafür geebnet, Verhalten als in gleicher Weise wie körperliche Merkmale als vererbbar zu betrachten. Untersucht wurde zunächst vor allem der sogenannte Instinkt, ein vager und letztlich abwertender Begriff, der bis heute gerne verwendet wird, das Verhalten von (anderen) Tieren zu benennen und vor allem von gleichgeartetem menschlichen Verhalten abzugrenzen. Klar definiert wurde der Begriff Instinkt nie. Der Zoologe Wolfgang Wickert, der die Ethologische Abteilung am Max-Planck-Instituts für Verhaltensphysiologie in Seewiesen bei Starnberg leitete, definierte „Instinkt“ treffend als ein „überkommenes hypothetisches Konstrukt, mit dem man planvolles Handeln der Tiere von dem des Menschen unterscheiden wollte.“
Ihren Eingang in den akademischen Lehrbetrieb der Hochschulen fand die Verhaltensbiologie erst Anfang des 20. Jahrhundert. Sie blieb weiterhin ideologisch gefärbt. Das Erbe René Descartes als geistigen Begründer der Aufklärung, der Tiere zu empfindungslosen Maschinen erklärte und in alter Tradition nur dem Menschen die Fähigkeit zum Denken zugestand, prägte in nie dagewesener Weise die Grundeinstellung, die anderen Tiere wahrzunehmen, aber nicht ansatzweise in ihrem Sein zu erkennen oder erkennen zu wollen. Es ist sicher kein Zufall, dass Descartes auch als Begründer der Vivisection gilt. Als einer der ersten nagelte er in aller Öffentlichkeit lebende Hunde an ein Brett, um sie aufzuschneiden und ihr Verdauungssystem zu studieren. Die Schmerzensschreie der Tiere tat Descartes mit dem Argument beiseite, es würde sich um das Quietschen einer Maschine handeln, Tiere seien nur Automaten und nicht in der Lage zu fühlen und zu denken. Und auch hier gehen Motivation – also Tiere zu foltern – Hand in Hand mit der Entwertung der Tiere zum vernunftlosen und sogar empfindungslosen Ding.
Diesem Erbe hielt die akademische Verhaltensbiologie zunächst über etwa 100 Jahre und damit nahezu über die gesamte Geschichte der Disziplin die Treue. Die Wissenschaft erklärte die anderen Tiere also weiterhin für dumm. Dieser Kunstgriff gelang vor allem dadurch, dass diese von einem Denkmodell dominiert wurde, das man mit Fug und Recht als erkenntnisunterdrückend bezeichnen kann: Der Behaviorismus. Dieses wissenschaftstheoretische Konzept untersucht und erklärt das Verhalten von Tieren ohne jegliche Introspektion oder Einfühlung. Begründet durch John B. Watson zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Behaviorismus in den 1950er Jahren vor allem durch Burrhus Frederic Skinner und Iwan Petrowitsch Pawlow populär. Generationen von Schülern sind seither mit einer Vorstellung vom Tier als „Black Box“ und Begriffen wie Reiz-Reaktions-Kette und Konditionierung aufgewachsen. Das wissenschaftliche Dogma über viele Jahrzehnte lautete, dass alles, was wir bei Tieren als Ausdruck ihrer Gefühle und Gedanken wahrnehmen, nichts anderes als Reflex, Reaktion und Instinkt sei und mit den höheren geistigen Leistungen des Menschen nichts zu tun habe. Ein geistig-seelisches Innenleben wird geleugnet, weil man es streng empirisch auch nicht beweisen kann.
„Wie die Hausfrau, die die Stube gescheuert hat, Sorge trägt, dass die Türe zu ist, damit ja der Hund nicht hereinkomme und das getane Werk durch die Spuren seiner Pfoten entstelle“, schrieb Albert Schweizer in seinem Buch Kultur und Ethik, „also wachen europäischen Denker darüber, dass ihnen keine Tiere in der Ethik herumlaufen.“ Für die Naturwissenschaften gilt Entsprechendes. Auch ihr Denken ist von dieser abgrenzenden Vorstellung geprägt und damit löst sich die Wissenschaft auch nur schwer vom alten Dogma der Zweiteilung in bewusstes und nicht-bewusstes Leben. Bis heute blendet sie beharrlich einen wichtigen Teil der Darwinschen Evolutionstheorie aus, hält der Wissenschaftstheoretiker Daniel C. Dennett in seinem Buch Darwins gefährliches Erbe fest. Der Gedanke, dass auch der menschliche Verstand ein Ergebnis der natürlichen Selektion sei, wirke auf viele Menschen zu revolutionär – bis heute.
Die interessanten Fragen zum Leben der (anderen) Tiere hat auch der Behaviorismus weder gestellt noch beantwortet. Er hat uns das Tier in nie dagewesener Weise als Ding vermittelt und bildete damit den ideologischen Überbau für die historisch alles übertreffende Ausbeutung der Tierheit durch eine einzige Gattung. Jahrzehntelang waren die Verfechter des Behaviorismus die einflussreichsten Verhaltensforscher an den Universitäten. In der Einflusssphäre dieser Ideologie konnte die seit den 1930er Jahren in Europa aus der Tierpsychologie entstandene vergleichende Verhaltensforschung keinen Fuß fassen. Ganz im Gegenteil riskierten Wissenschaftler ihre Reputation, wenn sie es wagten, das große Tabu zu brechen und Tiere zu „vermenschlichen“.
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch die Geschichte vom zählenden Pferd Hans, die gern hervorgeholt wird, um das Misstrauen gegenüber tierlicher Intelligenz zu begründen. Hans konnte einwandfrei buchstabieren, zählen und sogar Wurzeln ziehen – egal, ob „sein“ Besitzer, ein deutscher Mathematiklehrer, die Fragen stellte oder fremde Forscher. Das Pferd klopfte die Antworten mit dem Huf auf ein niedriges Pult oder nickte mit dem Kopf. Schließlich deckte ein Psychologe das eigentliche Talent von Hans auf: Eine ans Wunderbare grenzende Beobachtungsgabe hatte Hans verraten, wie oft er mit dem Huf pochen sollte. Das Pferd nahm feinste, den Fragern unbewusste Reaktionen wahr: Kopfnicken etwa, angehaltenes Atmen oder auch nur die nachlassende Anspannung der Zuschauer, wenn es beim richtigen Klopfzeichen angelangt war. Fortan stand für die Wissenschaft fest, dass Tiere eben doch nicht denken können. Und wenn es so aussehe, reagierten sie lediglich auf Hinweise ihrer Umgebung. Als ob die großartige Beobachtungsgabe von Hans, die zu erkennen eines besonders geschulten menschlichen Fachmanns bedurfte, nicht bereits eine anerkennenswerte geistige Leistung darstellte.
Vielleicht war es tatsächlich Desmond Morris´ Weltbestseller Der nackte Affe, der diese sorgfältige errichtete gedankliche Barriere zwischen Menschen und allen anderen Arten wirklich beschädigte, indem er systematisch offenlegte, wie viel „Tier“ im Menschen steckt. Damit war der Weg bereitet, auch umgekehrt „das Menschliche“ in den anderen Tieren zu entdecken.
In den vergangenen Jahrzehnten verlor der Behaviorismus jedenfalls zunehmend an Einfluss und man begegnete den Tieren schrittweise mit einer neuen Einstellung, die den Objekten des Interesses endlich gerechter wurde. Symbolhaft steht hier die große Verhaltensforscherin Jane Goodall mit ihrer Entscheidung, den von ihr beobachteten Schimpansen Namen zu geben – statt Nummern, wie es bisher üblich war.
Diese und andere Tabubrüche bewirkten in einer vergleichsweise kurzen Zeitspanne eine überwältigende und nicht endende Flut an Einblicken in das geistige und seelische Innenleben der anderen Tiere, die man zweifelsohne als die vierte narzisstische Kränkung der Menschheit bezeichnen kann – nach den erschütternden Erkenntnissen, dass wir weder der Mittelpunkt des Kosmos sind (Kopernikus), auch „nur Tiere“ (Darwin) und noch nicht einmal „Herr im eigenen Haus“ (Freud).
Es mag manche Exemplare der eitelsten Spezies des bekannten Universums zutiefst beleidigen, aber es ist ernsthaft nicht mehr zu leugnen: Die sorgfältig konstruierte und verbissen verteidigte Linie zwischen „uns Menschen“ und allen anderen Tierarten ist kein tiefer Graben. Marienkäfer und Meisen, Mäuse und Menschen stehen sich mit ihrem Innenleben ganz nah. Uns verbindet offensichtlich eine gemeinsame Struktur, die uns alle durch das Leben leitet: die der Gefühle und Gedanken. Welche Gefühle und Gedanken dies konkret sind, hängt von dem Leben ab, das wir führen und den Herausforderungen, denen wir ausgesetzt sind – egal, in welchem Körper wir nun geboren werden.
Die Denk- und Sprechtabus, die das Machtkonstrukt vom Menschen als Krone der Schöpfung zementierten, zu dessen Füßen und zu seinem Nutzen die Tiere tummeln, werden zunehmend aufgegeben. Unaufhaltsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass die anderen Tiere in ihren Empfindungen überaus menschlich sind. Mehr und mehr Forscher wagen es, darüber zu berichten. Sie müssen endlich auch nicht mehr fürchten, als Wissenschaftler erledigt zu sein, wenn sie nicht mehr rigoros leugnen, was so offensichtlich ist. Sie erzählen uns Anekdoten aus der Welt der Tiere, die uns unsere nahen und fernen Verwandten überaus vertraut werden lassen. „Seriöse“ Meldungen über die geistigen und emotionalen Fähigkeiten der Tiere füllen nun seit zwei Jahrzehnten die Wissenschaftsseiten der Zeitungen und bieten die Grundlage für Einsichten in die Erlebniswelten der anderen Tiere, die noch vor kurzem als völlig unwissenschaftlich und sentimental unterdrückt worden wären. Bücher zum Thema schaffen es in die Bestsellerlisten.
Auch die anderen Tiere lieben und hassen, sie können traurig sein, Mitleid empfinden, sie können wütend sein und rachsüchtig, hilfsbereit und freundschaftlich. Sie haben einen Schönheitssinn und bringen begabte Künstler hervor. Tiere können wahrnehmen, bewerten, entscheiden und handeln. Sie wissen, was sie tun. Sie denken. Und ihre Verstandesleistungen übertreffen die unseren teilweise sogar um Längen. Sie sind moralisch und mitfühlend, sind selbstbewusst und bilden Kulturen aus. Sie möchten, dass es gerecht zugeht. Sie sprechen und planen für die Zukunft.
Ausgerechnet die Wissenschaft, die sich auch bei der Verhaltensforschung – insbesondere, wenn diese in Laboratorien betrieben wird – an ihren Versuchspersonen ethisch gesehen teilweise sogar schwerwiegend vergeht, liefert das stärkste Argument für einen wertschätzenden Umgang mit den anderen Tieren und gegen die systemische Grausamkeit gegen sie. Umso verwunderlicher ist, dass Tierschützer und Tierrechtler auf diesen Wissens-Schatz bisher kaum zurückgreifen und es vorziehen, ihre Mitmenschen mit Horrorbildern und Tugendterror zu drangsalieren, was jeden mitfühlenden Menschen hilflos und erschüttert und mit nichts Besserem als dem schlechten Gefühl seiner eigenen Schuld zurücklässt und zur Verdrängung geradezu ermuntert. Wer sich nicht das Leben vergällen will, wendet den Blick von den Gefolterten ab – und damit auch den Blick von den (anderen) Tieren.
Dabei liegt es auf der Hand: Der wichtigste Schritt zur Beendigung ihrer Vernichtung ist, dieser die geistige Grundlage zu entziehen und der Verleumdung entgegenzutreten. Die Tiere selbst in ihrem wahren Sein – befreit von dem Vorurteil – in ihrer Schönheit, ihrer Sensibilität und Klugheit sind es wert, den gleichen Schutz und Respekt zu erfahren, wie wir ihn für uns selbst in Anspruch nehmen. Viel zu wenig wurde die Kraft, die in den Tieren selbst liegt, gewürdigt und ins Zentrum der Aufmerksamkeit gestellt, um sie aus ihrem Opfersein herauszuholen. Dabei sind diese Merkmale seit jeher der beste Schutz vor Gewalt gewesen. Kulturen, die (andere) Tiere zu Göttern erklärten, ihnen einen heiligen Status zusprachen, waren die besseren für sie. Heute liefert die Wissenschaft tausend Gründe, den Tieren mit Respekt zu begegnen. Appelle gegen die Folter von Tieren werden weiterhin ins Leere gehen, solange die Opfer nicht ernst genommen werden. Wer in den anderen Tieren die fühlende und denkende Person nicht erkennen kann, wird das Unrecht an ihnen nicht wirklich erfassen können.
Aus diesem Grund habe ich bewegende Geschichten und wissenschaftliche Erkenntnisse über das Fühlen und Denken der Tiere zu einer Enzyklopädie zusammengetragen. Sie eröffnen uns eine Innenwelt, die uns selbst so vertraut ist. Dieses Wissen schafft – so hoffe ich – ein neues artübergreifendes Wir-Gefühl als emotionales Manifest gegen die Gewalt an den anderen Tieren. Die gesammelten Informationen bilden dabei nur einen winzigen Ausschnitt dessen, was uns die Tiere tagtäglich über sich erzählen, aber sie sind bezeichnend. Und sie lassen ein Gefühl von Vertrautheit entstehen, das Gewalt und Missbrauch entgegensteht. Werden wir weiterhin nicht hören wollen und die Welt der Tiere mit Folter, Tyrannei und Tod überziehen, wenn wir erkennen, wen wir da vor uns haben, wen wir hier misshandeln und vernichten? Eher doch lassen uns diese Einblicke in das Innenleben der Tiere das Ausmaß der Schuld offenbar werden, die wir auf uns laden, wenn wir den Vertretern anderer Arten nicht mit Respekt begegnen, sondern mit Dünkel und Gewalt. Unsere Beziehung zu Tieren beruht auf einer gesellschaftlichen Konstruktion, die, wie dieses Buch zeigt, auf verleumderischen Lügen basiert. Mit der Entkräftung dieser Lügen beginnt die Dekonstruktion dieser zerstörerischen Beziehung. Sie ist ihre Voraussetzung. Deshalb liegt das Hauptaugenmerk dieses Buches auf der Intelligenz der Tiere. Gefühle werden in unserer Gesellschaft nicht so hoch gehandelt wie die vielgepriesene „Vernunft“ – auch, weil wir sie mit „Bewusstsein“ verknüpfen. Nur wer denkt, wird ernst genommen.
Zwei Anmerkungen zum Abschluss: Die angeführten Verhaltensstudien sind teilweise mit psychischer und physischer Gewalt gegen die Versuchspersonen verbunden. Es fehlt deren Einwilligung zur Teilnahme, in vielen Fällen sind sie schlichtweg Gefangene der Forscher. Diese Versuche hier zu erwähnen und zu beschreiben, bedeutet nicht, sie in irgendeiner Weise gutzuheißen. Sie aber zu verschweigen macht nichts ungeschehen, es nähme aber den Familien und nachfolgenden Generationen der Versuchsopfer eine Chance auf Veränderung. Mit jedem Experiment erzählen sie uns etwas über sich von wirklicher Bedeutung, und das verdient, gehört werden. Es ist nicht in ihrem Sinne, diese Aussage zu verschweigen.
Und schließlich: Die heutige praktizierte vergleichende Verhaltensforschung ist ein revolutionärer Fortschritt im Vergleich zum bisherigen behavioristischen Ansatz; der Stein der Weisen ist sie sicher nicht. Wissenschaft ist nicht frei von Weltanschauung. Auch sie ist eine Gefangene ihrer Selbst. In vielen Fällen sind ihre Versuchsanordnungen fern der Lebenswirklichkeit frei lebender Individuen. Die Versuche pauschalisieren und vernachlässigen die individuellen Begabungen der einzelnen Versuchspersonen. Ganz selbstverständlich wird vorausgesetzt, dass sich die Probanden anstrengen und sich beweisen wollen. Können und wollen sind zwei Paar Schuhe. Ihre geistigen Kapazitäten zu erforschen setzt ihre Kooperationsbereitschaft voraus. Zwangsmaßnahmen, Futterentzug und Manipulation bedeutet Stress, der sich aufs Denken hinderlich auswirkt. Schließlich wissen wir aus der Pädagogik, dass die Leistungen von Schülern durch die Erwartungshaltung der Lehrer stark beeinflusst werden. Es gibt keinen Anlass, anzunehmen, dass es bei den Tieren anders ist und sie eher versagen, wenn der Forscher sie für dumm hält.
Trotzdem steht trotz aller methodischen Unzulänglichkeiten bereits die Erkenntnis felsenfest: im Wesentlichen sind wir speziesübergreifend gleich. Wir stehen erst ganz am Anfang der Erkenntnis, aber wir wissen genug, um noch heute damit zu beginnen, den anderen Tiere auf Augenhöhe zu begegnen und sie endlich wertschätzend aus ihrer Sklavenrolle zu entlassen.
Viel Freude beim Kennenlernen der Familie!
Silke Ruthenberg
Wer sind Tiere?
Tiere sind neben Pflanzen, Pilzen, Protisten, Bakterien und Archaeen Lebewesen. Lebewesen sind organisierte Einheiten, die unter anderem zu Stoffwechsel, Fortpflanzung, Reizbarkeit, Wachstum und Evolution fähig sind. Von den Unter dem Begriff „Tier“ werden jene vielzellige Lebensformen zusammengefasst, die sich von Körpersubstanzen oder Stoffwechselprodukten anderer Organismen ernähren und eine Form des heterotrophen Stoff- und Energiewechsels betreiben und keine Pilze sind. Als Pflanzen werden Lebewesen bezeichnet, die sich nicht fortbewegen können und Photosynthese betreiben.
Was sind Empfindungen?
Empfindungsfähigkeit bedeutet, Reize bewusst aufzunehmen und darauf zu reagieren, indem man sie innerlich erlebt. Es ist die Fähigkeit, positiv oder negativ beeinflusst zu werden und Erfahrungen zu machen. Dies unterscheidet das bewusste Wesen entscheidend von einer unbewussten Entität wie zum Beispiel einer Maschine, die auch auf Reize reagiert, indem man zum Beispiel einen Knopf drückt. Die Reaktion auf äußere Reize ist keine Empfindungsfähigkeit. Das Zeigen einer körperlichen Reaktion dieser Art bedeutet nicht zwingend, dass die Fähigkeit zu subjektiver Erfahrung vorliegt.
Was ist Bewusstsein?
Bewusstsein ist gleichbedeutend mit empfindungsfähig, Bei Bewusstsein ist man in der Lage, positive und negative Erfahrungen zu machen. Wenn also ein Lebewesen nur (noch) lebt, aber nichts mehr er-lebt und also kein Bewusstsein mehr hat, kann es keine Erfahrungen mehr machen und hört somit auf, ein Individuum, ein Subjekt zu sein.
Was ist Selbstbewusstsein?
Selbstbewusstsein ist eine besondere Form des Bewusstseins. Dazu gehören beispielsweise das Bewusstsein vom eigenen Körper, das Bewusstsein, mit Absicht zu handeln oder sich als Wesen begreift, das in verschiedenen Zeiten existiert und in der Zukunft existieren wird.
Wer empfindet?
Die Voraussetzung für Empfindungsfähigkeit ist das Vorhandensein eines ausreichend zentralisierten Nervensystems. Lebewesen, die kein zentralisiertes Nervensystem haben, sind nicht empfindungsfähig. Zu den nicht empfindungsfähigen Lebewesen gehören Bakterien, Archaeen, Protisten, Pilze und Pflanzen. Sicher ist: Nur Tiere haben Empfindungen, alle anderen Lebensformen haben keine Empfindungen. Es gibt allerdings auch Tierarten, die nicht empfindungsfähig sind, weil ihnen die pysiologischen Voraussetzungen hierfür fehlen und möglicherweise sind einige Tiere mit sehr einfachen zentralisierten Nervensystemen ebenfalls nicht empfindungsfähig, aber dies ist wissenschaftlich ungeklärt.
Welche Tiere sind „bei Bewusstsein“, also empfindungsfähig?
Zu den Tieren mit Bewusstsein zählen Wirbeltiere und wirbellose Tiere wie Kopffüßer, da sie die Kriterien für Empfindungsfähigkeit vollumfänglich erfüllen. Die Physiologie von Arthropoden (Insekten, Spinnentiere und Krebstiere) ist offenkundig ausreichend organisiert, um Bewusstsein zu ermöglichen, und das Verhalten dieser Tiere bestätigt dies.
Welche Tiere empfinden nicht?
Tieren ohne Nervensystem wie den Porifera (der Stamm, der Schwämme enthält) fehlt die biologische Voraussetzung für Empfindungsfähigkeit. Stachelhäuter, zu denen Seesterne und Seeigel zählen, verfügen bereits über ein relativ komplexes Nervennetz, allerdings ohne Zentralisierung. Nesseltiere (Quallen, Korallen, Hydras und Anemonen) besitzen echte Nervenzellen, die ein diffuses Netz bilden, welches nur eine geringe Zentralisierung zeigt. Einige Nesseltiere wie Seeanemonen verfügen über komplexere Nervennetze mit sensorischen Ganglien, was die ersten Schritte in Richtung eines zentralisierten Nervensystems darstellen könnte. Gewisse Zentralisierung in der Struktur könnte mit den diffuseren Nervennetzen im Rest des Systems interagiert.
Würmer hingegen verfügen bereits über ein Zentralnervensystem. Das Nervensystem von Muscheln ist bis zu einem gewissen Grad zentralisiert, da es 3 Ganglienpaare enthält, die durch ein Nervenkabel verbunden sind. Die Nervensysteme von Schnecken ähneln denen von Muscheln. Sie sind etwas größer verfügen typischerweise über fünf Ganglien, die als Gehirn dienen, das zu Lernvorgängen befähigt ist. Insekten haben ein zentralisiertes Nervensystem mit einem ausgeprägten Gehirn. Krebstiere verfügen über ein zentrales Nervensystem. Ihre Gehirne liegen in Größe und Komplexität irgendwo zwischen Insekten und Kopffüßern.
Was ist Vernunft?
Unter „Vernunft“ versteht man die geistige Fähigkeit, Einsichten zu gewinnen, sich ein Urteil zu bilden, Zusammenhänge und die Ordnung des Wahrgenommenen zu erkennen und sich in seinem Handeln danach zu richten. Gemeinhin bezeichnet man mit diesem Begriff (der letztlich so vage ist wie „Instinkt“) Denkfähigkeit, Erkenntnisvermögen und Intelligenz. In der ursprünglichen Definition bedeutet sie „Erfassung, Wahrnehmung. Es ist schwer vorstellbar, dass Tiere, die jeden Tag unendlich viele Eindrücke bewerten und Entscheidungen treffen und treffen müssen, ihr Leben bewältigen und ihr Handeln koordinieren, ohne zu denken. Also sind sie vernünftig. Ihr Leben spricht davon Bände.
WIRBELLOSE TIERE
NESSELTIERE WEICHTIERE URMÜNDER
Seeanemonen: Strategische Denker mit Charakter
Seeanemonen, auch Aktinien genannt, gehören zur Ordnung der Blumentiere. Sie leben solitär im Meer. Aktinien sind halbsessil und können sich durch langsames Kriechen auf ihrer Fußscheibe fortbewegen. Überwiegend krallen sie sich damit allerdings auf hartem Untergrund fest oder in Sand und Geröll ein. Während „höher entwickelte“ Tiere ein komplexes Gehirn besitzen, das meist zusammen mit Sinnesorganen und einem Mund im Kopf angesiedelt ist, weisen diese Wirbellose – ähnlich wie Korallen – keine komplexen Gehirnstrukturen auf. Der Körper von Seeanemonen ist mit einem feinen Nervennetz durchzogen, ein Gehirn haben diese Tiere allerdings nicht.
Trotzdem scheint bereits ein Nervennetz zu so einigen Leistungen zu befähigen. Mark Briffa und seine Kollegen von der Plymouth University haben in zwei Studien festgestellt, dass Pferdeaktinien über eine Art Persönlichkeit verfügen und sogar logisch handeln können. Die Wissenschaftler beobachteten 65 Pferdeaktinien, die an zwei verschiedenen Ufern an der Süd-Westküste Großbritanniens leben. Um deren Reaktion auf Bedrohung zu untersuchen, zielten sie mit einer meerwasserbefüllten Spritze direkt auf das Mundloch der Anemonen. Die Pferdeaktinien verschlossen es daraufhin mit ihren Tentakeln. So tun das Anemonen gewöhnlich, wenn sie gestört werden.
Daraufhin stoppten die Forscher die Zeit, wie lange es dauerte, bis die Tiere ihr Mundloch wieder öffneten. Drei Mal spielten die Forscher dieses Bedrohungs-Szenario mit jeder Pferdeaktinie durch. Tatsächlich dauerte die Angstreaktion einzelner Individuen bei allen drei Versuchen etwa gleich lang. Allerdings gab es durchaus Unterschiede zwischen den einzelnen Anemonen, die nicht mit externen Faktoren wie die Wassertemperatur in Verbindung gebracht werden konnte. Diese hatte kaum eine Auswirkung auf die Reaktion der Tiere. Die Unterschiede im Verhalten der einzelnen Anemonen sind also im Wesentlichen auf ihren individuellen Charakter zurückzuführen.
Einer weiteren Studie ergab, dass Pferdeaktinien strategisch entscheiden, ob sich ein Kampf mit einem Artgenossen bezahlt macht oder nicht. Das Ergebnis ihrer Überlegung ist von der Kampftechnik des Gegners abhängig, also ob dieser beispielsweise seine Nesselzellen einsetzt oder eben nicht. Die Körpergröße, die Größe der Nesselzellen und die Schlagfertigkeit der Tentakel des Gegners beeinflussen die Entscheidung der Pferdeaktinie ebenfalls.1, 2
Regenwürmer treffen kollektive Entscheidungen
Erdwürmer galten bisher als Tiere ohne jegliches Sozialverhalten. Belgische Forscher konnten nun aber Gruppenbildungen bei Ringelwürmern nachweisen, die dem Verhalten von Schwärmen und Herden entsprechen. Die Biologen um Lara Zirbes von der Université de Liège stellten nämlich fest, dass die Tiere durch Berührung kommunizieren und sich dadurch gegenseitig beeinflussen. Auf diesem Weg werden kollektive Entscheidungen wie die grundsätzliche Bewegungsrichtung der Gruppe getroffen.
Bei ihren Untersuchungen setzten die Wissenschaftler zunächst 40 Regenwürmer in eine zentralen Kammer, aus der zwei identische Ausgänge führten. Nach Ablauf eines Tages wurde dann überprüft, wie viele Würmer die Kammer über welchen Weg verlassen hatten. Im Ergebnis zeigte sich, dass die Tiere sich lieber gruppieren und gemeinsam einen Ausweg dem anderen vorziehen.
In einem zweiten Experiment setzten die Wissenschaftler zunächst einen Wurm an den Eingang eines mit Erde gefüllten Irrganges, in dem zwei unterschiedliche Wege zu einer Nahrungsquelle führten. Nachdem der Wurm die Nahrung erfolgreich gefunden hatte, platzierten die Forscher zunächst einen zweiten Wurm am Eingang des Labyrinths, um zu sehen, ob dieser zweite Wurm dem Weg des ersten über eine mögliche chemische Signalspur folgen würde. Es konnte jedoch keine Bevorzugung für die Route des Vorgängers ausgemacht werden.
Wurden jedoch zwei Würmer gemeinsam am Eingang des Irrwegs gesetzt, so zeigte sich eine deutlich höhere Tendenz, dass die Individuen sich zunächst berührten, um dann einen gemeinsamen Weg einzuschlagen. Die Studie ergab, dass bis zu 40 Regenwürmer sich auf diese Weise untereinander austauschen und folgen können, wodurch die im ersten Experiment belegte Herdenbildung erklärt und bestätigt werden konnte.3
Wenn sich die Muschel mies fühlt
Muscheln zählen zum Stamm der Weichtiere. Sie verfügen über ein einfaches Nervensystem, das zwei Nervenzellhäufungen besitzt: das Pedal- und das Viszeralganglion, eine Art Muschelgehirn. Muscheln leben noch, wenn sie im heißen Sud geschwenkt oder mit Zitronensaft beträufelt aus der Schale geschlürft werden. Aber fühlt die Muschel dabei auch, was ihr geschieht?
Es gibt einige Indizien, dass Muscheln und andere Tierarten mit diesem einfachen zentralen Nervensystem bereits leidensfähig sind. 1993 hat eine italienische Arbeitsgruppe um G.B. Stefano erforscht, dass viele Körperbereiche der Miesmuschel Mytilus edulis hormonartige, schmerzlindernde Stoffe erkennen. Ist die Muschel gestresst, so findet man in ihr wenige freie Anti-Stress-Moleküle. Ist sie hingegen entspannt, so steigt der Spiegel dieser Substanzen. Die untersuchten Stoffe sind sogenannte Endorphine. Sie stammen aus derselben Chemikaliengruppe wie die Schmerzstiller Heroin und Morphium. Der menschliche Körper verfügt über ähnliche Stoffe, die er bei Stress und Schmerz zur Linderung ausschüttet.
Stefano und Mitarbeiter haben in den vergangenen Jahren immer mehr Hinweise darauf gefunden, dass sich Muschel und Mensch in hormoneller Hinsicht ähneln. „Kurz gesagt zeigen unsere Versuche“, schreiben die Nervenforscher, „dass Morphin auf Zellen eines wirbellosen Tieres (dieselben Auswirkungen) hat wie auf Menschen, obwohl sich beide seit 500 Millionen Jahren auf verschiedenen Zweigen der Evolution weiterentwickeln“.4 Da Hormone quasi messbare Spuren von Gefühlen sind, könnte man jetzt den Umkehrschluss wagen: Wo Hormone zu messen sind, existieren auch Gefühle.
Und es gibt weitere Indizien für ein vorhandenes Gefühlsleben bei Muscheln. So signalisieren Rezeptoren auf der Schale der Muschel Gewaltanwendungen. Die Muschel reagiert darauf hin mit extremer Ausschüttung von Stresshormonen.5 Man hat außerdem festgestellt, dass sich die Herzfrequenz bei Muscheln erhöht, wenn sie von Fressfeinden bedroht werden.6 Einige Muscheln besitzen auch Augen. Die Annahme liegt nahe, dass ein Lebewesen mit Augen auch über eine Empfindung des Sehens verfügt.7
Muscheln können sogar von einer Gefahrenquelle „weglaufen“. Filmclips auf Youtube dokumentieren auch dem Laien, wie eine Muschel ihren Fuß aus der Schale schiebt, um sich von für sie austrocknendem Salz wegzubewegen.8 Womöglich ist es Miesmuscheln und Austern also ganz und gar nicht egal, wenn sie verputzt werden.
Was merken sich Schnecken?
Schnecken gelten nicht unbedingt als Intelligenzbestien, aber ihre Gedächtnisleistung reicht immerhin aus, im Jahr 2000 dem österreichischen Neurobiologen Eric Kandel den Nobelpreis einzubringen.
Kandels Kollegen zweifelten zunächst am Verstand des Wissenschaftlers, weil dieser die Mechanismen von Lernen und Gedächtnis ausgerechnet an der Meeresschnecke Aplysia erforschen wollte. Die, auch als Seehase bekannte, bis zu 16 kg schwere Schnecke hat gerade mal 20.000 Nervenzellen, wo beim Menschen 100.000 sitzen. Ihre Neuronen sind aber teilweise so dick, dass man sie mit bloßem Auge erkennen kann. Unter dem Mikroskop kann man somit gut beobachten, wie Erlerntes seine Spuren hinterlässt.
Aplysia verfügt bereits über ein Kurz- und ein Langzeitgedächtnis. Erhält sie nur eine Trainingseinheit, vergisst sie das Erlernte bereits nach einer Viertelstunde. Übt Aplysia jedoch über vier Tage hinweg, auf einen bestimmten Reiz ihren Sipho einzuziehen, dann bleibt die Erinnerung wochenlang gespeichert. Auch das Umfeld hat Auswirkungen auf den Intellekt der Schnecke: Langeweile macht den Seehasen dumm, eine anregende Umgebung hingegen macht die Schnecken geistig fit.9
Schnecken haben unterschiedliche Talente
Spitzschlammschnecken (Lymnaea stagnalis) haben beim Lernen ganz unterschiedliche Begabungen. Gedächtnisexperimente eines englisch-walisischen Forschungsteams um Sarah Dalesman von der Aberysthwyth University zeigten, dass sich einzelne Schnecken entweder gut an Informationen über Nahrung oder aber an Dinge rund um ihre Fressfeinde erinnerten – nicht aber an beides gleichzeitig.
Die Arbeitsgruppe unterzog die Schnecken einem Trainingsprogramm, bei dem sie lernen sollten, dass zum Beispiel Futter mit Karottenduft bitter schmeckt oder dass sie an der Wasseroberfläche mit Stöckchen gepikst werden, was einen Fressfeind simulieren sollte.
Dabei zeigte sich, dass Schnecken, die einen Typ von Aufgabe gut lernten, sich bei dem anderen unbegabt anstellten. Individualisten sind sie also auch noch.10
Oktopussis Lust und Frust
Kraken sind die Hochbegabten unter den Weichtieren und zahlreiche Anekdoten beschreiben auch ein überaus differenziertes Gefühlsleben.
Eine besonders tragikomische Episode über einen Oktopus mit Tantalusqualen haben Wissenschaftler der Meeresstation von Banuyls zu erzählen. Der arme Kerl hatte so seine Probleme mit einem Einsiedlerkrebs, der sich einfach nicht erwischen lies. Bei jedem Angriff zog er sich ebenso eilig wie erfolgreich in sein Schneckenhaus zurück und schirmte den Eingang mit den gepanzerten Scheren ab. Dort war er nicht herauszubekommen und der Oktopus musste wiederholt unverrichteter Dinge abziehen. Doch nicht genug damit. Nach jedem Angriff spazierte der Einsiedler nach kurzer Zeit erneut provozierend am Höhleneingang des Oktopus vorbei. Der konnte erneut nicht widerstehen, und das Spiel wiederholte sich.
Doch irgendwann ist auch die Frusttoleranz auch des hartnäckigsten Kraken erschöpft und er hat die Faxen dicke. Oktopus schleppte also einen großen Stein heran und platzierte ihn als Sichtschutz zwischen sich und die Lockspeise. Endlich hatte er seine innere Ruhe wiedergefunden.11
Der Sporttaucher und Philosoph Peter Godfrey-Smith erzählt in seinem Buch Other Minds von der unmissverständlichen Botschaft eines Kraken an eine Forscherin in einer Meeresstation, die ihn enttäuscht hatte. Diese fütterte die Oktopoden mit aufgetauten Sepienstücken, die diese nur ungern essen. Sie bevorzugen lebende Krebse. Der Forscherin fiel dabei auf, dass einer der Kraken seine Ration nicht verspeiste, sondern abwartend festhielt und ihr dabei mit den Augen folgte, als sie den Gang mit den Aquarien hinunterging. Auch auf ihrem Rückweg behielt er sie fest im Blick. Als sie an seinem Aquarium vorbeikam, nahm er den verhassten Fraß und warf ihn in den Überlauf des Aquariums. Smith erzählt auch von gefangenen Oktopoden, die sich einen Spaß daraus machen, mit einem gezielten Wasserstrahl aus ihrem Siphon die Glühlampe im Raum auszuschießen oder einen solchen Wasserstrahl in den Nacken eines Tierpflegers richten, den sie offenbar nicht leiden konnten.12
Der träumende Tintenfisch
Oktopoden ändern ihre Farbe, indem sie durch neuronale Prozesse pigmenthaltige Zellen – sogenannte Chromatophoren – aktivieren. Wenn die Tintenfische beim Schlummern Farbe und Muster wechseln, sind das Reaktionen auf einen Traum.
David Scheel, Professor für Meeresbiologie an der Alaska Pacific University, konnte nun Oktopus Heidi beim Schlafen filmen und die deutlichen Anzeichen dokumentieren, wie Heidi im REM-(Rapid Eye Movement)-Schlaf vor sich hin träumte. In ihrem Traumreich muss es dabei wild zugegangen sein, denn die schlafende Heidi hatte vor lauter Aufregung Farbe und Muster ihrer Haut ungewöhnlich deutlich geändert. David Scheel hatte nach eigenen Angaben einen so schnellen Farbwechsel noch nie beobachtet. „Während sie träumt, ist das ein dramatischer Moment. Zuerst schläft sie, dann sie sieht eine Krabbe, und ihre Farbe beginnt sich ein wenig zu ändern. Dann wird sie ganz dunkel, Tintenfische machen das, wenn sie den Boden verlassen.“
Laut Scheel ist es selten, dass sich die Oberfläche eines Oktopoden so schnell verfärbt. Normalerweise würden die Kraken diesen Tarnmodus überhaupt nicht benutzen, während sie schlafen. Im Traum war die Jagd also offenbar erfolgreich. „Das ist eine neue Tarnung. Ganz so, als hätte sie gerade eine Krabbe gefangen. Jetzt sitzt sie still da und frisst die Krabbe auf. Dabei will sie nicht, dass sie jemand bemerkt“, erläutert Scheel die Beobachtung. In Freiheit schlummern Oktopusse in versteckten Höhlen, dort kann der plötzliche Farbwechsel sie nicht verraten.13
Very tricky: Tintenfische täuschen Rivalen mit Farbtrick
Auch Tintenfischmänner schätzen es gar nicht, wenn ihnen beim Werben um die Angebetete ein Nebenbuhler den Schatz ausspannt. Um sich die Konkurrenz vom Leib zu halten, haben die Herren deshalb einen ganz besonderen Trick ersonnen: Auf der zum Nebenbuhler hingewandten Seite färben sie ihre Haut so, dass sie wie die braun-weiß-gefleckten Tintenfischfrauen aussehen. Auf der Seite, die ihre Auserwählte im Blickfeld hat, stellen sie hingegen ihre gestreifte Balztracht zur Schau. Das berichten australische Forscher, nachdem sie Sepia-Populationen über Jahre hinweg in verschiedenen Lebensräumen beobachtet haben.
Für ihre Studie hatten die Meeresbiologen um Column Brown von der Macquartie University in Sydney Tintenfische im Hafen der Stadt untersucht. Wie die Forscher berichten, wandten die Sepia-Männer ihre Flirtstrategie in rund 40 Prozent aller Fälle an, in denen sich eine Gruppe aus zwei Single-Männern und einer Frau zusammenfand. Auf der dem Rivalen zugekehrten Seite zeigte der werbende Mann dabei die gefleckte Hautmusterung einer Sepiafrau. Auf der, zur Dame zugewandten Seite nahm er dagegen die typische gestreifte Flirt-Färbung an. Sah sich der Tintenfisch aber zwei Damen und einem männlichen Rivalen gegenüber, nutzte er diese Strategie nicht. „Vielleicht ist das Männchen dann zu abgelenkt und hat Schwierigkeiten, sich auf eines der Weibchen zu konzentrieren“, mutmaßen die Wissenschaftler.
Dass Tintenfische ihre Hautfarbe verändern, um sich vor Fressfeinden oder ihrer Beute zu verstecken, ist nicht neu. Auch Farbspiele bei der Balz wurden bereits bei Riesentintenfischen beobachtet. Einige Kopffüßer passen während der Balz den hinteren Teil ihres Körpers der Umgebung an, um unsichtbar für Fressfeinde zu werden. „Unsere Studie zeigt jedoch zum ersten Mal, dass Tintenfische beide Geschlechter gleichzeitig bei der Balz nachahmen können“, schreiben Column Brown und seine Kollegen in ihrer Veröffentlichung.
Die raffinierte, nur in passenden Konstellationen eingesetzte Täuschungsstrategie zeigt, dass die geistige Entwicklung dieser Meerestiere weit fortgeschritten ist. Denn würden sie ihre Taktik immer anwenden, wenn eine Dame in der Nähe ist, könnten sie leicht enttarnt und angegriffen werden, wenn mehrere rivalisierende Männer um die Tintenfischfrau herum postiert sind. Schließlich wäre dann für einige der Konkurrenten der Blick frei auf die Seite mit der Balztracht. Damit das Farbenspiel überhaupt funktioniert, müssen sich die Männer zudem genau zwischen den Nebenbuhler und das Subjekt der Begierde positionieren.14
Das Fühlen und Denken des Tintenfischs
Schon lange ist bekannt, dass Tintenfische ihr Farbkleid ändern können, und sie machen das zweifellos als Ausdruck ihrer Stimmung. Wenn sie aufgeregt sind, bekommen sie einen roten Kopf, entspannte Individuen nehmen den Farbton des Untergrunds an. Der flirtende Tintenfisch vermittelt sein Interesse über besondere Muster und Farbwellen auf dem ganzen Körper. Der Biologe Martin Moynihan vom Smithsonian Institute in Washington beobachtet seit vielen Jahren Tintenfische. Er vermutet, dass Tintenfische bewusst Botschaften übermitteln, da er eine differenzierte Kommunikation zwischen den Kraken untereinander mittels komplexer Farbspiele festgestellt hatte, der eine Art Grammatik zugrunde liegt.
Der Kognitionsforscher Michael Kuba vom Konrad-Lorenz-Institut im österreichischen Altenberg ist besonders am emotionalen Verhalten der Tiere interessiert und hat herausgefunden, dass sie auch spielen. Um dies zu untersuchen, wurde das Aquarium eines Kraken abgeschottet, sonst würde die neugierige Krake vermutlich viel lieber an der Scheibe kleben und die Umgebung beobachten. Anschließend wurde ein Spielzeug, ein Würfel aus Legosteinen, in dem Bassin platziert. Sofort betastete und erkundete der Oktopus den Legostein. Ein erstaunliches Verhalten, denn freilebende Individuen wurden noch nie beim Spiel beobachtet. Offenbar aber, so die Erklärung des Wissenschaftlers, langweilt sich das blitzgescheite Tier im Glaskasten und beschäftigt sich in seiner Not eben mit diesem Objekt.15
Tintenfische lernen Regeln und erinnern sich daran
Das erstaunliche Lern- und Erinnerungsvermögen der Tintenfische haben Pauline Billard, Nicky Clayton und Christelle Jozet-Alves in einer neuen Studie untersucht. Sie untersuchten, ob Tintenfische sich merken können, ob sie ein Beutetier gesehen oder aber gerochen haben.
Zunächst lernten junge Gewöhnliche Tintenfische auf ein Schild zu reagieren, das zu ihnen ins Aquarium gestellt wurde. Näherten sie sich dem Schild, erhielten sie einen leckeren Imbiss. Dann wurde etwas Wasser ins Aquarium gegeben und ein Glaszylinder hineingestellt. Entweder enthielt der Zylinder einen Krebs und das Wasser keine weiteren Inhaltsstoffe („Sehen“) oder der Zylinder war leer, aber das Wasser enthielt Duftstoffe eines Krebses („Riechen“). In der dritten Variante war weder ein Krebs im Zylinder noch sein Duft im Wasser („Kontrolle“). Jeder Auswahl mussten die Tintenfische mit einem Schild verknüpfen, die im Aquarium platziert wurden: Eins war mit einem Kreuz markiert, eins mit einem Pfeil und eins trug gar kein Symbol. Sahen die Tiere den Krebs (Krebs im Zylinder), mussten sie für eine Belohnung zum Schild mit dem Kreuz schwimmen. Konnten sie den Krebs (Krebs-Duft im Wasser) riechen, mussten sie für eine Belohnung zum Schild mit dem Pfeil schwimmen. Wenn ein Krebs weder zu sehen noch zu riechen war (Kontrolle), dann gab es die Belohnung am Schild ohne Symbol. Alle Tintenfische lernten erfolgreich, zwischen diesen drei Bedingungen zu unterscheiden. Im Anschluss wurden die Schilder mit den Symbolen nicht mehr gleichzeitig mit dem zusätzlichen Wasser und dem Zylinder ins Aquarium eingebracht, sondern zeitverzögert. Zunächst betrug diese Verzögerung eine Stunde, in einem weiteren Durchlauf drei Stunden. Tatsächlich erinnerten sich die Tintenfische an die Bedeutung. Selbst nach drei Stunden wählten noch acht von neun Tieren das korrekte Symbol.
Nun wurde bei einem letzten Test untersucht, ob die Tintenfische die Regel „Sehen: Kreuz, Riechen: Pfeil“ auch auf eine andere Beute übertragen konnten, indem man das Spiel mit einer Garnele und Garnelengeruch wiederholte. Zunächst scheiterte die Hälfte der Tintenfische. Daraufhin trainierten die Wissenschaftlerinnen die Tintenfische anhand von drei verschiedenen Beutetieren zwischen den Bedingungen „Sehen“ und „Riechen“ zu unterscheiden: einem Krebs, einer Garnele und einem Fisch. Dann wurde den Tintenfischen etwas völlig Neues, nämlich eine Muschel, angeboten – entweder im Zylinder sichtbar oder als Duft im Wasser. Diesmal wurden die Hinweisschilder gleichzeitig mit der Muschel bzw. ihrem Duft präsentiert. Tatsächlich gelang den Tintenfischen diesmal der Transfer: wenn sie die Muschel sahen, schwammen sie zum Kreuz, wenn sie diese rochen, zum Pfeil. Sie hatten nun also die generelle Regel „Sehen: Kreuz, Riechen: Pfeil“ gelernt. Im letzten Schritt wurde auch noch der Test wiederholt, an dem die Tiere im ersten Experiment gescheitert waren: Die Kombination aus Transfer und Erinnerung. Wieder wurde ein völlig neues Beutetier präsentiert (eine Schnecke), und die Schilder wurden erst drei Stunden später ins Aquarium gestellt. Das Ergebnis: Alle Tiere schwammen zum Schild mit dem korrekten Symbol.16
Schaffe, schaffe, Häusle baue
Auch wirbellose Tiere gehören zum Club der schlauen Werkzeugnutzer. Julian Finn vom Museum von Victoria in Melbourne (Australien) und seine Kollegen entdeckten, dass im Meer vor Indonesien Tintenfische weggeworfene Schalen von Kokosnüssen sammeln, um sich daraus eine Schutzhütte zu bauen. Die Weichtiere stapeln dazu halbe Kokosnüsse wie Müslischalen auf dem Meeresboden und tragen sie dann weg. Damit demonstriert der Oktopus eine Leistung, die lange als einzigartige Fähigkeit von Menschen und anderen Primaten galt: Das Sammeln eines Werkzeugs, das nicht direkt, sondern erst in der Zukunft einmal von Nutzen sein könnte.
Der Ader-Oktopus ist bereits bekannt dafür, dass er die reichlich vorhandenen Nussschalen vor den indonesischen Inseln als Versteck nutzt. Die neue Erkenntnis ist, dass die Schalen für die spätere Nutzung, also vorausschauend, gesammelt werden.
Verbunden ist damit freilich auch, dass die Oktopoden überhaupt eine Vorstellung von der Zukunft haben, was unsere Artgenossen gern allen anderen Tieren absprechen. Die gesammelten Schalen sind nämlich erstmal nicht nur nutzlos, sondern eine echte Last für den Ader-Oktopus. Um sie von der Stelle zu bekommen, setzt er sich in die oberste Schale, lässt seine acht Arme seitlich herunter, versteift sie und geht schließlich unbeholfen wie auf Stelzen. Dabei ist der Tintenfisch nicht nur langsamer als gewöhnlich, sondern auch schutzlos und offen sichtbar. Soviel Mühen nimmt man gewöhnlich nur in Kauf, wenn man auch versteht, dass es sich in der Zukunft auszahlt. Bei Gefahr kann der Oktopus allerdings die Schalen schnell zusammensetzen und sich in der hohlen Kugel verstecken.17
Essen mit Plan
Wenn ein köstliches Abendessen in Aussicht steht, schlägt sich der Mensch eher nicht zuvor den Bauch mit Brot voll. Forscher um Pauline Billard von der University of Cambridge belegten nun in einer Studie, dass auch Tintenfische auf der Grundlage von Erfahrungen Erwartungen an die Zukunft hegen und sich darauf einstellen. Die cleveren Kopffüßer halten sich bei der Jagd nach eher faden Strandkrabben zurück, wenn sie wissen, dass es abends leckere Garnelen gibt. Die Forscher führten ihre Untersuchungen am Gewöhnlichen Tintenfisch Sepia officinalis durch. Auf dessen Speiseplan stehen verschiedene Meerestiere wie Fische, Krabben und Garnelen. Zunächst wurden die Geschmacksvorlieben der Kopffüßer ermittelt. Es zeigte sich, dass Tintenfische eine starke Vorliebe für Shrimps haben. Dann erfassten die Forscher, wie viele Krabben ihre Tintenfische normalerweise verspeisten, wenn es keine Shrimps gibt. Anschließend gewöhnten die Forscher sie an abendlichen Luxus: Stets zur gleichen Zeit gab es die leckeren Garnelen.
Wie die Auswertungen der Futtermengen ergaben, hatte dieses Angebot einen deutlichen Effekt auf den Verzehr von Krabben: Die Tintenfische aßen tagsüber deutlich weniger von den Strandkrabben als üblich. Sie fasteten für das abendliche Festgelage. Wenn sich die Tintenfische nicht darauf verlassen konnten, dass abends ein Festmahl auf sie wartete, aßen sie tagsüber wieder mehr Krebse. In nur wenigen Tagen erfassten sie, wie wahrscheinlich es ist, dass es am Abend Garnelen geben wird. Dabei handelt es sich um ein erstaunlich komplexes Verhalten, das nur durch raffinierte Hirnfunktionen möglich ist“, resümiert Pauline Billard.18
1,2,3... Tintenfische können zählen
Tintenfische können zählen und sie tun das ähnlich wie Menschen. Um herauszufinden, ob die Weichtiere so wie die intelligenten Primaten, Wölfe, Krähen und Tauben ein Verständnis von Zahlen haben, ließen Tsang-I Yang und Chuan-Chin Chiao von der Tsing Hua Universität in Taiwan Tintenfische der Art Sepia pharaonis zwischen zwei durchsichtigen Behältern mit einer unterschiedlichen Anzahl von Garnelen wählen. Die Tintenfische wählten in jedem Fall den Behälter, der mehr Krebstiere enthielt, und das unabhängig davon, wie groß der zahlenmäßige Unterschied der Beutetiere war. Selbst wenn das Verhältnis bei zwei zu drei oder vier zu fünf lag, erkannten die Tintenfische, in welchem Becken die höhere Anzahl an Beute wartete. Damit aber schneiden sie besser ab als menschliche Kleinkinder oder sogar Rhesusaffen, denn diese kommen bei vier versus fünf ins Straucheln, wie die Forscher berichten.
Wie Menschen erfassen Tintenfische bei bis zu fünf Beutetieren offenbar auf einen Blick, ob die Zahl größer oder kleiner ist. Bei mehr als fünf Garnelen zählen die Tintenfische dann in Ruhe nach und wählen schließlich - wen wundert´s? - die größere Anzahl. Je höher und näher beieinander die Zahlen lagen, desto länger benötigte der Tintenfisch, um seine Entscheidung zu treffen.
„Das spricht dafür, dass der Tintenfisch tatsächlich zählte und nicht die Mengen auf einen Blick erkannte“, sagen die Forscher. Damit entspricht sein Zahlensinn einem der beiden Mechanismen, mit dem wir Menschen Zahlen erkennen. Denn Mengen bis vier erfassen wir auf einen Blick, ohne die Objekte einzeln zählen zu müssen. Bei größeren Mengen dagegen müssen wir entweder zählen oder schätzen die Unterschiede nur grob ab – ähnlich scheint es bei den Tintenfischen zu sein.19
Persönlichkeiten mit Tagesform
Um zu testen, ob Kraken eine Persönlichkeit haben und individuell unterschiedliche Reaktionen auf ihre Umwelt zeigen, fing eine Forschergruppe um Renata Pronk von der Macquarie University im Hafen von Sydney Kraken ein und setzte diese in Aquarien. Dort führte man ihnen dann einen selbst gedrehten Film vor. Dieser zeigte eine Krabbe, ein Konservenglas und einen fremden Artgenossen.
Zunächst scheiterte das Experiment an den minderwertigen Filmaufnahmen, die man den Kraken anbot. Also fertigte Pronk neue Aufnahmen in HDTV-Auflösung. Nun konnten die Kraken in bester Filmqualität sehen, wie die Krabbe auf sie zu marschierte.
Die Reaktion folgte prompt. Oktopus eilte auf den Bildschirm zu und versuchte, die Krabbe zu fangen und zu essen. Um nun herauszufinden, ob die Tintenfische eine Persönlichkeit haben, spielten die Forscher den Film mehrmals an verschiedenen Tagen ab. Dabei stellte sich heraus, dass das Verhalten eines jeden Oktopus innerhalb eines Tages konstant blieb. Die einen reagierten voller Enthusiasmus, andere eher zurückhaltend. Über verschiedene Tage hinweg allerdings veränderte sich die Reaktion der Tintenfische: Zeigte sich ein Individuum anfangs sehr enthusiastisch, so blieb es am darauffolgenden Tag eher scheu. Pronk schloss daraus, dass die Individuen „episodische Persönlichkeiten“ haben. Kurzum: Tintenfisch sind launisch.20
Beherrsch Dich! Tintenfische bestehen den Marshmellow-test
Das aus der Humanpsychologie bekannte Marshmallow-Experiment soll die Fähigkeit zur Impulskontrolle ermitteln. Der Versuchsaufbau beruht auf einem Experiment, das Ende der 60er Jahre der Psychologe Walter Mischel mit seinem Team durchführte. Dabei wurde Menschenkindern ein Marshmallow hingelegt und in Aussicht gestellt, dass sie einen zweiten Marshmallow bekommen, wenn sie den ersten noch nicht essen. Erst ab einem Alter von etwa vier Jahren bringen die Menschenkinder diese Selbstbeherrschung auf und dabei lassen sich auch längst nicht alle Kinder auf diesen Belohnungsaufschub ein.
Auch Schimpansen, Raben und Papageien wurden mittlerweile auf diese Weise bereits erfolgreich getestet. Nun berichten Forscher der Universität Cambridge von einem Versuch, bei dem die Impulskontrolle von Tintenfischen auf die Probe gestellt wurde. Und tatsächlich: Tintenfische können das auch – zumindest für zwei Minuten.
Die Psychologin Alexandra Schnell von der Universität Cambridge und ihr Team stellten die in zweigeteilten Wasserbehältern sitzenden Tintenfische vor die Wahl: Entweder ein Weichtier, das sie nicht so gerne essen, sofort zu bekommen – oder ihre Lieblingsspeise später. Das Resultat: Die Tintenfische bewiesen durchaus Geduld und warteten 50 bis 130 Sekunden lang, um an den begehrten Leckerbissen zu kommen.
Bei der Studie mit den Tintenfischen wurde auch deren Lernfähigkeit erforscht. So wurden sie vor die Wahl gestellt, zu einer weißen oder grauen Boje zu schwimmen. Nur an einer der Bojen wartete eine Belohnung in Form einer Krabbe. Sobald ein Tintenfisch gelernt hatte, an welcher Boje es die Belohnung gibt, wurde das Belohnungssystem umgekehrt, so dass er nun zur Boje mit der anderen Farbe schwimmen musste. Die Tintenfische, die das am schnellsten lernten, warteten bei dem anderen Experiment auch am längsten auf die begehrte Belohnung. Offenbar gilt bei Tintenfischen: Je cleverer, umso beherrschter.21
Steine an den Krakenkopf: Oktopusfrauen bewerfen zielsicher lästige Stalker
Wenn Sie zu der Sorte Mann gehören, die ihre Frauen so verärgern, dass ihnen gelegentlich Schlappen um die Ohren fliegen, trösten Sie sich: Tintenfischmännern geht es da ähnlich.
Ein Forscherteam aus Australien, Kanada und den USA hat herausgefunden, dass Krakenfrauen manchmal Steine, Muscheln und Schlamm auf zudringliche Männer schleudern. Lange waren sich die Wissenschaftler nicht sicher, ob die Tintenfische Geröll und anderen Meeresboden-Kleinkram mit Absicht auf ihre Mitbürger schleudern oder sie eher zufällig treffen. Doch die Hinweise waren sehr stark, „dass Würfe in einigen Fällen auf andere Tintenfische gerichtet sind und bei der Steuerung sozialer Interaktionen, einschließlich sexueller Interaktionen, eine Rolle spielen.“
Manche Männer erahnen zwar, dass da gleich was auf sie zufliegt und ducken sich vor den Wurfgeschossen weg, aber oft landen die Damen trotzdem einen Volltreffer. Allerdings beobachteten die Wissenschaftler kein einziges Mal, dass ein Mann etwas zurückwarf. Immerhin pfefferten sie manchmal ins Leere, offensichtlich wollten sie so ihren Frust ablassen. In einem Fall schmetterte ein abgewiesener Gigolo eine Muschel kraftvoll und in eine zufällige Richtung, atmete schneller und wechselte die Farbe.
Wenn die Krakenfrauen beim Höhlengroßputz ausmisten, werfen sie mit viel weniger Kraft weg und nehmen nicht so harte Gegenstände wie bei der Abwehr missliebiger Verehrer. So beobachteten die Wissenschaftler eine zornige Dame, die einen zudringlichen Casanova gleich zehn Mal hintereinander bewarf. Sie traf fünf Mal. Einmal beobachteten die Forscher, wie eine Tintenfischfrau eine Muschel wie eine Frisbee wegschleuderte. Ein Volltreffer.22
Eine Sterbende nimmt Abschied
In ihrem preisgekrönten Buch Rendevous mit einem Oktopus erzählt die amerikanische Naturforscherin, Sachbuch- und Drehbuchautorin Sy Montgomery auf berührende Weise von ihren Begegnungen mit Tintenfischen. Darin beschreibt sie auch, wie eine sterbende Octopusdame von ihr Abschied nahm. Montgomery kannte die Octavia, die im New England Aquarium in Boston lebte, seit mehreren Jahren. Als sie für ihr Buch recherchierte, hatte sie Octavia unzählige Male gefüttert und mit ihr gespielt.
Doch nun lag Octavia im Sterben. Tierpfleger hatten sie vom großen Ausstellungsaquarium in ein ruhigeres und dunkles Becken verlegt, das einer Oktopus-Höhle ähnelte. In der Wildnis begeben sich Octopusse an solche Orte, wenn sich ihr Leben dem Ende zuneigt.
Ihre Freundin Sy Montgomery wollte sich von Octavia verabschieden. „Sie war krank, sie war alt und sie stand offensichtlich kurz vor dem Tod“, erzählt Montgomery. „Ich kam an ihr Becken und sie schwamm an die Oberfläche, um mich zu sehen. Und nicht, weil sie hungrig war - ich gab ihr einen Fisch und sie nahm ihn und ließ ihn fallen. Sie hatte die Anstrengung auf sich genommen, vom Grund des Beckens an die Oberfläche zu kommen, um mich zu sehen und mich zu berühren. Sie legte ihre Saugnäpfe um meinen Arm, sah mir ins Gesicht und hielt mich so minutenlang.“
Diese anrührende Begegnung geschah nach etwa zehn Monaten, in denen Octavia zurückgezogen in ihrer Octopus-Höhle gelebt und keinerlei Kontakt zu Montgomery gehabt hatte. Für ein Tier, das nur drei bis fünf Jahre lebt, sind 10 Monate wie Jahrzehnte, erläutert die Naturforscherin.
Kurz nach dieser Begegnung verstarb Octavia.23
SPINNEN UND KREBSTIERE
Wenn Spinnen ihre Kinder lieben
Weibliche Wolfsspinnen bewachen ihre Eier und tragen die ausgeschlüpften Kinder mit sich herum. Ob sie dabei nur simpler Mechanismus motiviert werden oder von einem Gefühl von Liebe und Fürsorgebereitschaft, ist freilich schwer zu erfassen.
Folgende traurige Geschichte könnte zu denken geben: Der Wissenschaftler J.T. Moggridge berichtet von einer Falldeckelspinne, die er seiner Sammlung zuführen und in Alkohol aufbewahren wollte. Er wusste, dass sich Spinnen noch eine ganze Zeitlang bewegen, nachdem man sie in Alkohol eingelegt hatte, hielt dies aber für eine reine Reflexhandlung.
Moggridge entfernte die kleinen Spinnen von der Mutter und ließ diese in ein Gefäß mit Alkohol fallen. Als er glaubte, dass sie gestorben war, schickte er die 24 Babyspinnen hinterher. Zu seinem Schrecken streckte die Mutter ihre Beine aus, zog die Kinder an ihre Seite und hielt sie umschlossen, bis sie wirklich tot war. Nach dieser Erfahrung gebrauchte der erschrockene Moggridge bei seiner morbiden Vorliebe Chloroform.
Ein unbewusster Reflex oder so etwas wie Mutterliebe? Vor dem Hintergrund, dass schon das Weben eines Spinnennetzes eine Leistung von außerordentlicher Komplexität darstellt, sind durchaus auch vielschichtige Gefühle bei einer Spinne vorstellbar. Spinnen verfügen auch über ein zentrales Nervensystem, das bis zu 15 Prozent der Körpermasse ausmachen kann – bei Menschen liegt dieser Wert bei etwa zwei Prozent. Die Spinne weiß wohl, was sie treibt. Wir wissen es nicht. Aber wir könnten es uns denken.24
Umgang prägt: Im Miteinander bilden Spinnen ihre Persönlichkeit aus
Schon länger ist bekannt, dass selbst einzelne Spinnen unterschiedliche Charakterzüge haben. Die Individuen in sozialen Verbänden hausenden Spinne Stegodyphus dumicola haben zum Beispiel dauerhaft und nicht situationsabhängig mehr oder weniger furchtsame Persönlichkeiten. Eine Forschergruppe um Andreas Modlmeier von der University of Pittsburgh ist nun der Frage nachgegangen, wie es zur Ausbildung solcher Charaktere in der Spinnengemeinschaft gekommen ist. Dazu werteten sie aus, wie lange einzelne Spinnen in einer Gruppe mit anderen zusammenlebten, und ermittelten zudem, ob diese Spinnen allmählich bei einem Beutefangversuch zu besonders mutigem oder ängstlichem Verhalten neigten oder schlicht durchschnittlich blieben. Tatsächlich zeigten sich immer deutlichere individuelle Unterschiede bei immer längerer Gruppenzugehörigkeit. Soziale Interaktion fördert also die Ausbildung von Persönlichkeit, so die Forscher.25
Das lass mal mich machen: Arbeitsteilung in der Spinnen-WG
Vertreter der Art Anelosimus studiosus gehören zu den sogenannten sozialen Spinnen. Sie leben in einer Art Wohngemeinschaft mit mehreren Artgenossen zusammen und halten dort strikte Arbeitsteilung ein. Dabei verteilen die Spinnenfrauen die anfallenden Arbeiten – wie Beute fangen, das Netz verteidigen oder sich um den Nachwuchs kümmern – nach ihren individuellen Neigungen und Vorlieben. Spinnen, die sich in Verhaltensexperimenten aggressiver gebärden, übernehmen dabei häufiger Aufgaben, für die ein forsches Auftreten nützlich sein kann. Wie die Biologen um Colin Wright von der University of Pittsburgh beobachtet haben, engagierten sich aggressive Spinnen dreimal so häufig bei der Jagd auf Beute und der Abwehr von Feinden wie ihre gutmütigen Mitbewohnerinnen. Diese hingegen kümmerten sich dreimal so oft um den Nachwuchs.
Und das macht Sinn: Während aggressive Spinnen angesichts eines Angreifers oder einer Beute nicht lange fackeln, ehe sie einen Angriff starten, verharren gutmütige Spinnenfrauen lange regungslos – bis es zu spät ist. Umgekehrt gehen die aggressiven Spinnen ziemlich rücksichtslos mit dem eigenen Nachwuchs um und töten ihn häufig, sollten sie sich doch einmal um ihn kümmern. So kommt es der gesamten Kolonie zugute, wenn jede Spinne eine Arbeit entsprechend ihrer Persönlichkeit wählt.26
Spinnengesellschaft ganz menschlich: Ein schlechter Führer ist der Untergang
Offenbar ist der Mensch nicht die einzige Art, die schlechter Führung zum Opfer fällt. Eine Forschergruppe um Jonathan Pruitt von der University of California in Santa Barbara hat herausgefunden, dass es sich unter Spinnen ganz ähnlich verhält.
Die Wissenschaftler lehrten zunächst einzelnen Spinnen, dass andauernde leichte Vibrationen ihres Netzes einen Motten-Happen versprachen, während kurze, heftige Ausschläge vor Ameisen warnten. Dann wurden die Spinnen in eine Kolonie untrainierter, furchtsamer Artgenossen gebracht. Nun ließen die Forscher das gemeinschaftliche Netz vibrieren und so lernten auch die anderen Individuen, die Signale richtig zu interpretieren. Bei manchen Kolonien vertauschten die Forscher dann die Signale. Erwartete die trainierte Spinne eine Motte, geriet sie beim Lospreschen an eine Ameise; versteckte sie sich vor dem Feind, entging ihr der Leckerbissen.
Wenn nun die Neue eine schüchterne Spinne war, ließ sich die Kolonie von deren Fehleinschätzungen nicht lange beeindrucken. Bei einer falsch gepolten Führungskraft jedoch geriet die ganze Gemeinschaft in Gefahr. Manche Kolonien verhungerten trotz reichhaltiger Nahrung, andere wurden immer wieder von Ameisen angegriffen. „Offenbar sind die Kolonien gegenüber ihren Anführern einigermaßen geduldig und lassen einige Fehler durchgehen“, meint Kate Laskowski vom Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, die Erfahrung mit der Erforschung sozialer Spinnen hat. „Schlüssel-Individuen verbreiten falsche Informationen sehr effektiv, aber korrekte kaum“, schließt Pruitt aus dem Experiment. „Das war überraschend, um es vorsichtig auszudrücken.“ Aber warum sollte es bei Spinnengemeinschaften eigentlich nicht menschlich zugehen?27
Schon geil – Spinnenmänner haben Spaß am Sex
Lange dachten Forscher, dass Spinnen-Männer beim Sex nichts fühlen können. Doch das Liebesspiel von Spinnen ist offenbar aufregender als bisher vermutet.
Ein deutsches Forscherteam aus Biologen der Universitäten Greifswald und Jena hat nämlich Nervenzellen in den Geschlechtsteilen der männlichen Tasmanischen Höhlenspinne Hickmania troglodytes nachgewiesen. Das männliche Geschlechtsorgan dieser Spezies ist also nicht bloß eine gefühllose Struktur, sondern vermutlich in der Lage, Sinneseindrücke während der Spermienübertragung zu übermitteln.
Mikroskop- und Röntgenaufnahmen sowie ein dreidimensionales Computer-Modell eines Pedipalpus zeigten zwei verschiedene Arten von Nervengewebe im Geschlechtsteil der Höhlenspinne: Einen Nerv, der bis zur Spitze des Organs läuft, und Ansammlungen von Neuronen in der Nähe einer Drüse, die für die Spermienübertragung zuständig ist.
Auf diese Weise erhielten die Spinnen während der Paarung möglicherweise Informationen darüber, wie fortpflanzungsfähig die Dame ist, so die Forscher. Die Herren könnten dann den Ausstoß ihres Ejakulats entsprechend anpassen. Aber Hauptsache, sie haben Spaß dabei.28
Überleben nach dem Sex – Ich reiß mir für Dich ein Bein aus
Spinnensex ist häuft eine todernste Angelegenheit, da das Vernaschen oft auch eine buchstäbliche Komponente hat. Dass Spinnendamen sich ihre Sexualpartner nach dem Sex häufiger final einverleiben, hat sich auch bei unseren ethologisch uninteressierten Zeitgenossen herumgesprochen.
Dass dies nicht im gegenseitigen Einvernehmen geschieht, mag nicht verwundern. So haben Spinnenmänner über die Zeit postsexuelle Überlebensstrategien entwickelt. So scheinen viele Männer der Westlichen Schwarzen Witwe gut abschätzen zu können, wie hungrig eine sexuell interessierte Spinnendame ist und halten sich bei den Ladys mit dem großen Appetit eher zurück. Dies setzt ein gehöriges Maß an Impulskontrolle voraus, denn eigentlich stehen die Herren vornehmlich auf größere, stärkere Spinnendamen.
Wie Forscher um den Verhaltensbiologen Nicholas DiRienzo der University of Arizona nun auch herausfanden, sorgen die Spinnenmänner zudem für wirkungsvolle Sicherheitsmaßnahmen. Sie zerstören vor dem Sex möglichst große Teile des Spinnennetzes der Angebeteten. Dieser Akt der Zerstörung scheint die Aggressivität der Dame einzudämmen. Außerdem erleichtert es die postkoitale Flucht des Mannes. Und weil dieser außerdem die zerstörten Netzteile zusammenknüllt, werden weniger Duftstoffe abgesondert. Schließlich will man die Konkurrenz ja nicht anlocken.29
Das Biologenteam hat noch ein weitere bizarre Sexualpraktik entdeckt: Männliche Goldene Büschelweberspinnen reißen sich beim Sex buchstäblich ein Bein aus, manchmal sogar mehrere Beine, und offerieren sie ihrer Partnerin zum Verschmausen. Bei den Damen kommt die Opfergabe offensichtlich sehr gut an. Wie die Forscher herausfanden, bevorzugten die Spinnendamen Beine von einem Vertreter ihrer eigenen Art gegenüber den Extremitäten von anderen Insekten oder Spinnentieren.30
Bondage kann Leben retten
Die Männer der in Israel beheimateten Laufspinnenart Thanatus fabricii haben einen anderen Trick entwickelt, um nach oder während der Paarung nicht von der Dame verspeist zu werden. Spinnenforscher um Lenka Sentenská von der University of Toronto in Scarborough haben beobachtet, dass die Spinnenmänner die Damen mit Spinnfäden fesseln.
Dabei gehen die Männer so schnell vor, dass die Forscher die Details erst erkannten, als sie den Spinnensex im Labor mit einer Hochgeschwindigkeitskamera aufzeichneten. Es offenbarten sich Szenen aus der Welt des BDSM. Zunächst greifen die Männer die Spinnendamen überfallsartig an und beißen ihnen dabei mehrfach in die Beine. Die überraschten Spannenfrauen ziehen daraufhin in Abwehrstellung die Beine unter den Leib. Dies nutzt nun der liebeshungrige Spinnenmann und fesselt den weiblichen Spinnenkörper mitsamt untergeschlagenen Beinen mit Spinnfäden. Dann kommt es zur Vereinigung mit der so fixierten Spinnendame, bevor sich der Dominus schließlich nach durchschnittlich 20 Minuten befriedigt und meist unversehrt entfernt.
Sentenská und Kollegen sind sich allerdings nicht sicher, ob diese Sexvariante tatsächlich ausschließlich zum Schutz des Mannes vor dem Tod im Damenmagen dient. Zwar wurden einige Fälle beobachtet, bei denen sich annähernde T.-fabricii-Männer von unwesentlich größeren Damen verspeist wurden. Allerdings könnten sich die gefesselten Frauen mit nur wenigen Rucken leicht von der Fesselung befreien, wenn sie wollten. Womöglich misst die Dame die Qualität des Paarungspartners an seinem Geschick beim Fesseln und Vorspiel. Denkbar sei auch, dass chemische Signalstoffe an den Spinnenfäden der Dame bei der Entscheidung helfen, wie lange sie dem Herren die Paarung gestattet. Vielleicht aber ist es einfach nur eine sexuelle Vorliebe ohne größerem Sinn dahinter.31
Spinnen denken kausal