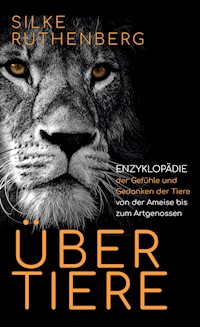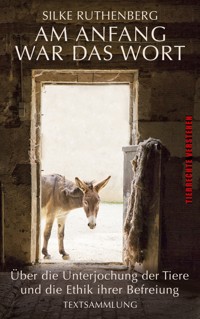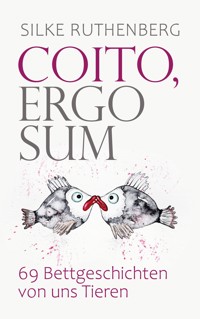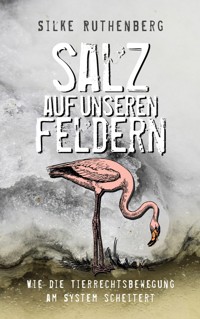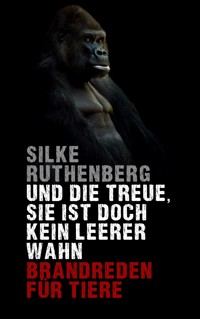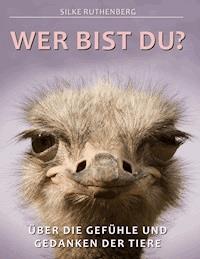
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Edtion Eliza
- Sprache: Deutsch
Über ein Jahrhundert hinweg wurde uns von der Wissenschaft die Vorstellung von Tieren als Reiz-Reaktions-Automaten vermittelt, die unbewusst, instinktgesteuert und ihren Trieben unterworfen durchs Leben laufen, fliegen, schwimmen. Nur ist dies alles einfach nicht wahr. Die moderne Verhaltensforschung hat in wenigen Jahren mit einer Flut an Erkenntnissen über das seelische und geistige Innenleben der anderen Tiere aufgedeckt, dass die sorgfältig konstruierte Grenze zwischen Menschen und allen anderen Tierarten ein Hirngespinst ist. Von der Muschel bis zum Menschenaffen verbindet uns alle eine gemeinsame Struktur, die uns durch das Leben leitet: die der Gefühle und Gedanken. Dieses Buch bringt auf Basis von über 350 Anekdoten und wissenschaftlichen Untersuchungen dafür eine Fülle an Belegen: Ameisen können zählen, Krabben berechnen Wege und Guppy kann lesen. Hühner führen inhaltliche Gespräche, Mäuse empfinden Mitleid und der Rhesusaffenmann schaut sich gerne Pin-ups an. Wir begegnen Seelenverwandten, in denen wir uns selbst wiedererkennen können. Das Fundament für ein neues Wir-Gefühl.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Man weiß, dass der indische Elefant zuweilen weint.
Charles Darwin
Mein Dank geht an alle, die mich zu und bei diesem Projekt inspirierten und ermunterten mit ihrer Meinung und ihrem Wort. Da ist zum Beispiel Aljoscha, mein Sohn, als er mit neun Jahren Ameisen beobachtete und es kommentierte mit den Worten: „Ich sehe genau, wer von denen die lieben Ameisen sind und wer einen schlechten Charakter hat.“ Da sind aber auch Kathrin, Otto, Marille, Reinhold, Sabine, Norbert, Roberta, Uwe, Gertrude und meine Eltern, deren Interesse mir Mut machte, das Projekt voranzutreiben und durch gelegentliche Schaffenkrisen hindurch half.
Dankbar bin ich auch all denen, die mich lehrten, dass Artzugehörigkeit nichts bedeutet, wenn es um tiefes Fühlen und um kluges Denken geht - vor allem die Katzen, Kaninchen und der Hund, mit denen ich zusammengelebt habe und noch lebe.
Insbesondere gilt mein großer Dank meiner Geist&Seelenschwester Nicole Huber, die mit Engelsgeduld sich immer wieder und ungezählte Tage durch die Fehlerberge in den Manuskripten durchgekämpft hat. Du bist unbezahlbar, auch deshalb widme ich Dir dieses Buch.
Die Autorin.
Silke Ruthenberg, geboren 1967 in München, studierte nach dem Abitur Politik und Rechtswissenschaften, bevor sie sich der neugegründeten Organisation ANIMAL PEACE anschloss und diese seit 1993 als Vorsitzende und mit spektakulären Aktionen für das Recht der Tiere zu internationalem Erfolg führte. „Lieber nackt als Pelzetragen“ ging um die Welt.
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit vertrat sie das Tierrecht in Talksendungen und Reportagen auf nahezu allen Kanälen. Der Spiegel porträtierte sie auf fünf Seiten, Joy übernahm sie in die Rubrik „Schön, reich, berühmt“. Sie erwarb sich den Ruf einer engagierten, glaubwürdigen und kompetenten Vertreterin des Tierrechts. Die „Jeanne d`Arc der Tiere“ erreichte sogar bei kritischen Medien Achtungserfolge.
Silke Ruthenberg ist Autorin mehrerer Bücher und zahlreicher Reportagen und Artikel zum Thema Tierrecht. Sie lebt mit Sohn und zwei fühlenden und denkenden Katzen in München.
INHALT
Vorwort
WEICHTIERE
Wenn sich die Muschel mies fühlt
Schnecken haben unterschiedliche Talente
Was merken sich Schnecken?
Aus den Augen, aus dem Sinn
Schaffe, schaffe, Häusle baue
Tintenfische: Die Denker der Meere
Very tricky: Tintenfische täuschen Rivalen mit Farbtrick
1,2,3... : Tintenfische können zählen
Tintenfische: Persönlichkeiten mit Tagesform
SPINNEN UND KREBSTIERE
Wenn Spinnen ihre Kinder lieben
Das lass mal mich machen: Arbeitsteilung in der Spinnen-WG
Umgang prägt: Im Miteinander bilden Spinnen ihre Persönlichkeit aus
Spinnengesellschaft ganz menschlich: Ein schlechter Führer ist der Untergang
Schon geil – Spinnenmänner haben Spaß am Sex
Spinnen denken kausal
Forscher entdecken den Schmerz bei Garnelen
Und auch den Krabben tut es weh
Schau mal meinen Dicken an
Suche: Sicherheit – Biete: Sex
Krabben bilden Bürgerwehren – aus reiner Berechnung
Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht etwas bessres findet
Winkerkrabben betreiben Schul-Trigonometrie – Sie berechnen Wege
Einsiedlerkrebse nutzen social networking
Mit Dir werd´ ich fertig: Einsiedlerkrebse wissen, wann sich zu kämpfen lohnt
Einsiedlerkrebse sind Charakterschädel
INSEKTEN
Der freie Wille der Fruchtfliegen
Fruchtfliegen beherrschen Selbstmedikation
Sie hat mich nicht rangelassen! Sexuell frustrierte Fliegen betrinken sich
Es ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt
Der (Alb)- Traum der Fliegen
Ich hab so Angst!
Fliegen planen ihre Flucht im Voraus
Kein Bock auf Sex? Die Migräne der Libelle
Überaus nachtragend: Schmetterlinge vergessen nicht
Mücken meiden Menschen, die nach ihnen schlagen
Kakerlaken haben Persönlichkeit
Schaben-Frauen stehen auf Softies
Es kommt nicht auf die Größe an – Bewusstsein und Intelligenz bei Insekten
Dich kenne ich schon! Gesichtsgedächtnis bei Wespen
Gute Laune, schlechte Laune –Hummeln haben Emotionen und Stimmungen
Bienen denken abstrakt
Hummeln – flexibel und zielorientiert
Wie mach´ ich das? Hummeln lösen Probleme
Bienen können zählen: Eins, zwei, drei, vier, viele
Sprachbarrieren: Kein Ding für Bienen
Rechenkünstler: Ameisen können zählen
Ameisen helfen ihren betrunkenen Stammeskollegen - aber nur denen
Ameisen lernen und lehren wechselseitig
Arbeitsscheu im Ameisenstaat
Die Landwirtschafter
Der Sklavenstaat der Ameisen
Born to be free: Ameisen-Sklaven rebellieren häufiger als gedacht
Da geht`s lang! - Ameisen stellen Wegweiser auf
Ich muss mal! Ameisen legen sanitäre Anlagen an
Auch Ameisen schlucken Medikamente
Disziplin, wenn ich bitten darf! Ameisen verstehen sich auf Selbstbeherrschung
Die beste Wahl – Ameisen sind kluge Werkzeugnutzer
110: Verwundete Ameisen rufen Rettungssanitäter
Wenn Mama Ohrwurm ausgeht, halten die Geschwister zusammen
FISCHE
Aua! Angelhaken schmerzen wie eine Augenverletzung
Die Angst des Goldfischs vor dem Schmerz
Napoleon des Meeres: Fische denken strategisch
Was steht denn da? Guppy kann lesen
Ganz menschlich: Im Alter sinken die Ansprüche
Gespräch unter Fischen: Barsche verstehen Muränen
Putzerfische sind gerissene Unternehmer
Schlitzohr im Schuppenkleid: Von Heiratsschwindlern und vorgetäuschten Orgasmen
Intelligenzbestien: Fische können sich mit Menschenkindern messen
Ach, Du bist das! Schützenfische erkennen Menschengesichter
Strenge Korallenfische: Wer beim Sex drängelt, fliegt raus!
You are so beautiful – Joe Cocker macht Haie scharf
Guppys sind treu und mutig
Erfolg macht feige Fische forsch
Schüchterne Stichlinge halten zusammen
Schwul ist cool
Lieber keinen Sex mit dem Grobian – Kärpflingsfauen bevorzugen die Loser
Schmausen mit Schutz
Komplex wie bei Delfinen: Das Sozialleben der Sandtigerhaie
Katzenhaie: Wie Teenies auf dem Schulhof
Fischfrauen lernen schneller als Männer
Von wegen Dreisekundengedächtnis: Fische können sich´s lange merken
Buntbarsche als Miethaie aufgeflogen
Das bin ja ich! Mantas erkennen sich im Spiegel
Seelenschmerzen: Fische können depressiv werden
Das hab ich doch gefurzt! Heringe sprechen mit dem Po
Schmus´ mich! Fische lieben Zärtlichkeiten
REPTILIEN UND AMPHIBIEN
Herr Frosch schweigt und genießt...
Schlange verliebt sich in Hamster
Klapperschlangen sind sozial veranlagt
Mit Plan: Schildkröten agieren systematisch
Owen und Mzee – Eine Liebe in Kenia
Die Eidechse – auch nur ein Nerd. Oder auch nicht
„Ich will doch nur spielen“... Reptilien mögen Jux und Tollerei
Komm, spiel mit mir, Kroko
Da geht´s lang: „Lehrer-Schildkröten“ weisen den Weg
Chamäleons Empfindsamkeit: Einsamkeit in der Kindheit beschädigt fürs Leben
Die Nachahmer: Bartagamen lernen von Kollegen
Moment mal! Da fehlt doch wer?! Über die Klugheit der Warane
Zwei Forscher entdecken den Verstand der Echsen
So groß, so dick! Alligatorenruf informiert über Körpergröße
Krokodile benutzen Werkzeuge
In Liebe und Dankbarkeit
VÖGEL
Straußeneltern – zu allem bereit
Hühner haben sich viel zu sagen
Hennen unterrichten ihre Küken
Hühner können vorausdenken
Hühner leiden mit
Gänse: Emotionale Intelligenzbestien
Gans traurig
Mary und John und die wahre Liebe
Liebe und Leben
Entenküken denken bereits abstrakt
Mit List und Gewalt: Vendetta bei Familie Kuckuck
Tauben: Kunstkenner mit Elefantengedächtnis
Hochbegabte Tauben: Im IQ-Test besser als Menschen
Brieftauben nehmen die Autobahn
Auch Tauben können Mathe und verstehen die Grundlagen von Einsteins Relativitätstheorie
Legasthenie Fehlanzeige – Tauben beherrschen Rechtschreibung
Tauben haben ein Gespür für Symmetrie – und erkennen Krebstumore
Kleptomane Möwen:
Muschelraub per Ententrick
Pinguin schwimmt 8000 Kilometer zu seinem Retter
Der trauernde Witwer
Die Brandstifter – Raubvögel legen gezielt Feuer
Not macht erfinderisch – Kakadus beim Werkzeugbasteln
Kakadus trommeln perfekten Beat
Zum Kaputtlachen – Keas amüsieren sich gern auf Kosten anderer
Ein indiskreter Papagei
Alles Nichts, oder?!
Beschaffungskriminalität: Indische Papageien stehen auf Schlafmohn
Namnam, wauwau, ticktack, dududu
Auch Vogeleltern zwitschern in Babysprache
Kohlmeisen zwitschern in ganzen Sätzen
Reisfinken unterscheiden Englisch und Chinesisch
Kleiber sind polyglott veranlagt
Stare verstehen Schachtelsätze
Angst und Lust – Wie man eine Frau rumkriegt
Haltet den Dieb
Kippen und Kräuter fürs Nest – Vögel schützen Nester vor Parasitenbefall
Auch Vögel richten sich nach dem Tempolimit
Beste Meteorologen – Vögel ahnen Tornados voraus
Ich habe Dir ein Haus gebaut – Jetzt darf ich aber auch ran
Ich reich die Scheidung ein – Auch treue Vögel können sich trennen
Machtfrauen ein Scheidungsgrund?
Gleichklang: Menschen und Vögel musizieren nach ähnlichen Prinzipien
Ein Star schreibt Musikgeschichte
Vogel singt wie Bach und Haydn komponierten
Spottdrosseln unterscheiden einzelne Menschen
Deine Schwingen sind altmodisch – Modediktat bei Trauerammern
Von wegen in den Tag hinein: Vögel planen im Voraus
Beziehungsschach bei Familie Rabe
Häher betrauern ihre Toten
Eichelhäher fühlen sich in die Liebste ein
Das verzeih ich Dir nie! Raben sind nachtragend
Schwarze Intelligenzbestien
Wie bei der Mafia: Diebische Krähen verschonen die Familie
Protestantische Krähen: Die hohe Kunst der Selbstbeherrschung
Die Krähen und das Mädchen
Spieglein, Spieglein ...
SÄUGETIERE
Großes Herz bei kleinen Tieren
Singende Mäuse können Melodien lernen
Ratten können die Folgen ihres Handelns voraussehen
Ratten erkennen den Schmerz im Gesichtsausdruck
Ratten begreifen Regeln
Der edle Samariter Ratten helfen selbst Fremden
Killekille – Ratten sind kitzlig
Auch Ratten träumen von der Zukunft
Das tut mir leid! Ratten können Reue empfinden
Auch Ratten helfen aus Mitleid
Liebe macht Meerschweinchen dumm aber glücklich
Der Frust des Hörnchens
Eichhörnchen arbeiten mit gezielten Täuschungsmanövern
Vampirfledermäuse: Echt nett zum Nachbarn
Fledermäuse belauschen sich beim Essen
Fledermäuse erkennen ihre Kumpel an der Stimme
Fledermäuse fragen sich zum nächsten Schlafplatz durch
„Und jetzt pressen. Pressen!“ Fledermaushebamme steht Gebärenden zur Seite
Flughunde sprechen Dialekte und werden persönlich
Mama ist schuld – Und die Geschwister sowieso
Dory, die Lebensretterin
Und noch eine Lebensretterin: Kaninchen „Rabbit“ bewahrt ihre Familie vor verheerendem Feuer
Ein unvergleichlicher Schafskopf
Schafe erkennen unsere Gesichter
Schafe können abstrakt denken
Die schlauen Schafe von Yorkshire
Selbstmedikation: Schlaue Schafe essen sich selbst gesund
Ziegen schätzen geistige Herausforderungen
Ziegen erinnern sich an komplizierte Tricks
Ziegen meckern Dialekt
Mein Kind hat gerufen
Mehr als nur Muh
Mutterliebe
Die Rache der Rinder
Die Freiheit führt das Rind
Auch Giraffen trauern um ihre Lieben
Pferde können über Symbole kommunizieren
Mach mal, ich hab Dir das Zeichen gegeben! Pferde bitten Menschen gezielt um Hilfe
Pferde erkennen unseren Gesichtsausdruck
Pferde: Gram steht ins Gesicht geschrieben
Lebensretter Schwein
Ehrenrettung für das Schwein
Optimisten und Pessimisten – Auch Schweine haben Charakter
Das empathische Schwein
Das bin ja Ich! Schweine erkennen sich im Spiegel
Frei Schnauze: Malendes Schwein verdient mit Kunstwerken Vermögen
Pekaris beim Trauern gefilmt
Ich bin dann mal weg – Hirsche meiden Jäger mit dem Alter geschickter
Trunksucht bei Familie Elch. Skål
Gute und schlechte Mütter gibt es auch bei Robben
Zu faul zum Selberfangen: Sammy, die Schnorrer-Robbe
Seelöwe rettet Selbstmörder
Gestatten: Otter, Werkzeugmeister
Die Trauer der Wölfe
Wenn Wölfe heulen
Der Wolf, ein Musterschüler
Talentierter Bär bekommt in Helsinki eigene Ausstellung
Der Feind meines Feindes ist mein Freund
Hatschi heißt ja
Wildhunde entscheiden demokratisch
Hunde erkennen menschliches Lächeln
Dackelblick ist bewusste Manipulation
Mein Mensch!
Hunde verfügen über ein „episodisches Gedächtnis“.
Ziemlich beste Freunde
Eins, zwei oder drei?
Die Teamplayer
Hyänengekicher verrät Persönliches
Mama ist die beste Lehrerin
Erdmännchen erkennen Stimmen
Erdmännchen sind gute und einfühlsame Pädagogen
Erdmännchen stehen gemeinsam auf
Mangusten integrieren Flüchtlinge behutsam und fürsorglich
Warzenschweine und Mangusten traut vereint
Eine Liebe in Indien
Gender Mainsteam in der Savanne
Von wegen Bestien: Geschichten von Moral und Mitgefühl bei Raubtieren
Die Schuldgefühle einer Mutter
...
und noch mehr moralische Löwen
Historische Tötungsverweigerer
Amur und Timur – Tiger und Ziege befreunden sich
Die Rache des Tigers
Der Blick in die Zukunft
Elefanten trösten sich gegenseitig
Eine hilfsbereite Mutter
Elefanten erkennen Menschen an der Stimme
Der Elefant vergisst nie
Elefanten befreien Antilopen
Verletzte Elefanten wissen, wo ihnen geholfen wird
Wale können wie Menschen sprechen
Belugaafrau lernt Fremdsprache: Sie spricht Delfinisch
Vom Ende des Privateigentums – Orcas auf Enteignungstour
Pottwale adoptieren verkrüppelten Delfin
Delfine vergessen die Namen ihrer Freunde nie
Cliquen und Alianzen bei Delfinen
Mausmakis sind schlauer als gedacht
Ich sehe was, was Du nicht siehst
Lemuren unterscheiden andere Lemuren am Gesichtsfarbmuster
Geschmäcker sind verschieden
Kinderstube und nicht Intelligenz – Über die Ausbildung des Altruismus
Und wer hat´s erfunden? Der Faustkeil und die Kapuzineraffen
Auch Affen mögen Nachäffer
Glücklicher, wenn die Familie versorgt ist
Küss die Hand – Kulturelle Rituale bei Kapuzineraffen
Besser als Josef Ackermann – Affen sind echte Finanzexperten
Kapuzineraffen sind auch nur Börsenzocker
Totenkopfäffchen bilden soziale Netzwerke
Kapuzineraffen pfeifen auf teure Marken
Echt fair: Affen haben einen Sinn für Gerechtigkeit
Ich bin Rhesus
Auch nur Spanner: Affenmänner mögen Pin-ups
Massengeschmack: Meerkatzen essen wie die anderen
Meerkatzen revolutionieren Sprachtheorien
Cherchez la femme
Teile und herrsche
Ich kann Euch nicht mehr sehen
Affenmänner müssen für Sex bezahlen
Makaken haben auch ihre Ndrangeta
Der heimliche Liebhaber
Berberaffen: Im Alter wählerischer
Paviane setzen auf sexuelle Nötigung
Von Liebe und Rache der Paviane
Paviane können lesen lernen
Paviane mit schwerer Kindheit sterben früher
Liebe über Artgrenzen hinweg
Paviane halten sich Hunde und Katzen – Oder umgekehrt
Paviane bilden Männerbünde
Alle Spielarten des Zusammenlebens: Feministinnen und Machos unter Pavianen
Gibbons: Eine Stimme wie professionelle Opernsänger
Gefolterte Orang-Utan-Frau dankt ihren Rettern
Servietten, Handschuhe, Kissen – Vom kulturellen Leben der Orang Utans
Orang-Utans teilen geplante Reiseroute mit
Kokos große Liebe
In flagranti
Berggorillas entschärfen Buschfallen
Der beste Mensch
Hasch mich!
Die Apotheke der Gorillas
Schimpansenmädchen spielen lieber mit Puppen
Gläubige (oder abergläubische) Schimpansen bei Religionsausübung beobachtet
Schimpansen bei Totenreinigung gefilmt
Gedächtniskünstler: Schimpanse schlägt Menschen in Gedächtnistests
Gibs ihm! – Schimpansen wollen Ungerechtigkeit bestraft sehen
Attacke! Mit Steinen gegen Zoobesucher
Schimpansen lernen „Schnick, Schnack, Schnuck“
Der Schimpanse. Ein Künstler
Lucys Lust
Liebe geht durch den Magen
Kopfschütteln heißt auch bei Bonobos „Nein“.
Rüpel bevorzugt: Bonobos mögen rücksichtslose Egomanen
Genetik: Schimpansen sind Menschen – oder umgekehrt
Eine Familie: Menschen können sich mit anderen Menschenaffen erfolgreich paaren
Menschen: Mehr Mitleid mit Hunden als mit Artgenossen
Menschen:
Auf Befehl fallen alle Hemmungen
Menschen verhalten sich rollengerecht bis zur Selbstaufgabe
Bonobo-Sex erregt Menschenfrauen
Quellen:
VORWORT
Fast einhundert Jahre lang und damit nahezu über die gesamte Geschichte der Verhaltensbiologie hinweg wurde diese von einem Wissenschaftskonzept dominiert, das man mit Fug und Recht als erkenntnisunterdrückend bezeichnen kann: Der Behaviorismus.
Dieses wissenschaftstheoretische Konzept untersucht und erklärt das Verhalten von Tieren mit naturwissenschaftlichen Methoden ohne jegliche Introspektion oder Einfühlung. Begründet durch John B. Watson zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Behaviorismus in den 1950er Jahren vor allem durch Burrhus Frederic Skinner und Iwan Petrowitsch Pawlow populär. Generationen von Schülern sind seither mit einer Vorstellung vom Tier als „Black Box“ und Begriffen wie Reiz-Reaktions-Kette und Konditionierung aufgewachsen, die ihr Bild von Tieren geprägt hat. Das wissenschaftliche Dogma über viele Jahrzehnte lautete: Alles, was wir bei Tieren als Gefühle und Gedanken wahrnehmen, sei nichts anderes als Reflex, Reaktion, Instinkt und habe mit den höheren geistigen Leistungen des Menschen nichts zu tun. Ein Innenleben wird geleugnet, weil man es streng empirisch auch nicht beweisen kann.
Die interessanten Fragen zum Leben der Tiere hat der Behaviorismus weder gestellt noch beantwortet. Er hat uns das Tier als Ding vermittelt und bildete damit den ideologischen Unterbau für die selbstverständliche Ausbeutung der Tierheit durch eine einzige Gattung. Immerhin ist die Leugnung des seelischen Innenlebens der Tiere die ideologische Wurzel ihrer systematischen Unterdrückung und Ausnutzung bis zum Tode. Alle menschlichen Kulturen leben auf den Knochen der anderen Tierarten und verweigern allen anderen Tieren alle Rechte, die sie für sich selbstverständlich in Anspruch nehmen. Dies widerspricht freilich unserem angeborenen Konzept von Gerechtigkeit grundlegend und funktioniert deshalb nur mit der großen Lüge von der Gefühls- und Gedankenlosigkeit der Opfer.
Jahrzehntelang waren die Verfechter des Behaviorismus die einflussreichsten Verhaltensforscher an den Universitäten. In der Einflusssphäre dieser Ideologie konnte die seit den 1930er Jahren in Europa aus der Tierpsychologie entstandene vergleichende Verhaltensforschung keinen Fuß fassen.
Doch Wahrheiten lassen sich nicht auf Dauer unterdrücken. In den vergangenen Jahrzehnten verlor der Behaviorismus zunehmend an Einfluss und man begegnete den Tieren mit einer neuen Einstellung. Dieser Wandel hat bereits bis heute eine überwältigende und nicht endende Flut an Einblicken in das geistige und seelische Innenleben der anderen Tiere erbracht, die man zweifelsohne als die dritte große narzisstische Kränkung der Menschheit bezeichnen kann - nach der Erkenntnis, dass wir weder der Mittelpunkt der Welt sind (Kopernikus) noch „Herr im eigenen Haus“ (Freud).
Es mag manche Exemplare der eitelsten Spezies des bekannten Universums zutiefst beleidigen, aber es ist einfach nicht mehr zu leugnen: Die sorgfältig konstruierte Grenze zwischen Menschen und allen anderen Tierarten ist kein tiefer Graben. Marienkäfer und Meisen, Mäuse und Menschen stehen sich mit ihrem Innenleben ganz nah. Uns verbindet eine gemeinsame Struktur, die uns alle durch das Leben leitet: die der Gefühle und Gedanken. Unaufhaltsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass Tiere in ihren Empfindungen überaus menschlich sind. Mehr und mehr Forscher wagen es, darüber zu berichten, und sie müssen mittlerweile auch nicht mehr fürchten, als Wissenschaftler erledigt zu sein, wenn sie nicht mehr rigoros leugnen, was so offensichtlich ist. Sie erzählen uns Anekdoten aus der Welt der Tiere, die uns unsere nahen und fernen Verwandten unendlich vertraut werden lassen. Seriöse Meldungen über die geistigen und emotionalen Fähigkeiten der Tiere füllen seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten die Wissenschaftsseiten der Zeitungen und bieten die Grundlage für Einsichten in die Tierwelt, die noch vor kurzem als völlig unwissenschaftlich und sentimental unterdrückt worden wären. Bücher zum Thema schaffen es in die Bestsellerlisten.
Tiere lieben und hassen, sie können traurig sein, Mitleid empfinden, sie können wütend sein und rachsüchtig, hilfsbereit und freundschaftlich. Sie haben einen Schönheitssinn und bringen begabte Künstler hervor. Tiere können wahrnehmen, bewerten, entscheiden und handeln. Sie wissen, was sie tun. Sie denken. Und ihre Verstandesleistungen übertreffen die unseren teilweise um Längen.
Ausgerechnet die Wissenschaft hat dem Tierschutz und insbesondere der Tierrechtsbewegung ein argumentatives Fundament geliefert, das kraftvoller kaum sein könnte. Umso verwunderlicher, dass die Fürsprecher der Tiere auf diesen Schatz bisher kaum zurückgreifen und es vorziehen, die Tiere als Opfer zu präsentieren und ihre Mitmenschen mit Realitäten zu traktieren, die jeden mitfühlenden Menschen hilflos und erschüttert und mit nichts Besserem als dem schlechten Gefühl seiner eigenen Schuld zurücklassen, das zur Verdrängung geradezu ermuntert: Die realen Folgen für die rechtlosen – entrechteten – Tiere in der Gewalt des ausnutzenden Menschen, eine Welt von Entwürdigung und Quälerei, von Gefangenschaft und Folter und blutiger Vernichtung. Milliardenfach. Wer sich damit nicht das Leben vergällen will, wendet den Blick ab - und damit auch den Blick von den Tieren.
Dabei ist das menschenverursachte Leid und Elend der Tiere infolge ihrer Rechtlosigkeit nicht unbedingt das stärkste Argument dafür, den Tieren ihre Rechte zurückzugeben, die ihnen nur durch die Macht des Tyrannen vorenthalten werden. Das stärkere Argument liegt in ihrem Sein begründet. Sie selbst in ihrer Schönheit, ihrer Sensibilität und Klugheit sind es wert, den gleichen Schutz zu erfahren wie wir ihn für uns selbst in Anspruch nehmen.
Viel zu wenig wurde die Kraft, die in den Tieren selbst liegt, gewürdigt und ins Zentrum der Aufmerksamkeit gestellt, um sie aus ihrem Opfersein herauszuholen. Dabei ist die Wertschätzung seit jeher der beste Schutz vor Gewalt gewesen. Kulturen, die Tiere zu Göttern erklärten, ihnen einen heiligen Status zusprachen, waren die besseren für sie. Heute braucht es dafür keine Religion mehr. Die Wissenschaft hat dafür 1000 Gründe geliefert, den Tieren mit Respekt zu begegnen – im allgemeinen Bewusstsein sind sie jedoch noch nicht wirklich angekommen.
Ich habe deshalb bewegende Geschichten und wissenschaftliche Erkenntnisse über das Fühlen und Denken der Tiere zusammengetragen. Sie eröffnen uns die Welt der Gefühle und Gedanken, die uns selbst so vertraut sind. Dieses Wissen schafft - so hoffe ich - ein neues Wir-Gefühl, das die Artschranke durchbricht. Die gesammelten Informationen bilden dabei nur einen winzigen Ausschnitt dessen, was uns die Tiere tagtäglich über sich erzählen, aber sie sind bezeichnend. Und sie lassen ein Gefühl von Vertrautheit entstehen, der Gewalt und Missbrauch entgegenstehen.
Werden wir weiterhin nicht hören wollen und die Welt der Tiere mit Folter, Tyrannei und Tod überziehen, wenn wir erkennen, wen wir da vor uns haben, wen wir hier misshandeln und vernichten? Vielleicht lassen uns diese Einblicke in das Innenleben der Tiere das Ausmaß der Schuld viel stärker spüren, die wir auf uns laden, wenn wir den Tieren nicht mit Respekt begegnen, sondern mit Dünkel und Gewalt. Und damit auch den Wunsch wachsen, diesem destruktiven Wahnsinn ein Ende zu setzen. Soviel ist sicher: Der Weg der Befreiung der Tiere aus der Tyrannei des Menschen führt über das Verstehen ihrer Gefühle und Gedanken.
Und damit hat dies Buch einen anderen Anspruch als andere Bücher mit ähnlichem Inhalt, die schlicht mit diesem neuen Wissen unterhalten möchten und sich teilweise auf geradezu groteske Weise vor den moralischen Folgen dieser Erkenntnisse drücken. Voll allem aber stehen die Tiere im Mittelpunkt und nicht die Fähigkeiten. Letztere sind nur Vehikel, unsere nahen und fernen Verwandten vertraut werden zu lassen.
Fakt ist: Mit dem gesicherten Wissen über unsere nahen und ferneren Verwandten können wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Dieses Wissen verpflichtet. Deshalb verbinde ich dieses Buch mit einer Forderung: Wer fühlen und denken kann, hat auch ein Grundrecht auf sein Leben und einen Anspruch auf eine selbstbestimmte und unversehrte Existenz. Elementare Menschenrechte über Artgrenzen hinweg stehen auch den anderen Tieren zu.
Ich wünsche viel Freude beim Kennenlernen der Familie!
Silke Ruthenberg
WEICHTIERE
Wenn sich die Muschel mies fühlt
Muscheln leben noch, wenn sie im heißen Buttersud geschwenkt oder mit Zitronensaft beträufelt aus der Schale geschlürft werden. Aber fühlt die Muschel dabei auch, was ihr geschieht?
Muscheln zählen zum Stamm der Weichtiere. Sie verfügen über ein einfaches Nervensystem, das zwei Nervenzellhäufungen besitzt: das Pedal-und das Viszeralganglion, eine Art Muschelgehirn. Es gibt einige Indizien, dass Muscheln und andere Tiere mit diesem einfachen zentralen Nervensystem bereits leidensfähig sind.
1993 hat eine italienische Arbeitsgruppe um G.B. Stefano erforscht, dass viele Körperbereiche der Miesmuschel Mytilus edulis hormonartige, schmerzlindernde Stoffe erkennen. Ist die Muschel gestresst, so findet man in ihr wenige freie Anti-Stress-Moleküle. Ist sie hingegen entspannt, so steigt der Spiegel dieser Substanzen.
Die untersuchten Stoffe sind nicht irgendwelche Substanzen, sondern sogenannte Endorphine. Sie stammen aus derselben Chemikaliengruppe wie die Schmerzstiller Heroin und Morphium. Der menschliche Körper verfügt über ähnliche Stoffe, die er bei Stress und Schmerz zur Linderung ausschüttet. Stefano und Mitarbeiter haben in den vergangenen Jahren immer mehr Hinweise darauf gefunden, dass sich Muschel und Mensch in hormoneller Hinsicht teilweise ähneln. „Kurz gesagt“, schreiben die Nervenforscher, „zeigen unsere Versuche, dass Morphin auf Zellen eines wirbellosen Tieres (dieselben Auswirkungen) hat wie auf Menschen, obwohl sich beide seit 500 Millionen Jahren auf verschiedenen Zweigen der Evolution weiterentwickeln“. 1
Und da Hormone messbare Spuren von Gefühlen sind, könnte man jetzt den Umkehrschluss wagen: wo Hormone zu messen sind, existieren auch Gefühle. Rezeptoren auf der Schale signalisieren zudem der Muschel Gewaltanwendungen an der Schale. Die Muschel reagiert daraufhin mit extremer Ausschüttung von Stresshormonen. 2
Man hat außerdem festgestellt, dass sich die Herzfrequenz bei Muscheln erhöht, wenn sie von Fressfeinden bedroht werden. 3 Einige Muscheln besitzen auch Augen. Es ist naheliegend, dass ein Lebewesen mit Augen über eine Empfindung des Sehens verfügt. 4
Muscheln können sogar von einer Gefahrenquelle „weglaufen“, auf Youtube kann man beobachten, wie eine Muschel ihren Fuß aus der Schale schiebt, um sich von für sie gefährlichem, austrocknendem Salz wegzubewegen. 5 Womöglich ist es Miesmuscheln und Austern also ganz und gar nicht egal, wenn sie verputzt werden.
Schnecken haben unterschiedliche Talente
Spitzschlammschnecken (Lymnaea stagnalis) haben beim Lernen ganz unterschiedliche Begabungen, fand ein Forschungsteam um Sarah Dalesman von der Aberysthwyth University heraus. Gedächtnisexperimente der Forscher aus England und Wales zeigten, dass sich einzelne Schnecken entweder gut an Informationen über Nahrung oder aber an Dinge rund um ihre Fressfeinde erinnerten – nicht aber an beides gleichzeitig. Die Arbeitsgruppe unterzog die Schnecken einem Trainingsprogramm, in dem sie lernen sollten, dass zum Beispiel Futter mit Karottenduft bitter schmeckt oder dass sie an der Wasseroberfläche mit Stöckchen gepikst werden, was auf einen Fressfeind hindeutete.
Dabei zeigte sich, dass Schnecken, die einen Typ von Aufgabe gut lernten, sich bei dem anderen ausnehmend unbegabt anstellten. Individualisten sind sie also auch noch. 6
Was merken sich Schnecken?
Schnecken gelten nicht unbedingt als Intelligenzbestien, aber ihre Gedächtnisleistung reicht immerhin aus, dem österreichischen Neurobiologen Eric Kandel im Jahr 2000 den Nobelpreis einzubringen.
Als dieser die Mechanismen von Lernen und Gedächtnis ausgerechnet an der Meeresschnecke Aplysia erforschen wollte, zweifelten Kandels Kollegen am Verstand des Wissenschaftlers. Die, auch als Seehase bekannte, bis zu 16 kg schwere Schnecke hat gerade mal 20.000 Nervenzellen, wo beim Menschen 100.000 sitzen. Ihre Neuronen sind aber teilweise so dick, dass man sie mit bloßem Auge erkennen kann. Unter dem Mikroskop kann man gut beobachten, wie Erlerntes seine Spuren hinterlässt.
Aplysia besitzt bereits ein Kurz- und ein Langzeitgedächtnis. Erhält sie nur eine Trainingseinheit, vergisst sie das Erlernte bereits nach einer Viertelstunde. Büffelt Aplysia jedoch über vier Tage, auf einen bestimmten Reiz hin ihren Sipho einzuziehen, dann bleibt die Erinnerung wochenlang gespeichert. Auch das Umfeld hat Auswirkungen auf den Intellekt der Schnecke: Langeweile macht den Seehasen dumm, eine anregende Umgebung hingegen treibt den Schnecken-IQ nach oben. 7
Im Internet findet man auch anrührende Videos von schmusenden Schnecken. Hier kann man mit eigenen Augen beobachten, dass auch Schnecken echte Genießer sind und dem Lustprinzip folgen.
https://www.youtube.com/watch?v=0UT6rmrr9a4
http://www.t-online.de/tv/webclips/lustige-videos/id_71686686/schnecke-geniesst-streicheleinheit-in-vollen-zuegen.html
Aus den Augen, aus dem Sinn
Kraken gehören nicht zu den Wirbeltieren, aber sie sind alles andere als dumm oder gefühllos. Wie überaus menschlich ihr Gefühlsleben ist, bewies ein Krake den Wissenschaftlern der Meeresstation von Banuyls:
Der Arme hatte sich schon dreimal die Zähne an einem Einsiedlerkrebs ausgebissen. Der Krebs war einfach zu kräftig: Bei Gefahr zog er sich in sein Schneckenhaus zurück und schirmte den Eingang mit den gepanzerten Scheren ab. Er war nicht herauszubekommen. Jedes Mal musste der Oktopus das Gehäuse wieder freigeben und unverrichteter Dinge abziehen.
Der Einsiedlerkrebs dagegen war nach kurzer Zeit wieder munter und spazierte erneut provozierend am Höhleneingang des Oktopus vorbei. Der konnte nicht widerstehen, und das Spiel wiederholte sich. Doch irgendwann war die Geduld des Kraken erschöpft. Er schleppte kurzerhand einen großen Stein heran und platzierte ihn als Sichtschutz zwischen sich und die Lockspeise. Diese Tantalusqualen musste er sich nun wirklich nicht länger antun. Oktopus hatte seine innere Ruhe wiedergefunden. 8
Schaffe, schaffe, Häusle baue
Auch wirbellose Tiere gehören zum Club der schlauen Werkzeugnutzer: im Meer vor Indonesien sammeln Tintenfische weggeworfene Kokosnussschalen, um sich daraus eine Schutzhütte zu bauen. Die Weichtiere stapeln dazu Kokosnussschalenhälften wie Müslischalen auf dem Meeresboden und tragen sie weg, berichten Julian Finn vom Museum von Victoria in Melbourne (Australien) und seine Kollegen. Damit demonstriert der Oktopus eine Leistung, die lange als Privileg von Menschen und anderen Primaten galt: Das Sammeln eines Werkzeugs, das nicht direkt, sondern erst in der Zukunft einmal von Nutzen sein könnte.
Der Ader-Oktopus ist bereits bekannt dafür, dass er die reichlich vorhandenen Nussschalen vor den indonesischen Inseln als Versteck nutzt. Die neue Erkenntnis ist, dass die Tiere die Schalen für die spätere Nutzung sammeln, sich also vorausschauend verhalten. Damit verbunden ist freilich damit auch eine Vorstellung von der Zukunft.
Die gesammelten Schalen sind nämlich erstmal nicht nur nutzlos, sondern eine echte Last für den Ader-Oktopus. Um sie von der Stelle zu bekommen, setzt sich das Tier in die oberste Schale, lässt seine acht Arme seitlich herunter, versteift sie und geht schließlich unbeholfen wie auf Stelzen. Dabei ist der Tintenfisch nicht nur langsamer als gewöhnlich, sondern auch schutzlos und offen sichtbar. Bei Gefahr kann der Oktopus allerdings die Schalen schnell zusammensetzen und sich in der hohlen Kugel verstecken. 9
Tintenfische: Die Denker der Meere
Der Biologe Martin Moynihan vom Smithsonian Institute beobachtet seit vielen Jahren Tintenfische. Schon lange ist bekannt, dass Tintenfische ihr Farbkleid ändern können, und sie machen das zweifellos als Ausdruck ihrer Stimmung. Wenn sie aufgeregt sind, bekommen sie einen roten Kopf, entspannte Tiere nehmen den Farbton des Untergrunds an. Der flirtende Tintenfisch vermittelt sein Interesse über besondere Muster und Farbwellen auf dem ganzen Körper.
Moynihan äußert den zwingenden Verdacht, dass Tintenfische bewusst Botschaften übermitteln. Er hat eine differenzierte Kommunikation zwischen den Tieren untereinander mittels komplexer Farbspiele festgestellt, der eine Art Grammatik zugrunde liegt.
Der Kognitionsforscher Michael Kuba vom Konrad-Lorenz-Institut im österreichischen Altenberg ist besonders am emotionalen Verhalten der Tiere interessiert und hat herausgefunden, dass sie auch spielen. Um dies zu untersuchen, wurde das Aquarium eines Kraken abgeschottet, sonst würde die neugierige Krake vermutlich viel lieber an der Scheibe kleben und die Umgebung beobachten. Anschließend wurde ein Spielzeug, ein Würfel aus Legosteinen, in dem Bassin platziert. Sofort betastete und erkundete der Oktopus den Legostein. Ein erstaunliches Verhalten, denn freilebende Tiere spielen nicht. Offenbar aber, so die Erklärung des Wissenschaftlers, langweilt sich das blitzgescheite Tier im Glaskasten und beschäftigt sich in seiner Not eben mit diesem Objekt. 10
Very tricky: Tintenfische täuschen Rivalen mit Farbtrick
Auch Tintenfischmänner schätzen es gar nicht, wenn ihnen beim Werben um die Angebetete ein Nebenbuhler im Genick sitzt, der ihnen den Schatz ausspannen könnte. Um sich die Konkurrenz vom Leib zu halten, haben sich Tintenfische deshalb einen ganz besonderen Trick ausgedacht: Auf der zum Nebenbuhler hingewandten Seite färben sie ihre Haut so, dass sie wie die braun-weiß gefleckten Tintenfischfrauen aussehen. Auf der Seite, die ihre Auserwählte im Blickfeld hat, stellen sie hingegen ihre gestreifte Balztracht zur Schau. Das berichten australische Forscher im Fachmagazin „Biology Letters“, nachdem sie Sepia-Populationen über Jahre hinweg in verschiedenen Lebensräumen beobachtet haben.
Dass Tintenfische ihre Hautfarbe verändern, um sich vor Fressfeinden oder ihrer Beute zu verstecken, ist nicht neu. Auch Farbspiele bei der Balz wurden bereits bei Riesentintenfischen beobachtet. Einige Kopffüßer passen während der Balz den hinteren Teil ihres Körpers der Umgebung an, um unsichtbar für Fressfeinde zu werden. „Unsere Studie zeigt jedoch zum ersten Mal, dass Tintenfische beide Geschlechter gleichzeitig bei der Balz nachahmen können“, schreiben Column Brown und seine Kollegen von der Macquartie University in Sydney in ihrer Veröffentlichung.
Für ihre Studie hatten die Meeresbiologen Tintenfische im Hafen von Sydney untersucht. Wie die Forscher berichten, wandten die Sepia-Männer ihre Flirtstrategie in rund 40 Prozent aller Fälle an, in denen sich eine Gruppe aus zwei Single-Männern und einer Frau zusammenfand. Auf der dem Rivalen zugekehrten Seite zeigte der balzende Mann dabei die gefleckte Hautmusterung einer Frau. Auf der, der Dame zugewandten, Seite nahm er dagegen die typische gestreifte Balzfärbung an. Sah sich der Tintenfisch aber zwei Damen und einem männlichen Rivalen gegenüber, nutzte er diese Strategie nicht. „Vielleicht ist das Männchen dann zu abgelenkt und hat Schwierigkeiten, sich auf eines der Weibchen zu konzentrieren“, mutmaßen die Wissenschaftler.
Die raffinierte, nur in passenden Konstellationen eingesetzte Täuschungsstrategie zeigt, dass die geistige Entwicklung dieser Meerestiere weit fortgeschritten ist. Denn würden sie ihre Taktik immer anwenden, wenn eine Dame in der Nähe ist, könnten sie leicht enttarnt und angegriffen werden, wenn mehrere rivalisierende Männer um die Tintenfischfrau herum postiert sind. Schließlich wäre dann für einige der Konkurrenten der Blick frei auf Seite mit der Balztracht. Damit das Farbenspiel überhaupt funktioniere, müssten sich die Männer zudem genau zwischen den Nebenbuhler und das Subjekt der Begierde positionieren. 11
1,2,3... : Tintenfische können zählen
Dass Tintenfische besonders kluge Tiere sind, ist schon länger bekannt. Jetzt haben zwei Forscher von der Universität Taiwan herausgefunden, dass sie auch zählen können, und zwar ganz ähnlich wie Menschen.
Dazu ließen die Wissenschaftler Tintenfische der Art Sepia pharaonis zwischen zwei durchsichtigen Behältern mit einer unterschiedlichen Anzahl von Garnelen wählen. Die Sepien wählten in jedem Fall den Behälter, der mehr Krebstiere enthielt, und das unabhängig davon, wie groß der zahlenmäßige Unterschied der Beutetiere war.
Wie Menschen erfassen Tintenfische bei bis zu fünf Beutetieren offenbar auf einen Blick, ob die Zahl größer oder kleiner ist. Das schaffen Kleinkinder erst ab einem Alter von einem Jahr. Bei mehr als fünf Garnelen zählen die Tintenfische dann in Ruhe nach und wählen schließlich - wen wundert´s? - die größere Anzahl.
Ihr Zahlensinn ist damit mindestens so gut wie der von Primaten. 12
Tintenfische: Persönlichkeiten mit Tagesform
Um zu testen, ob Kraken eine Persönlichkeit haben und individuell unterschiedliche Reaktionen auf ihre Umwelt zeigen, fing eine Forschergruppe um Renata Pronk von der Macquarie University Kraken im Hafen von Sydney, setzte sie in Aquarien und führte ihnen einen selbst gedrehten Film vor. Dieser zeigte eine Krabbe, ein Konservenglas und einen fremden Artgenossen.
Zunächst scheiterte das Experiment an den minderwertigen Filmaufnahmen, die man den Kraken anbot. Also fertigte Prink neue Aufnahmen in HDTV-Auflösung. Nun konnten die Kraken in bester Filmqualität sehen, wie die Krabbe auf sie zu marschierte.
Die Reaktion folgte prompt. Der Oktopus eilte auf den Bildschirm zu und versuchte, die Krabbe zu fangen und zu essen. Um nun herauszufinden, ob die Tintenfische eine Persönlichkeit haben, spielten die Forscher den Film mehrmals an verschiedenen Tagen ab. Das Verhalten eines jeden Oktopus blieb innerhalb eines Tages konstant, die einen reagierten voller Enthusiasmus, andere eher zurückhaltend. Über verschiedene Tage hinweg allerdings veränderte sich die Reaktion der Tintenfische: Zeigte sich ein Individuum anfangs sehr enthusiastisch, so blieb es am darauffolgenden Tag eher scheu. Pronk schloss daraus, dass die Tiere „episodische Persönlichkeiten“ haben. Kurzum: Sie sind launisch. 13
SPINNEN UND KREBSTIERE
Wenn Spinnen ihre Kinder lieben
Weibliche Wolfsspinnen bewachen ihre Eier und tragen die ausgeschlüpften Jungen mit sich herum. Was sie motiviert, ihre Jungen zu beschützen, ein simpler Mechanismus oder das Gefühl von Liebe und Fürsorgebereitschaft, ist freilich schwer zu erfassen. Folgende Geschichte könnte uns zu denken geben:
Der Wissenschaftler J.T. Moggridge berichtet von einer Falldeckelspinne, die er seiner Sammlung einverleiben und in Alkohol aufbewahren wollte. Er wusste, dass sich Spinnen noch eine ganze Zeitlang bewegen, nachdem man sie in Alkohol eingelegt hatte; er hielt dies aber für eine reine Reflexhandlung.
Moggridge entfernte die kleinen Spinnen von der Mutter und ließ diese in ein Gefäß mit Alkohol fallen. Als er glaubte, dass sie gestorben war, schickte er die 24 Babyspinnen hinterher. Zu seinem Schrecken streckte die Mutter ihre Beine aus, zog die Kinder an ihre Seite und hielt sie umschlossen, bis sie wirklich tot war. Nach dieser Erfahrung gebrauchte der erschrockene Moggridge Chloroform.
Ein unbewusster Reflex oder so etwas wie Mutterliebe? Vor dem Hintergrund, dass schon das Weben eines Spinnennetzes eine Leistung von außerordentlicher Komplexität darstellt, sind durchaus auch vielschichtige Gefühle bei einer Spinne vorstellbar. Die Spinne weiß wohl, was sie treibt. Wir nicht. 14
Das lass mal mich machen: Arbeitsteilung in der Spinnen-WG
Vertreter der Art Anelosimus studiosus gehören zu den sogenannten sozialen Spinnen, Sie leben in einer Art WG mit mehreren Artgenossen zusammen - und halten dort strikte Arbeitsteilung ein. Dabei verteilen die Spinnenfrauen die anfallenden Arbeiten wie Beute fangen, das Netz verteidigen oder sich um den Nachwuchs kümmern je nach ihren individuellen Neigungen und Vorlieben. Spinnen, die sich in Verhaltensexperimenten aggressiver gebärden, übernehmen dabei häufiger Aufgaben, für die ein forsches Auftreten nützlich sein kann. Wie die Biologen um Colin Wright von der University of Pittsburgh beobachtet haben, engagierten sich aggressive Spinnen dreimal so häufig bei der Jagd auf Beute und der Abwehr von Feinden wie ihre gutmütigen Mitbewohnerinnen. Diese hingegen kümmerten sich dreimal so oft um den Nachwuchs.
Und das macht Sinn: Während aggressive Spinnen angesichts eines Angreifers oder einer Beute nicht lange fackeln, ehe sie ihrerseits einen Angriff starten, verharren gutmütige Spinnenfrauen lange regungslos - bis es zu spät ist. Umgekehrt gehen die aggressiven Spinnen ziemlich rücksichtslos mit dem eigenen Nachwuchs um und töten ihn häufig, sollten sie sich doch einmal um ihn kümmern. So kommt es der gesamten Kolonie zugute, wenn jede Spinne eine Arbeit entsprechend ihrer Persönlichkeit wählt. 15
Umgang prägt: Im Miteinander bilden Spinnen ihre Persönlichkeit aus
Schon länger ist bekannt, dass selbst einzelne Spinnen unterschiedliche Charakterzüge haben. Die Individuen in sozialen Verbänden hausenden Spinne Stegodyphus dumicola haben zum Beispiel dauerhaft und nicht situationsabhängig mehr oder weniger furchtsame Persönlichkeiten. Eine Forschergruppe um Andreas Modlmeier von der University of Pittsburgh ist nun der Frage nachgegangen, wie es zur Ausbildung solcher Charaktere in der Spinnengemeinschaft gekommen ist. Dazu werteten sie aus, wie lange einzelne Spinnen in einer Gruppe mit anderen zusammenlebten, und ermittelten zudem, ob diese Spinnen allmählich bei einem Beutefangversuch zu besonders mutigem oder ängstlichem Verhalten neigten oder schlicht durchschnittlich blieben. Tatsächlich zeigten sich immer deutlichere individuelle Unterschiede bei immer längerer Gruppenzugehörigkeit. Soziale Interaktion fördert also die Ausbildung von Persönlichkeit, so die Forscher. 16
Spinnengesellschaft ganz menschlich: Ein schlechter Führer ist der Untergang
Offenbar ist der Mensch nicht die einzige Art, die schlechter Führung zum Opfer fällt. Eine Forschergruppe um Jonathan Pruitt von der University of California in Santa Barbara lehrte zunächst einzelnen Spinnen, dass andauernde leichte Vibrationen ihres Netzes einen Motten-Happen versprachen, während kurze, heftige Ausschläge vor Ameisen warnten. Dann wurden diese Spinnen in eine Kolonie untrainierter, furchtsamer Artgenossen gebracht. Nun ließen die Forscher das gemeinschaftliche Netz vibrieren und so lernten auch die anderen Tiere, die Signale richtig zu interpretieren. Bei manchen Kolonien vertauschten die Forscher dann die Signale. Erwartete die trainierte Spinne eine Motte, geriet sie beim Lospreschen an eine Ameise; versteckte sie sich vor dem Feind, entging ihr das Futter.
Wenn nun die Neue eine schüchterne Spinne war, ließ sich die Kolonie von deren Fehleinschätzungen nicht lange beeindrucken. Bei einer falsch gepolten Führungskraft jedoch geriet die ganze Gemeinschaft in Gefahr. Manche Kolonien verhungerten trotz reichhaltiger Nahrung, andere wurden immer wieder von Ameisen angegriffen. „Offenbar sind die Kolonien gegenüber ihren Anführern einigermaßen geduldig und lassen einige Fehler durchgehen“, sagt Kate Laskowski vom Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, die Erfahrung mit der Erforschung sozialer Spinnen hat. „Schlüssel-Individuen verbreiten falsche Informationen sehr effektiv, aber korrekte kaum“, schließt Pruitt aus dem Experiment. „Das war überraschend, um es vorsichtig auszudrücken.“ Und vor allem ziemlich menschlich... 17
Schon geil – Spinnenmänner haben Spaß am Sex
Lange dachten Forscher, dass Spinnen-Männer beim Sex nichts fühlen können. Doch das Liebesspiel von Spinnen ist offenbar aufregender als bisher vermutet. Ein deutsches Forscherteam hat Nervenzellen in den Geschlechtsteilen der männlichen Tasmanischen Höhlenspinne Hickmania troglodytes nachgewiesen. Biologen der Universitäten Greifswald und Jena schreiben im Fachmagazin Biology Letters: „Das männliche Geschlechtsorgan dieser Spezies ist nicht bloß eine gefühllose Struktur, sondern vermutlich in der Lage, Sinneseindrücke während der Spermienübertragung zu übermitteln.“
Mikroskop- und Röntgenaufnahmen sowie ein dreidimensionales Computer-Modell eines Pedipalpus zeigten zwei verschiedene Arten von Nervengewebe im Geschlechtsteil der Höhlenspinne: Einen Nerv, der bis zur Spitze des Organs läuft, und Ansammlungen von Neuronen in der Nähe einer Drüse, die für die Spermienübertragung zuständig ist.
Auf diese Weise erhielten die Tiere während der Paarung möglicherweise Informationen darüber, wie fortpflanzungsfähig die Dame ist, so die Forscher. Die Tiere könnten dann den Ausstoß ihres Ejakulats entsprechend anpassen. Aber Hauptsache doch, sie haben Spaß dabei. 18
Spinnen denken kausal
Spinnen verfügen über Fähigkeiten, die man bisher nur Wirbeltieren zugestanden hatte und die nicht als instinktives Reagieren abgetan werden können. In seinem Buch „Die Spinne“ schildert John Crompton eine Beobachtung mit einer Aranea sex punctata. Diese hatte den Ankerfaden ihres Netzes mit einem Stein beschwert und, als Cromptons das Netz zerstörte, es so erneuert, dass der Ankerfaden mit zwei Steinchen beschwert war. Wenn man nicht bloßen Zufall unterstellen will, so bleibt eigentlich nur die Deutung, dass das Gedächtnis der Spinne über den unmittelbaren Zweckzusammenhang hinaus kausales Denken einsetzen kann, so, als hätte die Spinne sich gesagt: „Das Netz ist zerrissen, weil der Ankerfaden zu wenig beschwert war. Ich muss ihn also das nächste Mal stärker beschweren.“ Und als Crompton dann auch das neue Netz zerstörte, zog die Aranea eine neue Konsequenz: sie gab den Platz auf. 19
Forscher entdecken den Schmerz bei Garnelen
Hummer und Garnelen können Schmerzen empfinden. Das stellten Biologen um Robert Elwood von der Queen‘s-Universität in Belfast nach Tests an Garnelen fest. Sie reizten die Fühler der Tiere und beobachteten charakteristische Reaktionen, wie sie auch bei Wirbeltieren vorkommen. Daher liege es nahe, auch den Krustentieren ein eigenes Nervensystem für die Schmerzempfindung zu attestieren, so die Forscher.
Im Rahmen ihrer Studie betupften die Wissenschaftler jeweils bei Felsengarnelen einen von zwei Fühlern mit Essigsäure. Die Garnelen krümmten daraufhin ihren Hinterkörper und begannen sofort, längere Zeit den betroffenen Fühler zu putzen und an der Aquariumwand zu reiben. Später träufelten die Wissenschaftler ein lokal wirkendes Schmerzmittel auf den Fühler, worauf die Garnelen aufhörten, die Antennen zu reiben. Dieses Verhalten führen die Biologen um Elwood Schmerzempfinden zurück. 20
Und auch den Krabben tut es weh
In Sachen Schmerzempfindung unterscheidet man wissenschaftlich zwischen der Schmerzwahrnehmung per Schmerzrezeptor – eine rein physiologische Reaktion – und dem Gefühlskonzept Schmerz. Dass Wirbellose über ersteres verfügten, wurde mit der zuvor beschriebenen Studie soweit bewiesen. Die zweite Kategorie ist schwieriger nachzuweisen.
Nun liefert eine neue Studie der Universität von Belfast weitere Hinweise auf die Leidensfähigkeit von wirbellosen Tieren. Elwood und viele seiner Kollegen setzen dazu auf das Konzept des Lernens. Erlebter Schmerz ist eine negative Erfahrung, die schützende und physiologische Reaktionen auslöst und aus der ein erlerntes Vermeidungsverhalten resultiert. Mit anderen Worten: Wenn ein Tier Situationen oder Objekte gezielt meidet, die ihm zuvor einmal Schmerzen bereitet haben, kann es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit tatsächlich Schmerzen spüren und auch darunter leiden.
Bei Garnelen und auch bei Einsiedlerkrebsen hat Elwood bereits gezeigt, dass diese Art des Lernens stattfindet. In seiner neuen Studie konzentrierte er sich nun auf Strandkrabben. Dabei stellte er sich die Frage, ob die Tiere so stark unter den Schmerzen leiden, dass sie sogar auf eine wertvolle Ressource verzichten, nur um die Schmerzen zu vermeiden. Er legte seinen Testkrabben dazu dünne Drähte um jeweils ein Bein, mit denen er ihnen leichte, aber mutmaßlich schmerzhafte Stromschläge zufügen konnte. Dann setzte er sie in ein hell erleuchtetes Aquarium, in dem es auf jeder Seite einen dunklen Unterschlupf gab – eindeutig der bevorzugte Aufenthaltsort der Krebse.
In der Studie selbst bekamen einige Krabben im Abstand von jeweils fünf Sekunden Stromschläge, sobald sie sich in einen der abgedunkelten Bereiche zurückzogen, andere wurden dagegen in Ruhe gelassen. Die Folge: Die meisten der geschockten Krebse lernten mit der Zeit, den Unterschlupf zu meiden, in dem sie die Stromschläge bekommen hatten – sie zogen sich entweder in den anderen zurück oder blieben sogar gleich in der hell erleuchteten Mitte des Aquariums. Dieses Verhalten entspreche fast exakt dem, das in Studien bei Wirbeltieren beobachtet worden sei, konstatiert Elwood.
Übrigens: Obwohl es gesetzlich für Wirbellose nicht gefordert wird, hat Elwood seinen Artikel mit einer „ethical note“ versehen, in der er versichert, seinen Versuchstieren so wenig Schmerz wie möglich zugefügt zu haben. Nach der Studie habe er zudem alle Tiere wieder freigelassen – an einem geeigneten Strand in der Nähe der Stelle, an der sie eingefangen worden waren. Immerhin. Wobei das Ergebnis der Studie genau das aussagt: dass es generell Unrecht ist, Strandkrabben einzufangen und mit Elektroschocks zu traktieren. 21
Schau mal meinen Dicken an
Winkerkrabben leben entlang der Küsten in Mangroven oder auf Schlammfeldern. Eine Forschergruppe um Simon Lailvaux von der University of South Wales in Sydney (Australien) hat nun beobachtet, dass männliche Winkerkrabben ihre Rivalen zuweilen mit einer großen Prachtschere täuschen, die stärker aussieht, als sie ist. Damit demonstrieren die Krabben eine Überlegenheit, die sie in Wirklichkeit nicht haben.
Verlieren die Tiere ihre Schere im Kampf, können sie eine nachbilden. Manche Männer verzichten dabei jedoch auf eine solide Bauweise. Die Gliedmaßen sehen dann zwar groß und stark aus, sind aber schwächer als die ursprünglichen Scheren.
Die Schere – sie ist mitunter größer als der Körper – spielt beim Werben um die Damenwelt eine wichtige Rolle. Auf der Suche nach Frauen „winken“ die Männer, indem sie die Prachtschere in die Luft heben und wieder senken.
Hier beobachteten Lailvaux und seine Kollegen, dass die regenerierte Prachtschere oftmals größer ist als die ursprüngliche. Außerdem stellten sie fest, dass das Verhältnis von Stärke und Größe bei den ursprünglichen Scheren viel besser übereinstimmte als bei den nachgewachsenen. Daraus schließen die Forscher, dass männliche Winkerkrabben ihre Konkurrenten täuschen.
Sobald die Winkerkrabben eigene Territorien haben, fliegt der Schwindel jedoch auf. Denn dann müssen sie ihr eigenes Revier verteidigen und den Kampf mit jedem Eindringling aufnehmen. Dabei bemerken die anderen Männer dann den Bluff. 22
Suche: Sicherheit Biete: Sex
In einer großen Krabbenkolonie herrscht Konkurrenzkampf, es gilt ständig, das eigene Revier zu verteidigen. Die Natur hat die Damen und die Herren dabei unterschiedlich gut für den Kampf gerüstet: Die Männer besitzen eine große Schere zur Verteidigung, die den Frauen fehlt. Trotzdem können sich diese mittels einer besonderen Art der Nachbarschaftshilfe behaupten.
Richard Milner und seine Kollegen von der Universität in Canberra beobachteten eine Winkerkrabbenkolonie vor der Ostküste Südafrikas. Wie sich zeigte, treten die Herren gegenüber benachbarten Damen als Beschützer auf: Will ein Rivale eine Nachbarin aus ihrem Bau verjagen, durchkreuzen sie dessen Plan. Auf weibliche Eindringlinge hingegen reagierten die Männer nur schwach.
Dabei fiel den Forschern auf, dass in Sachen Liebe die Wahl der Frauen auffallend häufig auf einen ihrer einsatzbereiten Nachbarn fiel: Bei 44 von 52 untersuchten Verhältnissen kamen die Herren aus der direkten Umgebung zum Zug. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Krabbenfrauen den Sex tatsächlich abhängig vom Leibwächterdienst und nicht als „Vorschuss“ gewähren. Mit dem außergewöhnlichen Belohnungssystem lasse sich auch das Verteidigungsverhalten der Winkerkrabben erklären: Sie bekämpfen nur Angreifer, die kleiner sind als sie selbst – im anderen Fall würde die Belohnung das Risiko nicht aufwiegen. 23
Krabben bilden Bürgerwehren – aus reiner Berechnung
Der Immobilienmarkt der Krabben ist hart umkämpft, die begehrten netten Plätzchen im Schlamm sind knapp, und nur Grund- und Bodenbesitzer haben später dann auch Erfolg bei den Frauen. Der Rest der Krabben wandert heimatlos durch die Kolonie und attackiert hin und wieder schwächlich scheinende Grundbesitzer in der Hoffnung, diese vielleicht zu vertreiben. Dabei beobachteten Patricia Backwell und Michael Jennions von der National University in Canberra Merkwürdiges: Häufiger kämpfen nicht zwei, sondern gleich drei Krabben miteinander und stets sind es zwei Grundbesitzer, die sich gegen einen herumstreunenden Landräuber zusammentun. Bilden Krabben Bürgerwehren? Und wenn ja – warum?