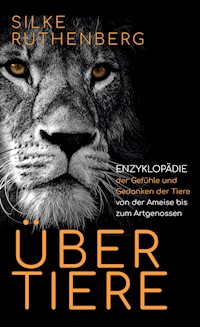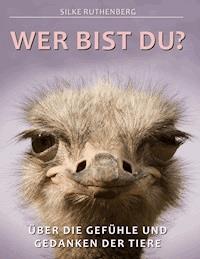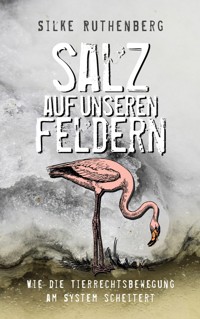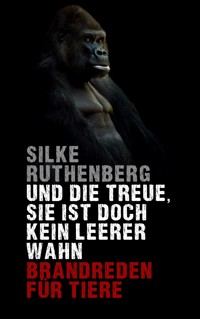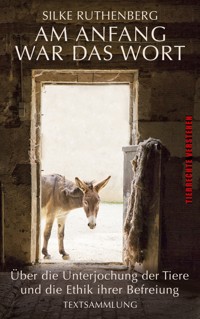
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Verleumdet, diskriminiert, vernichtet! Die anderen Tiere haben von ihren mächtigen zweibeinigen Stammesbrüdern nichts Gutes zu erwarten. Diese Sammlung an Texten der Begründerin der veganen Tierrechtsbewegung in Deutschland bietet einen umfassenden Überblick über die Mechanismen der Diskriminierung und das vielschichtige Lügengebäude, mit denen die Gewaltherrschaft über die Tiere eingeleitet und gleichzeitig unsichtbar gemacht wird. Das Buch deckt faktenreich und systematisch auf, auf welchen Grundlagen die Gewaltherrschaft über die Tierheit ruht, und es hält dagegen: Leidenschaftlich und liebevoll ergreift die Autorin das Wort für die Tiere und plädiert für eine Ethik, die ihnen endlich gerecht wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AUF JE TAUSEND, DIE AN DEN BLÄTTERN DES BÖSEN ZUPFEN, KOMMT EINER DER AN DER WURZEL HACKT.
HENRY DAVID THOREAU
INHALT
ERSTER TEIL
ÜBERTIERE ODER ÜBER WEN WIR SPRECHEN
DIE GEFÜHLE UND GEDANKEN DER TIERE
ZWEITER TEIL
MECHANISMEN DER UNTERJOCHUNG
DIE NATUR DES VORURTEILS ÜBER DIE ANDEREN TIERE
DER RUFMORD GEHT DEM MORD VORAUS
SCALA NATURAE – EIN NATURPHILOSOPHISCHES KONZEPT ZUR ENTWERTUNG DER ANDEREN TIERE
SPRACHE ALS ORGANON DER GEWALT
KULTUR UND NATUR – EIN HIRNGESPINST UND SEINE WIDERLEGUNG
DER MÖRDERAFFE! ODER:WUNSCH UND WIRKLICHKEIT ÜBER DIE NATUR DES MENSCHEN
WERTEHIERARCHIEN – ODER: KLEINE VORLESUNG IN SACHEN MORAL FÜR ALLE, DIE SIE UNS ERKLÄREN MÖCHTEN
DISKRIMINIERUNG PER RECHT UND GESETZ – TIERSCHUTZRECHT IN DEUTSCHLAND
DRITTER TEIL
ETHIK DER BEFREIUNG
FÜR BLUTIGEN MORD SEI BLUTIGER MORD! WER TAT, MUSS LEIDEN! ÜBER DIE RACHE DER TIERE
TÄUBCHEN, MEIN TÄUBCHEN
ZU GAST BEI FEINDEN – IN MEMORIAM BRUNO
DIE GÖTTIN DER LIEBE IST TOT – SIE HABEN FREYA ERMORDET
LIEBE GAIA
DIE ETHIK DER TIERRECHTE
VEGAN BEDEUTET, DASS NIEMALS EIN TIER EINEM ZWECK GEOPFERT WIRD – DIE PHILOSOPHIE EINER LEBENSWEISE
DAS ENDE DER SCHRECKEN – ODER: WARUM WIR VEGANER AUCH KEINE INSEKTEN FRESSEN
FÜNF TIERRECHTSPHILOSOPHIEN DER MODERNE
PLÄDOYER FÜR DIE RECHTE DER TIERE
ERSTER TEIL
ÜBERTIERE ODER ÜBER WEN WIR SPRECHEN
DIE GEFÜHLE UND GEDANKEN DER TIERE
Seit Jahrtausenden fragen sich Philosophen und Wissenschaftler, ob Tiere eine Seele haben oder, weltlicher ausgedrückt, ob Tiere fühlen und denken können. Die meisten Vertreter der Klientel sind in der Vergangenheit zum Ergebnis gekommen, dass sie es nicht können. Alles, was wir bei Tieren als Gefühle und Gedanken wahrnehmen, sei in Wirklichkeit nichts weiter als Reflex, Reaktion und Instinkt und habe mit den höheren emotionalen und geistigen Leistungen des Menschen nichts gemeinsam. Jede andere Sichtweise wurde mit dem Totschlagargument abgetan, sie sei „vermenschlichend“.
Diese Einzigartigkeitsvorstellung und die damit verbundene Annahme, dass die Tiere grundsätzlich anders sind als der Mensch, ist der wesentliche Grund, warum Menschen ihr Unrechtsbewusstsein abschalten können. Gegenüber unbewussten Biorobotern, deren Fühlen primitiv ist und sich entscheidend von den menschlichen Emotionen unterscheidet, braucht man keine Empathie zu empfinden. Und wer nicht denkt, der ist als individuelles Wesen letztlich bedeutungslos. Er ist damit auch kein Gegenstand der Gerechtigkeit und man kann an ihm kein Unrecht begehen. Damit wird Rücksichtnahme gegenüber Tieren um ihrer selbst Willen im Umkehrschluss zu einer sentimentalen Gefühlswallung und einer persönlichen Geschmacksfrage.
Das Unrecht an den Tieren überhaupt wahrnehmen zu können setzt deshalb voraus, dass wir sie in ihrem Sein erkennen. Und seit wenigen Jahren haben wir glücklicherweise mehr in der Hand als unsere Wahrnehmung, dass auch die anderen Tieren fühlen und Gedanken hegen. Die Wissenschaft liefert täglich neue bemerkenswerte Erkenntnisse und eine Fülle an Beweisen, die wissenschaftlich fundiert belegen, dass die Hybris des Menschen und seine emotionale Abgrenzung gegenüber den Tieren auf einer großen Lüge basieren.
Dieser Text beschäftigt sich einleitend mit dem Sein der anderen Tiere, denn hier nimmt jedes moralische Denken über sie ihren Anfang.
Die Sache mit dem SchmerzEs zieht sich durch die ganze Geschichte der Menschheit, dass dominante Gruppen den von ihnen unterdrückten Individuen Leidens- und Schmerzempfinden abgesprochen haben. So wird das Mitgefühl, das gedeihliches soziales Miteinander für alle Mitglieder der Gemeinschaft erst ermöglicht, kurzerhand abgeschaltet. Empfindungsfähigkeit entwickelt sich aber nicht mit dem Grad an Macht. Eher verhält es umgekehrt: Je mächtiger, umso unsensibler – zumindest gegenüber dem Leid der Schwächeren. Die Minderreagibilität des Menschen gegenüber seinen eigenen Artgenossen und erst recht gegenüber den anderen Arten ist ein Kontinuum seiner Geschichte. Es klingt beinahe unglaublich, dass man bis 1980 Operationen an menschlichen Säuglingen mit ruhigstellenden, aber nicht betäubenden Mitteln durchgeführt hat, weil man annahm, dass das Nervensystem von Kleinkindern noch zu unausgereift sei, um Schmerzen zu verspüren. Heute weiß man es besser.
Womit ich zur Kernfrage komme: Was wissen wir eigentlich vom Schmerzempfinden der anderen Tiere? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich zunächst klar machen, dass dem Reich der Tiere Lebewesen von außerordentlich verschiedener Art zugeordnet werden, Schimpansen zählen ebenso dazu wie Schwämme. Heutzutage sind etwa 1,3 Millionen Tierarten bekannt, man schätzt aber, dass eher 10-20 Millionen Arten unsere Erde bevölkern. 80% dieser Tierarten sind Gliederfüßer (dazu zählen die Insekten, Spinnen und Krebstiere), weitere 10% sind Weichtiere (Schnecken, Muscheln, Kopffüßer) und gerade mal 5% zählt man zu den Wirbeltieren (Säugetiere, Vögel, Fische, Amphibien und Reptilien). Ein Lebewesen der Kategorie „Tier“ zuzuordnen ist bei der Klärung der Frage nach Leidensfähigkeit wenig aussagekräftig, schon weil Bewusstsein und Empfindungsfähigkeit kein Kriterium ist, aufgrund dessen eine Lebensform als Tier definiert wird.
Schmerzempfindung ist eine subjektive Erfahrung, die nur uns selbst zugänglich ist. Selbst bei dem uns nächsten Menschen wissen wir nicht, wie sich Schmerz für ihn anfühlt. Woher also wollen wir wissen, ob jemand, mit dem wir uns kaum verständigen können, Schmerzen empfindet? Die Naturwissenschaft bietet zur Klärung dieser Frage verschiedene verhaltensbiologische und neurophysiologische Belege an, aus denen man Empfindungsfähigkeit ableitet.
Schmerz ist mehr als eine Reizreaktion. Er ist eine Empfindung des bewussten Lebens und in zweierlei Hinsicht von existentieller Bedeutung für das Leben und Überleben eines Individuums. Schmerz hat eine Alarmfunktion. Das Schmerzgefühl signalisiert: Achtung, Körperdefekt! Und der Leidende wird üblicherweise alles tun, die Ursache des Schmerzes abzustellen. Schmerz ist zudem ein Instrument der Vorbeugung. Was einmal Schmerzen bereitet und damit geschadet hat, wird künftig gemieden werden.
Bis heute kennen wir nicht einmal die genauen neuronalen Zusammenhänge von Schmerz beim Menschen und wissen nicht mit Sicherheit, wie das menschliche Gehirn das subjektive Schmerzempfinden erzeugt. Es ist auch nicht klar, welche Neuronen und Verbindungen beim Schmerz aktiv sind.
Um Schmerzen zu empfinden, so vermutet man, muss physiologisch ein ausreichend komplexes Nervensystem vorhanden sein. Eine weitere Voraussetzung ist das Vorhandensein von Schmerzrezeptoren (Nozizeptoren) und die ungestörte Weiterleitung an das Zentralnervensystem (ZNS). Der Teil des Gehirns, der bei uns Menschen mit Schmerzempfindung, oder allgemeiner, mit Bewusstseinsbildung verbunden wird, ist die Großhirnrinde (Cortex). Alle Säugetiere verfügen über einen Cortex und sind damit empfindungsfähig und fühlen Schmerzen. Hierüber besteht mittlerweile auch wissenschaftlicher Konsens. Bei den anderen Wirbeltieren (Vögel, Fische, Amphibien, Reptilien) übernimmt ein evolutionäres Homolog die Funktion des Cortex, das sie zur Schmerzempfindung befähigt.
Das Nervensystem der wirbellosen Tiere unterscheidet sich grundsätzlich von dem der Wirbeltiere. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass sie deshalb keinen Schmerz empfinden können. Das Reich der Wirbellosen ist überaus vielfältig. Tieren ohne Nervensystem wie den Schwämmen fehlt nach derzeitigem Wissensstand die physiologische Voraussetzung für Empfindungsfähigkeit. Es sind die ältesten vielzelligen Tierarten, die noch keine Muskel-, Nerven- und Sinneszellen besitzen. Allerdings verfügen sie über Neurotransmitter wie Adrenalin, Noradrenalin und Serotonin und sind dadurch in der Lage, beispielsweise Licht, mechanische Reize und Wasserströmungen wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Es scheint aber unwahrscheinlich, dass sie ohne Nervensystem diese Reize auch erleben.
Stachelhäuter, zu denen Seesterne und Seeigel zählen, verfügen bereits über ein relativ komplexes Nervennetz, das allerdings keine Zentralisierung aufweist, die (nach derzeitigem Wissensstand) für die Entwicklung von Bewusstsein und damit auch Schmerzempfinden unabdingbar ist. Nesseltiere (Quallen, Korallen, Hydras und Anemonen) besitzen echte Nervenzellen, die ein diffuses Netz bilden, welches eine geringe Zentralisierung zeigt. Trotzdem sind solche Nervennetze bereits erstaunlich leistungsfähig. Die fingernagelgroße Würfelqualle verfügt mit ihren 24 Augen möglicherweise bereits über die Empfindung des Sehens und kann durch ihre Beobachtungen und durch Erfahrung lernen. Einige Nesseltiere wie Seeanemonen besitzen komplexere Nervennetze mit sensorischen Ganglien, was die ersten Schritte in Richtung eines zentralisierten Nervensystems darstellen könnte. Gewisse Zentralisierungen in der Struktur können möglicherweise mit den diffuseren Nervennetzen im Rest des Systems interagieren. Seeanemonen haben bereits einen individuellen Charakter und können strategisch denken. Ob sie über ein Bewusstsein verfügen ist noch sehr fraglich.
Das Nervensystem von Muscheln ist bis zu einem gewissen Grad zentralisiert, da es drei Ganglienpaare enthält, die durch ein Nervenkabel verbunden sind. Die Nervensysteme von Schnecken ähneln denen von Muscheln. Sie sind etwas größer, verfügen typischerweise über fünf Ganglien, die als Gehirn dienen und zu Lernvorgängen befähigt sind.
Bei Muscheln ist das Nervensystem rudimentär, allerdings hatte bereits 1993 eine italienische Arbeitsgruppe um G.B. Stefano davon berichtet, dass viele Körperbereiche der Miesmuschel Mytilus edulis hormonartige, schmerzlindernde Stoffe erkennen. Ist die Muschel gestresst, so findet man in ihr wenige freie Anti-Stress-Moleküle. Ist sie hingegen entspannt, so steigt der Spiegel dieser Substanzen. Dies könnte darauf hindeuten, dass zu Notzeiten alle schmerzstillenden Anti-Stress-Faktoren gebunden und damit wirksam werden. Die untersuchten Stoffe sind nicht irgendwelche Substanzen, sondern sogenannte Endorphine. Diese stammen aus derselben Chemikaliengruppe wie die Schmerzstiller Heroin und Morphium: sie alle sind Morphine. Der menschliche Körper verfügt über ähnliche Stoffe, die er zur Linderung ausschüttet, wenn Stress und Schmerz heranrücken. Stefano und Mitarbeiter haben in den vergangenen Jahren immer mehr Hinweise darauf gefunden, dass sich Muschel und Mensch in hormoneller Hinsicht ähneln. „Kurz gesagt“, schreiben die Nervenforscher, „zeigen unsere Versuche, dass Morphin auf Zellen eines wirbellosen Tieres [dieselben Auswirkungen] hat wie auf Menschen, obwohl sich beide seit 500 Millionen Jahren auf verschiedenen Zweigen der Evolution weiterentwickeln“. 2023 entdeckten Wissenschaftler, dass sich Miesmuscheln fürchten können.
Zu den Weichtieren zählen neben den Muscheln auch andere Tiere, die mit gutem Appetit gegessen werden: Schnecken und Tintenfische. Bei letzteren ist es praktisch unumstritten, dass sie Schmerzen empfinden können. Sie haben sogar ein sehr differenziertes Nervensystem. Ihre Intelligenz und bemerkenswerte Kommunikationsfähigkeiten verblüffen schon lange die Wissenschaft. Schnecken hingegen gelten nicht gerade als Intelligenzbestien, aber ihre Gedächtnisleistung reichte immerhin aus, dem österreichischen Neurobiologen Eric Kandel im Jahr 2000 den Nobelpreis einzubringen. Dieser hatte die Mechanismen von Lernen und Gedächtnis ausgerechnet an der Meeresschnecke Aplysia erforscht, die bereits über ein Kurz- und ein Langzeitgedächtnis verfügt.
Erhält Aplysia nur eine Trainingseinheit, vergisst sie das Erlernte bereits nach einer Viertelstunde, büffelt sie jedoch über vier Tage, auf einen bestimmten Reiz hin ihren Sipho einzuziehen, dann bleibt die Erinnerung wochenlang gespeichert. Und wo Lernen und Gedächtnis zu Hause sind, macht Schmerzempfinden bereits doppelt Sinn.
Krebstiere verfügen über ein zentrales Nervensystem. Ihr Gehirn liegt in Größe und Komplexität irgendwo zwischen Insekten und Kopffüßern und ist so komplex, dass es höchstwahrscheinlich zur Schmerzempfindung befähigt. Sie zeigen auch ein Verhalten bei einem Schmerzreiz, der darauf hinweist, dass sie Schmerzen empfinden können.
Der Zoologe und Spezialist für Wirbellose, Dr. Jaren G. Horsley, ist sogar der Meinung, dass beispielsweise Hummer möglicherweise stärkeren Schmerz empfinden als wir Menschen: „Ein Hummer verfügt nicht über ein autonomes Nervensystem, das ihn in einen Schockzustand versetzt, wenn er verletzt wird. Der Hummer leidet daher enorme Qualen, wenn man ihn aufschneidet. Er empfindet Schmerz, bis sein Nervensystem durch das Kochen zerstört ist.“ Der Todeskampf im siedenden Wasser dauert drei bis fünf Minuten. Die Provinz Emilia in Italien hat deshalb mittlerweile das Kochen lebender Hummer unter Strafe gestellt. Auch Neuseeland, zwei Staaten in Australien, Schottland, England und Norwegen lehnen das Lebendkochen von Hummer inzwischen ab und planen in einem Gesetzesentwurf Hummer mit Wirbeltieren gleichzustellen, so wie es Österreich am 1.1.2005 getan hat.
Insekten haben ein zentralisiertes Nervensystem mit einem ausgeprägten Gehirn, doch ihr Verhalten gibt teilweise Anlass zur Annahme, dass sie keine Schmerzen empfinden können: Mücken zeigen beispielsweise kein verändertes Verhalten, wenn sie ein oder mehrere Beine verlieren, Bienen saugen Nektar, auch wenn ihnen der Hinterleib abgeschnitten wurde. Dies allerdings sind nur Indizien dafür, dass diese Insekten keinen Schmerz erfahren, Beweise sind es nicht. Es besteht nämlich beispielsweise die Möglichkeit, dass Insekten – wie Wirbeltiere – ihre Bedürfnisse priorisieren und nozizeptive Reflexe unterdrücken können. Das bedeutet, dass sie Schmerzen in Kauf nehmen, um für sie wesentliche Ziele zu erreichen. Das tun auch Menschen, wenn sie beispielsweise eine Glasscheibe mit bloßen Händen zertrümmern, um einer Feuersbrunst zu entkommen. Bei Bienen wurde bereits nachgewiesen, dass sie für priorisierte Ziele Schmerzen unterdrücken können. Es scheint auch so zu sein, dass die Schmerzerfahrung je nach Schmerzreiz bei den verschiedenen Arten unterschiedlich erlebt wird. Beispielsweise reagieren Fische auf Kältereize viel unsensibler als Menschen, weil sie an Kälte evolutionär angepasster sind. Insekten reagieren beispielsweise besonders sensibel auf Hitze und Elektroschocks, aber auch hier nehmen sie Hitzereize in Kauf, um leckere Nahrung aufzunehmen.
Insekten behalten Schmerzerfahrungen offensichtlich auch im Gedächtnis. So meiden Fruchtfliegen schmerzhafte Elektroschocks, wenn sie durch einen bestimmten Duft vorher gewarnt wurden. Das haben Forscher von der Uni Würzburg herausgefunden, als sie in einer Versuchsanordnung einige Insekten erst mit einem Duft konfrontierten und dann mit einem leichten Elektroschock bestraften. Hatten die Tiere diese Prozedur mehrmals durchlaufen, gingen sie dem Schmerz verheißenden Geruch zielstrebig aus dem Weg. Wenn man die kleinen Insekten bestraft und sie gleich danach einen bestimmten Duft riechen lässt, dann stufen sie genau diesen Geruch später als positiv ein. Bei Fruchtfliegen und Mücken wurden Nozizeptoren identifiziert, also spezielle Neuronen, die in die Nozizeption involviert sind. Dass so viele Forscher lange bestritten haben, dass Insekten Nozizeptoren haben, lag tatsächlich nicht daran, dass keine gefunden wurden, sondern, dass danach nie gesucht wurde. Mittlerweile hat man bei Fliegen bereits Phänomene wie chronische Schmerzen und Angst nachgewiesen. Hummeln können pessimistisch und hoffnungsfroh sein und haben sogar Spaß am Spiel. Schmetterlinge können sich sogar daran erinnern, was sie als Raupe erlebt haben. Eine Metastudie aus dem Jahr 2022 ist zum Ergebnis gekommen, dass Insekten mit hoher Wahrscheinlichkeit Schmerzen empfinden. Danach gibt es keine Belege für ein fehlendes Schmerzempfinden bei Insekten, aber mittlerweile je nach Insektenart bis zu sechs von möglichen acht Nachweisen dafür, dass diese Tiere empfindungsfähig sind. Dass noch Nachweise fehlen liegt einfach nur daran, dass diese schlichtweg noch nicht erforscht wurden und nicht etwa, dass die Tests negativ ausgefallen wären.
Nach Ansicht des Berliner Neurobiologen Menzel ist Schmerz nicht abhängig von der stammesgeschichtlichen Entwicklungsstufe. Für Menzel hat Schmerzempfinden etwas mit Identifikation zu tun: „Wenn Tiere sich als Individuum erfahren, dann können sie auch eine emotionale Komponente entwickeln – so etwas wie Schmerz.“
Noch mehr GefühleAuch die vielen anderen Gefühle, die uns für sinnvolles Verhalten „belohnen“ und schädliches Verhalten „bestrafen“, sind ganz und gar keine exklusiv menschliche Angelegenheit. Das Spektrum an Gefühlen hilft dem Individuum einfach nur bei der Entscheidungsfindung. Es gibt unzählige Belege dafür, dass zumindest Wirbeltiere, aber eben auch zumindest sehr viele Wirbellose durchaus komplexere Gefühle empfinden können. Trauer und Eifersucht, Wut und Einsamkeit quälen auch die anderen Tiere. Bereits Fliegen können depressiv werden, man traut sich bisher nur nicht, es auch so zu benennen. Andererseits kennen viele – vielleicht die meisten – Tierarten auch das Gefühl der Hoffnung, der Liebe, des Glücks und der Freude. Diese Gefühle machen bei allen strebenden Lebewesen auch nur Sinn – und nicht nur bei Menschen.
Gefühle brechen seit einigen Jahren wie eine Welle über die Biologie. Viele Wissenschaftler sprechen sogar über eine Revolution im Tierbild. Noch um die Jahrtausendwende war sich die Forschung sicher, dass nicht Emotionen die Tiere steuern, sondern Instinkte – ähnlich den Programmen bei Computern. Heute lautet die Frage nicht mehr: Fühlen Tiere? Sondern: Was fühlen Tieren genau? „Naturwissenschaftlich gesehen haben Tiere eindeutig Gefühle. Wir streiten nur noch, wie sie genau aussehen», so Jörg-Peter Ewert, Professor für Zoologie und Neurobiologie in Kassel.
Dem Anschein nach sind die Seelenzustände den unseren überaus ähnlich und das durchaus auch schon bei den fernen Verwandten. Wie menschlich auch deren Gefühlsleben ist, zeigt sich dabei eindrucksvoller in Anekdoten als in Studien. Deshalb möchte ich von einigen hier erzählen.
Die erste Episode spielte sich vor einigen Jahren in der Meeresstation von Banyuls ab. Dort demonstrierte ein Krake den staunenden Wissenschaftlern, wie er sich wirksam vor Tantalusqualen schützen kann. Der arme Kerl wurde nämlich von einem dreisten Einsiedlerkrebs schier zur Verzweiflung getrieben. Der Krebs war einfach zu geschickt: Bei jedem Angriff zog er sich flink in sein Schneckenhaus zurück, schirmte den Eingang mit den gepanzerten Scheren ab und war dann nicht mehr herauszubekommen. Jedes Mal musste der Oktopus das Gehäuse wieder freigeben und unverrichteter Dinge wieder abziehen. Der Einsiedlerkrebs aber war nach kurzer Zeit wieder munter und spazierte erneut herausfordernd am Höhleneingang des Oktopus vorbei. Dieser ließ sich wieder provozieren und das Spiel wiederholte sich. Irgendwann aber war die Geduld des Kraken erschöpft. Er schleppte einen großen Stein heran und platzierte ihn als Sichtschutz zwischen sich und die Lockspeise. Aus den Augen, aus dem Sinn! Der kluge Oktopus hatte seine innere Ruhe gefunden.
Auch Krake Charles demonstrierte eindrucksvoll, dass er zu heftigen Gefühlsregungen in der Lage ist. Zusammen mit Albert und Bertram, zwei weiteren Tintenfischen, wurde er darauf trainiert, einen Schalter zu betätigen, um ein Licht anzumachen, und dann auf das Licht zuzuschwimmen, was eine Belohnung einbrachte. Auch Charles schien zunächst lernwillig zu sein, doch irgendwann wurde ihm das Spiel zu blöde. Er saugte sich an einer Wand des Aquariums fest und zog so stark an dem Hebel, dass er abbrach. Und anstatt auf das Licht zu warten, um sein Stückchen Fischfleisch entgegenzunehmen, griff er nach der Lampe und zog sie ins Wasser. Schließlich tauchte er auf, fixierte über dem Wasserspiegel den Versuchsleiter und spritzte diesen dann gezielt mit einer Ladung Wasser an. Womöglich führte sich Charles bei diesen demütigenden Forschungsspielchen veräppelt und verschaffte seinem Zorn auf diese Weise einen wirkungsvollen Ablauf.
In Erstaunen versetzt da eher die Äußerung des Versuchsleiters zu diesem Vorfall. Dieser notierte pikiert: „Die Variablen, welche die Bedienung und dann das verstärkte Bedienen des Mechanismus und das Wasserspritzen bei diesem Tier bewirkten, ließen sich nicht erkennen.“ Man möchte geradewegs entgegnen: „Die Variablen, die den Versuchsleiter uneinsichtig und eingeschnappt auf die kleine Rache des Tintenfisches reagieren ließen, sind hingegen offensichtlich.“
Trauer im Tierreich
Hunde sind ja bekanntlich die besten Freunde des Menschen und beide Arten haben sich über die Jahrtausende des engen Zusammenlebens so aneinander gewöhnt, dass sie die jeweils andere Sprache lesen und verstehen können. Kaum jemand würde Hunden die Fähigkeit absprechen zu trauern. Auch die anderen Menschenaffen werden diesbezüglich nicht mehr grundlegend unterschätzt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es unsere nächsten Verwandten sind. Jane Goodall erzählte uns bereits vor Jahrzehnten die berührende Geschichte des Schimpansen Flint, der aus Trauer um seine tote Mutter starb. In einem Safaripark in Großbritannien wurden Schimpansen beobachtet, wie sie eine gerade verstorbene Schimpansin zärtlich streicheln und immer wieder versuchen, sie wachzurütteln. Die Gorillafrau Koko, die in einem Zeichensprachprogramm integriert war, signalisierte in der Gebärdensprache die Zeichen für Trauer und Weinen, nachdem ihr Kätzchen bei einem Unfall ums Leben gekommen war.
Viele Primaten tragen ihre verstorbene Kinder oft noch wochenlang mit sich herum. Wale berühren verstorbene Artgenossen mit den Flossen und schmiegen sich an den Verstorbenen. Manchmal bringen sie den toten Körper an die Wasseroberfläche. Elefanten kehren zu den Knochen von Verstorbenen zurück. Studien bestätigen mittlerweile, dass auch Schweine offensichtlich um verstorbene Gruppenmitglieder trauern. Und auch bei Giraffen wiesen Wissenschaftler Trauerreaktionen nach, obwohl man lange fälschlich annahm, dass diese Tiere nur geringe emotionale Bindungen entwickeln.
Offenkundig gibt es bei Tieren auch ein Bewusstsein vom Tod in seiner Endgültigkeit. Der weltbekannte Primatologe Frans de Waal berichtet von einer Beobachtung bei jungen Bonobos, die eine sehr gefährliche Schlange gefunden hatten und große Angst zeigten. Die Gruppenchefin kam hinzu und tötete die Schlange, woraufhin die jungen Bonobos schnell ihre Angst verloren und anfingen, mit der toten Schlange zu spielen und sie sich sogar um den Hals legten. Es war den Bonobos offenkundig bewusst, dass diese Schlange endgültig keine Gefahr mehr für sie darstellte.
Das Gefühl der Trauer kennen aber nicht nur Säugetiere: In den Rocky Mountains beobachtete der Biologe Marcy Cottrell Houle das Nest von zwei Wanderfalken, die er Arthur und Jenny nannte, und die mit der Aufzucht von fünf Jungvögeln beschäftigt waren.
Eines Morgens kam nur der männliche Falke zum Nest zurück. Jenny blieb aus, und das Verhalten von Arthur änderte sich schlagartig. Wenn er Nahrung brachte, wartete er bis zu einer Stunde am Nest, bis er sich wieder zur Nahrungssuche entfernte. So etwas hatte er zuvor nie getan. Hin und wieder stieß er seinen Ruf aus und wartete vergeblich auf die Antwort seiner Gefährtin. Am Abend des dritten Tages stieß Arthur am Rand des Nests einen befremdlichen Ton aus, „einen Schrei wie das Aufheulen eines verwundeten Tieres, den Schrei der leidenden Kreatur“, schrieb Houle betroffen. „Die Trauer in diesem Aufschrei war nicht zu verkennen; nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe, zweifle ich nicht mehr daran, dass ein Tier Empfindungen haben kann, die wir gerne für uns Menschen reservieren würden.“ Nach diesem Schrei saß Arthur bewegungslos auf dem Felsen und rührte sich während des ganzen Tages nicht. Am fünften Tag nach Jennys Verschwinden – sie war wahrscheinlich erschossen worden – versuchte er das Versäumte wieder gutzumachen und übertraf an Fürsorge und Aktivität alle Falken, die Houle je beobachtet hatte. Trotzdem verhungerten drei seiner Kinder, zwei erlernten unter der aufopferungsvollen Pflege des alleinerziehenden Vaters erfolgreich das Fliegen.
Konrad Lorenz beschreibt die traurige Geschichte von Ado und Susanne-Elisabeth, die ein liebendes Gänse-Paar waren: „Susanne-Elisabeth fiel einem Fuchs zu Opfer und Ado verharrte tagelang neben ihrem Nest, in dem ihr angefressener Leichnam lag. In gekrümmter Stellung stand er so da und ließ seinen Kopf hängen. Seine Augen fielen ein. Sein Status in der Schar der Gänse sank dramatisch, weil er nicht die Kraft hatte, sich gegen die Angriffe anderer Gänse zu verteidigen [...]. Ein Jahr später hatte sich Ado wieder gefangen und verliebte sich wieder.“ Wir begreifen: Gänse kennen das Trauerjahr, das uns selbst so vertraut ist.
Bei Krähen wurde beobachtet, dass sie sich an Orten, wo zuvor eine Krähe verstorben war, in großer Zahl schweigend versammeln, bis sie nach längerer Zeit ebenso still gemeinsam fortfliegen. Die Intensität der Trauer ist davon abhängig, wie intensiv die Bindung zum Verstorbenen war. Einige Vögel sitzen neben den toten Körpern und zupfen an den Federn und Gliedmaßen, andere picken auf den Schnabel, als wäre es ein Wiederbelebungsversuch. Manche schreien dabei aufgeregt.
Mitgefühl und Gerechtigkeitssinn
Der griechische Philosoph Hesiod begründete 800 v. Chr. die Vorstellung, dass Rechtsempfinden und Rechtsordnung den Menschen grundsätzlich von allen anderen Tierarten unterscheide. Damit ist die Ansicht verknüpft, dass nur der Mensch – durch seine angeblich exklusive Befähigung zum Mitgefühl und Sinn für Gerechtigkeit – zur Moral befähigt sei und deshalb auch im Gegensatz zu den anderen, angeblich moralunfähigen Tieren moralische Rücksichtnahme in Anspruch nehmen könne.
Dass diese Schlussfolgerung, die beispielsweise Kant vollumfänglich übernommen und ausgeformt hat, für sich genommen logisch und ethisch schwer zu halten ist, ist das eine. Sie beruht aber auch schlichtweg auf falschen Behauptungen. Denn (die anderen) Tiere können sehr wohl Mitleid empfinden, uneigennützig handeln und haben ebenso einen Sinn für Gerechtigkeit – und dies oft sogar artübergreifend. Diese Empfindungen sind für ein gedeihliches soziales Miteinander schlichtweg unerlässlich und sie werden geweckt, wenn eine Identifikation stattfindet oder, anders gesagt, wenn das Gefühl des „Wir“ erwacht. Und dieses „Wir“ ist dabei nicht an Artgrenzen gebunden.
Bereits Plutarch sammelte anekdotenhafte Belege für moralisches Verhalten bei Tieren. So berichtet er in De sollertia animalium (Über die Klugheit der Tiere): „Ein Tiger, dem man ein junges Zicklein gegeben hatte, fastete zwei Tage lang, ohne dasselbe anzurühren; am dritten Tag, als der Hunger übermächtig wurde, verlangte er so ungestüm nach Nahrung, dass er den Käfig zerbrach, in dem er eingesperrt war: Das Zicklein rührte er auch jetzt nicht an.“ Plutarch war sich sicher, dass der Tiger das Zicklein verschonte, weil er es für einen Gefährten und Verwandten hielt.
Diese offensichtliche Identifikation mit einem andersartigen Individuum, das normalerweise Beute wäre und nun offenbar zum Freund wurde, ist kein Einzelfall und wird immer wieder anekdotisch beschrieben. In einem Safaripark in Wladiwostok freundete sich 2015 ein Tiger namens Amur mit der zugedachten Mahlzeit in Gestalt eines Ziegenbocks an, den man fortan Timur nannte. Monatelang teilten die beiden friedlich ein Gehege, bis es leider nach einigen Monaten friedlichen Zusammenlebens zu einem tragischen Unfall kam. Amur hatte Timur einen Felsen hinuntergestoßen, nachdem dieser ihn stundenlang respektlos drangsaliert und permanent mit den Hörnern angegriffen hatte. Dabei verletzte sich der Ziegenbock ernsthaft und wurde in einer Moskauer Klinik behandelt. Timur verstarb 2019.
2018 erregte in dem albanischen Dorf Patok ein ähnlicher Vorfall internationale Aufmerksamkeit. Eine Familie hatte einen Wolf gefangen und eingesperrt, und weil der Wolf hungrig war. kam man auf die bemerkenswerte Idee, diesem den alten, ausgedienten Esel des Dorfes lebend zum Fraße vorzuwerfen. Und so steckte man den Esel zum Wolf in den Käfig. Doch der Wolf fiel den Esel nicht an, sondern schloss mit diesem eine innige Freundschaft. Auf Druck der Behörden entließ man den Wolf schließlich in die Freiheit und räumte dem Esel einen Gnadenplatz auf einer Weide ein. Nach einer Weile wurde in der Nähe des Esels ein Wolf beobachtet. Offenbar hatte dieser seinen Freund nicht vergessen. Auch aus Indien wurde der Fall eines Leoparden bekannt, der jede Nacht seine Freundin, die Kuh, besuchte und seine Zeit mit ihr verbrachte.
Weltweite Aufmerksamkeit löste 2014 eine Gruppe äthiopischer Löwen aus, als sie ein zwölfjähriges Menschenmädchen aus den Fängen ihrer Entführer befreiten und solange beschützten, bis die Polizei kam. Die Männer hatten das Kind sieben Tage lang festgehalten, bis die Löwen dem Mädchen zur Hilfe kamen und die Entführer verjagten. Medienberichten zufolge passten die Tiere anschließend auf das Mädchen auf, bis die Polizei eintraf und das Kind in Obhut nahm. Das Kind sei von seinen Entführern wiederholt geschlagen worden, sagte ein Polizeisprecher: „Die Löwen haben sie bewacht und sie dann einfach wie ein Geschenk zurückgelassen.“ Wenn die Tiere nicht gekommen wären, hätten die Männer das Mädchen wahrscheinlich vergewaltigt und zwangsverheiratet, hieß es weiter. „Alle glauben, es ist ein Wunder, weil die Löwen normalerweise Menschen angreifen“, so der Sprecher. Manche Zeitgenossen taten sich so schwer mit der Vorstellung, Löwen könnten sich moralisch verhalten, dass sie den klugen Tieren unterstellten, sie hätten das Mädchen mit einem Jungtier verwechselt.
Eine andere Form von Empathie über Artgrenzen hinweg beobachteten Forscher während der Regenzeit in Kenia. Eine schwarze Spitzmaulnashorn-Mutter war mit ihrem Kind an eine Lichtung gekommen, auf der man Salz ausgestreut hatte. Nachdem die Tiere etwas von dem Salz geleckt hatten, ging die Mutter weiter, doch ihr Kind war im tiefen Schlamm steckengeblieben. Es begann zu schreien, seine Mutter kehrte zurück, beschnüffelte und untersuchte es und zog sich daraufhin wieder in den Wald zurück. Das Kalb fing erneut zu schreien an, die Mutter kehrte zurück und zeigte sich so hilflos wie zuvor.
Eine Elefantengruppe erreichte die Salzlecke. Die Nashornmutter griff den Leitbullen an, der auswich und zu einer anderen, dreißig Meter entfernten Salzlecke ging. Beruhigt kehrte die Nashornmutter zur Nahrungssuche in den Wald zurück. Dann näherte sich ein ausgewachsener Elefant mit langen Stoßzähnen dem Kalb und betastete es mit seinem Rüssel. Dann kniete der Elefant nieder und versuchte, seine Stoßzähne unter das Kälbchen zu schieben und es herauszuziehen. Als er das tat, kam die Mutter aus dem Wald angeschossen, so dass der Elefant sich zurückzog. Über mehrere Stunden versuchte er trotzdem immer dann, wenn die Rhinozerosmutter in den Wald zurückgekehrt war, das Kalb aus dem Schlamm zu ziehen, doch immer eilte die Mutter herbei, um ihr Kind zu beschützen. Schließlich gab der Elefant auf und zog mit seiner Herde weiter. Am nächsten Morgen gelang es dem Kalb zum Glück, sich aus eigener Kraft zu befreien und zu seiner wartenden Mutter zu eilen.
Irritierend unempathisch reagieren eher die Menschen auf mitfühlende Tiere – zumindest die sogenannten Fachleute unter ihnen. Am 16. August 1996 eilte die Gorillafrau Binti Jua im Chicagoer Brookfield-Zoo einem dreijährigen Jungen zu Hilfe, der sechs Meter tief in das Primatengehege gestürzt war. Sie nahm ihn auf den Arm und trug ihn vorsichtig zu einer Pforte des Geheges, wo Pfleger den Jungen übernehmen konnten. Die Öffentlichkeit und die Medien feierten Binti Jua als Heldin, während manche Wissenschaftler von einem „verwirrten Mutterinstinkt“ fabulierten. Glücklicherweise bekamen sie auch mächtigen Gegenwind. Wie in aller Welt, schreibt der weltbekannte Verhaltensforscher Frans de Waal dazu, sollte ein so hochintelligentes Tier einen blonden kleinen Jungen in Turnschuhen und einem roten T-Shirt für einen kleinen Gorilla halten? Eigentlich sei das wirklich Erstaunliche an der Sache, wie überrascht die meisten Menschen über die mütterliche Geste der Gorillafrau waren.
Das Mitgefühl der Tiere versuchen Forscher nun auch im Labor zu erkunden und könnten dabei in Sachen Mitgefühl einiges lernen. Zum Beispiel von den als unintelligent und aggressiv verfemten Rhesusaffen: Bei Laborversuchen verhielten diese sich deutlich einfühlsamer als die menschlichen Versuchsleiter. Jedes Mal, wenn sich ein Versuchsaffe per Tastendruck Futter bestellte, wurde ein zweiter Affe mit Elektroschocks malträtiert – und zwar so, dass es der erste mitbekam. Das Ergebnis: Die Affen hungerten lieber, als ihre Artgenossen leiden zu sehen. Nachdem die Affen zwölf Tage nichts gegessen hatten, wurde das Experiment abgebrochen. Wir erinnern uns bei dieser Gelegenheit an die berühmten Milgram-Versuche mit menschlichen Testpersonen: Bei dieser Versuchsanordnung hatte man Probanden weisgemacht, an einem Forschungsexperiment über Lernen und Bestrafung als Assistent zu fungieren. Sie hatten – fingiert – Versuchspersonen im Nebenzimmer Elektroschocks ansteigender Intensität zu verpassen, wenn diese die gestellten Fragen falsch beantworteten. Die Probanden „folterten“ gehorsam. Mehr als 62% waren sogar bereit, tödliche Elektroschocks zu verpassen, wenn der Professor es angewiesen hatte. Noch nicht mal die (vermeintlichen) Schmerzensschreie von nebenan hielten sie ab. Man konnte zwar nachweisen, dass das Verhalten der Probanden wenig mit einer Lust am Quälen und viel mit Obrigkeitshörigkeit zu tun hatte. Aber warum sollte der innere Druck, gehorchen zu müssen, soviel stärker sein als die Qual des Hungerns? Und weil wir gerade bei Elektroschocks sind: Auch Ratten weigern sich rigoros, wenn sie dazu getrieben werden sollen, ihre Artgenossen mit Elektroschocks zu piesacken. Sie helfen auch Artgenossen uneigennützig, wenn sich diese in einer Notlage befinden.
Der Zweck der Lust ist: Lust
Einen geradezu sensationellen Sinneswandel vollzog in den letzten Jahren die Wissenschaft auch beim Thema Sex und Tiere. Ganz selbstverständlich ging man bisher davon aus, dass Tiere es nur der Arterhaltung wegen tun. Noch 1999 empörte das 750seitige Werk Biological Exuberance des Biologen Bruce Bagemihl die Fachwelt: er beschreibt darin die Vielfalt der Homosexualität im Tierreich – und stellte die provokative These auf, es sei Unsinn, beim Anblick schwuler Giraffen oder lesbischer Eichhörnchen über einen rationalen Sinn zu grübeln. Vielmehr sei die Homosexualität Ausdruck der Spielfreude der Natur - mehr nicht. Doch man gewöhnte sich schnell. Schon 2007 beeindruckt in Oslo eine Ausstellung über homosexuelle Tiere und lehrt uns, dass es nicht der Nutzen ist, der Tiere zum Sex treibt, sondern die Freude daran. Bei 1500 Tierarten wurden mittlerweile lesbische und schwule Verbindungen entdeckt. 5% der Enten und Gänse stehen auf gleichgeschlechtliche Partner, jeder 5. Pinguin ist homosexuell, jeder zweite domestizierte Rosenkakadu. Bei Giraffen werden sogar 94% aller Geschlechtsakte unter gleichgeschlechtlichen Partnern ausgeführt. Ein Sinn ist dahinter häufig nicht zu finden.
Auch Onanieren ist weit verbreitet bei Tieren - man hat es unter anderem bei Affen, Hirschen, Tümmlern und Pinguinen beobachtet, bei beiden Geschlechtern. Besonders Orang Utans seien dabei ,,sehr einfallsreich‘‘, berichtet Petter Böckman, verantwortlicher Zoologe einer Ausstellung in Oslo, die sich mit dem Thema Homosexualität bei Tieren beschäftigt. ,,Die machen sich Dildos aus Holz und Rinde.“ Maurice Temerlin, in dessen Haus ein Schimpansenmädchen aufwuchs, berichtet, wie er eines Morgens die Schimpansin Lucie beobachtete, wie sie mit einem eingeschalteten Staubsauger genüsslich masturbierte. Ganz offensichtlich hatte sie auch ihren Spaß mit Pornoheften.
Spaßvögel allüberall