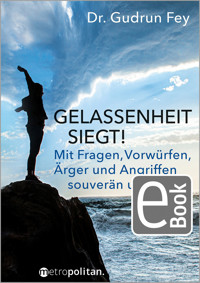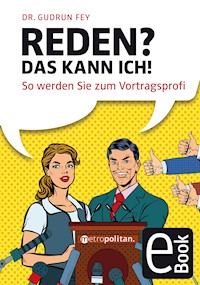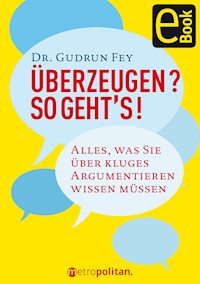
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metropolitan
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Nie mehr um ein gutes Argument verlegen
Jeder hat das schon erlebt: In einem Gespräch, einer Diskussion oder einer Besprechung gehen die Argumente aus. Vom Gegenüber in die Enge getrieben, bleibt man am Ende meist frustriert und verärgert zurück. Doch es geht auch anders.
Dass man auch ohne Sachargumente überzeugt kann, wusste schon Aristoteles. Rhetorik-Expertin Dr. Gudrun Fey knüpft daran an und motiviert, bewährte Techniken und Möglichkeiten vermehrt zu nutzen, um Gesprächspartner selbst ohne spezifisches Wissen für sich zu gewinnen:
- Redensarten und Topoi wirkungsvoll einsetzen
- Sie sind Ihr stärkstes Argument!
- Mit Glaubwürdigkeit und Emotionen überzeugen
- Wer fragt, führt - wer diskutiert, verliert!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
2. Auflage
© WALHALLA Fachverlag, Regensburg
Dieses E-Book ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe oder Leihe an Dritte ist nicht erlaubt. Auch das Einspeisen des E-Books in ein Netzwerk (z. B. Behörden-, Bibliotheksserver, Unternehmens-Intranet) ist nicht erlaubt. Sollten Sie an einer Serverlösung interessiert sein, wenden Sie sich bitte an den WALHALLA-Kundenservice; wir bieten hierfür attraktive Lösungen an (Tel. 0941/5684-210).
Hinweis: Unsere Werke sind stets bemüht, Sie nach bestem Wissen zu informieren. Eine Haftung für technische oder inhaltliche Richtigkeit wird vom Verlag aber nicht übernommen. Verbindliche Auskünfte holen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Rechtsanwalt ein.
Kontakt: Walhalla Fachverlag Haus an der Eisernen Brücke 93042 Regensburg Tel. (09 41) 56 84-0 Fax. (09 41) 56 84-111 E-Mail [email protected] Web
Kurzbeschreibung
Nie mehr um ein gutes Argument verlegen
Jeder hat das schon erlebt: In einem Gespräch, einer Diskussion oder einer Besprechung gehen die Argumente aus. Vom Gegenüber in die Enge getrieben, bleibt man am Ende meist frustriert und verärgert zurück. Doch es geht auch anders.
Dass man auch ohne Sachargumente überzeugt kann, wusste schon Aristoteles. Rhetorik-Expertin Dr. Gudrun Fey knüpft daran an und motiviert, bewährte Techniken und Möglichkeiten vermehrt zu nutzen, um Gesprächspartner selbst ohne spezifisches Wissen für sich zu gewinnen:
Redensarten und Topoi wirkungsvoll einsetzenSie sind Ihr stärkstes Argument!Mit Glaubwürdigkeit und Emotionen überzeugenWer fragt, führt - wer diskutiert, verliert!Autor
Dr. Gudrun Fey gehört zu den erfahrensten und renommiertesten Trainerinnen für Rhetorik und Kommunikation in Deutschland. Ende 2017 schied sie als geschäftsführende Gesellschafterin von study & train, Gesellschaft für Weiterbildung mbh in Stuttgart, aus.
Schnellübersicht
Vorwort
1. Tatsachen, Fakten, Bewertungen und Meinungen
2. Was Menschen überzeugt
3. Der Überzeugungsprozess als Trichter
4. Klug argumentieren
5. Plausibilität überzeugt
6. Emotionen beeinflussen
7. Werte und Taten überzeugen
8. Die Macht der Worte nutzen
9. Wer fragt, führt
10. Umgang mit Einwänden und Gegenargumenten
11. Womit Sie noch überzeugen
12. Welche Lösungen gibt es außerdem?
13. Beispiele: So können Sie überzeugen
14. Reife Abwehrleistung – aber gekonnt!
Nachwort
Nie mehr um ein gutes Argument verlegen
Wenn Wissen Macht wäre, müssten doch Sach- und Fachargumente immer wirken – oder? Trotzdem merken wir häufig, dass die Menge unserer Informationen und die Macht unseres Wissens die gewünschte Wirkung verfehlen. Es muss demnach noch Mächtigeres in der Kommunikation geben. Es ist die Plausibilität. Denn etwas, das plausibel ist, muss nicht bewiesen werden. Und genau diese Überzeugungskräfte erschließt Ihnen dieses Buch.
Das bedeutet nicht, dass Sie jetzt über alles Mögliche schwafeln oder sub- jektive Eindrücke als „alternative Fakten“ verkaufen sollen, um zu überzeugen.fn1 Denn wenn es nachweisbare Tatsachen gibt, die etwas anderes belegen, gefährdet dies Ihre Glaubwürdigkeit. Robert Bosch, der Gründer der Robert Bosch GmbH, hat erkannt: „Geld verloren, nichts verloren. Vertrauen verloren, alles verloren.“
Vertrauen gewinnen wir einerseits durch richtige und belegbare Informationen, andererseits durch unser Auftreten und eine überzeugende Form der Kommunikation: kluge, einfühlsame und wahrhaftige Redekunst – erfolgreiche Rhetorik! Deswegen möchte ich Ihnen hier kompakt und leicht lesbar die wichtigsten Helfer aus dem klassischen und modernen rhetorischen und psychologischen Instrumentarium vermitteln. Schon mit ein wenig Übung und Konsequenz können Sie Ihrer Meinung öfter Gehör verschaffen und auf Basis gegenseitigen Respekts die Kommunikation mit anderen Menschen in Ihrem Sinne beeinflussen.
Sie selbst sind Ihr stärkstes Überzeugungsmittel! Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit sind Ihr größtes Kapital. Setzen Sie es klug und gezielt ein! Denn so werden Sie mit den in diesem Buch aufgeführten Möglichkeiten häufiger und leichter überzeugen. Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg.
Wenn Sie für einen bestimmten Sachverhalt noch Argumente benötigen, schreiben Sie mir: [email protected] – Ich helfe Ihnen gern.
Gudrun Fey
Die Beraterin des US-Präsidenten Donald Trump Kellyanne Conway hat diesen Begriff eingeführt.
1. Tatsachen, Fakten, Bewertungen und Meinungen
Wie entstehen Meinungen oder Überzeugenen?
Wann Fakten überzeugen
Vom Besonderen auf das Allgemeine schließen – und umgekehrt
Kann man andere überhaupt überzeugen?
Mit Tatsachen Geschichten erzeugen
Je mehr Argumente, desto besser?
Menschenkenntnis bringt´s
Wie schnell kann man überzeugen?
Wann ist man überzeugt?
Mit der Wahrheit überzeugen?
Muss man immer nach seiner Überzeugung handeln?
Wie entstehen Meinungen oder Überzeugenen?
Sobald diese Frage geklärt ist, fällt es Ihnen leichter, Meinungen und Überzeugungen anderer zu beeinflussen oder zu ändern.
Aristoteles stellt in seiner Schrift „De anima“ fest: „Nichts ist im Verstand/Geist, was nicht zuvor in den Sinnen war.“ Alles, was wir mit unseren Sinnen (Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Berühren) wahrnehmen, landet – wie man heute weiß – zuerst im Kurzzeitspeicher des Gehirns. Doch nur das Wenigste davon wird einem bewusst, da nur wahrgenommen wird, was von momentanem Interesse ist.
Wenn ich Sie beispielsweise bitte, auf Ihre Armbanduhr zu sehen und mir deren Ziffernblatt zu beschreiben, können Sie das, nachdem Sie wieder aufgesehen haben, sicherlich auch. Frage ich Sie jetzt, wie spät es genau ist, wissen Sie das in der Regel nicht, weil Sie sich nur auf das Aussehen des Ziffernblatts konzentriert haben.
Oder stellen Sie sich folgende Szene vor: Sie fahren mit Ihrem Auto bei einsetzender Dämmerung mit eingeschalteten Scheinwerfern. Nun werden Sie in Ihrer Umgebung nur das sehen, was die Scheinwerferkegel beleuchten. Alles andere nehmen Sie zwar trotzdem wahr, aber eben nicht bewusst. Zauberkünstler machen sich genau dieses Phänomen zunutze, indem sie die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf Unwichtiges lenken.
Das, was letztlich den Kurzzeitspeicher in Bruchteilen von Millisekunden passiert, landet im limbischen System und wird dort im Hippocampus, der „Bewertungszentrale“, emotional eingefärbt, bevor es seinen endgültigen Speicherort im Gehirn erhält. Solche Bewertungen können sein: gut – schlecht, angenehm – unangenehm, süß – sauer, kalt – heiß usw. Geht von dem, was den Kurzzeitspeicher passiert hat, augenblicklich eine Gefahr aus – wenn etwa eine Schlange registriert wird –, kommt es im limbischen System nicht zu einer sofortigen Aktivierung des Hippocampus, sondern der Amygdala, des Mandelkerns. Dort werden Ereignisse, die wir als bedrohlich und damit als negativ bewerten, sogar dauerhaft gespeichert. Sofort im Anschluss wird der ganze Körper in einen Alarmzustand versetzt, vor allem bei der Ausschüttung des Stresshormons Adrenalin. Signalisiert dann nach Prüfung mit den über Schlangen gespeicherten Informationen das Langzeitgedächtnis „Moment, das ist eine harmlose, ungefährliche Blindschleiche“, beruhigt sich das ganze System wieder.
Es macht durchaus Sinn, dass alles, was unser Wahrnehmungsvermögen im Gehirn blitzschnell registriert, zugleich auch bewertet wird. Denn es gab und gibt noch immer Situationen, in denen das instinktive Einschätzen das Überleben sichert: Gefährlich oder nicht gefährlich, spontan reagieren oder abwarten, Feind oder Freund?
Bewertungen sind jedoch nicht in Stein gemeißelt. So kann eine neue Liebe zuerst der Traumprinz oder die Traumprinzessin sein und nach näherem Kennenlernen zum größten Schuft oder zur treulosen Tomate mutieren. Geändert hat sich meist nicht dieser Mensch, sondern wie man diese Person jetzt wahrnimmt und bewertet. Deshalb können schlimme Ereignisse oder Erfahrungen, die jemand in seiner Kindheit gemacht hat, nicht völlig gelöscht werden. Sie verblassen mit der Zeit oder können im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung so umgedeutet werden, dass der oder die Betroffene besser damit umzugehen weiß.2„Bewerten“ kann also auch ein „Umdeuten“ sein.
Das bedeutet, dass alles, was man überhaupt bewusst wahrnimmt, bewertet wird. Deshalb ist es naiv zu glauben, man könnte ohne Vorurteile durch das Leben gehen. Die wahre Klugheit besteht darin, genau das zu akzeptieren. So kann man sich seinen Vorurteilen stellen, sie überprüfen und gegebenenfalls ändern. Bereits als Hans-Georg Gadamer die Hermeneutik, die Lehre vom Auslegen und Verstehen, entwickelte, wurde vielen klar, dass alles, was wir wahrnehmen, gefiltert wird und letztlich nur aus dem Kontext heraus verstanden werden kann.
Die inzwischen durch die Hirnforschung gesicherte Tatsache, dass es keine auf Anhieb objektiven Erkenntnisse gibt, ist „starker Tobak“ für alle, die daran glauben oder glaubten. Dazu gehören viele Philosophen, wie etwa René Descartes oder Immanuel Kant. Es ist aber stets möglich, seine als wahr empfundenen Erkenntnisse zu überprüfen und zu objektivieren.
„Umdeuten bedeutet …, den begrifflichen und gefühlsmäßigen Rahmen, in dem eine Sachlage beurteilt wird, durch einen anderen zu ersetzen, der den ‚Tatsachen‘ der Situation ebenso gut oder sogar besser gerecht wird und dadurch ihre Gesamtbedeutung ändert.“ In: Watzlawick, Paul: Wenn du mich wirklich liebtest, würdest du gern Knoblauch essen.
Vom Besonderen auf das Allgemeine schließen – und umgekehrt
Wenn Sie also jemand von etwas überzeugen möchten, werden Sie schon festgestellt haben, dass die meisten Menschen zu dem entsprechenden Thema oder Sachverhalt bereits eine Meinung haben.
Oft wird jedoch – ausgehend von einem Einzelfall oder einigen wenigen Fällen – eine allgemeine Aussage getroffen. Fragt man jemanden zu einem bestimmten Thema nach seiner Meinung, bekommt man zwar manchmal die Antwort „Ich habe keine“, doch bedeutet das nur, dass sich dieser Mensch noch nicht mit diesem Thema beschäftigt hat, denn sonst hätte er eine. Warum? Die Meinungsbildung, sprich die Bewertung von Sachverhalten oder Menschen, vollzieht sich außerordentlich rasch. Meist genügen dafür wenige Fakten. Wie Sie inzwischen wissen, hängt das damit zusammen, dass alles, was in unserem Gehirn dauerhaft gespeichert werden soll, zuerst im limbischen System bewertet wird.
Nehmen wir folgendes Beispiel: Ein deutscher Vermieter hat einst mit einem italienischen Mieter schlechte Erfahrungen gemacht. Wird er die Wohnung erneut an einen Italiener vermieten? Wohl kaum. Selbst wenn er weiß, dass er hier „vom Besonderen aufs Allgemeine“ schließt. Man nennt dies einen induktiven Schluss. Natürlich kann es auch umgekehrt sein. Wenn der Vermieter gute Erfahrungen mit einem Italiener gemacht hat, wird er die Wohnung später höchstwahrscheinlich gern wieder an einen Italiener vermieten. Doch der Schluss, dass auch dieser Italiener ein angenehmer Mieter sein wird, ist genauso falsch wie das Gegenteil.
Man wird jedoch selbst feststellen, dass es ungeheuer schwierig ist, sich gegen solche Schlussfolgerungen innerlich zur Wehr zu setzen. Deshalb ist das Verallgemeinern beim Überzeugen eine wichtige Strategie, auch wenn sie von der klassischen Logik aus betrachtet als Fehlschluss gilt.
Ebenso logisch falsch ist der Schluss „vom Allgemeinen aufs Besondere“, der deduktive Schluss. Dieses Phänomen lässt sich häufiger in TV-Talkshows beobachten. Wenn sich die Beteiligten aufregen, neigen sie häufiger zu Verallgemeinerungen. Das zeigt sich beispielsweise an Wörtern wie „alle“, „jeder“, „niemand“ oder „nie“ und „immer“.
„Bei unserer ungesunden Lebensweise leiden wir alle mit 70 Jahren an Bluthochdruck. Wenn alle täglich Sport treiben würden, wären wir alle bis ins hohe Alter gesund.“
Da man einen induktiven ebenso wie einen deduktiven Schluss sehr leicht durch ein einziges Gegenbeispiel entkräften kann, ist es sinnvoll, sich differenziert auszudrücken: Das bedeutet nichts anderes als die Verwendung einschränkender Wörter wie „grundsätzlich“, „meist“, „in der Regel“, „normalerweise“, „oft“ oder „üblicherweise“.
Sowohl ein induktiver Schluss als auch ein deduktiver Schluss, der meist auf persönlichen Erfahrungen beruht, führen zur Bildung bestimmter, generalisierter Meinungen und Überzeugungen. Um sie gegebenenfalls zu erschüttern, genügt ein einziges Gegenbeispiel.
Kann man andere überhaupt überzeugen?
Nun, wenn Sie nicht dieser Meinung wären, dann hätten Sie vermutlich dieses Buch nicht gekauft. Rhetorik wird von vielen als „die Kunst zu überzeugen“ verstanden. Damit wird die Vorstellung geweckt, man könne, wenn man es nur richtig anstelle, Menschen so weit bringen, genau das zu tun, was man von ihnen will, vergleichbar mit der Kunst eines Schlangenbeschwörers.
Diese Meinung vertraten im antiken Griechenland die Sophisten. Sie behaupteten, dass es sogar möglich sei, zu einem Sachverhalt (wie etwa „Soll man an einem bestimmten Ort einen neuen Tempel für Athene bauen oder nicht?“) zwei argumentativ gleichermaßen überzeugende Reden zu halten. Das führten sie auch einer staunenden Menge auf dem Marktplatz von Athen vor. Darüber hinaus waren sie der Meinung, man benötige keine Fachkenntnisse, um zu überzeugen, da man genauso gut mit Wahrscheinlichkeit und Plausibilität überzeugen könne. Der bekannte Redner und Sophist Gorgias (der dem von Platon niedergeschriebenen Dialog seinen Namen gab) behauptete, derjenige, der die Rhetorik beherrsche, könne besser überzeugen als ein Arzt mit seinen Fachkenntnissen. Sein Gegner Sokrates wollte in diesem Dialog beweisen, dass die sophistische Rhetorik ein übles Manipulationsinstrument ist.4 Wie schaffte er das? Durch penetrantes Fragen. Denkt man an die heutigen Populisten aller Parteien, die mit Fake News, alternativen Fakten und üblen Beschimpfungen ihre Ziele erreichen wollen, wären auch hier bohrende Fragen ein probates Mittel, sie zu entlarven.
Aristoteles vertrat eine gegenteilige Meinung. Er erkannte, dass man niemanden überzeugen kann, sondern jeder Mensch sich selbst überzeugt. Das wird, wie eingangs geschildert, gegenwärtig von der Hirnforschung bestätigt. Als Beweis führt er an, dass auch kein Arzt in der Lage ist, einen Menschen zu heilen.5 Er kann aber die richtige Behandlung und die richtigen Medikamente verschreiben, um in einem Menschen den Heilungsprozess auszulösen. Denn gesund werden muss letztlich jeder selbst. Deshalb gibt es auch Spontanheilungen, die sich wissenschaftlich nicht erklären lassen.
Große Irritation löste vor etlichen Jahren das Buch „Mythos Motivation“ von Reinhard K. Sprenger aus. Bis dahin glaubten Führungskräfte und andere, dass man neben der extrinsischen Motivation, also zum Beispiel aufgrund eines höheren Gehalts, mittels Prämien oder Statussymbolen, auch die intrinsische Motivation der Mitarbeitenden wecken könne, etwa indem man attraktive Aufgaben vergebe oder mehr Verantwortung übertrage. Doch auch hier gilt, dass man lediglich ein motivierendes Umfeld schaffen kann, motivieren muss sich letztlich jeder selbst.
Wenn es um Gefühle geht, kann man sich einem Menschen gegenüber, in den man sich verliebt hat, zwar „liebenswürdig“ verhalten. Doch auch hier werden Sie nicht in der Lage sein, die andere Person zwangsweise davon zu überzeugen, sich ebenfalls in Sie zu verlieben.
Eine Freundin von mir lernte einen angenehmen und sympathischen Menschen kennen, der sich in sie verliebte. Er zeigte sich ihr gegenüber äußerst großzügig und überhäufte sie mit Geschenken. Das gefiel ihr sehr, zumal ihr so etwas noch nie im Leben passiert war. Sie mochte ihn auch wirklich gern und versuchte, sich in ihn zu verlieben. Doch es funktionierte nicht und nachdem er seine Enttäuschung überwunden hatte, schaffte sie es, mit ihm freundschaftlich verbunden zu bleiben.
Insgesamt gesehen ist es jedoch gut, dass es die Grenzen der Überzeugung gibt, denn sonst wäre die Rhetorik noch gefährlicher, als sie es manchmal schon ist. Deshalb wurden im antiken Griechenland viele Rhetoriklehrer ins Exil verbannt, um diese gefährliche Kunst nicht weiterverbreiten zu können. Doch mit einem Verbot des Rhetorikunterrichts erreicht man gar nichts, da grundsätzlich – wie schon Aristoteles bemerkte – jeder Mensch über rhetorische und dialektische Fähigkeiten verfügt. Diese kann man auch ohne ent- sprechenden Unterricht selbst weiterentwickeln, wenn man seine Überzeugungsversuche jeweils hinterher analysiert und erkennt, was überzeugend war und was nicht, beziehungsweise Letzteres zu optimieren versucht.
Leider sind die Überzeugungsmöglichkeiten manchmal schneller ausgeschöpft, als einem lieb ist. Enttäuschung macht sich breit. Denn wenn man jemanden überzeugen möchte, meint man es in der Regel auch gut mit dieser Person. Doch schon Kurt Tucholsky erkannte: „Das Gegenteil von Gut ist nicht Böse, sondern gut gemeint.“
Sie können zum Beispiel niemanden gegen seine Interessen überzeugen. Das heißt jedoch nicht zwangsläufig, dass diese Person nicht das tut, was Sie von ihr wollen.6 Das Arbeitsleben funktioniert häufig auf diese Weise. Im Frühling, wenn die Sonne vom Himmel lacht und es schön warm ist, würden Sie am liebsten nach draußen ins Freie gehen und einen ausgedehnten Spaziergang im nahegelegenen Park unternehmen. Doch machen Sie das wirklich? Vermutlich nur dann, wenn Sie es sich erlauben können. Müssen Sie allerdings noch dringend eine berufliche Aufgabe erledigen, werden Sie auf den Spaziergang verzichten.
Das bedeutet: Es liegt ganz allein an Ihnen, ob Sie sich von etwas oder jemandem überzeugen lassen.7Allerdings sollte man erkennen, dass man manchmal nur der Meinung ist, man hätte aus freien Stücken entschieden, und wurde in Wirklichkeit manipuliert. Doch es ist nicht Thema dieses Buches, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob und inwieweit der Mensch überhaupt einen freien Willen hat oder nicht. Wichtig ist hier nur, dass Sie den Eindruck haben, Sie hätten ohne innere und äußere Zwänge entschieden. Wenn man Menschen nicht überzeugen kann, lassen sie sich manchmal zumindest überreden und überrumpeln, erpressen oder „kaufen“. Doch ob das gut und richtig ist, obliegt erneut Ihrer Entscheidung. Ich hingegen möchte Ihnen möglichst viele Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie jemanden – auch ohne Sachargumente – zu Ihrer Meinung hinführen können.
Sie können Menschen mit den Möglichkeiten der Rhetorik und Psychologie zu einer Überzeugung hinführen, doch jeder überzeugt sich letztlich selbst.
Hierzu muss man noch wissen, dass es im Altgriechischen für die beiden Begriffe „überzeugen“ und „überreden“ nur ein Wort gab, nämlich „peithein“ (πεíθειν).
5Vgl. Aristoteles, Rhet. 1355b
6Vgl. Seite 134
7Mehr dazu in Kapitel 12, Die „Kompass-“ oder die Akzeptanzlösung
Mit Tatsachen Geschichten erzeugen
Im Berufsleben kommt es öfter vor, dass man in Kundengesprächen oder Präsentationen von etwas überzeugen soll, von dem man selbst nicht besonders überzeugt ist.
Angenommen, Sie sollen Neukunden ein technisch veraltetes Smartphone, verkaufen, weil davon noch so viele auf Lager liegen. Als ein an modernster Technik interessierter Verkäufer könnten Sie dabei ein schlechtes Gewissen bekommen, weil es jetzt Smartphones mit deutlich verbesserten und neuen Funktionen auf dem Markt gibt. Wenn Sie jedoch davon ausgehen, dass nicht alle Kunden immer nur das neueste Produkt haben wollen, sondern viele ein bewährtes, eingeführtes und für ihre Zwecke optimales Smartphone erwerben möchten, das darüber hinaus auch noch kostengünstiger ist, können Sie diesen Kunden auch ein älteres Gerät sehr überzeugend verkaufen. Probleme gibt es nur dann, wenn Sie erwarten, dass alle Menschen so denken und handeln wie Sie.
Solange Sie Ihren Standpunkt als den „allein selig machenden“ einschätzen, werden Sie ein Problem damit haben, den Standpunkt der Geschäftsleitung überzeugend zu vertreten.8
Erkennen Sie Ihren Standpunkt jedoch als einen möglichen unter vielen anderen an, ist es denkbar, sich für die Dauer der Präsentation und der Durchführung der Maßnahme mit dem Standpunkt des Unternehmens zu identifizieren – denn völlig abwegig ist dieser Standpunkt doch nicht, oder?
Außerdem ist es normal, dass Sie als Mitarbeiter andere Interessen haben als Ihre Vorgesetzten. Natürlich decken sich einige dieser Interessen, schließlich dürften Sie genauso Interesse daran haben, dass das Unternehmen am Markt erfolgreich agiert. Da Sie sich zur Loyalität gegenüber Ihrem Unternehmen verpflichtet haben, sollte es möglich sein, auch dessen Interessen zu vertreten. Natürlich hat Loyalität ihre Grenzen. Entscheiden Sie daher stets danach, was für Sie moralisch vertretbar ist. Sollen Sie beispielsweise daran mitwirken, einen älteren, nicht mehr ganz so leistungsfähigen kranken Mitarbeiter „aus der Firma zu ekeln“, wird hier sicher für die meisten eine Grenze überschritten.
Man muss nicht hundertprozentig von etwas überzeugt sein, um andere überzeugen zu können. Wichtig ist, dass Sie sich soweit mit einem anderen Standpunkt identifizieren, um ihn glaubwürdig vertreten zu können.
Vgl. Seite 134
Je mehr Argumente, desto besser?
Oft besteht der Irrglaube, je mehr Argumente man habe, desto leichter könne man überzeugen. Es ist jedoch nicht die Vielzahl der Argumente, die beeinflusst Bei vielen Argumenten steigt lediglich die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein oder zwei Argumente unter ihnen finden, die andere umstimmen. Da man beispielsweise bei einem Vortrag mit einer heterogenen Gruppe nicht weiß, wen welches Argument überzeugt, ist die Strategie „Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen“ 9 absolut richtig.
Es lohnt sich also generell, eine Liste mit Argumenten zu erstellen, um schließlich für die jeweilige Zielgruppe die drei auszuwählen, die am wahrscheinlichsten überzeugen werden. Um das herauszufinden, empfiehlt es sich, Mitglieder der entsprechenden Zielgruppe zu befragen, was sie überzeugen würde. Bringen Sie nämlich zu viele Argumente, erzeugen Sie einen sogenannten Overkill-Backfire-Effekt, das heißt „einen Schuss in den Ofen“. Ihre Argumente verpuffen, weil die andere Person gar nicht mehr zuhört oder sich das Argument herauspickt, das sie am besten zerpflücken kann.
Man überzeugt deshalb selten mit Quantität, manchmal ist allein die Qualität ausschlaggebend: Einem hungrigen Menschen verkaufen Sie für eine bestimmte Summe Geld eher ein großes Stück Kuchen als ein kleines Stück von höherer Qualität. Ist er jedoch satt, legt er mehr Wert auf andere Kriterien. Deshalb muss es so attraktiv aussehen, dass ihm beim Anblick der Schwarzwälder Kirschtorte schon das Wasser im Munde zusammenläuft.
Goethes Faust, V. 97, Vorspiel auf dem Theater
Menschenkenntnis bringt´s
Überzeugen können hat sehr viel mit Menschenkenntnis zu tun. Denn Menschen haben unterschiedliche Werte. Wenn man eine einzelne Person zu einer Überzeugung hinführen möchte, wäre es Zeitverschwendung, Argumente zu bringen, die diese Person nicht interessieren. Denn was nützen Argumente, die für Eltern schulpflichtiger Kinder überzeugend sind, wenn Sie vor Bewohnern eines Pflegeheims sprechen.
Ob Sie überzeugen oder nicht, hängt folglich weniger von Ihnen und Ihren Argumenten ab, sondern vielmehr davon, ob es Ihnen gelingt, Ihr Gegenüber richtig einzuschätzen. Über diese Eigenschaft – Empathie genannt – ist es möglich, sich in andere Menschen hineinzuversetzen.