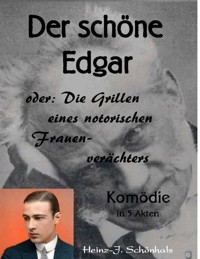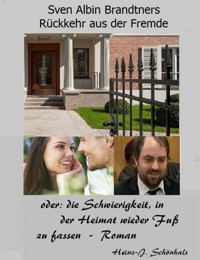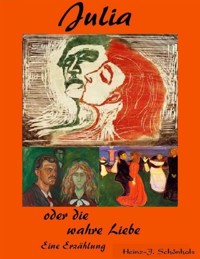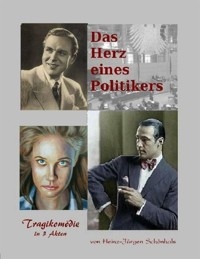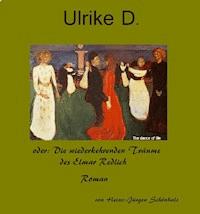
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In diesem Entwicklungsroman erinnert sich Elmar Redlich verschiedener Ereignisse seines Lebens. Dabei macht er eine merkwürdige Erfahrung: Obwohl er an sich die Dinge aus der Perspektive der Vernunft betrachtet, kann er die irrationale Vorstellung nicht ganz unterdrücken, unser aller Leben sei letztlich von einer anonymen Schicksalsmacht, der wir ausgeliefert sind, beeinflusst, und zwar nach Maßgabe der Schuld, die wir auf uns geladen haben. Gleich am Anfang taucht dieses irrationale Phänomen in Gestalt seltsamer, wiederkehrender Träume auf, in welchen dem Protagonisten ein Mädchen namens Ulrike D. erscheint, eine flüchtige Bekannte seiner Jugendzeit. Manchmal auch starrt ihm in diesen Träumen ein junger, unbekannter Mann mit unheimlichem Blick entgegen. Er meint, irgendein Schuldkomplex sei Auslöser dieser Träumerei. - Eine Reise in die alte Heimat (Waldstädten) stellt Elmar eine Wiederbegegnung mit seiner früheren Verlobten Julia in Aussicht. Seine Alpträume bringt er auch mit dem einstigen Zerwürfnis zwischen Julia und ihm in Verbindung. Elmar hat das Gefühl, Julia wolle zu ihm zurückkehren und ihm eine neue Heimat ermöglichen, die er bei seiner Familie nicht mehr findet; seine Ehe mit Lisi befindet sich in einer Krise. - Das Motiv der Schuld taucht auch in zwei anderen Ereigniskomplexen, ebenfalls zu Beginn des Romans, auf: Zuerst erinnert sich Elmar einer Katastrophe seines Lebens: Er war einmal fürchterlich "unter die Räder gekommen" und führte seit jeher diesen "Absturz" auf eine Strafe Gottes zurück. Doch außer irgendwelcher "Unkorrektheiten" fällt ihm als "Schuld" nichts weiter ein. Zum anderen denkt er an ein Gemälde, das ein Ereignis aus der Kleistnovelle "Bettelweib von Locarno" wiedergibt. Auch hier wird ein Mensch vom Schicksal furchtbar heimgesucht, aber eine Schuld des Mannes ist kaum ersichtlich, obwohl dem Leser der Novelle eine solche Schuld ständig nahegelegt wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 915
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinz-Jürgen Schönhals
Ulrike D.
oder: Die wiederkehrenden Träume des Elmar Redlich
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Eine Reise zu Verwandten
Rückkehr in die alte Heimat
Die Erzählung von der verlassenen Braut
Der Runenweiher
Der Jugendfreund
Der Pfadfinder
Osterlager in Haus ’Sternbald’
Berichte über gute pfadfinderische Taten
Erster Bericht: Die fatale Lydia
Zweiter Bericht: Der unsympathische Amtsgerichtsrat
Die Warnungen des ehemaligen Pfadfinders
Der brutale Mathematiklehrer
Abschied von der Pfadfinderzeit
Die Prüderie der Fünfziger Jahre
Julia
Das Tanzfest
Waldwanderung oder die Suche nach der seltenen Wildtulpe
Gustav Höhne und sein unvollendeter ’Orpheus’ - Roman
Cousin Hermann Beyer
Die Kriegserzählungen des Cousins
Julia zum Zweiten
Neue Bekanntschaften auf der Universität
Der mühsam geknüpfte Gesprächsfaden
Das Misstrauen
Ulrike D. und die Examensfeier bei Joachim Schaller
Irritierende Gerüchte
Unheimliche Orte
Ende eines Kapitels und Neuanfang
Studentin Iris Bürgel
Djamila Kermali oder die empfindsame Seele eines alternden Mannes
Noch einmal Iris Bürgel
Professor Dr. jur. Gebhard Wölfel
Schuldgefühle und die Beschwörung der Liebe Gottes
Und wieder: Julia
Erinnerungen an Ulrike D.
Impressum neobooks
Eine Reise zu Verwandten
Manchmal werden wir von Träumen behelligt, die uns seltsam abergläubisch berühren, weil sie uns wie Projektionen in die dunkle Zukunft vorkommen, als ob jemand das Buch unseres Lebens aufblättert und die noch unbekannten Seiten unserem träumenden Ich entgegenhält. Andere solcher lästigen Träume wiederum lassen fatale Ereignisse unserer Vergangenheit vor unserem träumenden Auge erscheinen, nicht selten in lebhaften, scharf gezeichneten Bildern, und falls es öfter geschieht, spekulieren wir in gleicher Weise, ob hier nicht unbewältigte Konflikte in unserer Seele rumoren oder ein Trauma unserer Vergangenheit, das sich irgendwo in unserer Seele eingenistet, beunruhigende Signale sendet, wie aus einer eingebauten, nicht zur Ruhe kommenden Störquelle.
Von diesen Letzteren wurde Elmar Redlich seit einiger Zeit in Unruhe versetzt, und zwar umso stärker, je mehr sich diese Träume auf unheimliche Weise ähnelten. Wiederholt träumte er, er forsche nach der Adresse von Julia Lambertz, seiner früheren Verlobten. Irgendwo im Norden, bei Hamburg, soll sich ihre Lebensspur verlieren, hatte er herausgefunden - im Traum! Dabei wusste er genau, wo Julia heute wohnt: in einer Stadt in Bayern, und sie ist dort verheiratet und hat eine Tochter mit Namen Jana. Manchmal erschien Julia auch selbst in diesen Träumen, aber mit eigenartig verändertem Aussehen: Zunächst glaubte er immer, er träume von seiner einstigen Verlobten, doch plötzlich glichen ihre Züge einer ganz anderen Person, die er aus früheren Zeiten ebenfalls kannte, allerdings nur flüchtig, denn nur hin und wieder war sie am Rande seines jugendlichen Bekanntenkreises aufgetaucht. Sie hieß Ulrike Düsterwald. Meistens wurde sie Ulrike D. genannt, wegen des langen und düsteren Nachnamens.
Noch eine andere Variante gab es bei dieser Träumerei, seltener allerdings, bisher eigentlich nur zwei- oder dreimal: Die Person, die ihm im Traum erschien, war dann nicht Julia oder Ulrike, sondern ein ihm völlig unbekannter junger Mann. Er wie auch Ulrike warfen Elmars träumendem Ich zuweilen kalte, drohende Blicke zu, und sofort wachte er danach immer auf, tief erschrocken, ja durch den kalten Strahl dieser Augen geradezu erschauert.
Da er immer wieder in dieser alptraumhaften Weise träumte und stets von den gleichen unnützen Gedanken hinterher belästigt wurde, überlegte er, ob er nicht einen Psychologen oder Therapeuten zu Rate ziehen sollte, der ihm diese seltsame Träumerei erklärte und ihn möglichst davon befreite. Doch rasch verwarf er den Plan wieder; er kam ihm albern vor. Außerdem ließ er nur ungern jemanden in seiner Vergangenheit herumspähen. Denn darauf lief es doch hinaus: Der Therapeut witterte irgendein Trauma, das er, Elmar, nicht verarbeitet hatte und das nun in aberwitzigen Träumen ständig wiederkehrend Gestalt annahm. Elmar stellte sich schon vor, wie der Psychologe mit penetranten Fragen forschend in sein Innerstes drang:
’In welcher Beziehung standen Sie, außer zu Ihrer Verlobten, zu dieser Ulrike oder zu diesem jungen Mann, Herr Redlich? Warum blicken Ulrike und der jungen Mann Sie immer so vorwurfsvoll an? Gibt es hier etwas, was Sie mir verschweigen?“
So oder ähnlich oder auch zurückhaltender wird der Therapeut vermutlich seine psychologische Untersuchungstechnik bei ihm erproben und dann mit seinen Ausführungen vielleicht so fortfahren:
„In der Jugend, Herr Redlich, reagiert man oft falsch, man ist naiv, weltunerfahren, bar jeder Menschenkenntnis und als junger Mann selbstverständlich auch bar jeder Kenntnis der Mädchen- und Frauenseele. So haben Sie sich Ihren Mitmenschen gegenüber ganz sicher nicht immer richtig verhalten, Sie haben sich in einem gewissen Sinne schuldig gemacht, schuldig nicht im moralischen Sinne, nein, das ist nicht gemeint! Sondern schuldig im - sagen wir einmal - existentiellen Sinne, und jetzt quillt diese ’Schuld’ in Form von Alpträumen aus Ihrem Unterbewusstsein hervor. Ihre Seele, Herr Redlich, ist diesem Schuldgemenge nicht mehr gewachsen!’
“Garantiert interessieren den Mann alle Details meiner früheren Beziehungen zu Mädchen, zu Frauen“, sprach Elmar leise zu sich, “auch das 'Existentiell-Schuldhafte' würde er ganz sicher mit einer Akribie aus den entlegensten Abstellkammern meiner Seele hervorzerren und inspizieren, dass am Ende dieser Prozedur der ganze stickige Qualm der Schuldgefühle aus meiner Seele entweicht, wie die verdorbene Luft aus einem prall gefüllten Säckchen. Anschließend wird er dann zu mir sagen, im Tone der Selbstgewissheit: ’Die Prozedur hat Erfolg gehabt, Herr Redlich. Sie sind von Ihren Alpträumen befreit!’“
„Oder auch nicht!“, setzte Elmar hinzu, jetzt mit lauter, aufbrausender Stimme, denn das Argumentieren des Psychologen - so wie er es sich vorstellte - hatte ihn wütend gemacht. Nach einigem Nachdenken fuhr er im entschiedenen Tone fort: „Nein, diese wahrscheinlich teure Rosskur kommt für mich nicht in Frage! Ich mach’ es anders: Ich forsche selbst nach den Ursachen. Indem ich die wichtigsten Vorkommnisse meiner Vergangenheit untersuche, stoße ich ganz von selbst auf die genannte Störquelle, und durch eine akribische Untersuchung im Umfeld der „Quelle“ befreie ich mich von meinen Alpträumen, oder anders gesagt: ich drehe dem Störsender mit einem erlösenden Handgriff den Strom ab; schon ist meine Seele entlastet, schon hat mein Gehirn keinen Anlass mehr, mich weiter mit unangenehmen Träumen zu belästigen.“
Allerdings, da gab es ein Hindernis: Elmar Redlich blickte nicht gerne zurück. Allenfalls tat er es unfreiwillig, bei einem Treffen mit alten Freunden, wenn sentimentale Erzählungen und der Zauberer Alkohol seine Seele übertölpelten. Im nüchternen Zustand kam ihm die Vergangenheit immer wie eine verstaubte Dachkammer vor, in die hineinzugehen er nicht die geringste Lust verspürte. Denn was erwartete ihn dort anderes als der trostlose Anblick eines Bereichs, wo altes Zeug, Sperrmüll und Plunder, herumsteht und herumliegt, was ihm früher einmal - unverbraucht und neu - etwas bedeutete, wo sein einst pralles, buntes Leben nun als konturloses Schattenspiel an ihm, dem Zurückblickenden, vorüberzieht, wo ihm ständig der kalte Hauch des Unwiederbringlichen entgegenweht und er das längst Erledigte, das, womit er sich seit langem hat abfinden müssen, nur noch in vergilbten Fotos oder altfränkischen Gemälden betrachten oder rückschauend in Selbstgesprächen erörtern kann. Vor allem das Gefühl, die Vergangenheit allein in der Form einer versteinerten Landschaft wahrzunehmen, wirkte von jeher niederschmetternd auf ihn: Wie in einem riesigen Eisblock auf ewig verschlossen, kommt ihm sein früheres Leben immer vor, wenn er in jener Dachkammer steht und ins Grübeln gerät; nichts an dem Abgelebten kann man mehr verändern, nicht mehr den einen oder anderen fatalen Verlauf noch einmal auf ein anderes, glücklicheres Ziel hin neu entwerfen.....! - Ja, so dachte Elmar nun einmal über seine Vergangenheit, so negativ, so verbittert, und es war deshalb nur zu begreiflich, dass er zögerte, sich dieser Vergangenheit in der genannten Dachkammer zu stellen. –
Elmar Redlich ist Lehrer und unterrichtet am L - Gymnasium in D*** die Fächer Deutsch und Philosophie. In den Ferien unternimmt er gern weite Fahrten mit seinem Wagen, meistens alleine. Seine Frau Lisi, ein häuslicher Typ, bleibt lieber zu Hause bei Elena und Ingeborg, ihren beiden Kindern. Vor allem lehnt sie es ab, ihre Schwiegermutter zu besuchen, die weit weg in Walldorf im Taunus wohnt, wohin Elmar aber nicht selten hinfährt, da er sich verpflichtet fühlt, hin und wieder nach seiner verwitweten alten Mutter zu sehen.
„Aha, wieder einmal geht es zu Muttern!“, hörte er Lisi hinter sich lästern, als er gerade seine Koffer für die Reise packte, „der Herr Sohn kann ja ohne seine Mutti nicht auskommen! Das wievielte Mal packst du denn in diesem Jahr deine Koffer, Elmar? Das fünfte oder, warte mal, ich glaube: es ist schon das sechste Mal!“
„Quatsch!“, erwiderte er mit lauter Stimme, da ihn der höhnische Ton seiner Frau provozierte, „es ist höchstens das dritte Mal.“
„Das dritte Mal? Dass ich nicht lache!“
Lisi, ihre dunkelblonden Haare mit hochmütiger Gebärde nach hinten streichend und den Kopf in den Nacken werfend, blickte ihn mit böse funkelnden Augen an.
„Das fünfte Mal ist es“, präzisierte sie mit schriller Stimme, „garantiert das fünfte Mal!“
Er schaute ihr in die blitzenden Augen, dann erfasste sein Blick ihre schlanke Gestalt. Ihre Haare, sonst zu einem Zopf nach hinten gebunden, hatte sie jetzt aufgelöst, sodass sie in langen Wellen ihr Gesicht umrahmten. Dieses, ebenmäßig, mit leicht gewölbter, hoher Stirn, einer geraden Nase und einem vollen Mund, wirkte reizvoll und sympathisch. Seine Frau war immer noch hübsch, auch wenn sie ihren schönen Mund gerade zu einer hässlichen Schnute verzog und ihre graugrünen, weit geöffneten Augen das Weiße zum Vorschein brachten. Doch ihr adrettes Aussehen täuschte Elmar nicht darüber hinweg, dass er seit einiger Zeit gar nicht glücklich mit ihr war.
„Und mich lässt du hier wieder einmal alleine, mit den Kindern und all den Problemen“, hörte er sie weiter mit schriller Stimme sprechen, „es interessiert dich wohl gar nicht, dass wir auch gesellschaftliche Verpflichtungen haben.“
„Du meinst die Heberers und die Reitmeiers!?“
„Und die Bergs! – Ja, die müssen wieder eingeladen werden!“
„Ach, das kann doch bis nächste Woche warten!“
„Das sagst du jedes Mal! Die Frau Heberer hat mich letzte Woche in der Stadt nicht gegrüßt.“
„Und du meinst, das hängt mit unseren..... gesellschaftlichen Verpflichtungen zusammen!?
„Klar! Ich würde das auch als Affront auffassen, wenn ich Freunde gerade fürstlich bewirtet habe, und die lassen dann eine Ewigkeit nichts von sich hören.“
„Na, dann nimm du das doch in die Hand. Ein Telefonanruf bei den Heberers, den Bergs und den Reitmeiers, sie sollen zu unserer Soiree kommen, sagen wir: übernächste Woche, schon wird dich Frau Heberer wieder grüßen!“
„Mach’ keine Witze! - Du hast dich ständig vor den Einladungen gedrückt. Und jetzt drückst du dich vor den Vorbereitungen. Ich muss das alles alleine organisieren, das ganze Drum und Dran, während du dir wieder eine Reise zu Mutti gönnst.“
„Ach, ich bleibe doch nicht lange weg.“
„Außerdem vergisst du, was gerade die Einladung an die Bergs für dich bedeutet – bei dem Einfluss, den Berg in deinem Kollegium hat!“
„Nein, nein, ich vergesse das nicht!“
Es hatte keinen Zweck, Lisi weiter zu widersprechen, sie wird immer nach neuen Anlässen zum Nörgeln suchen und sie garantiert auch finden. Wenn Elmar ihr erklärte, warum er mit den Einladungen an die Heberers, die Bergs et cetera noch ein bisschen warten wollte, wird sie bestimmt den Lehrerball übernächste Woche zum Thema machen, und sie wird ihm vorjammern, sie wüsste nicht, was sie anziehen soll, er solle ihr beim Aussuchen eines Abendkleides doch bitte helfen, damit seine Kollegen sie nicht so kritisch mustern, und wenn er ihr sagte, das Aussuchen des Abendkleides hätte noch Zeit bis Ende nächster Woche, käme garantiert der Vorwurf, er würde sich seine Freunde zu sehr bei den Lehrerkollegen aussuchen, er solle doch auch einmal andere Ehepaare in ihren Bekanntenkreis ziehen. Ständig musste er in dieser Art ihr Spötteln und Mäkeln über sich ergehen lassen, bei den geringsten Anlässen, dazu kam noch seit einiger Zeit ihre Lieblosigkeit. All das und überhaupt Lisis nicht enden wollende Reizbarkeit zeigten ihm deutlich, seine Ehe war nicht mehr das, was er sich einst von ihr versprochen hatte und was über viele Jahre diesem Versprechen, diesem Entwurf einer glücklichen Zweisamkeit durchaus nahe gekommen war. Nein - stellte er nüchtern und zugleich erschrocken fest - seine Ehe steckte in einer Krise, sie war vielleicht schon derart zerrüttet, dass sie gar nicht mehr zu retten war.
Ihn hatten deshalb schon seit einiger Zeit seltsame Gefühle und Sehnsüchte erfasst; zuallererst die Sehnsucht nach mehr Liebe und Verständnis, doch da er beides bei seiner Frau nicht mehr zu finden meinte, dachte er immer öfter über eine Erfüllung außerhalb seiner Ehe nach; auch empfand er nicht geringe Sehnsucht nach Befreiung von all diesen bürgerlichen Einengungen und lästigen Gepflogenheiten, diesen gesellschaftlichen Verpflichtungen, wie Lisi sie nannte, Verpflichtungen, die schon eher Zwängen glichen, zum Beispiel dem Zwang, da und dorthin, meistens an Kollegen, Einladungen auszusprechen und mit Spannung darauf zu warten, wer wann sich liebenswürdigerweise revanchierte und ihnen die Ehre der Einladung zu dieser oder jenen Soiree zuteil werden ließe.
Eine andere Einladung allerdings kam ihm letzte Woche sehr gelegen, nicht die von den Heberers oder den Bergs, sondern von seinem Cousin, dem Architekten Klaus Kerner. Er solle ihn und seine Familie doch bald wieder einmal besuchen, hatte Klaus am Telefon gesagt, und Elmars Interesse an diesem Besuch war umso mehr gestiegen, je geheimnisvoller sein Cousin sich am Telefon in Andeutungen über einen zweiten Besuch bei ihnen erging, der mit dem seinen zusammenfallen könnte, falls er zu einem bestimmten Zeitpunkt bei ihnen eintreffe. Aus irgendwelchen Gründen glaubte Elmar, Klaus meinte mit diesem zweiten Besuch seine Schwägerin, jene bereits erwähnte Julia, geborene Lambertz. Da er bei Klaus nicht weiter nachfragte, sondern einfach nur ’Aha!’ sagte, gab er sich nun der Vermutung hin, das heißt, es bildete sich bei ihm im Verlaufe dieses Telefongesprächs gerade mal ein diffuses Gefühl, Julia und er könnten nach langer Zeit wieder einmal zusammentreffen, und zwar in Fernwald bei G., wo sein Cousin mit seiner Familie in einem komfortablen, sehr geräumigen Haus wohnte. Elmar dachte kurz zurück an die Zeit mit Julia. Viel war es nicht, was ihm im Augenblick dazu einfiel, aber eins fiel ihm sofort ein: er hatte Julia einmal sehr geliebt, und so versetzte ihn die Aussicht, mit seiner Ex-Verlobten wieder zusammenzutreffen, in eine freudig erregte Stimmung, und diese Aufregung wuchs um so mehr bei ihm, je nachdrücklicher er sich bewusst machte, dass ihm die Streitlust seiner Frau das Zusammenleben mit ihr doch gehörig verleidete.
Doch Lisis Nörgeln und unfreundlich verzogenes Gesicht vergaß er schnell, seine Gedanken richteten sich sofort wieder ganz auf den Besuch bei seinem Cousin und auf das Wiedersehen mit Julia, auf das er sich - geschehe es nur wirklich oder nur mutmaßlich - bereits richtig freute. Da er einige Tage von zu Hause wegblieb, wollte er seine Frau nicht zusätzlich verärgern, und um ihre erregte Stimmung zu besänftigen, sprach er jetzt in beruhigendem Ton zu ihr, indem er den Kofferdeckel sanft nach unten drückte und sich anschickte, ihn abzuschließen.
„Ich fahre dieses Jahr garantiert das letzte Mal nach Walldorf, Lisi, ich verspreche es dir, Ehrenwort! Allerdings dauert es diesmal etwas länger. Ich besuche noch meinen Cousin; bei meiner Mutter bleibe ich nur einen Tag!“
Lisi machte ein Gesicht, als wittere sie in diesem beschwichtigenden Ton und in den an sich akzeptablen Ankündigungen eine neuerliche Provokation. Doch das Funkeln ihrer Augen schwächte sich mit einem Male ab, ging in ein undefinierbares Glitzern über, was vielleicht besagen sollte, dass sie die Erklärungen ihres Mannes zwar nicht als annehmbar, aber doch als deeskalierend empfand. Schließlich bequemte sie sich zu einer Reaktion, welche die zwischen den Eheleuten aufgekommene Spannung tatsächlich milderte:
„Na, dann wünsche ich dir gute Fahrt!“, sagte sie in nicht mehr so schrillem Ton, „und grüß’ auch schön deinen Cousin von mir!“
„Werde ich tun!“, erwiderte Elmar, und indem er den Koffer wieder öffnete, packte er weiter seine Sachen hinein.
Da die Herbstferien an diesem Tag begannen, wollte er unmittelbar nach der Schule losfahren. Nachdem er alle seine Sachen mitsamt dem Koffer im Kofferraum des Wagens verstaut hatte, verabschiedete er sich von Lisi und den Kindern, von der Ersteren zwar nicht besonders gefühlsbetont, aber auch nicht übermäßig kühl, von den Kindern allerdings herzlich.
Dann stieg er in den Wagen und fuhr Richtung Schule. Sein Unterricht begann an diesem letzten Tag erst in der vierten Stunde, nach der sechsten könnte er dann endlich in die Ferien starten, was also wieder einmal bedeutete - nach Lisis Rechnung das fünfte oder sechste Mal - , dass er in den Taunus nach Walldorf fuhr, zu seiner Mutter, um die er sich kümmern musste, schon aus moralischen Gründen. Und das sollte seine Frau eigentlich doch bitte einsehen!
Unterwegs musste Elmar an die Bemerkung Lisis über den Kollegen Berg denken. Sie hatte recht, Studiendirektor Berg, der im Kollegium ziemlich den Ton angab – er war nicht nur Stellvertreter des Schulleiters Bredenbrink, sondern auch dessen Freund – war mit Vorsicht zu genießen. Immer musste Elmar aufpassen, dass er dem Kollegen nicht mit einer unbedachten Bemerkung auf die Füße trat, vor allem, wenn er mit ihm auf einer Soiree zusammentraf. Er stellte sich schon vor, was dann vielleicht passieren könnte, jetzt, wo er sich wie seine Kollegen Heberer und Reitmeier um eine A14-Stelle bewarb. Berg könnte den Direktor zum Beispiel veranlassen, einige ungünstige ’Schlenker’, sogenannte Signalwörter, in Elmars Lehrerbeurteilung unterzubringen, schon hätten Ludwig Heberer und Karl Friedrich Reitmeier im Bewerbungsverfahren die Nase vorn. Na ja, beruhigte er sich, die Lehrerprobe vor einer Klasse musste ja noch hinzukommen, im Beisein des Dezernenten Dr. Kuschmann, dem Leitenden Regierungsdirektor von der Schulaufsicht. Doch da fiel Elmar ein, dass Schulleiter Bredenbrink mit Kuschmann immer ein herzliches Einvernehmen an den Tag legte, wenn dieser mal im L-Gymnasium weilte; der Draht zwischen den beiden ’hohen Tieren’ schien also prächtig zu funktionieren. Auch wusste Elmar nicht, ob einer seiner Mitbewerber in der X-Partei war, die im Gemeindeparlament und im Lande das Sagen hatte. Es galt nicht nur am L-Gymnasium als ausgemacht, dass nur Parteibuchinhaber in die höheren Beförderungsstellen gehievt werden. Berg und Bredenbrink waren garantiert in der X-Partei, das stand fest. Unklar war nur, ob auch bei den A14-Stellen die Parteizugehörigkeit schon eine Rolle spielte. Wenn also Heberer oder Reitmeier oder gar beide das Parteibuch der X-Partei besaßen, dann Gute Nacht! Seine Beförderungsträume wären schon jetzt wie Seifenblasen an einem gezackten Eisengitter zerplatzt. Wie ihn dieses ganze politische Geschacher um Posten und Pöstchen anwiderte, nicht nur am L-Gymnasium! Aber auch der vom Schulleiter gerne gesehene Brauch, sich gegenseitig einzuladen und bei den Soireen dann miteinander freundlichen Umgang zu pflegen, obwohl man sich als Konkurrenten gegenseitig belauerte - Elmar kam das nicht nur heuchlerisch und spießig vor, er fand das, gerade heraus gesagt, grauenvoll! So war es nur zu verständlich, dass er keine Eile an den Tag legte, die genannten Kollegen samt Ehefrauen wieder einmal zu einem Gesellschaftsabend zu bitten.
Elmar hatte inzwischen das L.-Gymnasium erreicht. Die Fünf-Minutenpause würde gleich zu Ende sein, er musste sich also sputen, um pünktlich zum Unterrichtsbeginn im Klassenraum der 9b zu sein. Rückgabe der Deutscharbeit plus Besprechung und Berichtigung standen auf dem Programm. Wie im Fluge würde die Stunde vorübergehen. Dann, in der 5. Stunde, folgte Philosophie im Grundkurs der 13a. Das Thema lautete: Die unterschiedlichen Konzeptionen des „Willens“ bei Schopenhauer und Nietzsche, anhand von Auszügen aus „Die Welt als Wille und Vorstellung“ und „Jenseits von Gut und Böse“. Doch die Schüler werden jetzt, unmittelbar vor Ferienbeginn, nicht recht bei der Sache sein. Elmar stellte sich vor, wie er die Schüler nur mühsam zur Mitarbeit motivieren könnte; dabei hätte er gerne mit den Schülern sein Herzensanliegen diskutiert, und nicht zu knapp, ob Nietzsche mit seiner These Recht hat, der Mensch sei Wille zu Macht und nichts außerdem! - In der 6. Stunde musste er noch eine Deutschstunde in der 12c, mit dem Thema ’Sophokles: König Oedipus’, hinter sich bringen. Auch hier, zumal in der letzten Stunde vor Beginn der Ferien, wird die Mitarbeit der Klasse garantiert zu wünschen übrig lassen. Elmar malte sich schon aus, wie der Unterricht zäh und schleppend dem Ende entgegentaumelt. Dann endlich wird es schellen, und die Schüler, die schon ständig auf die Uhr geguckt haben, werden schnell ihre Sachen zusammenpacken und erleichtert und froher Stimmung die Klasse und die Schule verlassen, begleitet von den guten Wünschen ihres Lehrers, die sie aber wohl kaum oder nur nebenbei zu Kenntnis nehmen.
Und so geschah es auch, wie es sich Elmar vorgestellt: Auch er verließ erleichtert die Schule, nachdem er sich noch von einigen Kollegen, insbesondere von dem Schulleiter und dem Stellvertreter, auch von Heberer und Reitmeier, verabschiedet hatte. Rasch stieg er in seinen Wagen und fuhr zur Stadt hinaus, Richtung Bundesstraße B X, die zur Autobahn führte. Die Fahrt wird sich wie immer in die Länge ziehen, dachte er, zumal auf der vielbefahrenen B X. Allein bis er die Autobahn erreichte und das Gaspedal durchtreten konnte, wird fast eine Stunde vergehen, nicht nur weil er mehrere Dörfer durchqueren muss, auch wegen der zahlreiche Lastwagen, die sich gerade auf dieser Straße gerne tummeln.
Während der langweiligen Fahrt gingen Elmar alle möglichen Gedanken durch den Kopf. Vor allem musste er an Studiendirektor Bergs forschenden Blick denken, als er sich von ihm im Lehrerzimmer verabschiedete. ’Na, Herr Kollege, Sie sind aber mit einer Einladung wieder mal dran!’, schien dieser Blick zu sagen. Sogleich stand ihm auch wieder die letzte Soiree bei Ludwig Heberer vor Augen. Lisi hatte recht, sie lag schon ziemlich lange zurück, die Heberers, eigentlich auch Berg hatten tatsächlich einigen Anlass, sich über Elmars Nachlässigkeit zu ärgern. Ludwig Heberer hatte damals nicht nur die Reitmeiers zu sich gebeten, auch Berg samt Ehefrau waren zugegen. Dazu hatte Heberer sogar noch den Schulleiter mit dessen entschieden jüngerer Ehefrau Kerstin eingeladen. Es war ein Abend, den Elmar in seinem Tagebuch als „völlig überflüssig“ kennzeichnete, und das Benehmen der anwesenden Kollegen bezeichnete er als „wichtigtuerisch“, „dünkelhaft“ und „hochnäsig“. Elmar erinnerte sich noch, wie er mit den beiden Kollegen, den Mitbewerbern um die A-14-Stelle, in einem Nebenzimmer zusammensaß und Reitmeier anfing, über eine Schülerin zu lästern. Der Schulleiter und der Studiendirektor hielten sich währenddessen im angrenzenden Speisezimmer auf, standen dort in einer Ecke und steckten die Köpfe zusammen. Die Ehefrauen saßen immer noch an dem Esstisch und plauderten miteinander.
„Ihr kennt doch die Ilse Müller aus der 10 a?“, fragte Karl Friedrich Reitmeier, der Mathematiklehrer. Er war etwa Mitte vierzig, hatte dunkelblonde, schon schüttere Haare, das Gesicht war leicht aufgedunsen und von bleicher Farbe. Über den schmalen, etwas gepressten Lippen prangte ein kleiner Schnauz. Die grauen Augen blickten unter buschigen Augenbrauen streng und herrisch.
„Klar kenne ich die!“, Ludwig Heberers Antwort kam spontan, fast wie aus der Pistole geschossen, „wer kennt die nicht, die ist doch so schön.“
„Ja, schön ist sie, aber strohdumm!“
„Nicht so laut! Feind hört mit!“ gab Elmar zu bedenken, „Bredenbrink hat gerade herübergeguckt.“
„Du weißt doch, Karl“, schloss sich Heberer Elmars Warnung an, „der Schulleiter lässt auf seine lieben Schülerinnen und Schüler nichts kommen. Beleidigung einer Schülerin ist für den tabu, erst recht, wenn sie schön ist.“
Ludwig Heberer, der Biologie- und Erdkundelehrer, dessen Stimme einen auffallend hellen Klang hatte, war von schlanker Gestalt, im Gegensatz zu Kollege Reitmeier, der nicht nur im Gesicht, sondern auch in seinem Körperumfang vergleichsweise dick wirkte. Ludwig strich sich über seine blonden, dichten Haare, seine braunen Augen, die ständig zu feixen schienen, als wollte sich der Kollege immer über etwas lustig machen, spähten hinüber ins andere Zimmer, wohl um sich zu vergewissern, ob Direktor Bredenbrink noch ausreichend entfernt stand und ihre Unterhaltung nicht mithören konnte.
„Ja, weiß ich!“ Karl sprach jetzt mit gedämpfter Stimme, „man darf ja heute die Dummheit nicht beim Namen nennen, sondern man muss sagen: die Schülerin hat noch einigen Nachholbedarf oder sie ist zur Zeit nicht in Form....“
„.... oder sie muss zu Hause noch etwas üben“, ergänzte Ludwig und feixte mit seinen Augen.
„Geht mir auf den Keks, diese Verniedlichung, diese Verhätschelung!“, meinte Elmar, „die Schüler werden zu sehr mit Glacéhandschuhen angefasst.“
„Na ja, die Zeiten haben sich halt geändert“, befand Karl, „ich jedenfalls halte nichts von den alten autoritären Methoden; der neue Umgang mit den Schülern ist mir sympathischer, er ist menschlicher.“
„Aber man tut den Schülern keinen Gefallen, wenn man sie zu sanft anfasst“, beharrte Elmar auf seinem Standpunkt, „im Leben werden sie später auch nicht sanft angefasst.“
„Die Ilse schon! Die wird bestimmt sanft angefasst, weil sie so schön ist“, meinte Ludwig und blickte Elmar grinsend an.
„Ach du meinst: die Männer gehen sanft mit ihr um“, räumte Elmar ein, „sie sind von ihrer Erscheinung so hingerissen, dass sie....“
„Nicht nur die Männer“, fiel ihm Karl ins Wort, „auch die Frauen; die vom Glanz ihrer Schönheit etwas abbekommen wollen, sich darin sonnen wollen.“
„Na, so schön ist sie auch wieder nicht!“, erwiderte Elmar in energischem Ton, doch er konnte damit die beiden nicht beeindrucken.
„Ich finde sie schon unwahrscheinlich schön!“, sagte Karl und strich sich selbstbewusst über seinen Schnauz.
„Ich auch!“, schloss sich Ludwig Karls Meinung an; dabei lächelte er wie einer, der im Begriffe ist, eine zarte Hammelkeule genießerisch zu zergliedern und zu verspeisen.
„Die Geschmäcker sind halt verschieden.“ Elmar konnte partout an Ilse Müllers Erscheinung nichts Außerordentliches erkennen; gewiss, sie war hübsch, aber besonders schön...? „Sie hat eine etwas lange Nase“, versuchte er seinen Standpunkt zu verteidigen.“
„I wo! Die stört doch niemanden“, entgegnete Karl.
„Ich finde gerade ihre Nase reizvoll“, sagte Ludwig in entschiedenem Ton.
„Na ja, die Geschmäcker sind halt verschieden“, wiederholte Elmar. Er ärgerte sich etwas, dass seine Meinung über Ilses Aussehen bei den Kollegen keine Anerkennung fand. Karl Friedrich kam wieder auf Ilses Versagen in Mathematik zurück:
„Jedenfalls ist das Kind in meinem Fach zur Zeit nicht - wie sagt man heute - nicht in Form. Zwei Arbeiten hat sie in den Teich gesetzt, eine war gerade mal ’Vier minus’: Jetzt überlege ich, was ich ihr auf dem Zeugnis geben soll. Na, ich prüfe sie noch einmal mündlich. Sie will ja mit der Mittleren Reife abgehen. Am Ende kriegt sie von mir sicher noch eine Vier Minus auf dem Zeugnis - weil sie so schön ist!“
Reitmeiers Augen strahlten, als wären sie gerade vom Glanz der Schönheit Ilse Müllers geblendet. Die anderen beiden lachten laut, weil Karl Friedrich den letzten Halbsatz in so trockenem Ton gesagt hatte.
Schulleiter Bredenbrink und sein Stellvertreter Berg betraten gerade das Zimmer.
„Na, hier herrscht aber eine aufgeräumte Stimmung!“, rief ihnen Bredenbrink zu, ein kleiner, dicklicher Mann mit Vollglatze und runden Augen.
„Die Herren haben wohl über einen unanständigen Witz gelacht?“ Studiendirektor Berg, der eine Neigung hatte, ein Thema gern ins Erotisch-Schlüpfrige zu ziehen, gab erneut diese seine Neigung zu erkennen.
„Nein, wir haben die Leistungen der besonders schönen Schülerin Ilse Müller begutachtet“, sagte Ludwig Heberer.
„Schöne Schülerin? Also war doch etwas Unanständiges im Spiel, was!“ Berg fuhr auf der von ihm so gerne gewählten Schiene munter weiter, dabei lächelte er tückisch.
„Wieso das?“ Bredenbrink blickte seinen Freund erstaunt an.
„Na, wenn hier von einer schönen Schülerin die Rede ist, spricht das doch Bände. Bei einer Schülerin darf doch nur die Leistung zählen, alles andere ist Nebensache!“
Berg sprach das im ernsten Tone aus, indessen seine Augen, die hinter der Brille klein wirkten, ebenfalls ernst, beinah grimmig dreinschauten, als wollte der Studiendirektor sagen: Kinder, schaut ja nicht auf die Schönheit einer Schülerin, konzentriert euch lieber auf eueren Unterricht. Berg war groß gewachsen und von schlanker Gestalt. Sein Gesicht, obwohl länglich und schmal, wirkte wegen der großen, fast voluminösen Brille breit und flächig.
„Genau, das finde ich auch!“ Karl Friedrich Reitmeier bekannte sich beflissen zu dem Standpunkt Bergs.
„Sie haben vollkommen recht, Herr Berg!“, schloss sich auch Heberer der Meinung des einflussreichen Studiendirektors an. „Wir haben ja in erster Linie die etwas problematische Leistung der Schülerin besprochen; sie gibt einigen Anlass zur Sorge.“
„Wer ist das eigentlich, diese Ilse Müller?“, wollte der Schulleiter wissen.
„Das ist die in der 10a“, beschrieb Berg das Mädchen, „wissen Sie, die Tochter vom Gardinen-Müller.“
„Ach die!“ Bredenbrink war jetzt vollkommen im Bilde, „na, so schön ist die auch wieder nicht!“
„Sie haben recht, Herr Direktor!“, Reitmeier hatte flugs seine Ansicht über Ilse Müllers angebliche Schönheit geändert, „ich würde sie allenfalls .... äh.... apart nennen.“
„So, so, apart!” Der Schulleiter war mit dieser Bewertung nicht ganz einverstanden, “sagen wir, sie ist hübsch, so im landläufigen Sinne, mehr nicht.“
„Ja, mehr auf keinen Fall!“, schloss sich Ludwig Heberer der Ansicht Bredenbrinks an, indessen Elmar zuerst Kollege Reitmeier, dann Ludwig Heberer irritiert anblickte. Es überraschte ihn, wie behände die beiden ihre Meinung über Ilse Müllers unwahrscheinliche Schönheit geändert hatten. -
Elmar hatte ungefähr die Hälfte der Strecke bis zur Autobahn zurückgelegt. Die Wut über diese letzte Soiree bei Karl-Friedrich Reitmeier stieg in ihm hoch, vor allem über Heberer und Reitmeier. Was man in deren Beisein auch für Ansichten äußerte, immer wussten die beiden es besser oder behaupteten das Gegenteil, es sei denn, sie sprachen mit Berg oder Bredenbrink. Da war dann ihr Widerspruchgeist wie auf Kommando verflogen. Und nun sollte er diese beiden Nervtöter zu einem Gesellschaftsabend einladen! Vielleicht könnte er Lisi doch noch überreden, die Einladung an die beiden weiter hinauszuzögern!?
Rechts tauchte eine Tankstelle auf. Er fuhr an der Zapfsäule vor und tankte erst mal den Wagen für die schnelle Fahrt auf der Autobahn voll. Kurz darauf fädelte er den Wagen wieder in die Zubringerstraße ein, doch an eine schnelle Fahrt war zunächst nicht zu denken. Da er an einem schweren ’Brummi’ partout nicht vorbeikam, konnte er seine Fahrt nur gemächlich fortsetzen. So gab er sich weiter irgendwelchen Gedanken hin. Dabei fielen ihm wieder seine Kollegen Heberer und Reitmeier ein. Oft ergab es sich, dass er sich mit den beiden in den Pausen oder auch während einer Freistunde unterhielt – alle drei saßen schon seit Jahren zusammen an einem Tisch. Einmal, während einer freien Stunde, in der kein anderer Kollege im Lehrerzimmer zugegen war, vertrieben sie sich die Zeit mit irgendwelchen Klatschgeschichten. Auch eine verheiratete Kollegin, die angeblich eine Affäre mit einem Kollegen haben soll, nahmen sie sich aufs Korn. Dabei versicherten sie sich, dass über diese Beziehung nur Gerüchte im Umlauf seien. Genaueres, Eindeutiges sei nicht bekannt, betonte Ludwig Heberer, und dürfte von ihnen auch nicht direkt genannt werden, weil die Folgen für die Kollegin oder den Kollegen gefährlich sein könnten. Schulleiter Bredenbrink, ein streng moralisch eingestellter Mann, hätte umgehend dafür gesorgt, dass die Beteiligten oder jedenfalls einer oder eine von beiden versetzt werden, nicht nur aus moralischen Gründen, sondern auch wegen ’Störung des Betriebsfriedens’. Solche Liebesverhältnisse spielten sich deshalb nur im Verborgenen ab, kein Lehrer, keine Lehrerin, die, ohne es vielleicht zu wollen, von einer Leidenschaft erfasst wurden, gaben ihre gegenseitige Zuneigung vor den Augen der Kollegen in irgendeiner Weise, durch Gesten oder verräterische Worte, preis, natürlich wegen der genannten unabsehbaren Folgen für ihre berufliche Situation. Dennoch wurden solche geheimen Beziehungen diskret wahrgenommen und gerne hinter vorgehaltener Hand beschwatzt, jeder interessierte sich halt für derartige Pikanterien. So beredeten auch die drei Kollegen wieder einmal dieses interessante Gerücht.
„Ich kann dem Chef nur recht geben“, meinte Elmar während des Gesprächs in der Freistunde, „wenn zwei Kollegen derart durch ihre privaten Beziehungen abgelenkt sind, muss doch ihre Arbeit darunter leiden.“
Er selbst vertrat auch wie Bredenbrink einen moralischen Standpunkt, allerdings nicht so einen strengen wie der Schulleiter, eher einen eingeschränkten, modifizierten.
„Du meinst, wenn die Kollegin nur noch den Kollegen im Kopf hat“, erläuterte Ludwig Heberer die private Schwierigkeit der Lehrerin, „kann sie sich nicht mehr auf ihren Unterricht konzentrieren!?“
„Und umgekehrt!“, ergänzte Reitmeier Heberers psychologische Analyse.
„Klar“, meinte Elmar, „man muss schon beides miteinander vereinbaren können, das Private und das Berufliche. Wer das nicht kann, sollte die Finger von solchen Techtelmechtel lassen.“
„Und wenn dir so eine attraktive Junglehrerin täglich über den Weg läuft, die obendrein noch hundertprozentig dein Typ ist, was dann?“, Heberer sagte das in einem Ton, als seien ihm solche prekären Begegnungen mit Junglehrerinnen schon öfter passiert; dabei grinste er vielsagend, „du bist schließlich auch nur Mensch und kannst nicht in jeder Phase deines Lebens die Vernunft walten lassen.“
„Ja, ja, die Gefühle müssen auch zu ihrem Recht kommen“, warf Reitmeier ein, „da hast du recht, Ludwig. Schließlich kann man die Gefühle nicht auf Kommando abschalten, nur weil es die Moral so befiehlt. Wenn man immer mit seinem Typ zusammen ist, von morgens bis abends, von Woche zu Woche, wenn sich also so eine Arbeitsgemeinschaft bildet und man steht so einem hübschen Wesen ständig Aug in Auge gegenüber, dann muss es doch zwischen den beiden, die füreinander bestimmt sind, funken. Was bleibt ihnen dann anderes übrig, als.... als...“
„...als der Venus Tribut zu zollen!“, ergänzte Heberer, der immer ein bisschen den Supergebildeten herauskehrte. Die beiden anderen lachten.
„Sehr vornehm ausgedrückt!“, sagte Reitmeier, „ich kenne da einige Redewendungen, die diesen Vorgang ein bisschen rustikaler ausdrücken.“
„Die kennen wir alle“, erwiderte Heberer, „du brauchst uns diesbezüglich nicht zu instruieren.“
„Schon wieder so ein vornehmes Wort: instruieren!“, meinte Elmar, „so redet doch kein Mensch, Ludwig; du hast heute offenbar deinen vornehmen Tag, was!“
„Ich nenne die Dinge halt gerne nur indirekt beim Namen. Das Drastische finde ich einfach peinlich, ordinär!“
„Gut, wir wissen alle, was gemeint ist“, sagte Elmar „ich möchte jetzt einmal einen anderen Aspekt einbringen....“
„Aspekt? Guck an! Auch nicht unvornehm, das Wort!“, fuhr Ludwig sofort seine Retourkutsche.“
„Also gut! Dann sage ich eben: Gesichtspunkt! Man kann sich zwar über diese erotischen Vorgänge amüsieren und ihnen viel Spaß abgewinnen...“
„Hört, hört, erotische Vorgänge!“, rief Reitmeier aus und grinste.
„Ich möchte jetzt....über ...äh.... diese Sache....“
„So, so, Sache!“, warf Reitmeier wieder ein.
„Lass mich doch mal zu Wort kommen! - Also, ich möchte euch folgende Geschichte erzählen, um einmal einen ernsten Asp...., Gesichtspunkt hervorzuheben: Die Geschichte spielt in einem Krankenhaus, in dem auch so ein strenger Chef seines Amtes waltete. Er wachte nicht nur über die Leistungsbereitschaft des Klinikpersonals, sondern behielt auch ihr moralisches Verhalten sorgsam im Auge. Nun ergab es sich einmal, dass sich ein Arzt und eine niedliche Krankenschwester ineinander verliebten. Beide waren verheiratet, nicht miteinander, sondern mit jeweils anderen Partnern! Doch wie es halt so kommt - da beide ständig Aug in Auge zusammen waren, haben sie schließlich.....“
„....der Venus Tribut gezollt!“, ergänzte Heberer und lächelte verschmitzt, indessen Reitmeier laut loslachte.
„Ja, aber die Sache bekam einen höchst tragischen Akzent. Der Ehemann der Krankenschwester kam hinter das Verhältnis. Er stellte eines Tages den Arzt in der Klinik laut redend, ja schreiend zur Rede, und als der die Liebesbeziehung abstritt, kam es zu einer Prügelei. Die hatte Folgen: der Arzt wurde vom Chef der Klinik umgehend entlassen, wegen Störung des Betriebsfriedens. Die Krankenschwester wollte aber partout nicht von ihrem Geliebten lassen, sie setzte das leidenschaftliches Verhältnis mit ihm fort. Darauf hat sich der Ehemann der Krankenschwester .... das Leben genommen.“
„Au! Das ist aber zu dumm!“, entfuhr es Ludwig Heberer, und Karl Friedrich Reitmeier schaute ebenfalls betroffen drein.
„Ich meine“, sagte Elmar, „hier bekommt der Begriff Moral seine eigentliche Bedeutung. Hier geht es ja nicht um das Moralin-Sauere, das sich über den freizügigen Sex allgemein echauffiert, sondern um ein im Kern verwerfliches Verhalten. Es ist unmoralisch, weil es die Existenz eines anderen tangiert, was heißt tangiert? Es vernichtet die Existenz eines anderen! Man muss also differenzieren: das leichte, flotte Sexleben ist das eine, das andere sind die Konsequenzen, die sich daraus ergeben können, und die können bitter ernst sein.“
Ludwig Heberer war anderer Meinung: „Ach Herr Je, man soll doch diese Angelegenheiten nicht so triefend Ernst nehmen. Der Mensch ist nun mal auch Naturwesen. Wer hier immer und überall Moral und Anstand walten lassen will und das Natürliche durch moralische Vorschriften knebeln will, wird dem wahren Wesen des Menschen nicht gerecht.“
„Ich meine das auch“, schaltete sich Reitmeier ein, „die Natur ist meines Erachtens eine der großen Gefahren, die jeden von uns bedrohen. Leben heißt nun mal in Gefahr sein, hat glaube ich jemand gesagt, und eine dieser Gefahren ist die Natur. Man denke an Erdbeben, Überschwemmungen, Vulkanausbrüche oder Feuersbrünste oder furchtbare Kältewellen. Auch die sogenannte Liebe kann wie ein Vulkanausbruch über uns hereinbrechen....“
„Über uns?“ warf Heberer ein und grinste.
„Ich meine: über den einen oder anderen! Hier kann man doch nicht mit der Moralmesslatte kommen, hier kann man nur noch....äh.... wie soll ich sagen: nur noch .... sich abfinden.“
„Ja, abfinden ... ist das richtige Wort“, bekräftigte Heberer Reitmeiers Ansicht, „früher konnte man ja noch wegen Ehebruchs vor Gericht ziehen, aber heute gilt das nicht mehr. Man hätte von dem Ehemann der Krankenschwester auch erwarten können, dass er sich abfindet. In solchen Situationen...., tja, was bleibt einem Mann anderes übrig....? Sich deshalb gleich das Leben zu nehmen....., also, ich muss schon sagen....“
„Aber die Frage der Schuld bleibt dennoch bestehen“, meinte Elmar, „wir sind schließlich keine reinen Naturwesen wie die Tiere, wir haben eine Vernunft, und hier haben halt auch Kategorien wie Moral, Schuld, Verantwortung und Sühne ihre Berechtigung. Niemand kann diese Krankenschwester einfach von Schuld und Verantwortung freisprechen, nur weil sie dem Ruf der Natur gefolgt ist. Schließlich tat sie das ohne Rücksicht auf Verluste.“
„Was soll denn mit der Frau geschehen? Soll man sie vor Gericht zerren, weil sie sich an ihrem Mann schuldig gemacht hat?“ rief Ludwig Heberer in scharfem Ton aus, „wir sind doch nicht mehr im Mittelalter oder bei den Arabern, wo man eine solche Frau steinigt!“
„Du huldigst wohl dem Satz ’Alles verstehen heißt alles verzeihen’, was!“, sagte Elmar.
„Nein, ich huldige allein einer vernünftigen, aufgeklärten Weltanschauung, und rede nicht einem bigotten, moraldurchtränkten religiösen Fanatismus das Wort!“
Elmar musste nachgeben. Da auch Karl Friedrich seinem Kollegen Heberer zustimmte, konnte sich Elmar mit seiner die Moral und das Schuldprinzip berücksichtigenden Auffassung nicht durchsetzen. So fand er sich damit ab, dass hier Meinung gegen Meinung stand, und ließ diesen Gegensatz der Auffassungen einfach im Raum stehen. -
Elmar hatte gerade die Autobahn erreicht, und sein Wagen begann rasant an Fahrt zu gewinnen. Nicht mehr musste er hinter schweren Lastkraftwagen, die sich wieder sonder Zahl auf der Landstraße getummelt hatten, im Schneckentempo herfahren, er konnte endlich das Gaspedal durchtreten und zu seiner Zufriedenheit beobachten, wie die Landschaft nur so an ihm vorbeiflog. Da überfiel ihn plötzlich eine starke Müdigkeit, kaum dass er gerade einmal zehn bis fünfzehn Kilometer auf der Autobahn zurückgelegt hatte.
Rasch entschloss er sich, auf dem nächstbesten Parkplatz anzuhalten und die lästigen, nicht ungefährlichen Schlafattacken durch ein kurzes „Nickerchen“ sanft aus seinem Kopf zu streichen. Nachdem er auf dem Parkplatz den Motor abgestellt und die Zentralverriegelung betätigt hatte, nahm er sogleich eine Schlafstellung ein und erwartete, da er ja müde war, dass er unverzüglich einschlafen werde. Doch da hatte er sich getäuscht. Statt zu schlafen, kauerte er hell wach auf seinem Sitz und ließ gleichgültige Blicke über die eintönige Landschaft rings um den Parkplatz schweifen. Dabei gingen ihm wieder Schulprobleme durch den Kopf, diesmal nicht ärgerliche Erlebnisse mit den Kollegen Heberer oder Reitmeier, sondern einige Szenen aus der letzten Unterrichtsstunde in der 12c. Er gehörte zu den Lehrern, die nicht schnell abschalten können: Schulereignisse und Schülerquerelen trug er meist noch lange mit sich herum.
Ein Satz Jokastes, gesprochen zu König Oedipus, hatte im Mittelpunkt der Diskussion in der 12c gestanden: „Wozu plagt sich der Mensch mit Angst? Der Zufall herrscht! / Vorsehung, klar bestimmte, gibt es nicht......“ Das Hin und Her der Schülerargumente wirbelte erneut in Elmars Kopf herum. Verärgert über dieses Nachhallen, versuchte er zunächst vergeblich, die kreisenden Gedanken aus seinem Kopf zu verscheuchen. Als ihm auch noch der Spruch eines Schülers einfiel: ‚Müssen wir unbedingt am letzten Tag noch den Sophokles beackern?’, probierte er es mit einem alten Trick: Er sagte laut: „Gedanken stopp!“, dann lehnte er sich in seinem Sitz zurück, schloss die Augen und presste beide Hände gegen die Schläfen. Tatsächlich, die Gedanken gehorchten, die Schulprobleme verflüchtigten sich, sein befreites Gehirn konnte endlich das ersehnte Einschlafsignal geben, und prompt fiel er entspannt ins Unbewusste. Doch die Entspannung hielt nicht lange an. Denn wieder fing er an zu träumen, wieder störte der alte, sattsam bekannte Alptraum seinen Schlaf, geisterte einige Zeit in seiner ruhebedürftigen Seele herum und erschreckte sie mit seinen Schauerbildern. Natürlich blickten ihm da im Traum nicht Julias Augen entgegen. Er wusste das. Er wusste, diese vorwurfsvoll dreinschauenden Augen gehörten zu einer anderen Person, zu deren Gesichtzüge sich Julias Antlitz wie gehabt verwandelte; Gesichtszüge diesmal mit einem unheimlich starrenden, fast kam es ihm vor: drohenden Blick. Jäh aufwachend, ließ er überstürzt den Motor an und fuhr aus dem Parkplatz wieder hinaus auf die Autobahn. Erschrocken war er auch deswegen, weil in dem Traum noch andere Figuren aufgetaucht waren, schon zum wiederholten Male: auch sie graue Gespenster aus fernen Zeiten, die er längst in den genannten Abstellkammern auf immer verschwunden glaubte. Sich zu wehren, die Türen der Kammern zu verriegeln, nützte ihm nichts; die Geister schlüpften durch die Ritzen und Spalten der Türen, schon standen sie vor ihm und starrten ihn an mit rollenden Lemurenaugen. Wie oft hatte er sich gewünscht, es gäbe eine Kraft in ihm, einen Lethe-Quell, der dieses Abgelebte mit all seinen unguten, manchmal kreuzunglücklichen Erlebnissen wegwischen könnte, als wäre es nie gewesen! -
Nach dem Aufenthalt bei seiner alten Mutter in Walldorf, wo er allerdings nicht, wie Lisi versprochen, nur einen Tag, sondern mehrere Tage blieb, fuhr er, wie geplant, Richtung Fernwald, um seinem Cousin Klaus Kerner zu besuchen. Schon von Walldorf aus hatte er den Zeitpunkt seines Eintreffens bei Klaus und Klara telefonisch angekündigt, um die beiden nicht unvorbereitet anzutreffen.
„Na endlich hast du dich einmal aufgerafft“, begrüßte ihn Klaus aufs Herzlichste, „es wurde ja auch Zeit, dass du uns mal besuchst, nach so vielen Jahren! - Wie lange haben wir uns eigentlich nicht gesehen? Na, zwei Jahre waren es bestimmt! - Du bleibst doch über Nacht?“
„Ich wollte eigentlich nur.....“
„Kommt nicht in Frage!“, sagte Klaus im Befehlston und blickte Elmar vorwurfsvoll an, als wollte er sagen: Willst du mich beleidigen? „Selbstverständlich übernachtest du bei uns, das Gästezimmer wartet schon. Klara bereitet für heute Abend schon einiges vor; sie wäre bestimmt stocksauer, wenn du....“ -
„Also gut, ich bleibe..........“
Elmar hatte bei dem freundlichen Ultimatum seines Cousins überhaupt keine andere Wahl; „aber morgen Vormittag spätestens muss ich weiterfahren!“
Klaus nickte zufrieden.
„Wie geht es zu Hause?“
„Danke, alles geht bestens! Lisi lässt euch herzlich grüßen.“
Dass alles bei ihm bestens gehe, stimmte natürlich nicht! Doch er wollte halt den Anschein erwecken, als wäre in seiner Familie alles in Ordnung! Lisis enervierendes Nörgeln fiel ihm wieder ein, desgleichen ihr Vorschlag kürzlich, sie beide sollten doch besser in getrennten Schlafzimmern schlafen, schon aus gesundheitlichen Gründen. Elmar machte sich seit einiger Zeit große Sorgen um seine Ehe.
Nachdem er auch Klaus’ Ehefrau Klara und die anderen Kerners, die kleinen Zwillingssöhne Alfred und Andreas sowie die 14-jährige Tochter Kirsten begrüßt hatte, bezog er zunächst das Gästezimmer im Kernerschen Haus und richtete sich für eine Nacht häuslich ein.
Ob auch Julia schon da war? Irgendeinen Wagen mit dem Autokennzeichen von Weiden / Niederbayern konnte er vor dem Haus seines Cousins nicht entdecken! Na, vielleicht kommt sie noch!?
Sie alle setzten sich schließlich an den schon zubereiteten Kaffeetisch, aßen Kuchen und tranken Kaffee, sprachen über Alltägliches und Aktuelles, über Elmars lange Autobahnfahrt, über das Wetter und die Verwandten und Freunde, was man sich so alles erzählt, wenn man nach langer Zeit wieder einmal Gelegenheit bekommt, miteinander zu plaudern, und so zogen sich ihre Unterhaltungen den ganzen Nachmittag hin.
Allerdings, seine Ex-Verlobte ließ sich immer noch nicht blicken. Vielleicht hatte er seinen Cousin am Telefon doch falsch verstanden!?
Ihre Unterhaltungen gingen sogar am Abend munter weiter, nur unterbrochen durch das Abendessen, das Klara, eine sehr geübte Köchin, mit besonderer Raffinesse und liebevoll ausgewählten Zutaten für ihn, den seltenen Besuch, zubereitet hatte.
Trotz des kleinen Wehrmutstropfens, dass die Hausklingel der Kerners immer noch nicht die Ankunft Julias meldete, fühlte sich Elmar bei Klara und Klaus wohl. Ja, als sie später im Wohnzimmer, plaudernd und Gebäck knabbernd, zusammensaßen, geriet er sogar in eine ungewohnt fröhliche Stimmung. Er hatte auf dem Sofa der Kerners Platz genommen, neben ihm knisterte ein lustiges Kaminfeuer, Klara servierte einen feinen Bordeaux, und zwei, drei Gläser von dem edlen Wein fegten alle bedrückenden, schwermütigen Gedanken aus seiner Seele. So musste das passieren, was er an sich gerne vermied, weil er den bitteren Geschmack der Ernüchterung am nächsten Tag schon mehrmals gekostet: Er blickte zurück, er erinnerte sich, zusammen mit seinen Gastgebern, den Weggefährten früherer Zeiten. Zwar taten sie es in heiterster Stimmung, und alle Abenteuer ihrer Jugend ließen sie in phantastischen Erzählungen aufleben, doch dieses wehmütige Schwelgen in alten Zeiten - Elmar kam sich dabei immer vor wie einer, der in einem Wald voller Trugbilder herumalbert, oder wie jemand, der ein Haus bewundert, nur weil es mit hübsch gemalter Vorderfront glänzt, die dürftige Rückseite aber nicht zur Kenntnis nimmt, die Seite mit der schmutzigen, abblätternden Fassade, den vor Dreck starrenden Innenhof oder den unansehnlichen, verwilderten Garten. Obwohl er von dem Schmutz wusste, blendete er bei diesem Herumalbern das Hässliche einfach aus, vor allem das Bedrohliche, und er gab sich dann dem falschen Gefühl hin, das Leben sei in der Jugend unbeschwert und heiter gewesen, als hätte es um ihn herum damals einen schützenden Wall gegeben, von dem alle gefährlichen Sturzwellen des Lebens wie an einer ehernen, unbezwingbaren Mauer abprallten. Dieses trügerische Empfinden!, dachte er hinterher immer, wie oft hatte es ihn schon überwältigt, wie oft hatte es alle seine klaren, beherrschten Gedanken zum Schweigen gebracht und die Vergangenheit, in der er zusammen mit seinen Freunden heiter herumspazierte, mit rosigem Nebel gefüllt, wie leicht vergaß er, dass seine erinnerungsseligen Gedanken eigentlich durch leere, öde Räume fuhren, wo nur Erinnerungsmüll herumlag oder bleiche Gestalten schemenhaft geistern, Gestalten, die früher quicklebendig seinen Weg kreuzten, heute aber nur noch als Schreckgespenster hin und wieder sein Denken behelligen. Und erst die gefahrvollen und zugleich verlockenden Abwege, welche ihn damals faszinierten und zugleich ängstigten. Dann die bezaubernden Figuren, die verführerische Blicke nach ihm warfen; einige aber, die gefährlichen, langten nach seiner Seele wie Raubtiere, die ihre Krallen ausfahren, um sie ins Fleisch eines Beutetiers zu schlagen. Alles schien in diesen Augenblicken der seligen Erinnerung wie weggefegt oder sonst wie auf wundersame Weise getilgt, alles Widrige, Schicksalhafte! Natürlich, der Zauberer Alkohol gab ihm das ein: er ließ das Schwere, das ihm früher oft wie ein Mühlstein auf der Seele lag, leicht und flockig werden und wischte es mit eleganter Gebärde weg, als wäre es Schaum.
Am nächsten Tag sollte es mit der Illusion allerdings rasch vorbei sein: Klara bat ihn, einen Abstecher zu ihrer alten Mutter zu machen, die in Waldstädten am See wohnte.
„Meine Mutter war vor ein paar Tagen hier zu Besuch“, sagte sie, „und hat ihren Haustürschlüssel vergessen. Könntest du ihn ihr nicht vorbeibringen, Elmar? Waldstädten liegt doch auf deinem Weg!“
Der Name Waldstädten weckte in ihm keine angenehmen Erinnerungen.
„Meine Mutter wird sich über deinen Besuch sehr freuen!“
Klara bemerkte sein Zögern, doch da der Schlüssel offenbar so schnell wie möglich nach Waldstädten befördert werden sollte, streckte sie ihn Elmar, dem Zögernden, mit beinah flehender Gebärde entgegen.
„Immerhin hat sie dich seit 25 Jahren nicht mehr gesehen. Erst neulich sprach sie von dir.....“
Elmar konnte dem Bettelblick Klaras nicht widerstehen. Da er zudem nicht nur in ihren graublauen Augen, auch in den dunkelblonden, schulterlangen Haaren und dem hübsch geformten, vollen Mund die Ähnlichkeit mit der Schwester wahrnahm, sagte er, ohne weiter zu überlegen:
„Klar erfülle ich den Wunsch deiner Mutter!“
Auch wollte er nicht unhöflich sein; immerhin hatte er so einen netten, erinnerungsseligen Abend mit Klara und Klaus verbracht, und er war auch auf das Angenehmste verköstigt worden. Allerdings ein Abstecher nach Waldstädten, seiner alten Heimat.... - Elmar machte sich keine Illusionen, was das für ihn bedeutete: unweigerlich eine zweite Rückkehr in die Vergangenheit; diesmal nicht mehr auf malerischen Pfaden, hin zu den anmutigen Gefilden, wo er gestern Abend noch mit Klaus und Klara so gerne verweilte; diesmal musste er sich auf Ernüchterung gefasst machen und auf Desillusionierung. Denn er sah sich gezwungen, dieser anderen Vergangenheit gegenübertreten, dieser hässlichen, brutalen, und er musste dann unverhüllte, illusionsfreie Blicke auf öde Hinterhöfe und verwilderte Gärten werfen. Jedes Haus in Waldstädten, jede Gassenbiegung, jeder verwinkelte Vorgarten erzählten ihm eine andere Geschichte, eine, die er gerne in jene genannten Abstellräume für immer verbannen möchte, am besten zusätzlich eingehüllt in undurchdringlichen Nebel, hingezaubert von Meister Lethe!
Waldstädten galt ihm nicht als eine Stadt wie irgendeine, die man vielleicht ihrer reizvollen Lage wegen gerne aufsucht; Waldstädten war die Stadt seiner Jugend! Er war dort geboren; beinah 25 Jahre hatte er dort gelebt. Aber heute? - Schlug er lieber einen Bogen um das Städtchen. Und das hing mit gewissen aufwühlenden Erlebnissen zusammen, an die er sich höchst ungern erinnerte und an denen Frau Lambertz gewiss nicht wenig, um nicht zu sagen: lebhaften Anteil genommen; Frau Adele Lambertz, die Mutter von Klara Kerner; aber nicht nur von Klara, auch von - Julia! Julia Lambertz, seiner langjährigen Freundin. Um ein Haar nämlich wäre Julia seine Frau geworden und die alte Frau Lambertz infolgedessen seine Schwiegermutter, wenn....., ja, wenn diese Freundschaft nicht nach einigen Jahren in die Brüche gegangen wäre.
Dennoch, trotz aller Furcht, dieser bedrückenden Vergangenheit in Waldstädten erneut ins Auge blicken zu müssen - er konnte es nicht lassen, sich beiläufig nach Julia zu erkundigen, jetzt allerdings insgeheim hoffend, Klara werde nichts mehr von einem bevorstehenden Besuch Julias erzählen, und er könnte alle Hoffnung, seiner Ex-Verlobten noch einmal gegenüberzutreten, zu Grabe tragen.
„Julia geht es nicht so gut“, sagte Klara, „sie ist nicht ganz gesund. Ständig leidet sie an zu hohem Blutdruck. Und ihre Tochter Jana.... - sie studiert Kunstgeschichte an der Uni Regensburg - aber Jana ist auch krank....“
„Sie war krank..., wolltest du sagen...!“
Klaus, der sich einschaltete, wollte die Erzählfreude seiner Frau bremsen; auch mit auffällig bohrendem Blick versuchte er ihren Mitteilungsdrang zum Schweigen zu bringen, doch vergebens.
„Warum soll Elmar es nicht wissen?“, ereiferte sie sich; „schließlich kannte er Julia einmal näher! - Also: Jana litt an einer geharnischte Depression. Das Kind wurde deswegen schon öfter behandelt....“
Arme Julia!, dachte Elmar, während Klara, munter weitererzählend, sich über die Arten und Unterarten der Depressionen ausließ. Zwar hatte er so gut wie alle Erlebnisse mit Julia aus seiner Erinnerung verbannt, doch einiges wusste er noch: Julia war ein äußerst reizvolles Mädchen gewesen, auch erinnerte er sich jetzt, dass er es manchmal bereut hatte, die Liebe dieses Mädchens aufs Spiel gesetzt zu haben. Eine Zeitlang hatte noch die Eifersucht an seiner Seele genagt, denn der Zauber, den Julia auf ihn ausübte, verlor nur langsam an Kraft. Zu oft war er ihr noch in Waldstädten begegnet, dabei versuchte er sie immer zu ignorieren, gleichwohl entging ihm nicht, wie ihn ihr ernster, verführerischer Blick traf, und er, immer noch berührt vom Blitzstrahl ihrer Augen und von der Schönheit und lieblichen Anmut ihrer Gestalt, überlegte manchmal, ob er nicht versuchen sollte, ihre Liebe zurückzugewinnen. Doch aus Gründen, die ihm heute entfallen sind, war das wohl nicht möglich. Da er bald darauf Waldstädten endgültig Lebe wohl sagte, konnte er sich langsam aus dem noch nachwirkenden Bann seiner zerbrochenen Liebe befreien.
„Julia wird übrigens auch in Waldstädten sein“, sagte Klara nun doch den Satz, den er auf einmal insgeheim fürchtete, „sie möchte sich ein paar schöne Tage bei ihrer Mutter machen.“
Das also hatte Klaus am Telefon gemeint; er hatte ihn also doch falsch verstanden; Julia besucht ihre Mutter, nicht ihre Schwester!
„Sie kommt doch sicher mit ihrem Mann?“, fragte er und ärgerte sich über das leichte Vibrieren seiner Stimme.
„Nein, sie kommt alleine. Ihr Mann hat keinen Urlaub bekommen!“
Nach einem Moment des Schweigens griff Klara nach einem Kuvert, das auf dem Tisch lag, und zog eine Fotographie heraus. Indem sie gleichzeitig das Foto einige Momente betrachtete, reichte sie es ihm. Dabei musterte sie ihn mit einem Blick, als wollte sie sagen: das wird dich garantiert brennend interessieren!
„Hier, ein Bild von Julia“, hörte er sie mit merkwürdig hohem Ton in der Stimme sprechen, „gerade erst aufgenommen, ich glaube, vor zwei Wochen. Da kannst du mal sehen, wie sie heute aussieht.“
Er betrachtete das Bild, eingehend. Zu seiner Überraschung oder richtiger müsste er sagen: zu seiner Bestürzung lächelte ihm auf dem Foto eine Julia entgegen, so wie er sie früher kannte, die Jahre schienen an ihr beinah spurlos vorübergegangen. Sofort wieder empfand er Sehnsucht nach ihr, es überkam ihn das unbedingte Verlangen, von diesen schillernden Augen leibhaftig angeblickt zu werden und von diesem wahnsinnig sinnlichen Mund noch einmal geküsst zu werden. Wenn es denn also passierte - sprach er zu sich - vielleicht schon in der nächsten halben bis dreiviertel Stunde, dass er Julia erneut verfiel...... Verfiel? Abrupt hielt er inne; denn er war entsetzt über dieses Wort; entsetzt auch über sich selbst, über seine, wie ihm beinah schien: frevelhaften Überlegungen; entsetzt auch darüber, dass er, solche Eventualitäten in seinen Gedanken formulierend, das bisher Undenkbare überhaupt erst ins Leben rief. Was hätte das alles für Konsequenzen? Für Lisi, für seine Kinder, für Julias Mann? Oder war Julias Ehe sowieso schon gescheitert, genau wie vielleicht auch seine Ehe vor dem Aus stand, und also könnte er sich doch ruhigen Gewissens in eine neue Heimat flüchten, in ein neues Zuhause, das er bei Lisi nicht mehr vorfand? Kam seine einstige Verlobte nach Waldstädten, um ihm erneut die Hand zu reichen, ihn erneut „heimzuführen“, in eine neue Geborgenheit?
Energisch versuchte er diesen Gedanken beiseite zu schieben, obwohl er ihn andererseits auch wieder für nicht völlig abwegig hielt. Warum sollte ihm Klara den Besuch ihrer Schwester in Waldstädten ankündigen und gleichzeitig ausdrücklich darauf verweisen, Julia käme ohne ihren Mann, gerade zu der Zeit, wo auch er, ihr Ex-Verlobter, nach Waldstädten reiste? Klara hatte gestern Abend bei Julia angerufen, verriet sie ihm jetzt! Lag also nicht offenkundig die Absicht vor, Julia und ihn wiederzusammenzubringen?
Doch im selben Moment fiel ihm ein, er war als junger Mann ja gar nicht glücklich gewesen mit Julia, ja er hatte eines Tages sogar genug von ihr gehabt, er war - jedenfalls vorübergehend - geradezu von dem Wunsch beseelt, sich von ihr zu trennen. Auch meinte er, er wäre noch aus manch anderen Gründen dieser eventuell auf ihn zukommenden Veränderung in seinem Leben nicht gewachsen: Könnte er es zum Beispiel fertig bringen, seiner Ehe, die vielleicht noch nicht völlig am Ende war, den Todesstoß zu versetzen? -
Rückkehr in die alte Heimat
Elmar machte sich also auf den Weg nach Waldstädten. Kaum hatte er die letzten Häuser des Dorfes hinter sich gelassen und die Auffahrt zur Autobahn genommen, als es heftig zu regnen anfing. Herbstlich kühle Schauer stürzten pausenlos vom Himmel, nicht enden wollende Wolkenbrüche peitschten heran und trommelten von links, rechts, von oben und von vorne an die Scheiben seines Wagens. Der Wald, die hügelige Landschaft, die er eben noch deutlich sehen konnte, waren hinter einer gewaltigen Regenwand verschwunden. Sturmböen trieben den Regen vor sich her, wirbelten die Tropfen immer wieder gegen die Fenster, wo sie prasselnde und knisternde Geräusche verursachten. Blitze jagten in grotesk gezackten Linien über den Himmel und schleuderten ihr fahles Licht über die Lande, und als der Wald, bislang nur als dunkle, unförmige Masse sichtbar, im bengalischen Licht der Blitze kurz aufschien, krachte es auch schon, beängstigend lange mit einem Getöse, als splittere im nahen Wald ein Baumriese auseinander. Fasziniert betrachtete er das Naturschauspiel. Gleichzeitig wunderte er sich, war doch ein Gewitter zu dieser Jahreszeit, im Oktober, nicht gerade üblich. Obwohl die Regengüsse die Sicht erschwerten und er nur mit gedrosseltem Tempo fahren und konzentriert auf den Verkehr achten musste, eilten seine Gedanken öfter zu den Ereignissen voraus, die in Waldstädten vermutlich auf ihn zukamen. Vor allem stellte er sich die Situation vor, wie er wohl von Frau Lambertz empfangen und in ihr Haus geführt werde. Das große Wohnzimmer der Lambertz, eigentlich eine größere und kleinere Zimmerhälfte, stieg mit all seinem Inventar in seiner Erinnerung auf. Wie oft hatte er dort auf dem langen Familiensofa gesessen, verabredet mit Julia, die er abholen wollte, um sie Gott weiß wohin auszuführen, wie viele Feste hatte er mit ihr und ihren zahlreichen Geschwistern in diesen Räumen gefeiert! Über zwanzig Jahre waren das nun her. Im Geiste schon wandelte er durch die beiden Zimmer, warf Blicke auf den massiven Bücherschrank mit all den unbenutzten Klassikerreihen, oder er inspizierte die Gemälde in der kleineren Zimmerhälfte. Zeitlebens war ihm eines in Erinnerung geblieben, welches das Werk eines Großonkels von Julia war, eines ehemaligen Rektors der Realschule von Waldstädten. „Der Geist des Bettelweibes“, lautete sein Titel oder so ähnlich. Gemalt war eine unheimliche Szene aus einer Novelle von Heinrich von Kleist, die der Rektor vermutlich sehr geschätzt hatte. Ein Ritter mit blutrotem Umhang steht in der Mitte einer Kemenate, schlägt mit seinem Degen wild in die Luft, als kämpfe er gegen einen unsichtbaren Feind. Seine Augen starren voller Entsetzen auf eine Stelle des Zimmers. Neben ihm weicht sein Hund mit gefletschten Zähnen vor irgend etwas zurück, vermutlich vor dem unsichtbaren, aber hörbaren Geist des Bettelweibes. Der Ritter sollte der Marchese der Kleist - Novelle sein. Er hatte das Bettelweib einst in barschem Ton hinter den Ofen verwiesen, wo das Weib zusammenbrach und verstarb. Später erschien es ihm als Gespenst, das heißt, er hörte stets nur ihre schlurfenden Schritte; immer wieder schlurfte es nachts in dem Zimmer und an dem Ofen, wo das arme Weib jämmerlich zugrunde gegangen war. Der Marchese aber, wahnsinnig geworden, zündete sein Schloss an und kam in den Flammen elendig um. Was für eine rätselhafte, absonderliche Verstrickung!, dachte Elmar immer, wenn er das Bild betrachtete oder die Novelle von Kleist las; er kannte sie von seinen Deutschstunden her. Irgendeine Schuld des Marchese am Tod des Bettelweibes war nicht ersichtlich, ja man konnte noch nicht einmal annehmen, er hätte sich später, als das Gespenst auftauchte, an den Vorfall überhaupt erinnert; trotzdem erscheint das Gespenst, als wäre es sein personifiziertes schlechtes Gewissen, als wäre es von der Göttin Nemesis geschickt, um ihn für eine schlimme Tat büßen zu lassen.
Noch an andere düstere Gemälde in diesem Zimmer glaubte sich Elmar zu entsinnen, und er wundert sich noch heute, warum Julias Vater an solchen wenig anheimelnden Schicksalsbildern Gefallen fand. Denn nicht nur das „Bettelweib“ erzählte von einem furchtbaren Geschick, auch die anderen kündeten - soweit er sich erinnerte - von Verhängnis und Unglück. Sollte das Unheilvolle, Chaotische dieser Bilder an die ewige Drohung der Himmelsmächte gemahnen, oder hatte Herr Lambertz aus diesem Kontrast zu seinen wohlgeordneten Verhältnissen ein überhöhtes Selbstbewusstsein geschöpft?
Elmar hatte inzwischen die Autobahn verlassen und war Waldstädten schon recht nahe gekommen. Auf einem Schild las er: „Waldstädten, 15 Kilometer“. In den nächsten Minuten durchfuhr er ein größeres Waldstück, und er hielt an einem Wanderweg an, da ihm dieser bekannt vorkam.
‚Ja, dieser Weg!’ murmelte er, durch das Seitenfenster auf das Waldstück blickend, ’so gerade läuft er in den Wald hinein, und hinten verliert er sich im Ungewissen, Dunklen! Ja, er ist es, ich bin ihn so oft mit meinen Eltern gegangen.’
Es war keine erbauliche Geschichte, die sich da in seine Gedanken drängte, zuerst in flüchtiger Gestalt, mit wenigen schemenhaften Erinnerungsfetzen, doch nicht lange dauerte es, bis die Bruchstücke sich mehr und mehr zu wahren Schreckensbildern formten, und er war außerstande, sich der Gewalt dieser unentwegt aus seinem Seelenabgrund emporschießenden düsteren Erinnerungen zu entziehen. Einst nämlich - so erzählten ihm diese Bilder - war er in sein Elternhaus zurückgekehrt, nicht geschmückt mit dem Lorbeer irgendeines gelungenen Abschlusses, auch nicht gestählt durch einen anderen Erfolg, auf den er stolz hätte verweisen können; nein, er konnte auf nichts verweisen, er war buchstäblich mit leeren Händen zurückgekehrt, er war beruflich gescheitert! Ohne fremde Hilfe konnte er damals nicht existieren, und also blieb er lange bei seinen Eltern wohnen, die ihn wie in früheren Zeiten umsorgten und ernährten. Zu allem Unglück hatte noch eine gefährliche Viruskrankheit alle seine Kräfte gelähmt.
‘Himmel noch mal’, dachte er, ‘was für Zeiten waren das! Wären seine Eltern nicht gewesen, er wäre jämmerlich zugrunde gegangen, in jenen dunklen Verliesen, die das Schicksal für manchen Zeitgenossen bereithält.’