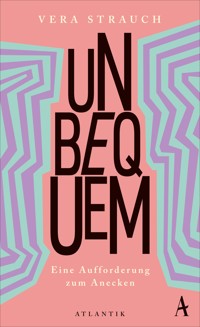
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
Schluss mit angepasst – nur wer aneckt, bringt etwas in Bewegung Wollen wir angepasst leben, nicht auffallen und keinesfalls anecken – und dabei unsere eigenen Werte verraten, weil wir uns ständig verbiegen? Oder lohnt es sich vielleicht, mal nicht angepasst zu reagieren, aus der Rolle zu fallen und wirklich einzutreten für das, was richtig ist, für die Gesellschaft oder auch nur für uns selbst? Inspirierend und kenntnisreich lädt Vera Strauch dazu ein, unbequem zu sein – und damit wirklich etwas zu bewegen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Vera Strauch
Unbequem
Eine Aufforderung zum Anecken
Atlantik
FÜR MEINE SCHWESTER HANNAH und alle, die so wie sie mit offenem Herzen, klugen Gedanken und großem Mut im Unbequemen den Weg ebnen
Einleitung
Ich wollte dieses Buch nicht schreiben. Das ist meine erste unbequeme Wahrheit. Dieses Buch sollte eigentlich ein ganz anderes werden. Eines, das Mut macht, ja. Und sich mit dem Anecken beschäftigt, ja. Aber ich hatte nicht vor, so tief einzutauchen, so große Themen aufzumachen. Ich wollte Fakten liefern und praktische Ratschläge geben für unangenehme Situationen und Gespräche. Es war nicht geplant, dass ich dabei selbst so viel Zeit mit dem Unbequemen verbringe. Mit diesem Zustand der innerlichen Orientierungslosigkeit, der so tief aufrütteln kann. Doch der ist genau deshalb jetzt zum Kern dieses Buches geworden.
Bei mir zeigt sich das Unbequeme zum Beispiel in Momenten, in denen ich mich nicht zugehörig fühle, weil ich mich unpassend verhalte oder etwas übersehen habe, was anderen ganz klar war. Oder in Situationen, in denen ich mich verloren fühle, weil meine vermeintliche Wahrheit, meine Welt, infrage gestellt wird – und damit irgendwie auch ich. Es macht keinen Spaß. Ich mag es nicht und ich kann es nicht gut. Warum sollte ich da so tief reingehen wollen? Und dann auch noch darüber schreiben
Es ist riskant, denn ich könnte missverstanden werden als eine, die sich anmaßt, so vieles zu können und zu wissen, was sie nicht kann und nicht weiß. Eine, die sich ihrer Privilegien und Kompetenzgrenzen nicht bewusst ist. Ich könnte Aspekte übersehen, zu persönlich oder zu abstrakt werden. Über das Unbequeme zu schreiben, ist also zugleich richtig unbequem für mich.
Mein erster Impuls war deshalb bei vielen Themen hier, sie schlicht zu vermeiden und einfach eine andere Richtung einzuschlagen. Dieses Verhalten beschreibt ziemlich genau, was das Unbequeme mit uns machen kann (wenn wir es lassen): Wir weichen aus. Umschiffen, verschweigen, ignorieren, finden Ausreden – uns selbst und anderen gegenüber. Doch die Auseinandersetzung lässt sich nicht dauerhaft vermeiden. Sie kann temporär ausgespart werden, aber das Unbequeme ist trotzdem irgendwie da.
Es heißt, man solle das schreiben, was man selbst gerne lesen würde. Was man selbst braucht. Also wage ich es.
Die Kraft des Unbequemen spielt in diesem Buch auf dreifache Weise eine Rolle: Im ersten Abschnitt liegt der Fokus darauf, wie ich als Einzelperson aus meiner Komfortzone treten und warum das wertvoll sein kann. Im zweiten Abschnitt sehen wir uns den kollektiven Umgang mit dem Unbequemen aus der Perspektive des Miteinanders an. Denn es gibt nicht nur Situationen, in denen wir mit uns selbst im Innen anecken, sondern auch die, in denen wir im Außen durch unser Verhalten bei anderen Diskomfort erzeugen und als Gruppe damit einen Umgang finden können. Im dritten Abschnitt blicken wir dann auf die gesellschaftlichen Auswirkungen unserer kollektiven Kompetenz zur Unbequemlichkeit.
Dabei erhebt dieses Buch nicht den Anspruch, alle Themenfelder vollständig abzudecken, denn es ließe sich zu jedem Kapitel wahrscheinlich ein eigenes Buch schreiben. Vielmehr ist mein Ziel, die Bandbreite des Unbequemen aufzuzeigen. Es greifen viele unterschiedliche Felder ineinander und geben uns so Ecken und Enden zum Ansetzen und Aktivwerden. Jedes Kapitel funktioniert in sich geschlossen, und das Buch kann, je nach Interesse, auch in einer anderen Reihenfolge als der von mir entwickelten gelesen werden. Mein Wunsch ist, nicht nur durch das Aufzeigen von Notwendigkeiten zu aktivieren, sondern auch konkrete Ansätze zur Umsetzung vorzuschlagen.
1. Das Unbequeme ist einflussreich.
Je besser wir in der Lage sind, unbequeme Momente zu erkennen, und je klarer wir uns werden, was uns im Umgang mit ihnen wichtig ist, desto mehr Einfluss können wir (zurück)gewinnen. Statt Aufwand in das Umschiffen, Ignorieren oder Überspielen des Problems zu stecken, gibt es uns die Möglichkeit, proaktiv zu handeln und bewusst zu entscheiden. Es stärkt unsere Selbstwirksamkeit, gerade in den Momenten, in denen wir uns ohnmächtig fühlen. Denn wir verstehen, dass wir nicht schief gewickelt sind, weil etwas nicht rundläuft.
Das gilt für uns als Einzelpersonen, aber auch als Gemeinschaften. Wenn wir einen konstruktiven Umgang mit dem finden, das für uns allein, aber auch gemeinsam unbequem ist, spart uns das nicht nur Energie (und setzt damit zusätzliche für andere Herausforderungen frei), sondern es kann uns neue Perspektiven eröffnen.
Wir dürfen Gestalter*innen sein, auch und gerade wenn Probleme auftreten. Mit jeder noch so kleinen Entscheidung zur aktiv gewählten Unbequemlichkeit ermöglichen wir es, uns als Menschen und Gruppen mit Selbstwirksamkeit und Einfluss zu erleben.
2. Das Unbequeme ist individuell.
Das Wort bequem wird in seiner heutigen Bedeutung seit dem 18. Jahrhundert verwendet und kommt aus dem Mittelhochdeutschen »bequæme« bzw. dem Althochdeutschen »biquāmi«, was so viel heißt wie »zukommend, passend, tauglich«.[1] Es bedeutet, dass jemand oder etwas »angenehm, keinerlei Beschwerden oder Missbehagen verursachend«, »leicht, mühelos« oder »jeder Anstrengung abgeneigt, träge« ist.[2] Das Gegenteil davon ist unbequem. Etwas oder jemand ist unbequem, wenn es oder er*sie Schwierigkeiten bereitet und andere in ihrer Ruhe oder in ihrem Vorhaben stört.[3]
In diesem Buch geht es um zwei Ebenen der Unbequemlichkeit, die sich auch in diesen Definitionen wiederfinden: den Umgang von anderen damit und den Umgang von uns selbst mit Unbequemlichkeit. Es geht um das Anecken im Außen – und im Innen. Denn an der ungemütlichen Innenschau führt kein Weg vorbei, wenn wir uns von der Verlockung der Anpassung emanzipieren wollen. Wenn wir unser rohes, lebendiges Ich entdecken und spüren wollen, braucht es den Mut, Blicke auf und in uns selbst zu richten.
Es gibt nicht die eine Sache, die für alle gleichermaßen unbequem ist. Für die eine Person ist es angenehm, Zeit allein zu haben, für andere ist das kaum auszuhalten. Konflikte sind für einige eine Strafe, andere blühen im Streitgespräch auf. Vor Menschenansammlungen auf die Bühne zu treten ist der blanke Horror für die einen, während es die anderen energetisiert. Viele können sich ein Leben ohne monatlichen Gehaltsscheck nicht vorstellen, während andere in der Selbstständigkeit aufgehen. Sogar das Sterben ist etwas, dem manche Menschen wohlwollend entgegensehen, während es für viele der wohl unbequemste Gedanke im Leben ist. Was für mich angenehm ist, kann für andere unbequem sein. Was weit außerhalb meiner Komfortzone liegt, mag für andere ein Kinderspiel sein. Das Empfinden ist individuell. Deshalb ist das Unbequeme individuell.
3. Das Unbequeme ist komplex.
Dieses Buch ist eine Aufforderung zum Anecken – innen und außen. Das bedeutet allerdings nicht, dass es darum geht, immer anzuecken. Das wäre allenfalls auch bequem und zu kurz gedacht. Wir brauchen den Komfort, die Bequemlichkeit, ebenso wie den Diskomfort, die Unbequemlichkeit.
Ich sehe die Verlockung des Bequemen und wie es immer mehr zu einem Wert an sich wird. Dem soll dieses Buch gegensteuern. Es soll die Balance in den Mittelpunkt stellen. Das Spannungsverhältnis anerkennen: Wir brauchen beides. Wir sind als Einzelpersonen und als Gemeinschaften gefragt, auch beidem Raum zu schenken und uns nicht von der Bequemlichkeit einlullen zu lassen.
Es gibt keine kurzen Antworten auf die Herausforderungen des Unbequemen – und damit auch keine einfache Definition des Unbequemen. Wir können uns nur annähern.
Es gibt Geschichten, die kurze Antworten liefern. Das sind in vielen Fällen Narrative der Unterdrückung: Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Klassismus oder Ableismus zum Beispiel.[4] Sie bedienen sich des zu kurz Gedachten und sind bequem, weil sie die Welt schematisch in Gut und Böse unterteilen. Durch einfache Erzählungen erschaffen sie ein Feindbild, einen Sündenbock oder grenzen Menschen aus, weil sie vermeintlich anders oder nicht normal seien. Diese Geschichten können so tief verinnerlicht sein, dass sie auch unbewusst zutage treten. Ihre Wirkung bleibt trotzdem unterdrückend.
Vermeintliche »Querdenker«[5] oder Rechte mögen von sich behaupten, unbequem zu sein. Doch sie folgen dabei nur den kurz gedachten Narrativen. Mit dem einfachen und sehr effektiven Instrument der Angstmache bringen sie Menschen zusammen: Angst zu schüren ist einfach, bequem – und effektiv.[6] Angst entsteht aus Angst. Und Angst verursacht Angst. Allen, die sich fragen, wie sie gesellschaftlich etwas bewirken können, möchte ich antworten: Dies ist ein Weg, um etwas zu verändern. Wir können der Angst mit unserer Unbequemlichkeit begegnen. Durch klare Grenzen. Durch eindeutige Verurteilung und durch bedingungslose Solidarität mit denjenigen, gegen die sich die geschürte offensichtliche und versteckte Aggression richtet.
4. Das Unbequeme wählen zu können ist ein Privileg.
Es ist ein Ausdruck von Privilegiertheit, es bequem zu haben. Ich schreibe dieses Buch aus der Perspektive einer sehr privilegierten Person. Das äußert sich unter anderem darin, dass ich oft frei wählen kann. Dass ich wählen kann, es bequem zu haben. Andere Menschen, die nicht so privilegiert sind, haben diesen Luxus nicht. Menschen, die diskriminiert werden, erleben weniger Möglichkeiten der Bequemlichkeit, weil sie zum Beispiel eine Behinderung haben oder als nichtweiß1[7] gelesen werden. Oder Menschen, die nicht den sozioökonomischen Status genießen wie ich. Hätte ich durch aneckendes Verhalten meine Festanstellung verloren, wäre ich weich gefallen auf ein finanzielles Polster und sehr gute Chancen, schnell einen neuen Job zu finden. Andere hingegen können es sich finanziell nicht leisten, ihren Job zu verlieren. Je mehr Privilegien ich habe, desto mehr Macht und damit auch Verantwortung für den Status quo trage ich. Diese Verantwortung wahrzunehmen beginnt bereits im Umdenken und in der unbequemen Offenheit.
Milliarden von Menschen haben es von vornherein »unbequem« und kommen gar nicht erst in die Lage, es sich (zu) bequem machen zu können. Sie sind immer schon im Unbequemen unterwegs mit Mangel, Diskriminierung, Ausgrenzung, politischer Unfreiheit und der Akzeptanz dessen, was ist. Je mehr Raum zum Gestalten ich habe durch finanzielle Mittel, Beziehungen, gesellschaftliches Ansehen und andere Privilegien, desto leichter wird es für mich, es mir bequem zu machen.
Es ist erforderlich, dass diejenigen, die mehr Macht und damit auch mehr Annehmlichkeiten haben, davon etwas abgeben. Dass sie ihren Einfluss teilen und einige ihrer Bequemlichkeiten aufgeben. Es entsteht leicht eine Lethargie der Bequemlichkeit und diese gilt es zu überwinden. Wir müssen uns nur entscheiden, wo und dass wir damit bewusst anfangen. Dieses Buch hat dazu Ideen.
5. Das Unbequeme führt zu Spannung oder Konflikt.
Das Unbequeme ist häufig auch deshalb unbequem, weil es den Status quo infrage stellt. Die meisten Menschen würden die Frage danach, ob sie sich eine gerechtere Gesellschaft wünschen würden, bejahen. Doch wenn wir diesen Gedanken konsequent weiterdenken, wird es wie gesagt unbequem für diejenigen, die heute mehr Einfluss als andere haben.
Denn eine gerechtere Gesellschaft bedeutet eine Gesellschaft, an der mehr Menschen und ganz unterschiedliche Menschen partizipieren können. In der sie mitentscheiden und mitdiskutieren. In der wir alle mitwirken und vorgeben dürfen, was normal ist und was nicht – und damit übrigens auch definieren, was aneckt und was nicht. Das bedeutet unweigerlich, dass Macht anders verteilt wird.
Der Soziologe Aladin El-Mafaalani beschreibt das als Teil des sogenannten Integrationsparadox. Dazu zeichnet er folgendes Bild des sich wandelnden gesellschaftlichen Systems: An einem Tisch sitzen zunächst einige wenige (cis) Männer2. Der Rest der Gesellschaft sitzt am Boden. Dann werden (cis) Frauen dazu- geholt. Es wird enger am Tisch. Dann kommen Migrant*innen, Ostdeutsche, People of Color, Menschen mit Behinderung, queere Menschen, nichtbinäre und transgeschlechtliche Menschen[8] dazu. Es wird immer enger, immer ungemütlicher. Aber damit nicht genug: Die Dazukommenden wollen sich aktiv einbringen, sie stellen Fragen und fordern, die Regeln und Mechanismen des Miteinanders neu zu definieren, sodass sie auch zu ihnen passen.[9]
Das führt unweigerlich zu Spannung und Konflikt und ist deshalb erst mal unbequem. Doch es muss nichts Schlechtes sein. Nach El-Mafaalani braucht es ein Umdenken:
»Der Klebstoff des ›alten‹ Zusammenhalts bestand aus Unterdrückungsverhältnissen, von denen all die genannten Personengruppen betroffen waren. Mit der Überwindung der Unterdrückung ist auch der Klebstoff ausgetrocknet. Der Zusammenhalt wurde durch Konflikte ersetzt. Prinzipien des kulturellen und strukturellen Zusammenlebens wandeln sich.«[10]
Die Unterdrückung bestehender Machtstrukturen und, ich würde hinzufügen, die daraus resultierende Bequemlichkeit der Mächtigen, war der Klebstoff, der den Zusammenhalt ermöglichte. Konflikte sind unweigerlich Teil eines gerechteren und damit auch vielfältigen Miteinanders. Für gesellschaftlichen Fortschritt brauchen wir die Kompetenz, mit dem Unbequemen und mit dem daraus häufig resultierenden Konflikt umzugehen.
Worauf es dabei auch ankommt, ist eine Verbesserung der zwischenmenschlichen Kommunikation, um Konflikte gewaltfrei anzugehen und in der Konsequenz hoffentlich zu lösen. Der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun schlägt drei Ansatzpunkte vor, die dafür zur Verfügung stehen:
»1. Ansatz am Individuum. Das heißt: Ich fange bei mir selber an bzw. berate und trainiere einzelne Menschen. […]
2. Ansatz an der Art des Miteinanders. Der ›Patient‹ ist hier nicht ein einzelnes ›schwarzes Schaf‹, sondern der Umgangsstil einer ganzen Gruppe […].
3. Ansatz an den institutionellen/gesellschaftlichen Bedingungen. Veränderungswürdig erscheinen […] die Zustände, unter denen die Menschen zusammenkommen und die ihnen bestimmte Umgangsformen aufzwingen oder zumindest nahelegen.«[11]
An diesen Schritten orientiert sich auch meine Gedankenführung.
6. Das Unbequeme ist persönlich unverzichtbar.
Wir können im »kleinen Kreis der unmittelbaren Reichweite«[12] anfangen. Das Unbequeme und mein Umgang damit beginnen mit mir selbst. Damit, dass ich mit meinem Denken, Fühlen und Handeln den wichtigen Themen nicht ausweiche, sondern das, was mir auch innerlich im Weg steht, aktiv angehe.
Das ist auch deshalb so wertvoll, weil sich so eine innere Struktur, eine Form der mentalen und emotionalen Stärke aufbauen lässt, die es leichter machen kann, im Außen anzuecken. Denn unbequem zu sein ist, wie wir sehen werden, eng mit dem Hinterfragen bestehender, häufig unsichtbarer Machtstrukturen verbunden. Patriarchale Narrative prägen unseren Alltag und die Vorstellung davon, was wir als normal oder richtig bewerten, ohne dass es uns bewusst sein muss. Der Status quo hat eine große Widerstandskraft, und ihn zu hinterfragen und verändern zu wollen verursacht unweigerlich Gegenwind.
Um mit dieser Dynamik von Veränderungsprozessen umgehen zu können, ist es wertvoll, sie zum einen zu kennen, zu verstehen und von der eigenen Person trennen zu können. Dazu wird es hier deswegen immer wieder um konkrete Ansätze im Umgang mit Veränderung gehen. Zum anderen können wir gezielt unsere mentale Widerstandskraft fördern und Selbstfürsorge betreiben, um uns nachhaltig für unbequemen, aber notwendigen gesellschaftlichen Wandel einzusetzen. Dazu werden wir mit Ansätzen arbeiten, die sich im Alltag anwenden lassen und die Kraft von Selbstliebe indirekt und direkt immer wieder aufgreifen. Wie wir sehen werden, braucht es innere Stärke, um nicht die gewaltvollen Muster der Machtausübung zu reproduzieren, sondern bewusst gewalt- und unterdrückungsfrei Veränderung bewirken zu können. Der Umgang mit mir selbst spielt deshalb eine zentrale Rolle.
7. Das Unbequeme ist fürs Miteinander unverzichtbar.
Im Miteinander anzuecken bedeutet häufig, Konflikte zu riskieren. Das scheuen wir oft, aus gutem Grund. Denn wann, wie und wo haben wir gelernt, mit diesen heiklen Kommunikationssituation so umzugehen, dass sie konstruktiv ablaufen? Wer hat uns beigebracht und gezeigt, wie sich Konflikte lösen lassen und sogar zu einer Stärkung statt einer Entfremdung in Beziehungen führen können? Meine Vermutung ist, dass wir in unserem privaten und gesellschaftlichen Umfeld (in Schule, Ausbildung oder Arbeitsverhältnissen beispielsweise) eher das Gegenteil vorgelebt bekommen haben.
Dabei ist es möglich und sogar ganz entscheidend zu lernen, wie man heikle Situationen anspricht und erfolgreich löst, anstatt ihnen auszuweichen oder sie eskalieren zu lassen. Denn auch wenn und gerade weil sie so wichtig sind, liegt großes Potenzial in diesen Momenten. In allen Lebensbereichen kann das Deeskalieren von (potenziellen) Konflikten uns weiterbringen.
Das erfordert Mut in vielerlei Hinsicht. Denn Konflikt und Gewalt sind auch sprachlich eng miteinander verbunden. Im zweiten Teil des Buches widmen wir uns deshalb dem Miteinander. Wie kann ich mich integer verhalten, wie Konflikte angehen und gleichzeitig Beziehungen stärken? Wir werden sehen, dass sprachliche Gewaltfreiheit zu einem sinnstiftenden Auftrag an uns selbst werden kann. Und das ist unabdingbar. Denn sprachliche Gewalt ist allgegenwärtig. So sehr, dass sie uns in alltäglichen Situationen bei der Arbeit, in der Familie oder mit Freund*innen gar nicht mehr auffällt. Das muss sich ändern.
Wenn wir Methoden ausfindig machen, um missbräuchliches Verhalten in allen Lebenssituationen zu verringern oder am besten ganz zu beenden, ist das der Weg in eine friedlichere Welt. Es wird ein Stück weit dazu führen, dass wir uns anders mit den enormen Herausforderungen unserer Zeit auseinandersetzen und sie konstruktiv angehen können.
Es kann heilsam sein, nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch als Auswirkung auf die Gesellschaft, wenn wir Gemeinschaft mit vertrauensvollen Bindungen leben können.
8. Das Unbequeme ist für die Gesellschaft und unsere Zukunft unverzichtbar.
Wir brauchen einander. Vieles funktioniert nur, wenn wir im Großen gemeinsam daran arbeiten. Wachsende soziale Ungleichheit (bei fehlender Chancengleichheit),[13] globale Migration, die Klimakatastrophe sind nur einige Beispiele für das Wegsehen oder auch Wegdenken existenzieller Themen – bis es eben nicht mehr anders geht und wir hinschauen müssen.
Es ist unbequem, dieser Tatsache nicht auszuweichen. Es braucht dazu nicht nur individuelle und kollektive Kompetenzen, sondern auch strukturelle Rahmenbedingungen. Einige davon sehen wir uns in einem Ausblick im dritten Teil des Buches an. Denn die Kernfrage lautet: Was brauchen wir, um gesellschaftlich dem Unbequemen nicht länger auszuweichen?
Die Ideen und Erkenntnisse, die ich teile, nehmen seit Jahren Einfluss darauf, wie ich denke, lerne, arbeite, anderen begegne, auf Erziehung blicke – wie ich mich durch mein tägliches Leben bewege. In den Curricula von Schulen, Universitäten, insgesamt in Bildung, Erziehung und auch der Arbeitswelt spielen viele Themen dieses Buches keine oder, wenn überhaupt, nur am Rande eine Rolle. Dabei sind sie in meinen Augen entscheidend, wenn wir auf unsere individuelle und gesellschaftliche Entwicklung blicken.
Ich hoffe sehr, dass die Texte hier ein neues Licht darauf werfen werden, wie wir über unser Denken, Fühlen und Handeln als Student*innen, als Arbeitskräfte, als Eltern, als Partner*innen und als Bürger*innen, Führungspersönlichkeiten und Gestalter*innen einer aktiven Zivilgesellschaft Veränderung in die Welt tragen. Denn das tun wir ohnehin. Wir alle. In jedem Moment.
Auch die auf den ersten Blick unbedeutend erscheinenden Momente können etwas auslösen. Das, was wir, und sei es auch nur ganz kurz, als unbequem empfinden, kann uns dabei den Weg weisen. Das können Momente sein, in denen wir das Smartphone beiseite legen, und unserem Gegenüber ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Momente, in denen wir uns einer vertrauten Person öffnen und darüber sprechen, wie wir uns wirklich fühlen. Momente, in denen wir es riskieren, anzuecken, weil wir aufrichtig etwas Unbequemes, aber Notwendiges ansprechen. Es sind diese Momente, die wir wahrscheinlich nicht mit großen Veränderungen in Verbindung bringen würden. Doch das Kleine hat Einfluss auf das große Ganze – weil es andere zum Hinsehen einlädt, bewegt und manchmal sogar inspiriert.
Statt wie ursprünglich geplant in diesem Buch ausschließlich über die Kraft von und Methoden zum Umgang mit dem Unbequemen zu schreiben, ist es jetzt auch eine Aufforderung geworden, die auch unsere Narrative und Strukturen von Macht infrage stellt. Die kritisch auf bestehende Systeme blickt und immer wieder Gerechtigkeitsfragen stellt. Das ist besonders unbequem für mich. Denn obwohl ich mich seit Jahren mit meiner Arbeit feministischen Themen verschrieben habe, formuliere ich die Worte in diesem Buch mit großem Respekt vor klugen Vordenker*innen und im Bewusstsein meiner Privilegiertheit.
Es schwingt die für mich sehr unangenehme Sicherheit mit, dass sich Perspektiven, Wissen und Notwendigkeiten zu den großen Themen, die ich anspreche, fortlaufend verändern. Das bedeutet, dass auch meine Erkenntnisse und Blickwinkel sich verändern werden und dass das, was ich schreibe, nicht vollständig und perfekt sein kann. Doch deswegen die Texte dieses Buches von meiner feministischen Haltung und Arbeit zu entkoppeln, wäre für mich nicht stimmig und irgendwie bequem gewesen. Bei der Autorin Kübra Gümüşay habe ich dieses Zitat von Roxane Gay gelesen: »I would rather be a bad feminist than no feminist at all.«[14] Also schreibe ich hier als Bad Feminist, genauso, wie ich eine Bad Discomfortist bin. Weil ich lieber unperfekt feministisch und unperfekt unbequem bin, als es gar nicht zu sein.
Ich habe in diesem Buch keine abschließenden Lösungen, dafür viele Ideen und Vorschläge. Dabei geht es um große Veränderungen und Themen von gesamtgesellschaftlicher Relevanz. Immer aber geht es auch darum, wie wir bei uns selbst beginnen können. Denn diese Selbstwirksamkeit haben wir und können sie (er)leben. Das entbindet diejenigen, die die strukturellen und institutionellen Rahmenbedingungen gestalten, nicht von ihrer Verantwortung. Es gibt uns aber die Möglichkeit, uns zu erleben – in unserer Wirksamkeit als aktive Zivilgesellschaft. Denn ohne sie kann Demokratie nicht funktionieren. Und wir werden sehen: Die aktive Zivilgesellschaft ist heute so gefragt wie vielleicht selten zuvor.
Dieses Buch ist eine Einladung, zusammen zu hinterfragen, ins Gespräch mit anderen zu kommen, aktiv zu werden. Es soll Mut machen, weil nicht weggeschaut, aber auch nicht verurteilt wird. Es möchte konkrete Wege aufzeigen, um Respekt, Augenhöhe und radikale Selbstliebe als einen Schlüssel zu friedlicher Veränderung zu nutzen. Es soll konstruktiv anecken, weil es nicht nur zeigt, dass wir ein Problem mit Macht und Gewalt haben, sondern auch Ideen dazu vorstellt, wie wir dem begegnen könnten.
Unser individuelles Verhalten hat Auswirkungen auf das große Ganze. Wir sind Familienmitglieder, aber auch Bürger*innen in einer Demokratie. Wir sind Kolleg*innen im Team, aber auch Gestalter*innen von Zusammenarbeit. Wir sind Freund*innen, aber auch Menschen, die Nachbarschaften, Gemeinden, Gesellschaften durch ihr Miteinander prägen. Was im Kleinen passiert, hat Auswirkungen auf das Große. Jede*r von uns leistet einen wichtigen Beitrag zu einer aktiven Zivilgesellschaft und damit zu einer Welt, die wir für ein gerechtes Miteinander und eine bessere Zukunft brauchen. Unser Umgang mit dem Unbequemen kann ein wichtiger Bestandteil dieses Beitrags sein.
Individuum – Unbequem mit mir
1. Verstehen: Anpassung hinterfragen
»Das Hindernis, das uns im Weg war, wird der Weg.« [15]
Marc Aurel
Mit Anfang 30 habe ich meinen sehr gut bezahlten unbefristeten Konzernjob gekündigt – ohne etwas Neues in Aussicht zu haben. Ich hatte Jobangebote, ja, aber keine Lust, sie anzunehmen. Stattdessen wollte ich etwas anderes machen. Ich wusste nur leider nicht genau was. Es war ein Schritt heraus aus der Komfortzone, und ich hatte ihn gut vorbereitet. Vor allem auch, um die Ängste von anderen aufzufangen, die auf einmal auf mich einprasselten.
Meine Großmutter, die mein Verhalten wütend machte, weil es ihr unverantwortlich erschien, Freund*innen, die mir rieten, das Angestelltenverhältnis doch noch für die Familienplanung zu nutzen, oder die Personalsachbearbeiterin des Konzerns, die mich anrief in Sorge, ich würde für immer arbeitssuchend bleiben. Die Ängste anderer landeten bei mir, und ich war darauf vorbereitet. Ich hatte ein finanzielles Polster, diverse Ideen und Lust auf etwas Neues. Doch trotzdem: Auch die beste Vorbereitung macht den Sprung ins kalte Wasser nicht weniger unangenehm. Denn ich konnte nicht alles antizipieren und im Vorfeld planen.
Als ich nach der Kündigung meine ersten Schritte in die Selbst-ständigkeit ging, merkte ich schnell, dass ich zwar gut vorbereitet war – aber bei weitem nicht auf alles. Ich war auf einmal beruflich allein. Dieser Zustand lag außerhalb meiner Komfortzone und fühlte sich unangenehm an. Wenn mein Mann morgens die Wohnung verließ und zur Arbeit ging, saß ich vor meinen Konzepten – allein. Wenn ich zu Netzwerkveranstaltungen ging, war ich allein. Wenn ich mich mit meinen Ideen und meiner Vision bei anderen Organisationen vorstellte, dann allein. Niemand in der neuen Branche kannte mein noch nicht gegründetes Unternehmen und mich als Vera, die selbstständig ist. Bis vor kurzem war ich noch Geschäftsführerin eines traditionsreichen Unternehmens gewesen, den Namen eines globalen Konzerns im Rücken und auf der Visitenkarte, und jetzt war da nur noch ich. Ohne Rückendeckung. Ohne Team. Ohne die Referenzen, die ich eigentlich brauchte.
Die Formulierung »die Komfortzone verlassen« geht einem leicht von den Lippen. Danach zu leben ist jedoch ungleich schwerer. Denn es ist unangenehm, sich nicht in allem sicher und souverän zu fühlen. Es ist schwer, sich verletzlich zu machen. Nicht zu wissen, nicht zu können, nicht zu kennen, nicht vertraut zu sein. Die (Illusion von) Kontrolle abzugeben und ein Risiko einzugehen in Bezug auf etwas, was uns wichtig ist. Das ist hart.
Doch diese Empfindung darf gemildert werden durch eine zentrale Erkenntnis. Nämlich den Gedanken, dass Unbequemlichkeit sehr wertvoll sein kann. Denn das Herausbewegen aus der Komfortzone hat einen entscheidenden Effekt: Wir erleben uns anders. Die Vera, die ich in dieser Unbehaglichkeit erlebe, ist anders als die, die sich in ihrer Wohlfühlzone aufhält. Dieses neue Erleben ermöglicht uns, neue Erfahrungen zu sammeln, und die wiederum führen zu einem erneuerten Selbstverständnis.
Gleichzeitig hat die Komfortzone auch Vorzüge. Sie ist ein Ort der empfundenen Sicherheit. Hier kennen wir uns aus und wissen, was zu tun ist. Das kann zwar mitunter etwas langweilig sein, doch dafür ist es ruhig und entspannt, gibt uns die Chance, Energie zu sparen. Beruflich liegen in der Komfortzone beispielsweise die Tätigkeiten, die wir sicher und routiniert ausführen können, persönlich die Menschen und Orte, mit denen wir vertraut sind.
Dieses Buch soll kein Angriff auf die Komfortzone sein. Es wäre zu kurz gegriffen – zu bequem –, die Komfortzone zu verurteilen. Denn sie ist wichtig und wertvoll. Ich möchte vielmehr einladen, andere Zonen zu erkunden, mit ihnen vertraut zu werden und sich aktiv und bewusst in den unterschiedlichen Bereichen des Lebens immer wieder zwischen den Zonen zu bewegen.
Grafik: Zonen des Wachstums (in Anlehnung an Keks Ackermann CCBY-NC, basierend auf Nadjeschda Taranczewski)[16]
Wenn wir aus der Komfortzone austreten, gelangen wir in die Inspirationszone (auch Lernzone genannt). Dort ist es neu und aufregend. Es ist interessant und beflügelnd, auch wenn es mitunter unbequem werden kann. Treten wir zu weit aus unserer Komfortzone heraus, gelangen wir in die Gefahrzone. Hier wird aus Inspiration Angst, und wir können uns überfordert fühlen.[17]
Kurz in der Gefahrzone vorbeizugucken ist ein Effekt, der beim Verlassen der Komfortzone eintreten kann. Für unsere Entwicklung ist es wichtig, dass wir zwischen den drei Zonen zu differenzieren lernen und ein für uns stimmiges Gleichgewicht zwischen unserem Bedürfnis nach Sicherheit (in der Komfortzone) und unserem Bedürfnis nach Entwicklung und Wachstum (in der Inspirationszone) finden. Diese Balance können wir nur erreichen, wenn wir uns bewusst und regelmäßig zwischen beiden Zonen bewegen. So lernen wir unsere Wachstumsgrenze kennen und wissen, wie weit wir uns bewegen können, ohne in die Gefahrzone einzutreten.
Der Austritt aus der Komfortzone muss nicht unter Druck geschehen. Vielmehr dürfen wir uns von der Inspiration anziehen lassen. Wir können unseren Bedürfnissen und dem inneren Antrieb der Neugier, Lebenslust und Erkundung folgen – und auch den äußeren Gegebenheiten, die uns mit Widerständen, Spannungen und Konflikten konfrontieren.
Verlockende Anpassung
Es ist acht Uhr morgens, die Klingel läutet, und ich laufe mit den anderen Kindern gemeinsam die Treppen der Schule hoch zum Klassenzimmer. Als wir den Raum betreten, sehe ich es sofort: Die kleinen Streichhölzer, die gestern noch liebevoll zu einem Holzhäuschen zusammengeklebt waren, liegen verwüstet auf der Pappunterlage verteilt. Jemand hat das Kunstprojekt kaputt gemacht. Jetzt steht es da allein und ausgestoßen auf dem Schrank in unserem Klassenzimmer. Zwischen lauter schönen, noch intakten Projekten liegt ein kaputtes, mein kaputtes. Es könnte nicht symbolhafter sein: Ich gehöre nicht dazu. Oder noch viel schlimmer: Ich bin nicht erwünscht.
Ich war acht Jahre alt, als wir in ein mehrere Hundert Kilometer entferntes, kleines Dorf in Norddeutschland umzogen. Wir kannten dort niemanden, und das dritte Schuljahr begann ich mit sechzehn anderen Schüler*innen, die sich alle seit dem Kindergarten kannten. Es war klein, idyllisch – und richtig unschön für mich als das neue Kind. Mein gebasteltes Kunstprojekt, das meine Mitschüler*innen heimlich kaputt gemacht hatten, war nur eines von unzähligen Belegen für meinen Status als die Neue.
Mein Erscheinen in diesem Dorf war anders, nicht vertraut und deshalb unangepasst. Ich kannte die Regeln nicht. Ich beherrschte die Spiele und Sportarten nicht. Ich verwendete andere Worte und hatte andere Ideen. Ich störte das Vertraute und Gewohnte. Und das, obwohl ich nur eine längere Autofahrt entfernt gelebt hatte, im selben Land, dieselbe Sprache spreche. Es scheint so banal: ein Umzug, ein neues Kind.
Ich gab alles, um mich möglichst schnell einzufügen: Ich lernte die Spiele, die alle spielten. Ich versuchte, allen zu gefallen, um zu den Geburtstagsfeiern eingeladen und nicht mehr als Letzte beim Gruppensport ausgewählt zu werden. Doch es änderte alles nichts. Ich begann Montage zu hassen, und meine vorher so guten Noten wurden schlechter und schlechter. Sie waren mir egal. Alles, was jetzt noch zählte, war, nicht allein und ausgeschlossen zu sein.
Wenn ich meine Worte heute als Erwachsene und Mutter eines kleinen Kindes lese, empfinde ich Mitgefühl mit diesem kleinen Menschen. Es macht mein Herz schwer, so wie jedes Mal wenn ich ähnliche Geschichten von Kindern höre. Kinder, die gemobbt oder ausgegrenzt werden, weil sie von der vermeintlichen Norm abweichen. Ich war ein kleines weißes Mädchen mit gutem sozioökonomischem Status, Akademikereltern, unzähligen Privilegien. Für mich war es nur ein Umzug, mit dem ich umzugehen hatte, vielleicht auch die Tatsache, dass ich ein Mädchen war – nicht aber mit all den Diskrimierungsrealitäten wie beispielsweise Ableismus, Klassismus oder Rassismus. Schon ich mit all meinen Privilegien bekam eine Ahnung davon, wie hart es sein kann, nicht dazuzugehören, sich ausgegrenzt zu fühlen. Kinder können gnadenlos sein. Das höre ich dann häufig Menschen sagen. Und ich frage mich: Führen Kinder nicht nur das ungefilterter und roher aus, was Erwachsene auch leben?
Dazugehören zu wollen ist menschlich. Unser Hirn ist regelrecht süchtig nach Sicherheit – und die Zugehörigkeit zu Gruppen gibt uns Sicherheit.[18] Wie der Geschichtsprofessor Yuval Noah Harari in »Eine kurze Geschichte der Menschheit« zeigt, kam ein Ausschluss aus der Gemeinschaft noch im 18. Jahrhundert einem Todesurteil gleich.[19] Nicht dazuzugehören bedeutete unter anderem, dass der Schutz der Gruppe und der Zugang zu gemeinsam organisierter Nahrung und zur kollektiven Intelligenz entzogen wurden. Dieser Instinkt des menschlichen Überlebens ist auch heute noch Teil von uns. Denn die Tatsache, dass der Ausschluss aus der Gruppe nicht mehr lebensbedrohlich ist, ist eine neuere Errungenschaft in der Menschheitsgeschichte. Homo sapiens existiert seit ca. 300.000 Jahren. Aber erst mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert hat die Individualisierung Einzug gehalten – und damit die Möglichkeit, Gruppen selbstbestimmter zu wählen oder sogar ohne Gruppenzugehörigkeit in Gesellschaft zu überleben.[20]
Was mir in der Grundschule widerfuhr, ist das, wovor wir uns alle mehr oder weniger bewusst fürchten: nicht dazuzugehören. Ich habe schon häufig darüber nachgedacht, wie sehr mich diese Erfahrung geprägt hat und wie froh ich bin, dass ich es irgendwie geschafft habe, das Blatt zu wenden. Nach den Sommerferien stellte ich fest, dass es nur noch ein Jahr sein würde, das ich überbrücken müsste, bis ich auf die weiterführende Schule kommen würde. Dort warteten andere Kinder, andere Gruppen auf mich. Also legte ich meine bisherige Strategie des Anpassens und Gefallenwollens ab. Ich trat anders auf: bemühte mich nicht mehr, den anderen zu gefallen. Ich suchte mir andere Kinder in der Nachbarschaft, mit denen ich mich zum Spielen nach der Schule traf, konzentrierte mich wieder auf den Unterricht, hörte auf, meinen Mitschüler*innen hinterherzurennen.
Dann passierte etwas Überraschendes. Auf einmal wurde ich zu Kindergeburtstagen eingeladen. War nicht mehr die Letzte, die beim Sport aufgerufen wurde. In der Schule wollten andere Kinder neben mir sitzen. Ich lernte einen interessanten Effekt kennen. Statt extremer Anpassung aus dem Wunsch heraus, Menschen gefallen zu wollen, die ich gar nicht mochte, zeigte ich den Respekt mir gegenüber. Diese Erkenntnis hat mich geprägt und mir viele bedeutsame Momente, echte Verbindung und Gemeinschaft in Gruppen beschert – aber auch immer wieder Schmerz, wenn ich mal nicht in eine Gruppe passte. Ich hatte das Glück, dass der Schmerz mir gezeigt hat, wie sehr ich auf die Systeme einwirke, die mich umgeben. Ich bin ein Teil von ihnen und kann meine Selbstwirksamkeit spüren und nutzen, um mein Umfeld zu beeinflussen.
Wichtig dabei ist zu betonen, dass das natürlich auch maßgeblich von meiner Macht abhängt, die ich in diesen Systemen habe. Je größer mein Einfluss, auch aufgrund meiner Privilegien, desto mehr kann ich bewirken. Es einfach nur zu wollen reicht in vielen Fällen nicht. Man muss auch die Mittel zur Verfügung haben. Dazu kommen wir gleich noch ausführlicher und werden immer wieder im Buch auch darauf eingehen.
Meine Geschichte könnte hier ihr Happy End haben: Ich habe schon als Kind die Kraft des Unbequemen verinnerlicht und so als Erwachsene das Anecken und Für-mich-Einstehen mit Bravour gemeistert. Vielleicht zeigt die Tatsache, dass das Gegenteil eingetreten ist, wie groß der Druck ist. Wie hart die Strafen für die sind, die anecken – je weniger privilegiert, desto härter in der Regel. Wie süß die Belohnung für die zu sein scheint, die funktionieren, reinpassen, angepasst sind.
Luxus der Nichtanpassung
Ich habe tief verinnerlicht, dass Anpassung für mich als Frau ein Weg ist, um das zu erreichen, was ich mir wünsche. Immer wieder erwische ich mich dabei, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich anecke. Das hat vor allem damit zu tun, dass ich Repressalien fürchte. Die Konsequenzen für mich als Frau, die nicht die gleichen Ausgangsbedingungen wie cis Männer hat. Der Luxus, nicht anecken zu können, ist ein Luxus der zunimmt, je privilegierter ich bin.
Vor ein paar Monaten bin ich mit meiner Familie umgezogen. In einem Telefonat mit dem Hausverwalter der alten Wohnung kam es zum Streit. Nichts Schlimmes – eher ein kleines Missverständnis. Doch nachdem ich aufgelegt hatte, ging es mir durch Mark und Bein. Was denkt er jetzt von mir? Bin ich im Unrecht? Liege ich falsch? Was, wenn ich irgendwann mal wieder eine Wohnung brauche und er mich nicht mag?
Dass andere – in der Regel Männer – auch Macht über mein Leben haben, war mir immer klar, wenn auch nicht ständig präsent. Auf dem Amt, in der Arztpraxis, mit dem Vermieter, im Job sowieso. Wenn ich Menschen mit mehr Macht gegen mich aufbringe, kann es sein, dass sie mir Steine in den Weg legen. Für jemanden wie mich – mit vielen Ideen, Plänen und einem ausgeprägten Wunsch nach Unabhängigkeit – ist das keine angenehme Vorstellung. Also habe ich mit den Jahren unbewusst eine einfache Strategie entwickelt, um nicht gebremst zu werden: Ich gefalle.
Diese Strategie hat in erster Linie nicht (nur) mit meinem Geschlecht zu tun, viel mehr ist sie eine Reaktion auf eine Form von Diskriminierung, wie sie zum Beispiel auch Schwarze Menschen, queere Menschen oder Menschen mit Behinderung erfahren. Denn bei meinem Beispiel geht es nicht um Mann oder Frau, sondern um Macht. Weiße Menschen üben Macht über nichtweiße Menschen aus (Rassismus[21]). Akademiker*innen üben Macht über Menschen mit anderer sozialer Herkunft aus (Klassismus). Nichtbehinderte Menschen üben Macht über Menschen mit Behinderung aus (Ableismus). Ja, Einzelfälle können abweichen, doch die Strukturen der ungerechten Machtverteilung sind vorhanden. Davor die Augen zu verschließen, wenn es um ein neues Selbstverständnis des Aneckens und eine Emanzipation von der Anpassung gehen soll, wäre fahrlässig.
Intersektionaler Feminismus
Ich habe es immer mal wieder geschafft, mich mit eigener Kraft aus den Zwängen der Anpassung zu befreien. So kommt es mir jedenfalls vor. Doch im Laufe der letzten Jahre habe ich festgestellt: Es lag nicht nur an mir, sondern auch an der Welle der Privilegien, von der ich getragen wurde und werde. Meine Eltern haben studiert. Ich bin weiß, habe einen deutschen Pass, bin in einem gutbürgerlichen Haushalt in sehr stabilen finanziellen Verhältnissen aufgewachsen. Strukturelle Marginalisierungserfahrungen kenne ich deshalb nur aufgrund meines Genders.
Die Überschneidung von Diskriminierungsformen wird als Intersektionalität bezeichnet.[22] Die Juraprofessorin Kimberlé Crenshaw hat den Begriff Ende der achtziger Jahre geprägt, unter anderem weil überwiegend weiße





























