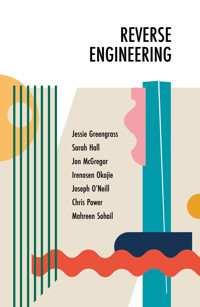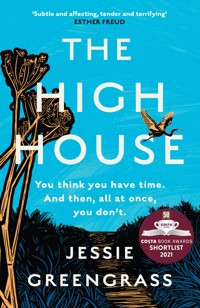18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein atemberaubender, emotional präziser Roman über Elternschaft, Aufopferung, Liebe und das Überleben unter der Bedrohung der Auslöschung, der unter die Haut geht und zeigt, was auf dem Spiel steht. Auf einer Anhöhe abseits einer kleinen Stadt am Meer liegt das High House. Dort leben Grandy und seine Enkeltochter Sally sowie Caro und ihr Halbbruder Pauly. Das Haus verfügt über ein Gezeitenbecken und eine Mühle, einen Gemüsegarten und eine Scheune voller Vorräte – die Vier sind vorerst sicher vor dem steigenden Wasser, das die Stadt zu zerstören droht. Aber wie lange noch? Caro und ihr jüngerer Halbbruder Pauly kommen im High House an, nachdem ihr Vater und ihre Stiefmutter, zwei Umweltforscher*innen, sie aufgefordert haben, London zu verlassen, um im höher gelegenen Haus Zuflucht zu suchen. In ihrem neuen Zuhause, einem umgebauten Sommerhaus, das von Grandy und seiner Enkelin Sally betreut wird, lernen die Vier, miteinander zu leben. Doch das Leben ist anstrengend, besonders im Winter, die Vorräte sind begrenzt. Wie lange bietet das Haus noch die erhoffte Sicherheit?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jessie Greengrass
Und dann verschwand die Zeit
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jessie Greengrass
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jessie Greengrass
Jessie Greengrass, geboren 1982, studierte Philosophie in Cambridge und London, wo sie heute noch lebt. Ihre Erzählungssammlung »An Account of the Decline of the Great Auk, According to One Who Saw It« wurde mit renommierten britischen Literaturpreisen ausgezeichnet. Mit ihrem ersten Roman steht sie auf den Shortlists mehrerer Preise und gilt als eine der vielversprechendsten englischen Autorinnen.
Andrea O’Brien, geboren 1967, übersetzt seit fast 20 Jahren zeitgenössische Literatur aus dem Englischen. Für ihre Übersetzungen wurde sie mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Übersetzerstipendium des Freistaat Bayern und dem Literaturstipendium der Stadt München.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Auf einer Anhöhe abseits einer kleinen Stadt am Meer liegt das High House. Dort leben Grandy und seine Enkeltochter Sally sowie Caro und ihr Halbbruder Pauly. Das Haus verfügt über ein Gezeitenbecken und eine Mühle, einen Gemüsegarten und eine Scheune voller Vorräte – die Vier sind vorerst sicher vor dem steigenden Wasser, das die Stadt zu zerstören droht. Aber wie lange noch?
Caro und ihr jüngerer Halbbruder Pauly kommen im High House an, nachdem ihr Vater und ihre Stiefmutter, zwei Umweltforscher*innen, sie aufgefordert haben, London zu verlassen, um im höher gelegenen Haus Zuflucht zu suchen. In ihrem neuen Zuhause, einem umgebauten Sommerhaus, das von Grandy und seiner Enkelin Sally betreut wird, lernen die Vier, miteinander zu leben. Doch das Leben ist anstrengend, besonders im Winter, die Vorräte sind begrenzt. Wie lange bietet das Haus noch die erhoffte Sicherheit?
Ein atemberaubender, emotional präziser Roman über Elternschaft, Aufopferung, Liebe und das Überleben unter der Bedrohung der Auslöschung, der unter die Haut geht und zeigt, was auf dem Spiel steht.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Sally
Kapitel 1
Caro
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
xviii
xix
xx
xxi
xxii
xxiii
xxiv
xxv
xxvi
xxvii
xxviii
xxix
xxx
xxxi
xxxii
xxxiii
xxxiv
xxxv
xxxvi
xxxvii
xxxviii
Kapitel 2
Sally
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
xviii
xix
xx
xxi
xxii
xxiii
xxiv
xxv
xxvi
xxvii
xxviii
Pauly
Sally
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
xviii
xix
xx
xxi
xxii
xxiii
Pauly
Sally
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
Pauly
i
ii
Kapitel 3
Sally
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
Caro
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
Sally
Caro
Sally
i
Pauly
i
ii
iii
Sally
Caro
Sally
i
ii
iii
Caro
Kapitel 4
Pauly
Caro
i
ii
Pauly
Caro
Sally
Pauly
i
ii
Sally
i
Caro
Kapitel 5
Sally
Pauly
i
ii
iii
Sally
i
ii
iii
Caro
Sally
i
ii
Caro
Sally
i
Caro
i
Sally
i
ii
Caro
Pauly
Sally
i
ii
iii
iv
Caro
i
ii
iii
Sally
i
ii
iii
iv
v
vi
Pauly
Sally
i
ii
iii
Caro
i
ii
Pauly
Caro
i
ii
Sally
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
Caro
i
Sally
i
ii
iii
Caro
i
ii
Sally
i
Pauly
i
Sally
Caro
i
Pauly
Danksagung
Fördervermerk
Wer sang, See schluckt
Braust Brack, bricht Grus.
Steiler die Seeschwalbe.
– Basil Bunting, Briggflatts
SALLY
Am Morgen bin ich vor den anderen wach. Ich steige in Pulli und Socken aus dem Bett, schlüpfe in den Bademantel, danach in Leggings und Stiefel. So gehe ich nach unten, es ist kalt und dunkel und sehr still. An meinen Stiefeln lösen sich die Absätze, jetzt, aber diesen Winter will ich sie noch auftragen. Pulli und Leggings sind an den Säumen ausgefranst, der Bademantel ist eine alte Decke mit Armlöchern, denn an so was wie Bademäntel hat Francesca nicht gedacht – und wir drei haben zwar einiges drauf, aber nähen kann keiner von uns.
In der Küche sehe ich nach dem Feuer im Herd, lege frische Holzscheite auf die Glut und öffne die Klappe für die Luftzufuhr, bis Flammen lodern. Den Rest vom gestern geschöpften Brunnenwasser gieße ich in einen Kessel, stelle ihn auf die Herdplatte und warte, bis es kocht. Ich schütte ein paar getrocknete Pfefferminzblätter in einen Becher und brühe Tee auf. Ich hätte Kaffee gekocht, früher. Das denke ich jeden Morgen. Ich denke es und glaube, mich kurz an den Geschmack zu erinnern, aber das alles ist schon so lange her, es könnte der Geschmack von irgendwas sein. Milch, Senf, Schinken. Egal, er macht mir auf dieselbe Weise den Mund wässrig, auf dieselbe Weise das Herz schwer.
Gestern hat es geregnet, und ich hatte meinen Mantel nicht richtig zugeknöpft. Das Wasser ist mir in den Kragen gelaufen, den ganzen Tag waren meine Sachen klamm, aber heute ist es wolkenlos, ich spüre die Kälte des klaren Himmels, vermutlich bleibt es trocken. Draußen vorm Fenster, hinter dem Obstgarten, ist es noch stockdunkel, doch schon bald wird es dämmern. Ich öffne die Tür einen Spalt, die Luft ist frisch, eisig, riecht nach Salz. Die anderen stehen erst eine Stunde nach mir auf. Caro schläft schlecht und geht nachts oft in Paulys Zimmer, legt sich auf die Matratze, die er für sie am Boden neben seinem Bett bereithält. Wenn er aufwacht, bleibt er still liegen, um sie nicht zu stören. Es ist seine Art, Frieden zu finden, sagt er, unter der warmen Decke in der Dunkelheit zu liegen und nichts tun zu müssen. Wir genießen diese Auszeiten, wann immer sie sich bieten, vor allem im Winter.
Bei so viel Platz – Haus, Garten, Wäldchen, Heide, Dünen und Strand, und niemand außer uns – sollte Alleinsein kein Problem sein, aber wir sind wie die Kletten. Hängen aneinander. Jeder von uns weiß, wo der andere gerade ist, so wie wir immer auch die Uhrzeit wissen, sie an den Lichtverhältnissen erkennen, sie instinktiv spüren, und deshalb habe ich nur in diesem Moment, frühmorgens, vor Tagesanbruch, wenn Pauly und Caro oben schlafen oder reglos im Bett liegen, das Gefühl, allein zu sein. Durch die Terrassentüren betrete ich den Garten, und um mich herum breitet sich Stille aus. Ich spüre die Leere. Die Luft wird leichter. Atem wabert. Ich gehe hinunter in den Obstgarten, durch den Bogen in der Hecke, den Weg entlang, am Gezeitentümpel vorbei, dorthin, wo der Fluss sich ausdehnt, ohne Einschnitte und Befestigungen, entfesselt, frei, seinen eigenen, trägen Weg ins Meer zu finden …
Der Frühling kommt. In der Erde steckt sein Stichwort, in den Zweigen, den grünenden Knospen, den frischen, zwischen verdorrten Gräsern hervorlugenden Spitzen – die Kälte kriecht mir unter die Kleidung, doch ich denke an die Wärme, die sie schon bald vertreiben wird. Das Gras an meinen Fußknöcheln ist feucht. Die Luft ist unbewegt. Von hier aus kann ich sehen, was von Grandys Haus übrig ist, darunter liegt der verfallene Pub, der Dorfanger. Wie ein Monument ragt das verrostete Schaukelgerüst in den Himmel. Wasser und Verwahrlosung nagen am Dorf, Jahr für Jahr ist ein bisschen weniger davon übrig. Aus Mauerritzen sprießt Gras, büschelweise. Gärten versanden. Krebse krabbeln über das zersprungene Kopfsteinpflaster der Straßen. Ich lausche dem Ki-Kiewip der Austernfischer und dem einsamen Ruf des Brachvogels, doch ich bin nicht unglücklich, auch wenn das vielleicht seltsam klingt. Die Dämmerung bricht an. Ich wende mich ab und kehre auf demselben Weg zurück, weg vom Fluss, hinauf nach High House, das jetzt mein Zuhause ist.
1
Caro
High House gehörte zuerst Francescas Onkel, aber der starb, kurz nachdem sie und mein Vater sich kennengelernt hatten. Weil er kinderlos geblieben war, hinterließ er alles Francesca, das Haus und das dazugehörige Grundstück mit dem Obst- und Gemüsegarten, dem Gezeitentümpel, der Mühle. Lange Zeit kümmerte sich niemand darum. Als ich das erste Mal herkam, in den Sommerferien, zusammen mit Francesca und Vater, hatten die Zimmerecken oben feuchte Flecken. Dem Dach fehlten Ziegel. Ich erinnere mich noch an die Kälte im Haus, sogar im Sommer, und daran, wie der Wind nachts durch den Kamin fegte. Der Obstgarten vor der Terrassentür in der Küche war verwildert, hinter der wuchernden Buchenhecke mit dem einst bogenförmigen, inzwischen aber überwachsenen Durchgang erstickte der Gezeitentümpel unter einem Schilfteppich. Zweimal am Tag füllte sich der Tümpel, doch das Schleusentor war schon lange zerstört, sodass das Wasser, früher gestaut, um das Mühlrad anzutreiben, bei einsetzender Ebbe einfach wieder ablief. Die Mühle war halb im Schlamm versackt. Das Rad morsch. Früher wurde hier Weizen gemahlen – heute rattert das Rad wieder, treibt unseren Generator an, der uns im nebligen Winter Licht spendet, solange wir noch Glühbirnen haben, und im Sommer unseren Kühlschrank laufen lässt. Jetzt werden die Obstbäume sorgfältig gestutzt, im Winter beschneiden wir die Apfelbäume, um Mittsommer sind die Pflaumenbäume dran, wie Grandy es uns beigebracht hat – die Baumsäge stets sauber halten und schleifen, die Schere immer an einem Band um den Hals tragen, sonst verliert man sie schnell. Jetzt ist die Hecke getrimmt. In den Beeten gedeiht allerlei Gemüse. Es gibt ein Treibhaus mit Glasscheiben, noch intakt. Damit sind wir beschäftigt, jetzt. Wir graben und jäten. Wir pflanzen. Wir lagern Saatgut, wir achten aufs Wetter, auf die ersten Anzeichen von Frost. Jetzt ist der Hühnerstall voller Hennen, die sich im Winter allerdings meist in der Spülküche aufhalten. Wir haben sogar Felder, haben sie uns genommen, weil es niemanden gibt, der sie beanspruchen könnte. In meiner Kindheit waren die Obstbäume und Gärten verwildert. Der Hühnerstall war leer. Das Haus verstaubt und ungeliebt.
i
Seinem Namen entgegen ist High House gar nicht hoch, es liegt nur höher als das Umland, und als es gebaut wurde, in der Zeit vor der Eindeichung des Flusses, als Entwässerungsgräben das Land durchschnitten, war das Haus nach heftigen Regenfällen bei Flut vermutlich fast eine Insel, damals konnte sich das Wasser ungehindert ausbreiten, nur der westliche Teil des Grundstücks wurde nicht überschwemmt, ein Dammweg verband es mit der Heide. Jetzt ist es wieder so, bisweilen ist das Haus fast eine Insel.
ii
In diesen ersten Jahren, vor Paulys Geburt, als Francesca schon bei mir und Vater wohnte, verbrachten wir häufig die Sommerferien hier, verteilten uns auf die vielen Zimmer von High House, jeder hatte seinen eigenen Bereich. Wir grenzten uns sehr voneinander ab. Francesca arbeitete in einem der Zimmer im obersten Stock, dort, wo wir jetzt Äpfel lagern, aufgereiht auf den Dielenbrettern, und Kartoffeln in Säcken. Ich streifte damals durch den Garten, baute Höhlen im Geißblattgestrüpp, das an der verfallenen Gartenmauer wucherte, schmückte mir das Haar mit Labkraut, bastelte Feenschirme aus Huflattichblättern. Vater nahm die Küche in Beschlag. Er saß im alten Sessel neben der Terrassentür und las oder stand am Küchentresen und schnippelte Gemüse fürs Mittagessen. Wenn ich genug hatte vom Alleinsein im Garten, kam ich ins Haus und heftete mich an seine Fersen, quengelte herum, ich wollte, dass er mit mir irgendwohin ging.
– Wohin denn, Caro?
– Zum Tümpel, bitte.
Der Gezeitentümpel gehörte damals zu meinen Lieblingsorten. Selbst jetzt, da wir auf ihn angewiesen sind, tut es mir leid, dass er nicht mehr so verwildert ist wie früher, bevor Francesca die Mühle restaurierte, damals war sein Ufer dicht bewachsen mit Schilf, kleine Geschöpfe raschelten darin, huschten auf geheimer Mission hinein und wieder heraus. Ich fand es wunderbar, wie ruhig er dalag, wie sich das Wasser hob und senkte, ohne Kräusel am Ufer hinaufkroch, wie die Oberfläche in der Sonne glitzerte – aber Vater hatte Angst, ich könnte hineinfallen oder im Schlamm versinken, deswegen durfte ich nicht allein in seine Nähe.
– Na gut,
sagte er, holte Jacke und Stiefel. Ich wartete im Obstgarten auf ihn, trat von einem Fuß auf den anderen, bis er endlich herauskam und wir durch die Hecke hindurch auf einem gewundenen Weg über eine Art Weide hinunter zum Tümpel gingen. Dort saß er dann und sah mir zu, wie ich durch die Gräser schweifte, mir die Schuhe auszog, weil ich spüren wollte, wie der Schlamm meine nackten Füße umschmatzte, und nach Schätzen suchte – Steine oder Federn oder einmal, wie ein Wunder, ein Nest mit Gelege, ein Ei aufgesprungen, wo das Küken geschlüpft war, aber ansonsten unversehrt, hellblau mit Tupfen, fast schwerelos in meiner Handfläche. Er sah mir zu, bis die Schatten länger wurden und den Tümpel fast bedeckten, bis ich zu zittern und zu gähnen begann, und dann sagte er
– Ab nach Hause, Caro. Zack, zack.
– Ich will aber die Schuhe nicht wieder anziehen.
– Dann geh barfuß.
Ich gab sie ihm zum Tragen und hielt seine Hand, einträchtig liefen wir zurück zum Haus, wo Francesca, allein in ihrem Zimmer im obersten Stock, immer noch arbeitete.
iii
An manchen Nachmittagen gingen Vater und ich an den Strand, wo wir Löcher gruben oder Steine ins Wasser warfen, handtellergroße Kiesel, die wie seltsam verzogene Eier entlang der Flutlinie lagen. Manchmal durfte ich seine Füße im Sand einbuddeln, und wenn es heiß genug war, trug er mich zum Schwimmen ins Meer, hielt mich unter den Achseln und ließ mich planschen. Wenn ich glaubte, dass mich unter Wasser etwas am Fuß berührte, schrie ich auf, er lachte, und ich klammerte mich an ihm fest, die Arme um seinen Hals geschlungen, die Beine um seine Hüfte. Ich hatte noch keine Angst vor dem Wasser, damals – verspürte höchstens diese angenehme Erregung, die einen unter kreischendem Gelächter zum Strand zurücksausen lässt, wenn eine große Welle auf einen zurollt, bevor man sich doch wieder umdreht und ihr hinterherjagt. In meiner Kindheit war es im Juli und August oft heiß, allerdings nicht so heiß wie später, als der Sommer das halbe Jahr andauerte, weiße Sonne am bleichen Himmel. Im Dorf gab es viele Ferienwohnungen, und bis zum späten Vormittag war der Strand voller Menschen, reihenweise lagen sie auf dem Rücken oder saßen da, umringt von spielenden Kindern, Eimer und Schaufel überall, Picknickreste, Sonnencremeflaschen, Hüte, Kleidung zum Wechseln. Francesca, im Haus, fragte oft
– Wie können sie es nur genießen, dieses Wetter?
Im Gegensatz zu uns hatte sich Francesca nicht angewöhnt, in zwei Wirklichkeiten zu denken, zwei Versionen der Zukunft zu sehen – die ganz normale, mit Sommerferien und dem herannahenden Beginn neuer Schuljahre, Weihnachtsfeiern und Geburtstagen und Kontoständen in einem endlosen Kreislauf, und die andere, die lange und leere Version der Zukunft, über die wir nur hypothetisch sprachen oder einfach gar nicht.
– Sie tun so, als wäre das alles ein Ammenmärchen, das sie erschrecken soll,
sagte Francesca,
– und nicht das bevorstehende Ende unseres verdammten Planeten,
und ich wusste, dass sie mit »sie« auch Vater meinte und mich ebenso.
iv
Das war ganz am Anfang, als wir noch unsicher waren und glauben konnten, dass alles völlig in Ordnung war, nur eine Reihe ungewöhnlich heißer Julimonate und heftige Januarstürme. Den ganzen Sommer lief ich halbnackt durch die herrlichen Tage, und als das Wetter umschlug, der Regen so heftig wurde, dass das Wasser wie lange Schnüre vom Himmel peitschte, saß ich auf High House und blickte hinaus, beeindruckt von der schieren Menge, der Kraft, mit der es alles wegspülte, womit es in Berührung kam, Chipstüten aus Hecken fegte, Gestrüpp plättete, alles vom Staub befreite – und dann, am nächsten Morgen, war es wieder heiß, aber die Luft dampfte und das Meer an der Flussmündung war mit Schlamm verschmutzt.
v
Auch Weihnachten verbrachten wir gelegentlich auf High House, es gab Jahre, da war der Strand mit Schnee bedeckt, Eis glitt in grauen Schollen den Fluss hinab, und andere Jahre, wenn sogar noch Gras wuchs und das Laub an den Bäumen kaum die Farbe gewechselt hatte. Wir aßen Risotto mit Pilzen, gefolgt von pochierten Birnen, und danach, wenn Vater das Feuer entfacht hatte, öffneten wir vor dem Kamin unsere Geschenke. Doch egal, was wir anstellten, das Haus wirkte trotzdem leer, seine Türen und Fenster waren wegen der Kälte immer geschlossen und die vielen Zimmer dunkel, und während Vater und Francesca auf dem Sofa lasen, versuchte ich, die Leere mit meiner Stimme zu füllen, aber mein Lärm allein reichte nicht aus. Es war eine Erleichterung, endlich wieder in die Stadt zurückzukehren, denn dort, um uns herum, hatte sich unser Leben geformt. Zu Hause konnte ich einsam sein, ohne dass es auffiel. Ich konnte mich beschäftigen, auf meine Weise, in meiner eigenen Welt, separat von Vater oder Francesca, privat. Zu Hause konnte ich mir genug sein. Ein paar Jahre später beschloss Francesca, High House zu vermieten. Eine junge Künstlerin zog für eine Weile ein. Francesca gefielen deren Bilder nicht, sie fand sie zu heimelig,
– Als gäbe es nichts Wichtigeres, über das wir uns Gedanken machen sollten.
Nachdem die Künstlerin ausgezogen war, wurde das Haus von einer Gruppe Studierenden von der nahe gelegenen Hochschule für Landwirtschaft bewohnt, sie bezahlten Francesca nur eine geringe Miete und setzten als Gegenleistung den Garten instand.
vi
All das geschah vor Paulys Geburt, als wir noch zu dritt waren. Francesca war nicht meine Mutter. Sie liebte mich, aber ohne Struktur. Ich liebte sie, war mir ihrer aber nie sicher. Wir berührten einander nur selten. Vater liebte uns beide, aber hintereinander – erst eine, dann die andere. Es war ihm nicht möglich, uns beide gleichzeitig zu lieben, denn wir brauchten völlig unterschiedliche Dinge von ihm. Als Dreiergespann waren wir eigentlich nicht unglücklich, aber auch nicht richtig glücklich – und obwohl es mir im Rückblick oft scheint, als hätte meine Kindheit mit Paulys Ankunft geendet, kann ich nicht behaupten, dass es mir leidgetan hätte. Es war zu still, damals, und ich zu oft allein. Es ist schwer, als Kind in Isolation. Man nimmt das Erwachsensein an wie einen Fleck.
vii
Ich war vierzehn, als Francesca Pauly aus der Klinik nach Hause brachte. Vater und ich hatten den ganzen Vormittag geputzt, poliert, gefegt und Staub gewischt, bis es in jedem Zimmer nach Bienenwachs und Essig roch. Auf dem Tisch im Flur stand ein Strauß Sonnenblumen in einem Wasserkrug.
– Sie sagt bestimmt, dass wir keine Schnittblumen kaufen sollten,
bemerkte ich, doch Vater war sicher, dass sie sich ausnahmsweise darüber freuen würde, was ich bezweifelte. Francesca war eine Woche weg gewesen. Es war eine schwere Geburt, hatte Vater mir erklärt, als er mitten in der Nacht heimkam, um Kleidung zum Wechseln zu holen. Das Baby lag ungünstig, es war über längere Zeit mit den Schultern im Geburtskanal stecken geblieben, und als es versucht hatte, sich aus dem Becken zu befreien, hatte sich die Nabelschnur um seinen Hals gelegt und mit jeder Bewegung enger zugezogen, sodass es, nachdem man es endlich befreit und mit einer Zange am Schädel herausgezerrt hatte, blaugrau und ganz schlaff war, und bevor Francesca oder Vater es noch hatten schreien hören, hatten die Ärzte es schon davongetragen, in eine andere Abteilung der Klinik, wo man es zum Schutz vor Hirnschäden in eine Kühldecke wickelte.
– Es ist ein Junge,
sagte Vater,
– und wir haben ihm den Namen Paul gegeben.
Vater sah völlig fertig aus. Immer wenn er aus der Klinik heimkam, brühte ich Tee auf, kochte ihm Nudeln mit Tomatensoße und beruhigte ihn, natürlich würde alles gut werden – aber insgeheim hegte ich Zweifel, vielleicht ging es doch nicht gut. Ich dachte an Säuglinge auf Frühgeborenstationen, an Fotos von Wohltätigkeitsorganisationen bei ihren Spendenaufrufen an Weihnachten, die winzigen Körper, greisenhaft, an Schläuche angeschlossen, kaum Mensch, Haut dünn wie Seidenpapier, über Vogelknöchelchen gespannt. Ich dachte an den Säugling Paul, meinen Halbbruder, eingemummelt in einem Brutkasten, und versuchte an Francesca zu denken, wie sie wartend neben ihm saß – aber es war unmöglich, sie in einer solchen Situation zu sehen. Undenkbar, dass sie den Ärzten ausgeliefert sein sollte, die Hand nach einem Kind ausgestreckt, das sie nicht berühren durfte. Ich konnte sie mir nicht verängstigt vorstellen, sondern erinnerte mich stattdessen an das, was sie einst zu mir gesagt hatte, als ich wissen wollte, warum ich Saft nicht direkt aus dem Karton trinken durfte.
– Wir alle müssen Opfer bringen, Caroline. So ist es nun mal.
Niemand außer Francesca hat mich je Caroline genannt.
viii
Als wir mit dem Hausputz fertig waren, aßen Vater und ich zu Mittag, dann wuschen wir das Geschirr ab, räumten alles wieder auf, fegten die Krümel weg. Beseitigten sämtliche Spuren. Vater fragte, ob ich mit ihm in die Klinik fahren wolle, aber ich lehnte ab, denn ich hatte Angst, vor dem Baby und seinen Geburtsmalen genau wie vor Francesca, vor allem, was ihr widerfahren war, und den Konsequenzen – dass sie entweder sie selbst wäre oder nicht, verändert, einen unbekannten Säugling im Arm. Vater drückte mir einen Kuss auf, dann zog er seinen Mantel an und ging hinaus zum Wagen. Ich stand auf der Schwelle und sah ihn davonfahren, und erst als er schon lange verschwunden war, schloss ich die Tür und wartete. Zuerst trat ich ins Wohnzimmer, wo die Kissen makellos auf dem Sofa lagen und jedes Buch am korrekten Platz im Regal stand. Danach ging ich in die Küche, wo keine schmutzigen Becher mehr standen, dann ins Bad, wo das Handtuch sauber und gefaltet hing und die Seife mittig in ihrer Schale ruhte. Ins Zimmer, das Francesca mit meinem Vater teilte, wo frische Laken säuberlich unter die Matratze gespannt waren. Der Wäschekorb war leer, das übliche Knäuel aus Pullovern und Strumpfhosen entwirrt, gewaschen und wegsortiert. Nebenan wartete das Kinderzimmer, perfekt, bereit für ein Baby. Sogar mein Zimmer war sauber, der Teppich freigelegt, Bücher und Kleidungsstücke weggeräumt, das Bett gemacht, alles gefegt, ordentlich und unvertraut. Ich saß am Fuß der Treppe, die Haustür fest im Blick, wartete inmitten der makellosen Leere unseres Hauses, und in diesem Moment hätte ich mir unerwünscht vorkommen können. Ausgemerzt, so als hätten Vater und Francesca mich aufgegeben, um noch einmal von vorn zu beginnen – doch in Wahrheit war ich bereit, gespannt. Ein Ende war gekommen, aber kein Beginn, noch nicht – und dann schließlich, das Geräusch eines Wagens, der Schlüssel in der Tür. Vater trat auf die Seite, um sie hereinzulassen, Francesca mit dem Baby im Arm, und es war, als wäre nicht nur mein Bruder, sondern sie beide neugeboren, die zarte Haut rosig von den ersten Sonnenstrahlen. Ich stand im Flur, spürte die ganze Welt noch immer um mich herum, als Francesca mir das Baby hinhielt und sagte,
– Schau, Caroline! Das ist Pauly …
und ich streckte die Arme aus, übernahm ihn von ihr, und die Zeit begann von vorn.
ix
Manchmal, wenn Francesca duschen wollte, gab sie mir Pauly, und ich betrachtete ihn, seinen winzigen, rundlichen Körper, der sich in meine Armbeuge schmiegte, Arme und Beine wogten sanft wie Seegras in der Strömung. Er fühlte sich an wie ein Teil von mir, damals, und wenn wir einander mit den gleichen geweiteten Augen ansahen, dachte ich, ich würde ihn kennen und er mich – bis sein Mund zu suchen begann, er das Köpfchen hektisch von Seite zu Seite bewegte, seine gehusteten Schluchzer zu Schreien wurden und er dafür sorgte, dass Francesca rasch angelaufen kam.
x
Jeden Morgen bezog Vater am Toaster Stellung.
– Was darf es heute sein?
– Zwei Scheiben, bitte.
Ich schenkte uns beiden Kaffee ein, und einen weiteren Becher für Francesca, die im Morgenmantel herunterkam, die Augen verschwollen, das Gesicht zerknittert, und sagte,
– Frag mich bloß nicht, wie die Nacht war. Ich könnte die ganze verdammte Toastpackung leer fressen.
Sie schnallte den Kleinen in die Babywippe, setzte sich daneben und bewegte sie mit dem Fuß, tick-tick schaukelte er auf und ab, seine Hände fuchtelten im Takt vor dem Gesicht. Im Hintergrund liefen Nachrichten: … während neue Unwetter drohen, wächst die Sorge um die östlichen Küstenregionen der USA …
– Mach das Ding aus!,
rief Vater, und Francesca hielt mich nicht zurück, doch sie sagte,
– Du kannst es ausmachen, aber davon geht es auch nicht weg …
Wir schenkten uns Milch ein, reichten die Marmelade herum. Vater nahm sein Mittagessen aus dem Kühlschrank und verstaute es in seiner Tasche, suchte nach Geldbörse und Schlüssel, startklar für die Universität, wo er arbeitete.
– Noch ein Tag voller Studenten. Wann ist das eigentlich mal vorbei …
Ich schälte eine Orange, bot sie Francesca an, die sie nahm, in Spalten teilte und sich nacheinander in den Mund schob, während Pauly sie von seiner Wippe aus beobachtete und eine Art Brummlaut von sich gab.
– Danke, Caroline.
Wir hatten uns neu aufgestellt. Zu dritt hatte uns das Gleichgewicht gefehlt, doch jetzt, durch die Schwere des Babys, war die Waage wieder ausgeglichen. Zeitweilig kam mir das alles vor wie ein Zaubertrick, geschickt ausgeführt, so rasch und raffiniert, und das beunruhigte mich, denn sollte ich je erfahren, wie der Trick mit dem Glück funktionierte, würde er nicht mehr wirken. Beim Zuknöpfen des Mantelkragens sagte Vater,
– Und? Was steht heute an?
– Doppelstunde Mathe,
antwortete ich,
– und Französisch. Ich hasse Französisch.
Francesca nahm Pauly aus der Wippe,
– Komm her, du kleines Ferkel,
sagte sie zu ihm,
– wir ziehen dir erst mal frische Sachen an …
und sie trug ihn fort, wieder nach oben, in den watteweichen Kokon seines Zimmers.
xi
Als ich von der Schule zurückkehrte, lagen Vater und Francesca im Bett, Pauly hielt sein Mittagsschläfchen und Francesca arbeitete, ein Buch in der Hand, einen Notizblock neben sich. Pauly, rosige Wangen, der Atem ging gleichmäßig, lag wie über ihren Schoß gegossen, und ich gesellte mich zu ihnen, machte meine Hausaufgaben auf dem Boden am Fußende des Betts, bis Pauly erwachte, dann spielten Francesca und ich mit ihm, stapelten Bauklötze zu Türmen, damit er sie zum Einstürzen bringen konnte, schoben Spielzeugautos über den Boden, sodass ihre Räder ratterten. Er baumelte gern kopfüber, und wenn er rückwärts über unseren Beinen hing, juchzte er erfreut. Das Telefon klingelte. Francesca ging ran, und während ich Pauly gegenüber auf dem Boden saß und ihm zeigte, wie man in die Hände klatschte, hörte ich sie sagen,
– Sie denken, das Kind sei eine Kapitulationserklärung,
und dann,
– Sie denken, mir sei jetzt alles egal. Oder ich würde nicht mehr an das glauben, was ich sage –
doch als ich sie ansah, konnte ich keine Spur von Kapitulation erkennen. Stattdessen war da eine Art grimmiger Trotz, der sie dazu gebracht hatte, dieses Kind zu bekommen, trotz allem, was sie über die Zukunft zu wissen glaubte – ein Pakt mit der Welt, bei dem sie nun, da sie ihren Einsatz erhöht hatte, alles daransetzen würde, das zu schützen, was sie zu lieben gelernt hatte.
Es fällt mir sehr schwer, mich jetzt daran zu erinnern, wie es war, in diesem Raum zwischen zwei Zukunftsvarianten zu existieren, unser ganzes Leben in die Lücke zwischen Furcht und Sicherheit zu stopfen –, doch ich glaube, es war meist wie in diesen Träumen, aus denen man unbedingt erwachen will, aber es nicht schafft, stattdessen wieder und wieder zurücksinkt auf die Matratze, die Bettdecke fallen lässt und die Augen schließt. Es gibt eine innere Barmherzigkeit, tief in uns verankert, dank derer es uns leichtfällt, für kleine, uns nahestehende Geschöpfe zu sorgen, denn wie sonst könnten wir leben? Als ich aufwuchs, rutschte die Krise von der fernen Bedrohung in eine unmittelbar bevorstehende Wahrscheinlichkeit, doch wir blendeten sie aus wie statisches Rauschen, passten uns an jede neue Normalität an und taten das, was wir immer getan hatten – Pendeln und Urlaub, Großeinkäufe am Freitag, Tagesausflüge aufs Land, Nachmittage im Park. Diese Dinge taten wir weder aus Ignoranz noch aus Gedankenlosigkeit, sondern weil uns scheinbar nichts anderes übrig blieb – und auch, weil sie wie ein kleinteiliges Beschwörungsritual wirkten, ausgeführt in Fleisch und Zeit. Das tägliche Einerlei unseres Alltags, so vertraut und schlicht, vermittelte uns Sicherheit, und sogar Francesca, die alles so deutlich vorausgesehen hatte – selbst sie, die sich nicht von der Hoffnung hatte einlullen lassen –, stand um fünf Uhr nachmittags fluchend vor dem leeren Kühlschrank, weil sie nichts zu essen hatte fürs Baby. Also fütterten wir den Kleinen mit Fischstäbchen aus dem Gefrierfach. Vater kam heim. Pauly wurde gebadet, er planschte mit geballten Fäusten im Wasser herum, nuckelte am Lappen und weinte, wenn man diesen wegzog, um ihn damit zu waschen. Bald danach, getröstet, wurde er zum Abtrocknen in ein Handtuch gewickelt. Ich drückte ihm einen Kuss aufs nasse, wirre Haar.
– Gute Nacht, Pauly.
Francesca trug ihn ins Bett. Vater bereitete das Essen zu und öffnete eine Flasche Wein, sodass schon ein volles Glas für sie bereitstand, wenn sie wieder nach unten kam, gegen das Licht anblinzelnd.
– Er ist endlich eingeschlafen, Gott sei Dank …
Währenddessen, draußen, das Ding, dem nur sie direkt ins Auge sehen konnte: die vorzeitigen Frühlinge und zu langen Sommer, die plötzlichen Wintereinbrüche, die aus heiterem Himmel kamen und Überflutungen mit sich brachten, Eis und Sturm, oder nichts davon, stattdessen schwüle Feuchtigkeit, Tag für Tag, die Blätter faulten an den Bäumen, die Vögel sangen noch im Dezember, bauten Nester, bis schließlich doch der Schnee kam, und sie, weil sie den Aufbruch in wärmere Länder versäumt hatten, auf den Zweigen erfroren und starben.
xii
Auf meinem Laptopmonitor hielt Francesca eine Rede. Pauly, noch keine sechs Monate alt, schlief in einem Tuch vor ihrer Brust, er hatte den Kopf eingezogen, seine Beine baumelten. Sie sagte: Wir müssen erkennen, dass dies unsere letzte Warnung ist – denn wenn wir dies nicht tun und jetzt nicht handeln, werden die Konsequenzen schlimmer sein als alles, was wir bisher erlebt haben, dann haben wir unsere Chance verpasst …
Damals waren sie ein echtes Paar, Francesca und Pauly, und als er sich entwickelte, als sich seine Persönlichkeit entfaltete wie frische grüne Blätter, wuchs er zu ihr hin, streckte die Hände aus, um zu fangen und zu klettern. Es war mir eine Freude, sie zu beobachten. Es gefiel mir, Pauly auf den Arm zu nehmen, wenn Francesca das Zimmer verließ, um etwas zu holen oder ans Telefon zu gehen, und ihm, wenn er das Gesicht verzog, ins Ohr zu flüstern, Mach dir keine Sorgen, Pauly, sie kommt wieder …
Es grenzte an ein Wunder, dass dieser winzige Mensch, beinah eine Persönlichkeit, dessen Bedürfnisse dermaßen dringend waren, den der Trennungsschmerz dermaßen überwältigte, so leicht wieder ins Lot kam, sobald Francesca zurückkehrte und ihn sich wieder auf die Hüfte setzte. Seine Tränen versiegten sofort, er blickte vorwurfsvoll in die Welt, verkrallte die Fäuste in ihrer Bluse – aber nichts bleibt, wie es ist. Nachts sieht es aus, als hätte die Welt lauter Kanten. Der Mond scheint durchs Fenster, offenbart Ecken und Brüche. Pauly und Sal glauben, es sei Furcht, die mich weckt, aufstehen und in den Garten gehen lässt, um in der Dunkelheit am Fluss entlangzulaufen, aber es ist keine Furcht, oder nicht nur. Es wäre ein Leichtes, sich an diesem grünen Ort einzubilden, wir hätten obsiegt – unser Geschick oder unsere Vorausschau hätte ausgerechnet uns hierhergeführt statt all die anderen, die es hätten schaffen können. Es war kein Geschick. Es war lediglich eine Chance, die Francesca uns gegeben hatte, und die Entscheidung, sie für uns zu nutzen. In Paulys Zimmer, bevor ich einschlafe, betrachte ich sein Gesicht, das Gesicht eines jungen Mannes, und versuche mir ins Gedächtnis zu rufen, wie er als Kind ausgesehen hat, aber ich habe es vergessen. Ich ziehe mir die Decke enger um die Schultern und passe meinen Atem an seinen an, bis ich schließlich einschlafe.
xiii
Eines Nachmittags, während Pauly schlief, saßen Vater, Francesca und ich im Wohnzimmer und sahen zu, wie eine Insel mitten im Pazifik versank. Wir sahen das Unwetter aufziehen, die Kameras filmten den Regen, den stärker werdenden Wind. Wir sahen, wie Türen aus den Scharnieren gerissen wurden, Palmen sich bogen und brachen. Wir sahen, wie eine ganz normale Piazza in einer fernen Küstenstadt entzweibarst, die Straßenschilder zersprangen, Laternenmasten abknickten, das Café an der Ecke zerplatzte wie ein Ei. Vater sagte,
– Wenigstens wussten sie, was auf sie zukommen würde.
Ein Auto flog über den Bildschirm.
– Ich meine, alle sind vorher rausgekommen.
Francesca, das Gesicht wutverzerrt, sprang auf, trat in die Zimmerecke und trommelte gegen die Wand.
– Das,
sagte sie, von uns abgewandt,
– geht völlig an der Sache vorbei. Außerdem,