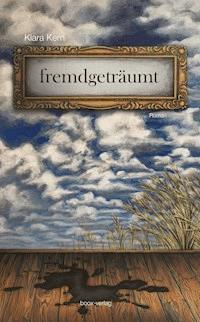Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Porträt einer Mörderin Der tragische Tod einer Schülerin bei einer Klassenreise sorgt bei Lehrerin Elaine für heftige Schuldgefühle – auch weil sie den Verdacht hat, dass es kein Unfall war. Beweise hat sie jedoch nicht, also behält sie ihre Theorie für sich. Um abzuschließen, verarbeitet sie ihre Vermutung in einem Roman. Doch vierzehn Jahre später ereignet sich ein weiterer mysteriöser Todesfall, der alles auf den Kopf stellt: Denn das Opfer ist eine ehemalige Schülerin aus derselben Klasse, und die Vorlage für die Tat liefert Elaines Buch. Was hat das zu bedeuten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kiara Kern stammt aus Zürich und ist gelernte Immobilienbewirtschafterin. Während sie sechs Jahre in Hongkong und Singapur lebte, veröffentlichte sie zahlreiche Blogserien und entwarf ihren ersten Kriminalroman, einen Hongkong-Krimi. Seit 2007 lebt die Autorin wieder in der Schweiz. Es folgten publizierte Kurzgeschichten sowie die unkonventionellen Romane »fremdgefabelt« und »fremdgeträumt«. »Und mittendrin die Limmat« ist ihr erster Zürich-Krimi.
www.kiarakern.com
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sowie einige Gebäude und Institutionen sind frei erfunden, das Erscheinungsbild der Stadt und der Umgebung wurde an wenigen Stellen zugunsten der Geschichte geringfügig verändert. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2025 Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, 50667 Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Shutterstock/Oleksiy Mark
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-257-4
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Prolog
Flashbacks sind wie Mücken im Hochsommer. Sie weilen irgendwo in einer Ecke meines Zimmers und lauern darauf, dass ich müde werde. Sie riechen meinen Atem und machen sich bereit für den Angriff. Still liege ich im Dunkeln, wage kaum, mich in den Schlaf sinken zu lassen. Noch erkenne ich die Flashbacks nicht. Doch sie sind da. Manchmal sind sie übereifrig und surren todesmutig um mich herum – machen mich unruhig und aggressiv. Das Surren hört sich an wie geflüstertes Unheil, wird lauter, immer bedrohlicher, ich halte mir die Ohren zu. Genervt versuche ich, die »Mücken« zu verscheuchen oder zu erschlagen. Doch die sind flink. Zeitweise werden sie unsichtbar, sodass ich denken könnte, ich bilde sie mir nur ein. Und dann … gerade wenn ich mich in Sicherheit wiege, schlagen sie zu. Stechen mich direkt in die Stirn.
1
ELAINE
Das Straßenschild wird sich in mein Gedächtnis einbrennen. Statt über den Pausenplatz eile ich dem Trottoir entlang, dem Wegweiser »Friedhof Fluntern« folgend. Ein Windstoß schubst mich vorwärts, reflexartig schiebe ich meine Hände in die Taschen meines Blazers. Gemäß Wetterprognose sind in der Region Zürich gegen Abend kräftige Sommergewitter zu erwarten. Wie passend, denke ich und blicke mich um, ob weitere Trauergäste aus dem Tram ausgestiegen sind und mir folgen – ich kann jetzt unmöglich mit jemandem reden. Mein Zorn ist noch nicht verraucht, und ich weiß nicht, wohin damit. Das geht nicht nur mir so. Seit dem tödlichen Unfall von letzter Woche herrscht im Schulhaus eine kollektive Schockstarre. Meine Schüler sind kaum wiederzuerkennen: Mit hängenden Köpfen schleichen sie ungewohnt wortkarg durch die Schulkorridore – als ob die jemand auf mute geschaltet hätte. Es ist tatsächlich eine Zumutung, im Alter von fünfzehn Jahren an die eigene Sterblichkeit erinnert zu werden.
Das Friedhofsareal drängt sich noch nicht in mein Blickfeld, sicherheitshalber schaue ich auf meine Armbanduhr: halb zwei. Normalerweise würde mir um diese Zeit Gegröle aus den einzelnen Klassenzimmern entgegenschlagen. Ich würde die Türklinke von Zimmer 28 berühren, und gewisse Schüler würden bei meinem Anblick in ihren Bewegungen innehalten, ihre Gesichter verziehen und sich widerstrebend auf ihre Stühle fallen lassen. Andere säßen bereits still über ihren Büchern. Viktor käme erst nach mir ins Zimmer gehuscht, und ich würde so tun, als merkte ich es nicht. Was würde ich dafür geben, nun lautes Geschrei statt des Gurrens friedhofseigener Tauben zu vernehmen. Ich presse die Lippen zusammen. Werden die Schüler es verkraften? Es wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als den leeren Stuhl im Klassenzimmer zu akzeptieren.
Notgedrungen ignorierte ich das leise Gefühl in mir, dass etwas nicht stimmte; denn Wahrnehmungen dieser Art geben auf einer Polizeidienststelle wenig her. Die verstohlenen Blicke, das Flüstern hinter vorgehaltener Hand und die damit verbundene stille Resignation einzelner Schüler habe ich zwar mitbekommen, speicherte die Summe dieser Eindrücke jedoch erst mal ab, ohne ihnen konkret nachzugehen. Mitten im durchgeplanten Schulalltag hat man als Lehrerin kaum Zeit für so was, zumindest nicht an gewissen Tagen: Wenn alles drunter und drüber läuft und man die verhassten Elterninfotage vorbereiten muss und zeitgleich noch vierundzwanzig Aufsätze korrigieren sollte. Insbesondere nicht, wenn im Mail-Postfach mal wieder eine einschüchternd formulierte Anfrage einer Mutter – in Kopie an die Schulleitung – auf Antwort wartet. Womöglich hätte ich gar nicht richtig hingehört. Man nimmt wahr, was man wahrnehmen will. Für Zwischentöne macht man keine Überstunden.
Doch ist eine der Schülerinnen nun tot.
Die innere Stimme in mir ist aktiviert und fragt: Wer trägt die Schuld?
Wie uns die Polizei mitgeteilt hatte, wurde das betroffene Waldstück bei der Felsenegg, wo Rebekka rund hundert Meter in die Tiefe stürzte, inzwischen für Fußgänger gesperrt und eine entsprechende Untersuchung eingeleitet. Was mich direkt zur nächsten Frage bringt: Will ich es denn wissen?
Ein durchdringender Vogellaut reißt mich aus meinen Gedanken und lässt mich zusammenzucken. Bestimmt kam der von den Zoogebäuden her, die aufgemalten Hufspuren am Boden weisen zumindest diese Richtung an.
Zu meiner Linken folgt bereits die Frontseite des Friedhofs. Während ich der Mauer entlanghaste, kehren meine Gedanken zur Hauptakteurin dieser Tragödie zurück: Rebekka. Beinah täglich hatte diese für ihr Alter ziemlich geistreiche Fragen in den Unterricht eingebracht. Als Lehrkraft sollte man unparteiisch sein, dieses Mädchen jedoch war mir ganz automatisch ans Herz gewachsen. Ausgerechnet sie war meine Lieblingsschülerin gewesen – inzwischen auf ein Häufchen Asche reduziert. Das ist derart grotesk, dass ich das einfach nicht auf die Reihe kriege. Immerhin, sie wird nun im Friedhof Fluntern bestattet – der letzten Ruhestätte von James Joyce. Ein kleiner Trost, an den ich mich klammere. Wie soll ich Rebekkas Familie bloß entgegentreten? Rebekka war fünfzehn … So leid mir ihre Eltern tun, ich kann nicht mit ihnen reden und fragen, wie es ihnen geht. Schweigend die Hand drücken und dann den Blick abwenden. Denn was sagt man zu Eltern, die ihr Kind indirekt durch einen verloren haben? Entschuldigen Sie bitte, es wird nicht wieder vorkommen.
Nein, wie hämisch! Nein, ich trage keine Schuld, ermahne ich mich selbst. Ich hatte die Route nicht allein ausgewählt. Gemeinsam mit sämtlichen beteiligten Lehrkräften wurde diese vor Monaten beschlossen. Und für einmal steht auch der Schulleiter entschlossen hinter uns und versuchte zu beschwichtigen: Wir Verantwortlichen hätten die Sorgfaltspflicht nicht verletzt, und entsprechend werde wohl auch der Prozess verlaufen.
Wobei ich diejenige gewesen war, die nach der Rekognoszierung des Gebiets auf die Vorteile dieser Variante hingewiesen hatte: passabler Schwierigkeitsgrad, Schattenspender Wald, separater Saal im Restaurant beim Ausflugsziel, die Luftseilbahn in der Nähe öffentlicher Verkehrsmittel. Tagtäglich spazieren Hunderte von Wanderern auf diesem Pfad ohne Zwischenfälle. Warum also musste dieser fatale Unfall ausgerechnet während unserer Schulabschlussreise passieren?
Ich erreiche das Eingangstor zum Friedhof und lasse meinen Blick über die vereinzelt mit Blumen geschmückten Gräber schweifen. Merkwürdig, wie das Gras hier ganz normal wächst und blüht. Dabei liegt nichts Geringeres als der Tod darunter. Wie ich über das Kopfsteinpflaster gehe, sehe ich die Friedhofskapelle, in der die Trauerfeier stattfinden soll. Kaum ein Laut dringt zu mir durch, lediglich ein dumpfes Gemurmel aus dem Gebäude. In der Kapelle mache ich einige mir bekannte Gesichter aus, doch mir ist nicht nach Begrüßungsfloskeln. Strammen Schrittes gehe ich mit ernster Miene an einzelnen Trauergästen vorbei und reihe mich in die Bank zuäußerst ein. Gerade noch rechtzeitig, der Pfarrer hebt nun ein Bündel Papiere aus seiner Tasche und räuspert sich laut, blättert konzentriert durch die Seiten. Zu meiner Linken erblicke ich Viktor, der als einziger Schüler neben zwei Lehrern und dem Schulleiter sitzt. Seine Körperhaltung wirkt seltsam starr, wie steif gefroren. Rebekkas engste Klassenkameradinnen, Laura und Anna, blicken synchron betrübt und tuscheln nicht wie üblich. Laura wühlt in ihrer Handtasche, bemerkt mich nicht. Sie trägt eine übertrieben elegante Bluse, und ihr braunes, langes Haar ist streng nach hinten gekämmt, was sie erwachsener als ihre Mitschülerinnen erscheinen lässt.
Argwöhnisch betrachte ich die Gruppe und finde es seltsam, die sonst unerträglich quirligen Schüler hier in dieser ehrfurchtsvollen Umgebung zu sehen, wo die Zeit stehen geblieben scheint. Ich lasse meinen Blick zurück in Viktors Richtung schweifen, dem inoffiziellen Außenseiter meiner Klasse. Mit ausdrucksloser Miene sitzt er da, in sicherem Abstand zu seinen Mitschülern. Diese sehe ich von meinem Platz aus nur von hinten. Eine bedrückende Stille breitet sich aus, alle warten unruhig auf den Beginn der Zeremonie. Wie ich versuche, mich innerlich zu sammeln, steigt erneut ein eigentümliches Gefühl in mir hoch. In dieser Geschichte fehlt ein relevantes Puzzlestück, von dem wir alle keine Ahnung haben. Irgendetwas ist zwischen den Mädchen vorgefallen. Rebekka hatte nicht mehr an ihren besten Freundinnen geklebt, und im Unterricht hatte sie unkonzentriert gewirkt. Würde Rebekka noch leben, wenn ich aufmerksamer gewesen wäre? Wenn ich Laura und Anna in die Schranken gewiesen hätte? Die Wahrheit ist, dass ich die Konfrontation bewusst gemieden habe, weil ich die ständigen Reibereien hormongesteuerter Teenager und deren Allüren leid war. Noch nie hatte ich den Klassenwechsel so sehr herbeigesehnt. Und jetzt ist es zu spät. Es sei denn … aber diesen Gedanken kann ich dem Schulleiter nicht anvertrauen. Der will das nicht hören, findet sowieso, dass Ellbogenkämpfe Lebensschule seien. Nie und nimmer würde er mir glauben, dass diese klitzekleine Möglichkeit im Raum steht, dass es … Absicht gewesen ist. Es ist bloß ein Gefühl; ein transparentes Fragezeichen, das seither durch meine Gedanken tanzt. Womöglich würde der Freybacher an meinem Verstand zweifeln und mir raten, mich zusammenzureißen. Während sich Laura, die Anführerin der Klasse, weiterhin in der Kunst der Zerstörung üben würde.
Was wäre, wenn Laura oder Anna tatsächlich etwas mit dieser Tragödie zu tun hätten? Viktor war am Tag der Schulabschlussreise krankgemeldet gewesen – hatte er etwas geahnt? Nur Anna und Laura hätten die Gelegenheit gehabt, Rebekka zu stoßen – sie konnten sich theoretisch gegenseitig ein Alibi geben. Doch was wäre das Motiv gewesen? Und bin ich wirklich die Einzige, die es wagt, das auch nur zu denken? Ohne Beweise bleibt mir nichts anderes übrig, als meinen Verdacht zu verdrängen. Was sich auf meinen Schlaf auswirken wird, das weiß ich jetzt schon.
Leider gibt es noch keine Selbsthilfegruppe für Lehrer mordender Schüler.
Schnell schüttle ich die absurden Gedanken ab und richte meinen Blick nach vorn, zum Pfarrer hin. Dieser beginnt die Trauerrede mit lauten, klaren Worten, wirft mit jedem Satz neue Adjektive in die Menge: aufgeschlossen, beliebt, talentiert sei es gewesen, dieses Mädchen, welches viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde.
Verstohlen bemerke ich, wie manche Gäste der Trauergesellschaft zu weinen beginnen. Einzelne Schluchzer lassen mich zusammenzucken, doch bleibe ich selber still. Während der gesamten Rede fixiere ich einen Punkt neben dem Pfarrer, meine Hände ruhen gefaltet in meinem Schoß.
Ich bete nicht. Ich knete bloß meine Daumen wund.
Auf einem Gabentisch liegen einzelne schwarz umrandete Briefcouverts und Blumen neben dem gerahmten Foto. Ich lehne mich ein Stück vor, um Rebekkas Bild genauer zu betrachten. Es muss sich um eine ältere Aufnahme handeln, denn sie trägt noch Stirnfransen und ihr scheues Lächeln entblößt eine Zahnspange. Dadurch wirkt sie lächerlich brav, zumindest im Gegensatz zu gewissen Mitschülerinnen. Wobei Rebekka im Grunde keines dieser Kids gewesen war, die stets die coolsten Looks präsentieren mussten und dafür den Schulweg zum Catwalk machten. Das hatte sie ja gerade sympathisch gemacht.
Nach der Abschiedsrede verlässt die Trauerfamilie als Erste die Kapelle, wir andern folgen mit gesenkten Köpfen, gehen dankbar nach draußen, an die frische Luft. Auf einem Rasenstück unweit des Eingangs kondolieren wir den starr vor sich hin blickenden Eltern.
Das letzte Mal, als sie sich mit mir im Klassenzimmer unterhielten, waren die beiden fokussiert bei der Sache, keine Schwätzer, die sich bei mir einschleimen wollten, auch nicht die Art Eltern, die meinen, ständig von sich selbst erzählen zu müssen. Das Gespräch verlief angenehm, drehte sich hauptsächlich um die Schulleistung ihrer Tochter, an der es nichts auszusetzen gab. Und jetzt stehen sie und ihr Sohn hilflos da und müssen den Tod der geliebten Tochter und Schwester hinnehmen.
Wie auch Rebekka hat ihr kleiner Bruder die roten Wuschelhaare vom Vater geerbt. Ich blicke in die Gesichter der übrigen Eltern, die sich weiterhin an ihren Kindern samt Macken erfreuen dürfen. Frage mich, ob die verärgert sind, dass sie durch diesen Anlass an die Vergänglichkeit des Lebens erinnert werden.
Jemand schnäuzt sich überlaut die Nase, und ich mache unauffällig einen Schritt zurück, als sich mein rechter Absatz in den Rasen bohrt. Seufzend wappne ich mich für die Aufgabe, Rebekkas Eltern mein Beileid auszusprechen, wobei der Sohn nicht mehr zu erblicken ist. Und schon bin ich an der Reihe. Die Hand der Mutter fühlt sich eiskalt an. Die Frau nickt mir knapp zu, ihre Lippen sind zusammengepresst. Der Händedruck des Vaters ist kräftiger. Ein Kloß im Hals lässt mich krächzen, die Trostworte klingen abgedroschen. Ich fühle mich schrecklich, wende mich allzu schnell von ihnen ab. Erneut schaue ich in die Runde der herumstehenden Trauergäste. Freuen die sich auf den Aperitif? Das Wort »Leichenschmaus« will ich nicht mal denken. Es ist brutal: Bald wird uns alle die Normalität einholen. Im neuen Semester werden andere Schüler Lauras »Zepter der Macht« übernehmen, und irgendwann wird Rebekka zum unglücklichen Schulgeist verblassen – wie diese traurige Mädchenfigur in »Harry Potter«. Aus Erfahrung weiß ich, wie schnell man lernt, den Tod hinzunehmen. Wobei die einzelnen Mitschüler bestimmt alle unterschiedlich um Rebekka trauern werden. Der eine Junge wird vermutlich etwas länger brauchen. Silvio hatte sie ziemlich auffällig angehimmelt – und auch Viktor verstand sich in letzter Zeit gut mit Rebekka. Was wohl in ihnen vorgeht? Suchend blicke ich mich um: Weder Lauras Vater noch Annas Eltern sind anwesend. Das sagt schon so einiges aus. Abgesehen vom engsten Familien- und Freundeskreis scheinen die meisten Gäste Schüler und einige Mütter aus dem Zürichberg-Quartier zu sein. Sie sehen durch mich hindurch, nicht alle erkennen mich in meiner Funktion als Klassenlehrerin, was mir gerade recht ist. Sie sind in Gespräche vertieft oder fixieren einander wortlos mit ernster Miene. »Lachen verboten«, steht auf jeder Stirn. Alles andere könnte ja pietätlos wirken. Interessant, wie wir uns alle der Situation anpassen und uns gegenseitig etwas vormachen.
Gott sei Dank ist das Semester bald zu Ende … Nach den Sommerferien werden diese Halbwüchsigen allesamt ihre Lehrstellen antreten. Alle außer eine. Die bislang anstrengendste Klasse meiner gesamten Karriere löst sich auf, doch werden die Mitspieler bloß ausgewechselt, der Wettstreit wird wieder von vorn beginnen. Neue Alphatiere werden sich mit Ellbogeneinsatz an die Spitze drängen; das gehört zum Programm. Meinerseits hasse ich solche Spielchen. Leider enden die nicht im Schulzimmer, sondern wirken munter bis ins Lehrerzimmer nach. Die Schulleitung will es nicht wahrhaben; Worte wie »Mobbing« und »Manipulation« sind inoffiziell aus dem Vokabular des Schulhauses »Pilgeri« gestrichen.
Laura, sagen Sie?
Nein, nein, Frau Gerber, da übertreiben Sie. Laura ist nun mal sehr reif für ihr Alter, darum langweilt sie sich. Alles noch im grünen Bereich.
Stillschweigend habe ich also ausgeblendet, was sich längst inmitten des Schulgeschehens abgezeichnet hat.
Wenn man denn genau hingesehen hätte …
Innerhalb meiner Klasse hat sich die Dynamik seit Rebekkas Tod verändert, das lässt sich nicht abstreiten. Laura scheint diese Tatsache zudem beinah zu genießen – und genau dieses Verhalten macht mich stutzig. Laura braucht das Drama. Sie lässt Dinge passieren, um ihr Umfeld leiden zu sehen, um etwas zu fühlen. Mich dazu zu bringen, dass ich mich mit ihr auseinandersetze. Nun, das hast du geschafft, Laura. Ich werde mich mit dir auseinandersetzen. So sehr, dass du es noch bereuen wirst. Ich werde darüber schreiben.
Das war kein Unfall. Etwas passt nicht ins Bild.
2
ELAINE
Erneut stecke ich inmitten meiner Zeilen fest. Verharre irgendwo zwischen Ideentsunami und Vorfreude auf die Vorfreude. Der Schreibfluss ist zum Greifen nah. Blöd nur, wenn sich sämtliche Impulse nach jedem ersten Kapitel als unbrauchbar erweisen und den Schreibstrom versiegen lassen. Es ist eben wahr, was sie sagen. Dass einige Autoren ein wenig spinnen, dass sie sich zwischendurch in den Abgrund hineinschreiben und es nicht mal merken. Wobei ich diesen Zustand längst schätzen gelernt habe. Wenn ich kurz vor dem Durchdrehen bin, liefere ich die wertvollste Tinte. Und bei welcher anderen Arbeit hat man schon die Möglichkeit, auf legale Weise mit dem eigenen Ich Verstecken zu spielen? Sich in spannende Figuren hineinzuversetzen, um dem langweiligen Selbst zu entfliehen? Wenn ich im Flow bin, darf mich niemand stören. Das Festnetz hab ich gekündigt, das Smartphone auf Flugmodus gestellt. Ein letztes Mal hole ich Luft, dann tauche ich ab. Was gewisse Risiken mit sich bringt. Wie soll man aus der Dunkelheit herausfinden, wenn der Lichtschalter in einer fiktiven Parallelwelt steckt?
Leider lässt die Muse auf sich warten und hängt bei anderen Autoren ab. Während ich vor dem Bildschirm sitze und auf das aufdringlich weiße Dokument starre, frage ich mich, ob es richtig war, nach so vielen Jahren auf Erwachsenenbildung umzusteigen. Ob die neunmonatige Auszeit, die ich mir für mein Schreibprojekt leiste, für ein zweites Buchbaby reichen wird?
Noch vermisse ich das Unterrichten nicht, doch manchmal wird mir die Stille zu viel, gerade jetzt, wo die Tage wieder kürzer und dunkler werden. Im Nachhinein fände ich es trotz allem nett, wenn gelegentlich eine Tochter oder ein Sohn oder wie man es nennen mag, zu Besuch kommen könnte. Ob man die mittlerweile mieten kann? In Japan bestimmt.
Wenn ich das wirklich gewollt hätte, hätte ich das mit der Familie womöglich hingekriegt. Allerdings genügten mir die tickenden Zeitbomben, die ich in der Sekundarschule belehren, bändigen oder erziehen musste. Die Klassen waren durchwegs aufgeteilt in anmutige Schwäne und hässliche Entlein, deren schmächtige Körper in übergroßen Federkleidern verschwanden. Meist starteten einige der Schüler als Entlein und endeten gegen Ende der Oberstufe in Schwänen. Man konnte quasi zusehen, wie sie sich verwandelten: Je reiner deren Haut wurde, desto unreiner ihr Mundwerk. Deswegen waren mir die Entlein lieber – die hatten weniger Aggressionspotenzial.
Anstrengende Zeiten waren das gewesen … doch nie langweilig. Seit meinem Schritt in die Selbstständigkeit aber vermischen sich Werktage mit Wochenenden, und es gibt kaum Abwechslung.
Ungeduldig klopfe ich mit meinen Fingerspitzen auf die Tastatur.
Ob da noch was kommt?
Mein letztes Werk hatte sich von allein geschrieben, denn das Material lag mir damals direkt auf der Zungenspitze. Eine Geschichte über die Kampfzone Pubertät: Verrat, Schuld. Damals hatte ich die Figuren direkt vor Augen und konnte sie entsprechend authentisch beschreiben. Das ist inzwischen vierzehn Jahre her. Aber jetzt? Diesmal habe ich keine Vorlage aus der Realität und muss alles aus dem Nichts erschaffen. Wenn ich erste Entwürfe durchlese, scheinen die Romanfiguren wie aus Pappmaché. Wie es sich gezeigt hat, nützt es auch nichts, dass ich zurzeit bloß Thriller und Kriminalromane lese, um mich inspirieren zu lassen. Da frage ich mich prompt, ob ich als Krimiautorin konkret Erfahrung im Morden haben sollte? Wäre ich fähig, einen Menschen zu töten? Sind wir das nicht alle, unter gewissen Umständen? Schwierig wird’s mit der Zuversicht, wenn sich gleichzeitig negative Rezensionen betreffend meinen längst publizierten Bestseller häufen. Die lapidar hingeworfenen Sätze der unzufriedenen Leser nisten sich in meinem Kopf ein und sorgen dafür, dass eine Schleuse geöffnet wird. Selbstzweifel gelangen in meine Gedanken und stoppen den Tintenfluss. Kommt dazu, dass diese Bewertungen nur noch tröpfchenweise erfolgen und dadurch umso mehr Gewicht aufweisen.
Als Autorin ist man der Meinung von Fremden ausgeliefert. Und genau so haben sich womöglich meine Schüler gefühlt, wenn sie mein Urteil zu ihren Aufsätzen oben rechts auf dem A4-Blatt haben ablesen müssen: verwundbar. Je nachdem, wie sie die Buchstaben in ihren Aufsätzen aneinandergereiht hatten, zeigte mein Daumen rauf oder runter.
Das Problem ist, dass mich mein eigener Rahmen langweilt und einengt. Alles schon gesehen, alles schon erlebt. Was hab ich denn in meinem Leben geleistet? Die Hunderte von Kids, die ich während meiner Karriere unterrichtet habe, zählen auf einmal nichts mehr. Weil eines davon weggestorben ist. Immerhin, auf meinen Roman bin ich ein bisschen stolz: In der Fiktion habe ich versucht, für Gerechtigkeit zu sorgen. Eine Art Schlüsselroman, den ich nach Rebekkas Tod zu ihren Ehren verfasst habe. An diese Zeit denke ich nicht gerne zurück. Nach der Tragödie während der Schulabschlussreise erinnerte mich alles im Schulhaus an Rebekka, ich konnte mich kaum mehr auf das Unterrichten konzentrieren. Was für einen Sinn ergab es überhaupt, Noten zu verteilen? Hauptsache, meine Schüler waren am Leben! Visionen von Rebekkas leblosem Körper, der in der Tiefe der Schlucht aus dem Geröll herausmanövriert werden musste, plagten mich. Irgendwann realisierte ich, dass ich kündigen musste. Zwar hatte ich damals im Infobrief an die Schüler die Relevanz des Schuhwerks unterstrichen: Wanderschuhe seien für die Abschlussreise entlang der Albiskette Pflicht. Das war gerade der Punkt: Hätte ich damals drei Viertel der Klasse nach Hause schicken sollen, weil sie Turnschuhe trugen?
Es gab zu viele Worte, die ungesagt blieben und darauf warteten, von mir geordnet zu werden; die wollten raus, damit ich mit mir selbst ins Reine kommen konnte. Ich gönnte mir eine Pause und schrieb mein Innerstes über den Haufen. Dafür brauchte ich zwingend eine andere Schuldige als mich selbst. So »verschrieb« ich, Elaine Gerber, Sekundarschullehrerin, meiner Schülerin Laura, meiner Meinung nach die Verantwortliche hinter dieser Tragödie, ihren eigenen Tod. Wortwörtlich.
Das durfte niemand erfahren. Deswegen überlegte ich mir ein Pseudonym und wechselte zudem in ein Schulhaus in meiner Wohngegend, im Kreis 6. Fortan unterrichtete ich tagsüber, während ich abends das Manuskript überarbeitete. Auf knapp vierhundert Seiten gestaltete ich Rebekkas Leben, so, wie sie es verdient hätte – durch mich wurde sie wieder zum Leben erweckt. All die bösen Worte und Ungerechtigkeiten, die noch in der Luft lagen … Ich wollte sie einsammeln, auf Papier bringen, zusammenknüllen und in Flammen aufgehen sehen. Laura stand im Prinzip für all die Kids, die ihre Mitschüler mobben. Da konnte ich nicht länger zusehen und wollte auf meine Weise etwas beitragen, um zu sensibilisieren.
Gewiss hätte ich mit meinem Verdacht, dass unmittelbar vor dem Ausflug etwas zwischen den Mädchen vorgefallen war, zur Polizei gehen oder mich zumindest an das Careteam wenden können. Doch hätte es dann eher so ausgesehen, als wollte ich von mir selbst ablenken, war ich doch als eine der Verantwortlichen selber im Fokus der Untersuchung des Unfallgeschehens. Zudem konnte ich nicht riskieren, potenziell unschuldige Jugendliche in Bedrängnis zu bringen. Die Polizei hatte Anna und Laura, die Rebekkas Sturz in den Abgrund mit ansehen mussten, sowie sämtliche Beteiligte zum Unfallhergang befragt. Angeblich hatte keiner der Schüler oder Lehrpersonen während der Wanderung einen verdächtigen Streit zwischen Rebekka und einer weiteren Person beobachtet. Nicht die Mitschüler, die auf dem Waldpfad weit vor den drei betroffenen Mädchen marschiert waren. Nicht mal Rob und Adri, die beiden Lehrer, die ihnen hinterherliefen, bevor sich alle in der Nähe des Restaurants aus den Augen verloren hatten.
Einige Schüler sagten jedoch aus, dass Rebekka wortkarger als sonst gewesen sei. Lediglich in der Luftseilbahn, bei der Anreise, habe die eine Schülerin einen »stechenden Blick« Rebekkas bemerkt, konnte oder wollte jedoch nicht sagen, in welche Richtung Rebekka dabei genau geschaut hatte. Anna hatte ausgesagt, dass sie zum Zeitpunkt des Unfalls mitten in ein Gespräch über die Lehrfirma verwickelt gewesen seien und dabei nicht auf den aufgeweichten Erdboden bei der Abrutschstelle geachtet hätten. Nach gründlicher Inspizierung der Spurensicherung wurde ein Fremdverschulden schließlich ausgeschlossen.
Doch habe ich genügend Fernsehkrimis geschaut, um Bescheid zu wissen: Bei Stürzen dieser Art gibt es einen gewissen Spielraum …
Ungewissheit ist schwer zu ertragen, aber sie gab mir den nötigen Antrieb. Knapp zwei Jahre nach dem Unglück veröffentlichte ich meine Variation der Geschichte heimlich unter dem unspektakulären Pseudonym Pia Pinsan in einem Zürcher Kleinverlag. Den überraschend eingetretenen Verkaufserfolg konnte ich zu dieser Zeit kaum genießen – denn ich kam mir dadurch wie eine Hochstaplerin vor. Idiotisch, ich weiß.
Warum ist es diesmal so schwer, eine Geschichte zu finden? Ist es der Druck, den ich mir selber wegen meiner Schreibambitionen mache? Einen Zufallsbestseller zu toppen ist kein Zuckerschlecken. Fehlende Zuversicht und nicht fehlende Selbstzweifel sind dabei die größten Hindernisse: Warum sollten sich Leser nach all den Jahren erneut für meinen Hirnschmalz interessieren? Und was gibt’s in meinem Alter schon zu erzählen? Was die Liebe betrifft, bestimmt nichts Lesenswertes. Es ist nun mal so, dass mir Männer schnell verleiden. Das liegt womöglich am Beruf. Als Lehrerin war ich es gewohnt, die Schüler nach drei Jahren weiterzureichen. So halte ich das mit den meisten Leuten aus meinem Umfeld. Ich reiche sie weiter. Meine Ehe hielt interessanterweise gerade mal sechs Semester. Dann war Schluss.
Seufzend schüttle ich die nervtötenden Gedanken ab, als ich realisiere, dass ich noch immer vor dem Bildschirm sitze. Wie viele Minuten hab ich diesmal mit Selbstgesprächen vertrödelt? Genauso gut hätte ich all diese Eingebungen eintippen können, dann würde das leere Dokument nun nicht derart vorwurfsvoll zurückstarren. Ohne nachzudenken, schreibe ich diesen einen Satz und staune selbst über das Resultat: Jemand hat meine Zuversicht entführt, und jetzt ist die weg.
In letzter Zeit wiederholt sich das Muster des Nicht-Schreibens: Es fängt mit Selbstironie an und rutscht Stunden später, mit jedem Glas Wein mehr, stetig in Richtung Zynismus ab. Apropos Wein: Ist es schon sechs Uhr? Die Zeitangabe am Computer widerspricht. Warum ist es noch nicht sechs Uhr? Dabei ist mir klar, warum ich trinke: um meine Sensibilität zu killen. Kurzfristig gelingt mir das. Das Problem ist, dass es auch langfristig wirkt. Dank der demenzfördernden Wirkung meines nicht ganz unbescheidenen Alkoholkonsums werde ich irgendwann auch den ganzen Rest vergessen. Und das ist vielleicht gut so.
3
ANNA
Gereizt tigere ich durch mein Schuhschachtel-Appartement in Berlin und lasse einzelne Szenen aus der Vergangenheit Revue passieren, nur um mich zu strafen. Wie bei einem Horrorfilm, den man sich reinzieht, obwohl es einem davor graut, zwinge ich mich hinzuschauen. Ich hab’s mal wieder verbockt und bin wütend auf mich selbst. Mein Freund Severin hat gerade mit mir Schluss gemacht, und ich kann es ihm nicht verdenken. Irritiert durch meine sporadischen Alpträume wollte er wissen, was los sei. Doch werde ich nie fähig sein, jemandem von meinen Dämonen zu erzählen, nicht mal dem Therapeuten. Mich einfach mal fallen zu lassen und jemandem komplett zu vertrauen, liegt nicht drin, nicht in meiner Situation. Lieber verkümmere ich innerlich, als in sein entsetztes Gesicht sehen zu müssen. Wie sollte ich ausgerechnet dem Typ, der es schafft, mich zum Lachen zu bringen, und auch sonst kaum nervt, zwei schwarze Kapitel aus meiner Vergangenheit erklären? Kapitel, die sich weder revidieren lassen noch jemals verziehen werden können? Als Dank für seine Fürsorge habe ich ihn angeschnauzt, dass er mich in Ruhe lassen soll. Dass die Alpträume stets dann auftauchen, wenn mich eine Beziehung allmählich einenge. Doch er wusste, dass es sich bloß um eine Ausrede handelte, und schenkte mir zum Abschied einen verletzten Blick.
Der wahre Grund liegt im Friedhof Fluntern begraben. Und zwar seit über vierzehn Jahren.
Alles fing damit an, dass meine Schulfreundin Rebekka die Katze einer Nachbarin füttern sollte. Knapp ein Jahr zuvor hatte Rebekka eine handgeschriebene Notiz »Katzenhüterin gesucht« in einem Quartierladen entdeckt. Die Auftraggeberin war eine wohlhabende Rentnerin, die jeden Winter wenige Wochen in Marrakesch verbrachte. Für die tierliebende Rebekka war dies der perfekte Nebenjob – fair bezahlt und erst noch in der Nähe ihrer Wohnung an der Susenbergstraße.
Noch vor den Frühlingsferien im dritten Sekundarschuljahr wurde Rebekka erneut angefragt, auf unbestimmte Zeit die Katze zu füttern sowie gelegentlich die Pflanzen im Haus zu gießen. Rebekka kam das gelegen, denn ihre Eltern arbeiteten beide und hatten keine Ferien gebucht, somit hatte sie eine Ausrede, nicht ständig auf ihren jüngeren Bruder aufpassen zu müssen. Alles lief gut, bis eines Abends die Katze nicht zur üblichen Zeit zurückgekommen war. Rebekka rief mich an und forderte mich verzweifelt auf, ihr beim Suchen zu helfen. Bis anhin sei es noch nie vorgekommen, dass Tiggi nicht um sechs Uhr durch die Katzenklappe reingerannt kam – die sei pünktlich wie eine Uhr. Laura maulte, da wir eigentlich in ein Billardcenter gehen wollten, aber ich überredete sie, mich zu begleiten. Warum nur habe ich darauf bestanden? Rebekka wäre heute noch am Leben, wenn wir damals abgelehnt hätten.
Als wir die besagte Adresse weit oberhalb unseres Wohnquartiers endlich erreichten, staunten wir nicht schlecht: Villen entlang den steilen Hängen des Zürichbergs waren keine Überraschung – dieses Haus bestach jedoch durch die beiden spitzen Türme und seine Tarnlage: in einer versteckten Nebenstraße, umgeben von Tannenbäumen, die auf uns wie strenge Wachsoldaten wirkten. In diesem »Schloss« sollte eine einzelne Person leben? Wir hatten uns eine kleine, mufflige Parterrewohnung vorgestellt – und nun so was. Laura pfiff durch die Zähne, als sie ihren Blick über den Privatpark schweifen ließ und dabei ein Schwimmbecken entdeckte. »Aber hallo«, sagte sie leise und ging sogleich die Treppen hoch zur messingeisernen Außentür.
Hastig beschrieb uns Rebekka das Tier als »ziemlich scheue, kleine Kurzhaarkatze mit gelbgrünen Augen und seidigem Fell in Tigermuster« und rannte dann weiter durch die Gegend, während sie in flehendem Ton den Namen der Katze rief. Es war schon fast peinlich. Laura und ich hielten eher lustlos im weitläufigen, überwucherten Garten Ausschau, denn es dunkelte bereits ein, und das machte die Sache schwieriger. Als ob man einen grün gestreiften Osterhasen im Schilf suchen müsste. Wir spähten zu den meterhohen Tannenbäumen hoch, die hinter dem Hauseingang die Fassade vor unerwünschtem Einblick schützten, doch konnten wir weder aufblitzende Katzenaugen noch ein Miauen oder eine Bewegung ausmachen. So schlenderten wir über den Rasen und erkundeten das Grundstück. Hinter einer Scheune entdeckten wir sogar einen Brunnen, dessen Schacht tief in die Erde verlief. Ob das Tier da hineingefallen war? In der Dämmerung ließ sich rein gar nichts erkennen – bloß ein schwarzes Loch. Rebekkas Sorge konnten wir nicht nachempfinden. Es war doch bloß ’ne Katze! Na und, dann hatte die ihren Radius halt erweitert, wieso machte Rebekka sich deswegen solch einen Stress?
Irgendwann hörten wir von Weitem Rebekkas Rufe. Minuten später erblickten wir erstmals die Katze, die von einer überglücklichen Rebekka gestreichelt wurde. Na also.
»Hast dein Taschengeld gerade noch gerettet, was?«, rief Laura ein wenig zu laut, und die Katze sprang weg.
»Könnt ihr bitte im hinteren Teil des Gartens warten?«, bat uns Rebekka und scheuchte uns mit einer Handbewegung fort, Richtung Pool.
Dort machten wir es uns auf den einladend aussehenden Liegebetten bequem. Weitere Liegen, vereinzelte Stühle und ein Sonnenschirm umrandeten den leeren Swimmingpool, der im Rasen eingebettet war. Laura ließ sich in die Lehne des metallenen Liegestuhls zurückfallen und betrachtete den verdunkelten Himmel, während ich sie dabei beobachtete. Inzwischen war es fast neun Uhr. »Das ist so geil hier«, flüsterte sie und warf mir einen begeisterten Blick zu. Wir sahen uns bereits mit Cocktaildrinks in der Hand bei sternenklaren Nächten Party machen.
Schließlich tauchte Rebekka mit einer Taschenlampe und einer Flasche Mineralwasser auf und erzählte uns von der Hauseigentümerin. Sie mochte Frau Kirnisch, das merkte man an der Art, wie sie über die Frau redete und von deren Eigenheiten schwärmte. Rebekka berichtete eifrig, was diese für ein erstaunlich abenteuerliches Leben führe. Laura hörte zwar zu, schien jedoch nicht sonderlich beeindruckt von Rebekkas Ausführungen. Stattdessen betrachtete sie die Villa aus den Augenwinkeln, als ob sie sich merken wollte, in welchem Stock welche Zimmer lagen. Rebekka bemerkte ihre Unkonzentriertheit und ging ins Haus, um nach einem Fotoalbum zu suchen. Minuten später zeigte sie uns die privaten Ferienfotos von Frau Kirnisch. Mir war nicht ganz wohl bei der Sache, und ich war überrascht, dass Rebekka sich nichts dabei dachte. Lauras Interesse war jedoch geweckt, als sie die Fotos von roter Erde, Schlangenbeschwörern, schmucken Palästen mit Marmorsäulen und kunstvollen Mosaiktüren erblickte.
»Das ist ja wie ein Fenster in eine neue Welt«, sagte sie leise, und Rebekka nickte zufrieden. »Ihr Sohn lebt schon seit Jahren in Marrakesch. Davon hat sie sich inspirieren lassen. Die Deko ist der Oberhammer. So was habt ihr garantiert noch nie gesehen.«
Kurz entschlossen stand Rebekka auf, öffnete die Glasschiebetür und führte uns ohne Umschweife ins Innere des Hauses.
Eine mit Ornamenten verzierte Stehlampe beleuchtete den Raum mit warmem Licht: Vor uns thronte ein länglicher Holztisch mit zwölf Stühlen auf einem wunderschönen pastellfarbenen Teppich, und in der Ecke stand eine edle samtbezogene Chaiselongue, welche mit zwei bunten Paillettenkissen geschmückt war. An der Wand hinter dem Esstisch hing ein eindrücklicher Spiegel, dessen Rahmen lauter kobaltblaue Mosaiksteinchen aufwies. Laura und ich waren baff. Rebekka aber genoss diesen seltenen Moment, für einmal im Mittelpunkt zu stehen, und ließ es sich nicht nehmen, uns eine Hausbesichtigung zu gestatten. Wie eine Maklerin führte sie uns stolz durch die Villa und machte uns auf besonders exquisite Einzelgegenstände aufmerksam wie die handgemachte marokkanische Vintage-Teekanne. Die exotische Einrichtung bewies, dass die Hauseigentümerin ein interessantes Leben führen musste. Ich spürte einen leisen Stich von Sehnsucht – oder war es Neid?
»Ab-ar-tig!«, stieß Laura hervor, während ich mich ebenfalls staunend umsah. Dabei verdrängte ich den Gedanken, dass wir gerade eine Grenze überschritten hatten. Es gehörte ja indirekt zu Rebekkas Job, das Haus zu lüften und es bewohnbar aussehen zu lassen. Und das war nun mal genau das, was wir taten – das Licht brennen lassen, um damit mögliche Einbrecher abzuschrecken.
An diesem Abend wurde Frau Kirnisch, eine für Laura und mich völlig Fremde, zu der Person, die uns, ohne es zu wissen, ein Stück Freiheit schenkte. Keine nervigen Eltern, die rumnörgelten, keine Regeln, keine Aufgaben. Einfach mal Raum für uns haben. Wir fühlten uns beinah erwachsen. Aufmerksam betrachtete ich die restlichen Aufnahmen im Fotoalbum, welches mir Rebekka weiterreichte, und blätterte Seite um Seite um.
»Wenn du wüsstest, was wir hier machen«, flüsterte ich zu der kleinen, gepflegt wirkenden Lady, die mich direkt anblickte. Die Frau war sorgfältig geschminkt und trug einen merkwürdigen Hut und lederne Handschuhe – eine Dame von Welt, wie meine Mutter sie bezeichnen würde. Die meisten Fotos zeigten Momentaufnahmen inmitten eindrücklicher Landschaften. Sie selber war nicht oft abgebildet; erst auf den letzten Seiten des Albums entdeckte ich ein weiteres Foto von Frau Kirnisch. Ihre offensichtlich blond gefärbten Haare hatte sie zu einem Dutt gesteckt, was ein wenig altbacken wirkte. Doch hatte sie etwas an sich, was mich einschüchterte. War es ihr offener Blick? Die Art, wie sie zufrieden mit sich selbst schien? Auf dem nächsten Bild legte ein Mann mittleren Alters seinen Arm um sie. Wahrscheinlich ihr Sohn, die Gesichtszüge waren ähnlich geschnitten, obwohl er sehr hager war. Auch er wirkte selbstbewusst, wie er derart heiter in die Kamera strahlte. Dem Hintergrund nach zu urteilen, saßen die beiden in einem teuren Restaurant. Zumindest sah man einen übertrieben elegant gekleideten Kellner zur Hälfte im Bild, und die Servietten schienen aus feinstem Stoff. Ich klappte das Album zu und schaute mich weiter um.
»Und du bist sicher, dass hier keine Kameras installiert sind?«, fragte ich Rebekka, die auf einmal hinter mir stand.
»Hätte ich euch sonst hereingelassen?«, antwortete Rebekka und verscheuchte damit meine Bedenken.
Nachdem wir die liebevoll eingerichteten Zimmer inspiziert hatten, machten wir es uns auf den Sesseln im Wohnzimmer bequem und betrachteten weitere Fotos, die fein säuberlich in altmodischen Lederalben klebten. Wir kamen uns dabei wie Voyeurinnen vor – und das fühlte sich herrlich verboten an. Es war ja auch viel einfacher, ein analoges Fotoalbum zu durchstöbern, als in einem Computer nach einer entsprechenden Datei zu suchen. Weder Passwort noch Sicherheitscode hielten uns davon ab. Auch bedienten wir uns der Schweppes-Flaschen im Kühlschrank, nutzten das Klo, setzten uns auf den Bürostuhl im Nebenraum und drehten uns darauf lachend um unsere eigene Achse. Nur auf die dunkelgrüne Chaiselongue im Esszimmer getrauten wir uns nicht – die war zwar wunderschön, aber wirkte altersgemäß unstabil.
Rebekka winkte uns in die Küche, wo sie spontan ein Rätselspiel veranstaltete. Sie hatte verschiedene, auffallend farbenprächtige Gewürzsorten aus Marokko auf je einen Unterteller gestreut und ließ uns daran schnuppern. Neugierig tunkten Laura und ich unsere Zeigefinger in die würzigen Aromen und kicherten, hatten keine Ahnung, wie wir die zuordnen sollten – mit Ausnahme von Zimt. Später wechselten wir ins Wohnzimmer und brachten Kekse mit, die wir in einem Küchenregal entdeckt hatten. Ich hatte gar nicht bemerkt, wie hungrig ich war, und griff gierig nach dem trockenen Mandelguetzli, welches mir Rebekka gönnerhaft hinstreckte. Laura winkte ab, tat so, als wäre sie die Hausherrin und wir ihre Untertanen. Ich erwischte sie dabei, wie sie am Fenster stand und sehnsüchtig ihren Blick in die schwarz getünchte Ferne schweifen ließ. Als ob sie ihre Ländereien betrachten würde.
»Komm da weg!«, rief Rebekka. Sie machte sich Sorgen, dass man Laura von außen entdecken könnte. Dabei war da nichts – nur Bäume. Und die biederen weißen Vorhänge boten zusätzlich Schutz.
»Ich meine es ernst.«
»Das sieht doch niemand«, wehrte sich Laura.
»Und wenn doch? Es ist meine Aufgabe, mich um das Haus zu kümmern. Ich brauche diesen Job. Sie bezahlt pro Tag zwanzig Franken.«
»Ist ja der Wahnsinn«, spottete Laura. »Dafür, dass du den Dachhasen fütterst?«
»Und alle Pflanzen am Leben erhalte.« Rebekka stemmte demonstrativ ihre Hände in die Taille.
»Krasse Verantwortung.« Laura guckte verächtlich.
»Musst du auch mit Tiggi spielen?«, fragte ich.
»Das mache ich liebend gerne.«
»Die ist doch sowieso kaum da, hast du vorhin gesagt.«
»Wenn wir solchen Krach machen, verängstigt sie das.« Rebekka schien auf einmal genervt. Als ob sie einen Schalter umgelegt hätte und ihr erst jetzt bewusst geworden wäre, was wir da taten. »Wir sollten aufbrechen. Meine Mutter wird sauer, wenn ich nicht pünktlich zu Hause bin.«
»Chill! Es ist Freitagabend.«
»Nein, wir müssen jetzt gehen. Auch wegen Tiggi. Ich krieg ein schlechtes Gewissen. Die hat bestimmt Angst vor euch und haut womöglich wieder ab.«
»Das ist der doch schnuppe«, meinte ich genervt. Sie machte echt ein Theater um dieses Tier. Doch Rebekka stand entschlossen auf und bugsierte uns zur Tür hinaus. Die Party war vorbei.
4
ELAINE
Der nachmittägliche Spaziergang durch die Altstadt tut gut. Jeden Samstag mische ich mich bewusst unters Volk, um meinen Kopf mit Impressionen zu füllen, damit ich sonntags, statt miesepetrig rumzusitzen, den Tintensaft theoretisch bloß noch aus meinen Erinnerungen auspressen müsste. Heute fahre ich mit dem Tram die Kurzstrecke von der Ottikerstraße hinunter bis zur Rudolf-Brun-Brücke und spaziere über den Holzsteg der Limmat entlang Richtung Schipfe. Dort schlendere ich durch meine Lieblingsgassen, die zum ältesten dauerhaft besiedelten Gebiet Zürichs gehören, und steige die Steintreppen zum schattenreichen Lindenhof hoch – die einzige Form von Fitness, die ich hinnehme. Der leicht erhöhte Platz ist dank seinen rund fünfzig Lindenbäumen ein beliebter Rückzugsort: Er erlaubt eine atemberaubende Sicht über die Dächer von Zürich und lebt von Touristen, die eifrig Fotos knipsen, Anwohnern, die Schach spielen, und Eltern, die ihre Kleinkinder auf der Schaukel hin- und herschwingen lassen. Das Lachen, Gemurmel und Gerede, vermischt mit dem Gurren der Tauben und dem Knirschen des Kiesbodens, wärmt meine Gedankenblasen: Du bist zwar allein, aber bist es doch nicht.
Während ich dem Aussichtspunkt zu meiner Linken entgegenschreite, blicke ich mich suchend um. Die vereinzelt herumstehenden Statisten in Groß und Klein haben keine Ahnung, dass sie entweder als potenzielle Romanfiguren dienen oder als Ersatzfamilie herhalten müssen. In meinen spontan geschriebenen Gedankenabsätzen geben einige ziemlich interessante Figuren ab – der bärtige Mann beim Bodenschachspiel zum Beispiel. Wobei die Anzahl der transparenten, unbrauchbaren Statisten stetig wächst: Leute, die bloß auf ihre Smartphones glotzen und von ihrer Umgebung nichts wahrnehmen. Wie kann man bei diesem prächtigen Panoramabild lieber in sein Handy gucken? Denn in meinem Blickfeld liegt die spannendste Aussicht Zürichs: der historische Stadtkern rund um das Grossmünster, das Wahrzeichen der Stadt. Dazwischen bunte, in sich verschachtelte, mit Erkern und Terrassen versehene Altstadtbauten, die sich im Niederdorf aneinanderreihen. Mir direkt gegenüber thronen die Universität Zürich und der Campus der ETH, der Eidgenössischen Technischen Hochschule, und steil unter mir fließt die Limmat der Quaipromenade entlang Richtung Landesmuseum. Längst habe ich realisiert, dass der träge treibende Fluss jeden Tag eine andere Farbe aufweist; heute ist er petrolfarben. Nachts jeweils tintenschwarz.
Mindestens eine halbe Stunde sitze ich auf einer der hellgrünen Bänke und beobachte die Leute um mich herum. Es gibt auch Jugendliche, die Klapphandys nutzen, stelle ich fest. Dumbphones? Smart! Wenn weltweit der letzte Daumen digitalfest ist, werden wir womöglich wieder auf analog umschalten … halbintellektuelle Künstlichkeit hin oder her. Vor mich hin murmelnd mache ich mir Notizen zu den nichts ahnenden Besuchern und wähle dabei gezielt einen der Handysüchtigen als Antagonisten. Selber schuld.
Zurück in meiner Wohnung platziere ich meine Einkäufe auf dem Küchentisch – frisches Brot, Camembert, eine Flasche Sancerre und ein Taschenbuchkrimi, der in der Bretagne spielt. Wie ich Wein und Käse in den Kühlschrank hebe, piepst mein Handy. »Heutige Sofa-Lesung abgesagt«, steht da in einer automatischen Nachricht. »Ach nee!«, rufe ich aus. Die Buchpräsentation einer Newcomerin im Quartiercafé hätte meinen Tag perfekt abgerundet. Unauffällig hätte ich mich unter Leute und Buchstaben mischen und mich inspirieren lassen können. Dabei haben die Verantwortlichen dort keine Ahnung, dass ich selbst Autorin bin. An solchen Tagen bereue ich es bitter, dass ich unter Pseudonym schreibe. Grimmig stehe ich auf, trotte zum Korridor und blicke in den weiß gerahmten Spiegel, der dort hängt. Doch, ich sehe mich!
Das seltsame Gefühl, allmählich unsichtbar zu werden, überkam mich zuvor erneut. Es sind bloß unbedeutende Vorkommnisse, doch wenn die sich aneinanderreihen, werden sie gewichtig: ausdruckslose Gesichter im Supermarkt, die durch mich hindurchschauen, Passanten, die mich auf der Straße anrempeln. Hallo – sieht mich jemand? Allmählich verblasse ich direkt vor der Welt und löse mich in nichts auf. Außer ich liefere Tinte.
Seufzend gehe ich zurück zum Kühlschrank und greife zielstrebig nach der Flasche Weißwein. Schenk mir ein Glas ein und gönne mir einen Schluck Zweisamkeit. Dann öffne ich erneut den Kühlschrank, um im Gemüsefach nach einer Zwiebel zu graben, lege diese auf das Holzbrettchen, um sie säuberlich zu schälen. Dabei erzähle ich ihr, welchen Namen meine neue Hauptfigur erhalten soll. Während ich die Zwiebel eifrig zerhacke, tue ich so, als ob ich auf ihre Zustimmung warte. Als ob die jetzt noch klar denken könnte, nachdem ich ihre Zellen zerstört habe. Oh doch, die Zwiebel lebt – ihre aggressive Antwort steigt mir in Sekundenschnelle in meine Augen. Wie ich so dastehe und fokussiert die Zutaten für das Kichererbsencurry vorbereite, realisiere ich auf einmal, was ich da tue, und schäme mich sogleich. So weit ist es also schon: Ich diskutiere mit Gemüse, während mir Tränen die Wangen hinunterlaufen. Ist das der Preis für meine Unabhängigkeit? Dieses süßschwere Gefühl, welches mich nachdenklich stimmt und mich längst getroffene Entscheidungen hinterfragen lässt? Nein, ich bin nicht einsam, ich fühle mich nur gerade so. Ich weiß, wie ich die Stunden füllen muss: mit Struktur und Aufgaben, die ich mir selbst immer wieder auferlege.
Schlag die Zeit tot, bevor sie dich totschlägt.
Um mich von meinem elenden Dasein abzulenken, greife ich nach dem Abendessen erneut nach der Zeitung, obwohl ich die Schlagzeilen am Morgen bereits überflogen hatte. Nur um zu prüfen, welchen Personen es schlechter geht als mir. Alle reden vom Negativitätseffekt, doch der hat eben auch was Positives. Nein, Blödsinn. Ich will nicht abstumpfen. Wenn die Welt jedoch verrücktspielt, hilft nur noch Selbstironie.
Wie ich es mir auf dem Sofa bequem mache, lese ich mir laut vor: »Video von zwei Jugendlichen, die im Zürcher Fundbüro verzweifelt nach ihrer verlorenen Perspektive fragten, geht viral.« Die ticken heute einfach anders, denke ich. Ich mag das, wenn die sich was Originelles einfallen lassen. Direkt darunter lese ich: »Die Gefahr lauert im Busch: Die Zecke bedroht die gesamte Schweiz.« Herrje. Haben Zecken heutzutage etwa die besseren Zukunftsaussichten als die Jugend?
Ob es auch am Unterricht liegt? Jemand hatte mal behauptet, der neue Lehrplan plane mehr, als er lehre. Und was wohl mit unserem Gefühl für die Sprache passieren wird, wenn inzwischen schon Schüler ihre Zeilen von KI verfassen lassen? Wobei wir Alten ja auch nicht besser sind … Verlassen uns beim Texten auf die Autokorrektur, statt das Geschriebene vor dem Senden nochmals durchzulesen; wohl hauptsächlich, weil die Lesebrille grad außer Reichweite ist. Was hatte meine Freundin Debby in ihrer WhatsApp-Nachricht geantwortet, als ich sie neulich auf eine anstehende Feier ansprach? Ach ja … dass sie sich auf die Freier freue.
Nein, ich habe keine Nerven mehr für den anspruchsvollen Job als Sekundarschullehrerin, predige ich mir selbst. Der Druck, allen Anforderungen gerecht werden zu müssen, würde mir den Schlaf rauben. Die meisten Kids und manche Eltern sind toll, aber allein das Zuhören ist anstrengend. Die Jugendlichen sind wie von einem anderen Stern. Neulich im Restaurant ist mir das gerade wieder passiert, das Problem mit der Kommunikation. Um meine Gedanken zu ordnen, spaziere ich regelmäßig durch die Zürcher Altstadt. Inzwischen kenne ich im Kreis 1 jeden Blumentopf. Obwohl ich mich dank dem andauernden Ladensterben nicht selten umorientieren muss, da ständig die Kulisse verschoben wird. Irgendwo zwischen Pflasterstein und Dachterrasse hab ich für mich mal wieder was Neues entdeckt: ein winziges, charmantes Beizli, welches auf eine unrentable Papeterie folgte. Welche zuvor einen Kinderspielzeugladen ablöste. Welcher wiederum einen Blumenladen ersetzte. Schade drum. Jedenfalls hatte ich in dieser trendigen Brasserie oder wie man das nennt, den jungen Kellner, so einen Zappelphilipp, nicht verstanden. Und zwar nicht bloß, weil ich seinen Französischakzent erst filtern musste. Sein Mund, das reinste Maschinengewehr, schoss das Menüangebot auf mich ab. Bitte was? Er wiederholte alles noch mal in derselben Geschwindigkeit, als ob ich inzwischen schneller hören könnte. Und dann sagte dieser Sürmel noch was von einem Code. QR-Code? Nein danke, ich brauche die normale Menükarte. Ein Typ neben mir hatte zugehört und geduldig auf das Scannerdings am Tisch gezeigt. »Da müend Sie Ihres Phone anehebe, dänn chönd Sie’s Menü läsä.« Ach ja? Sehe ich so aus, als ob ich das nicht selber wüsste? Ich bin fünfundfünfzig, nicht hundert. Mein Akku ist leer, das ist alles. Und was wird aus den Leuten, die kein Smartphone besitzen, müssen die verhungern? Einer nach dem anderen werden wir früher oder später auf dem Abstellgleis landen, während die Generation Alpha von Z übernimmt.
Apropos … mein Rücken schmerzt. Umständlich wechsle ich die Position und setz mich ein Stück weiter nach rechts und blättere zum Wirtschaftsteil. Witzig, wie sich diese Techgiganten um die Macht streiten, ob nun künstlich oder nicht. Apfelhändler und Datendealer. Dopaminlieferanten, die uns beibringen, wie man sich von echter Nähe entfernt. Insbesondere dieser x-beliebige, unbescheidene Typ … Wie auch immer all diese übereifrigen Dompteure heißen; die erinnern mich tagtäglich daran, dass ich alt bin, und das mag ich nun mal nicht. Wie ich den Kulturteil vor mir ausbreite, sticht mir sogleich ein Artikel ins Auge.
Kunstprojekt zu WortMACHT und Einsamkeit, welches Betroffene inspirieren soll. ANNA Koma will sensibilisieren und möchte mit ihren Kreationen aufzeigen, wie Worte zur Heilsalbe oder Schusswaffe werden können.
»Moment mal«, rufe ich aus, als ich das Foto unterhalb des Abschnitts genauer betrachte. Dieses Gesicht kommt mir bekannt vor. Dieser eindringliche Blick, unterstrichen von dichten Augenbrauen, die blauschwarzen Haare, das markante Kinn. Na, so was! Das ist Anna. Meine Anna. Sie hat ihren Nachnamen geändert … Heirat? Nein, das ist bestimmt ihr Künstlername. Aufgeregt lese ich weiter.
Die Künstlerin ANNA Koma vom Studio Nichtig & Keiten zeigt ihre Werke in Zürich, in der Pop-up-W©RTGALERIE vom 5. bis am 21. Oktober 2023. Das Projekt »Ein Same keimt« soll Hoffnung vermitteln, während die Ausstellung WortMACHT sich der Konsequenz unbedachter Worte widmet. Die Ausstellung hat in Berlin dank der Hauptattraktion erfolgreich gestartet: »Olga«. Ein weibliches Hologramm, welches auf neuester, KI-verknüpfter Technologie basiert. Nach erfolgter »Fragerunde« mit dem Hologramm können sich die Besuchergruppen untereinander austauschen und Feedbacks erteilen. Das Ziel ist, dem Thema Einsamkeit Raum zu geben.
Ach … sieh mal einer an! Ausgerechnet Anna, Lauras beste Freundin. Was weiß die denn schon von sozialer Isolation, bitte schön! Die beiden waren zu Schulzeiten für ihre spitzen Bemerkungen und Provokationen bekannt gewesen, darum klingt das jetzt beinah heuchlerisch, was Anna da anpreist. Ob sie sich mit dieser Ausstellung etwa öffentlich entschuldigen möchte? Neugierig geworden, lese ich weiter im Text.
ANNA Koma hat sich als Gamedesignerin im letzten Jahr einen Namen gemacht. Die Vision, die aktuelle Ausstellung den Einsamen dieser Stadt zu widmen, sei aufgrund des Lockdowns entstanden und soll, unter anderem durch die Lichtinstallation »Schluss:Punkt«, auf die unterschätzte Gefahr von Einsamkeit aufmerksam machen.
Zudem steht ein separater VR-Raum zur Verfügung, in welchem interessierte Ausstellungsbesucher ein Virtual-Reality-Erlebnis ausprobieren und für einige Minuten in eine inspirierende virtuelle Welt eintauchen können.
Vernissage: 5.10.23, 17 Uhr. Tickets: NichtigundKeiten.de
Minuten später gebe ich im Rechner den Namen »ANNA Koma« ein und finde prompt einen weiteren Eintrag.
… Mobbing führt zu Ausgrenzung, führt zu Einsamkeit. Wir sind für das, was wir anderen an den Kopf werfen, verantWORTlich. Mal ausgesprochen, können gewisse Sätze nicht einfach ausradiert werden. Da möchte ich einen Denkanstoß bieten.
»Mal ausgesprochen, können gewisse Sätze nicht einfach ausradiert werden«, wiederhole ich flüsternd. Habe ich das meinen Schülern nicht einmal so ähnlich klarmachen wollen, noch während des Deutschunterrichts? Ich fühle mich geschmeichelt.
Auf einmal spukt mir wieder Rebekkas Gesicht im Kopf herum, und ich versetze mich gedanklich zurück in die Zeit, als ich diese Anspannung zwischen dem befreundeten Dreiergespann im Klassenzimmer gespürt hatte. Dies könnte eine Chance sein, endlich zu erfahren, was damals zwischen Laura, Anna und Rebekka vorgefallen war. Ich muss Anna persönlich treffen – womöglich versteckt sich die Antwort in ihrer Kunst. Ob das bedeutet, dass Anna als Schülerin die harte Schale bloß vorgespielt hatte? Dann hätte mich mein Gefühl, dass Anna im Grunde gar nicht so abgebrüht war, nicht getäuscht. Eher undurchschaubar und zurückhaltend, vielleicht auch sensibel oder bloß wütend – ein gebranntes Kind? Die Ausstellung wäre die Möglichkeit, Anna – die erwachsene Version von ihr – ganz zufällig anzutreffen. Zwar sind die Künstler während ihrer Ausstellung längst nicht immer anwesend, doch bei der Vernissage oder der Finissage würde sie wohl vor Ort sein. Nächste Woche stehen nur wenige Termine an, also werde ich das Ticket am besten noch heute buchen. Wobei die Vorstellung, mit einem Hologramm zu reden, eher abschreckend als aufregend klingt, diesen Part werde ich besser auslassen.
Angeregt klopfe ich mit den Fingerspitzen meiner linken Hand auf meine Wange. Ein gutes Zeichen, denn es bedeutet, dass ich inspiriert bin. Wer die Einsamkeit sucht, findet sie auch, denke ich spontan. Das Glück liegt in sozialen Beziehungen versteckt, in welcher Form auch immer. Womöglich könnte ich das für meinen Text nutzen; das Thema Einsamkeit betrifft mich genau genommen auch. Titel: Längst nicht jeder wird von Backen glücklich. Da muss ich glatt an meine missglückte Ehe denken. Die Scheidung war dazumal nicht das Schlimmste gewesen – eher das ganze Drumherum, das vom Umfeld aufgezwungene Gefühl des Versagens. Als ob ich gemeinsame Freunde mit meiner Ent-Scheidung persönlich beleidigt hätte. Dabei wollte ich nun mal nicht länger mit jemandem verheiratet sein, der schon nach drei Jahren an mir vorbeiliebte, ohne es zu merken. Wie sollte so einer mich wiederfinden, wenn er nicht mal wusste, dass er mich verloren hat?
Jedenfalls lässt es sich nicht abstreiten, dass andauernde loneliness potenziell verheerende Auswirkungen haben kann und manchmal gar als Vorstufe von Depression oder anderen Krankheiten herhält. In Simbabwe hat sich das Friendship-Bench-Konzept als Vorbeugung gegen die stille Bedrohung längst bewährt – dank dem Einsatz von Großmüttern als Notlösung für die fatalen Engpässe in der psychotherapeutischen Versorgung. Darüber habe ich erst neulich gelesen. Und auch bei uns gibt’s für den sozialen Austausch immerhin Projekte wie die »Plauderkasse« bei gewissen Supermärkten oder »Zuhörbänklis« an öffentlichen Plätzen.
Da bin ich ja mal gespannt, was Anna dazu zu sagen hat.
LAURA
Willkommen in meinen Gedanken.
Warnung:
Dies ist eine Sondermülldeponie.
Die folgenden Zeilen sind potenziell tödlich,
die Buchstaben vergiftet.
5
ANNA
Vor mich hin sinnierend sitze ich im »The Greens« in Berlin und betrachte das Foto auf meinem Handy. Die Aufnahme stammt aus einer alten Schülerzeitung, die ich vor Jahren abfotografiert hatte. Zwischendurch war ich immer wieder mal versucht gewesen, den Beweis meiner Schuld kurzerhand zu löschen, aber damit hätte ich die letzte glückliche Erinnerung vernichtet. Es wäre mir wie Verrat vorgekommen. Rebekka, die mir entgegenlacht, umrandet von offenem Feuerhaar. Ihr Gesicht mit den hellbraunen Sommersprossen ist eingefroren im Alter von knapp dreizehn Jahren, als wir uns gerade kennengelernt hatten. Heute wäre sie beinah so alt wie ich, dreißig Jahre jung. Resigniert reiße ich meinen Blick von ihrem Lächeln los, ertrage dieses nicht länger. Why?, schreie ich mich selbst in Gedanken an und greife nach meiner Kaffeetasse, blinzle eine aufkommende Träne weg. Um mich herum schwatzen und lachen die anderen Cafébesucher und unterhalten die kleinen und großen Pflanzen, die rundherum von den Decken hängen oder direkt auf den Tischen selbst mithören. Kurz blitzt eine digitale Version für eine mögliche Spielvariante auf, aber ich schieb die gleich wieder weg. Ich bin nicht zum Arbeiten da. Diesmal nicht.
Rebekka hätte ihr Leben im Griff gehabt, keine Frage. Hätte in einem Unternehmen Karriere gemacht und wäre wohl längst verheiratet, vielleicht sogar schon Mutter. Sie war die Jüngste und Klügste innerhalb unserer Clique gewesen und hatte mehr Common Sense als der Rest von uns. Wobei diese Tatsache wohl ihr Todesurteil gewesen war. Umgehend versuche ich, die aufkommenden gefährlichen Gedanken zu verscheuchen, doch die Flashbacks schieben sich bereits wieder vor alles andere. Zum Beispiel diese eine Frage, die mir Rebekka gestellt hatte: Warum bemühst du dich derart um Lauras Freundschaft?
Gleich zu Beginn der Sekundarschule hatte mich Rebekka das gefragt. Damals kannten wir uns noch nicht so gut, und die Frage hatte mich ziemlich irritiert. Alle waren doch um Lauras Gunst bemüht. Oder täuschte ich mich? Wollte Rebekka lieber nur mit mir befreundet sein und nahm Laura bloß hin? Nein, das konnte nicht sein, keiner von uns nahm Laura einfach hin – Lehrerschaft inklusive. Lauras Präsenz überstrahlte die gesamte Schulklasse. Darum habe ich als Antwort bloß mit den Schultern gezuckt. In unserer Klasse waren wir zu Beginn zwischen zwölf und vierzehn Jahre alt und hatten den Kopf voller Flausen, verachteten Spießbürgerlichkeit, suchten nach abgefahrenen Idolen. Meine Eltern waren kurz vor Semesterbeginn mit mir im Schlepptau nach Zürich zurückgezogen, und ich kannte noch niemanden genauer, musste mich erst mal orientieren. Laura stach heraus: Von Anfang an war ich von ihrer Energie und ihrer starken Persönlichkeit fasziniert gewesen. Sie war keine von den aufgeregt plappernden Mädchen, die den Jungs nachglotzten und dabei womöglich noch rot wurden. Bereits vor dem ersten Schultag habe ich Laura vor einem Zeitungskiosk außerhalb der Schule stehen sehen. Sie war in ein Magazin vertieft gewesen, sah älter aus, als sie war. Ihre Züge makellos, kaum Pickel im Gesicht, ihr braunes Haar unter einer Mütze verdeckt. Ihr Kleidungsstil – Tanktop zu Cargohose in Tarnfarben – wirkte wie ein Statement. Darum war ich ein paar Tage später überrascht, als sie in der neu zusammengewürfelten Schulklasse direkt vor mir saß. Von meinem Platz aus konnte ich Laura unauffällig beobachten und dabei bemerken, wie sie zwischendurch freudlos ins Leere blickte, während ihre Sitznachbarinnen aufgeregt tuschelten. Bereits nach ein paar Tagen änderte ich meine vorgefasste Meinung über sie. Laura schien stark und cool, gleichzeitig fragte ich mich, ob das bloß Fassade war. Es war mehr ein Gefühl; andere urteilten womöglich nach ihrem attraktiven Äußeren und ihrem selbstbewussten Auftreten. Wie es sich herausstellte, hatte Laura während der Primarschule ein Schuljahr wiederholen müssen. Genau wie ich aufgrund meines zweifachen Schulwechsels im Ausland. Auch deswegen wirkte sie innerhalb der Klasse irgendwie … deplatziert. Ein stolzer Zürcher Phönix mit gebrochenem Flügel, der sich in einem Gehege voller zirpender Wellensittiche verflogen hat. Habe ich das bloß in sie hineininterpretiert? Es war wohl diese versteckte Verletzlichkeit, die mich an ihr reizte. Lauras Verhalten war unberechenbar und voller Widersprüche: Mal war sie verschlossen, dann witzig oder unverhältnismäßig streitsüchtig. Normale Teenagerallüren eben – wer verhielt sich in diesem Alter den Lehrern gegenüber nicht