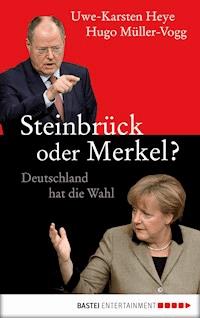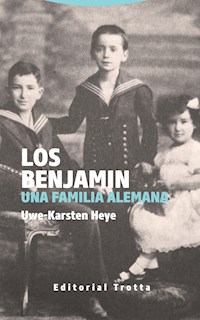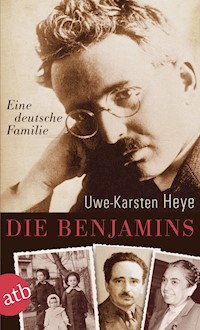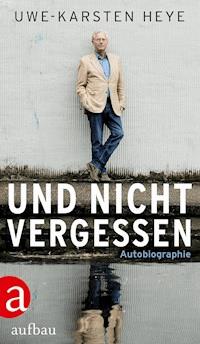
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Was im Zwielicht der Geschichte zu erkennen ist. Mit seiner Autobiographie legt Uwe-Karsten Heye ein sehr persönliches Geschichtsbuch vor. Berührend, wunderbar erzählt, eine Kindheit in Ost- und Westnachkriegsdeutschland, ein politisches Leben zwischen Willy Brandt, dessen Redenschreiber Heye war, und Gerhard Schröder, für dessen Regierung er als Sprecher arbeitete, zwischen Berlin und New York, zwischen Diplomatie und Journalismus. Als Kind erlebte Uwe-Karsten Heye, was Krieg und Nachkrieg angerichtet hatten. Der Kalte Krieg setzte andere Prioritäten als konsequente Entnazifizierung. Vergessen und Verdrängen waren die Devise. Heye arbeitete als Redenschreiber für Willy Brandt, als Journalist, unter anderem für Kennzeichen D, legte er den Finger in die Wunden des geteilten Landes, wurde Regierungssprecher unter Gerhard Schröder und schließlich Generalkonsul in New York und Chefredakteur des „Vorwärts“. Heyes Autobiographie ist eine deutsche Geschichtsstunde, aber auch Selbstbefragung: Was wurde versäumt, dass wir es heute erneut mit einem wachsenden Rechtsextremismus zu tun haben? Darauf sucht er Antworten und will Auskunft geben, damit sich Geschichte nicht wiederholt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über Uwe-Karsten Heye
Uwe-Karsten Heye, geb. 1940, Journalist, arbeitete als Redenschreiber für Willy Brandt, Regierungssprecher von Gerhard Schröder sowie als Autor für ARD und ZDF. Seine Erinnerungen an Flucht und Nachkriegszeit »Vom Glück nur ein Schatten« wurden unter dem Titel »Schicksalsjahre« mit Maria Furtwängler verfilmt. Im Frühjahr 2014 erschien bei Aufbau »Die Benjamins. Eine deutsche Familie«.
Informationen zum Buch
Was im Zwielicht der Geschichte zu erkennen ist
Mit seiner Autobiographie legt Uwe-Karsten Heye ein sehr persönliches Geschichtsbuch vor. Berührend, wunderbar erzählt, eine Kindheit in Ost- und Westnachkriegsdeutschland, ein politisches Leben zwischen Willy Brandt, dessen Redenschreiber Heye war, und Gerhard Schröder, für dessen Regierung er als Sprecher arbeitete, zwischen Berlin und New York, zwischen Diplomatie und Journalismus.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Uwe-Karsten Heye
Und nicht vergessen
Autobiographie
Inhaltsübersicht
Über Uwe-Karsten Heye
Informationen zum Buch
Newsletter
Vorwort
1. Im Zwielicht deutscher Geschichte
2. … und nichts verschweigen
3. Im Spiegel
4. Wenn Albträume verblassen
5. Nierentisch und Opernarien
6. Schule des Lebens
7. Willy Brandt
8. »Kennzeichen D«
9. An der Leine
10. Emigranten in New York
11. Zurück auf Anfang
Dank
Verwendete Literatur
Bildteil
Impressum
Vorwort
Es gibt eine Reihe von Menschen, deren Leben und deren Widerstand für mich wichtig sind und die mir Orientierung geben. Sie als Vorbilder zu sehen, ihnen im Denken und Handeln Konkurrenz zu machen, könnte aber atemlos machen, und jeder Versuch, sie einzuholen, würde höchstens zu Seitenstichen führen.
Vorbilder sind also so eine Sache, kommt man ihnen nicht nah genug, geraten sie leicht außer Sichtweite. Aber als Nachbilder sind sie schon geeigneter, denn sie alle hatten Wünsche und Vorstellungen an ein erfülltes Leben, die ich teile. Ein paar Namen nur: Christa Wolf, deren Bücher erkennen lassen, wie sehr ihre Wünsche mit der Wirklichkeit des »Projektes DDR« kollidierten. Günter Grass, dem viele gern heimzahlen wollten, dass ihm erst spät im Blick zurück die SS in die Erinnerung kam. Dabei ist damit kein kritischer Satz von ihm über die Wirklichkeit der Bundesrepublik falsch betont. Ihnen wie auch Willy Brandt begegnete ich persönlich in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts an unterschiedlichen Orten, sie waren mir nahe auch als Nachbilder, wie manch andere.
Daneben habe ich Namen von Literaten und Künstlern im Gedächtnis, die zwischen den beiden großen Kriegen verzweifelt gegen das Unheil anzuschreiben suchten und gegen das, was mit und nach dem Ersten Weltkrieg begann und zum Zweiten Weltkrieg führte. Geweiht im Tempel Garnisonkirche und Preußens Gloria und dort 1933 feierlich am Tag von Potsdam überreicht: die freiwillige Übergabe der Macht an die NSDAP und ihren Führer. Sie brauchten gerade mal zwölf Jahre, um die Kultur zu zerstören, die Walter Mehring in der »Bibliothek seines Vaters« fand, und die er später Buch für Buch als »Autobiographie einer Kultur« erinnerte und beschreiben konnte.
Sie war tatsächlich materiell verloren, als ein SA-Trupp die Bibliothek seines verstorbenen Vaters zerstörte, die er 1933 in seinen ersten Fluchtort Wien mitgenommen hatte. Er erinnert in »Briefe aus der Mitternacht« an viele seiner Kollegen aus den zwanziger Jahren, die in der Schreckenszeit des Naziterrors verstarben oder ermordet, deren Bücher verbrannt wurden und deren Namen ohne ihn und seine an sie erinnernden Bücher aus dem kulturellen Gedächtnis verschwunden wären.
Auch sie gehören zu meinen Helden. Manche habe ich gelesen, von manchen weiß ich nur den Namen. Umso mehr gilt es, erneut an ihren Kampf zu erinnern und damit zu lernen, warum er verloren wurde. Die Nazis wussten, was sie taten, als sie die Bücher auf den Scheiterhaufen warfen. Sie sollten Asche werden und damit für immer aus der Erinnerung verbannt sein.
In der restaurativen Nachkriegszeit war es der Kalte Krieg, der die Lebenslüge verbreitete, dass die Nazis vielleicht doch in richtiger Voraussicht die Sowjetunion überfallen hatten, um nach Polen auch das slawische Großreich zu vernichten und die Überlebenden zu versklaven, und damit, was es wohl entschuldigen sollte, den Bolschewismus zu zerstören. Dreißig Millionen Tote waren in Russland zu bestatten. In den fünfziger Jahren jedenfalls gab es in den USA geradezu panische Furcht vor kommunistischer Unterwanderung. Das passte gut in die Zone der Verdrängung und Vergesslichkeit, die als Bundesrepublik Deutschland und Frontstaat des Kapitalismus die Nachfolge des »Dritten Reiches« antrat.
Es war der republikanische Senator McCarthy, der in den fünfziger Jahren in den USA jeden, der links der Mitte zu verorten war, zum Agenten Moskaus stempelte. Entsprechend das Echo in der Bundesrepublik, wo es keine Scheu gab, die braunen Eliten in Wirtschaft, Wissenschaft und Justiz zu rehabilitieren und sie erneut an die Schaltstellen des Staates zu lassen. In dieser Zeit und dieser restaurativen Stimmungslage, die der McCarthyismus in den USA in den fünfziger und sechziger Jahre anfachte, hatten die Mahner der zwanziger Jahre wie Carl von Ossietzky und die Autoren seiner »Weltbühne« keine Konjunktur. Durch sie wurde ich politisch wach und spürte in deprimierenden Gesprächen zu Hause das Elend einer politischen Restauration, in der jede Kritik an der Bundesrepublik Anlass zu dem Rat gab: »Dann geh doch nach drüben.« Drüben, das war die DDR, in der es nach Meinung des damaligen Bundeskanzlers »schlimmer als in der Nazizeit« zuging.
Erneut liefert derzeit rechtsextremer Populismus quer durch Europa Anlass zur Besorgnis, sodass im Oktober 2017 vor dem Brandenburger Tor in Berlin sich spontan 12000 Menschen versammelten, um dagegen Protest anzumelden. Sie kamen fast 75 Jahre nach dem Marsch der Sturmabteilungen der Nazis (»SA marschiert«) zusammen, die 1933, von Fackeln gespenstisch beleuchtet, das Tor passierten. Aktueller Anlass war zudem der Einzug der rechts- und braungefärbten AfD in den neuen, gerade gewählten Bundestag.
Kann es sein, dass etwas mehr als zwölf Prozent für eine Partei, die nach rechtsaußen keine Grenze zieht und neunzig Abgeordnete stellt, bei mehr als 700 Abgeordneten im neuen Bundestag, einen solchen Schrecken auslösen? Eher wohl, weil zeitgleich in Polen und in Ungarn rechtspopulistische Parteien regieren und jetzt auch in Österreich und in der Tschechischen Republik die Regierungen stellen.
Da zieht etwas herauf, was die Idee des grenzenlosen Europa als Zone des Friedens zu zerstören in der Lage ist. Das begründet wachsende Befürchtungen, auf die ich in diesem Buch nach Antworten suche. War unser nachwirkender Widerstand womöglich zu schwach? Grund genug, auch auf mein Leben und auf entsprechende biographische Stationen zurückzublicken, und warum ich lange glaubte, dass »nie wieder« sei tief genug verankert und werde halten. Sollte ich irren, wäre es Zeit und dringend geboten, aufzuwachen.
Potsdam, im März 2018
Uwe-Karsten Heye
1. Im Zwielicht deutscher Geschichte
Wie ist ein Leben zu beschreiben? Wie lässt sich Erinnerung aufbereiten und dabei vermeiden, dass schwierige Erlebnisräume zugeschlossen bleiben und dann auf einmal unbedeutend erscheinen und der Blick zurück abschweift? Wie lässt sich das eigene Leben betrachten und ihm gerecht werden?
Könnte ein Ich-Erzähler die Rolle des Beobachters übernehmen, der Fiktion und Wirklichkeit auseinanderhält? Da es am Ende doch ein und derselbe ist, der beschreibt, und der, über den erzählt wird, könnte es vielleicht doch Distanz bringen, die ein ehrliches Bild herzustellen erleichtern könnte?
Als Günter Grass sein eigenes Leben besichtigte und in den Tiefen verdrängter Erinnerung auf »SS« stieß, war es mit der Sicherheit vorbei, mit der er bis dahin zurückgeblickt hatte. Ist über sich selbst zu schreiben nur ehrlich, wenn es weh tut? Jedenfalls ist es nur dann sinnvoll, glaubt Christa Wolf, als sie über den biographischen Selbstversuch von Günter Grass schreibt, der »beim Häuten der Zwiebel« seine Haut zu Markte trug. Meine Nähe zu beiden ist auch geprägt davon, wie sie ihre Erinnerungen entziffern.
Es ist große Literatur, wie sie sich den Lesern ausliefern. Dass sie mir, der ich lesend bei ihnen bin, ganz nahe sind, könnte daran liegen, dass auch mich historische Erfahrungen begleitet haben und prägten. Ihnen ausgesetzt und mit gleicher Irritation wie Christa Wolf und Günter Grass aufgewachsen zu sein und von gemeinsamer Geschichte nicht loszukommen, lässt Entfremdung zu ihnen nicht entstehen.
Wie oft im Leben wird man ein anderer? Christa Wolf zitiert Grass und folgt ihm nachdenklich. Wie er sehe ich auf ein Passfoto, das ich in meinem zerfledderten Führerschein finde, der geradezu antiquarischen Wert hat. Der junge Mann darauf ist mir zugleich nah und seltsam fremd, die gleiche Empfindung hatte Grass, als er sein Jugendfoto beschreibt. Meine Großmutter hatte zehn Fahrstunden bezahlt, und ich bekam den Führerschein als Geschenk zum 21.Geburtstag. Was weiß ich noch über den, dessen Foto meinen Führerschein bebildert?
Auf gewisse Weise schließt sich für mich nach einer langen Reise und vielen Wohnorten mit Babelsberg ein Kreis. Denn immer wieder kam meine Mutter auf die mit der Filmstadt verbundenen Künstler zu sprechen, die sie damals vor mehr als siebzig Jahren nach Danzig verpflichten konnte. Für sie nur »die Babelsberger«. So lange weiß ich von Babelsberg. Sie kamen aus Berlin oder eben von der Ufa in Potsdam-Babelsberg. Jede und jeder hatte Starruhm. Für sie war Truppenbetreuung Pflicht, meine Mutter engagierte sie im Auftrag des Reichspropagandaamtes, Außenstelle Danzig.
Heinrich George, Marika Rökk und, und … Große Namen geisterten durch Ursels Erinnerungen. Das Publikum waren verwundete Soldaten, versorgt auf den Lazarettschiffen vor Danzig. Halbwegs genesen, enterten sie die Salons der »Kraft durch Freude«-Flotte, zu denen auch das Kreuzfahrtschiff »Wilhelm Gustloff« gehörte. Im Januar 1945 durchlöchert von einem Torpedo russischer Bauart, ist es ihr Untergang mit Tausenden Toten, dem das Schiff bis heute tragische Erinnerung verdankt. Solange es bei Danzig vor Anker lag, wurden auch von dort bunte Abende gesendet und über die Volksempfänger verbreitet. Auf dem Schiff ein Publikum, das vom Krieg gezeichnet war, manche konnten auf Stühlen sitzen, andere konnten nur liegend oder in Rollstühlen den bunten Abenden folgen. Dieses dankbare Publikum fügte sich zu einem grotesken Bild, in Mullbinden verpackt und Prothesen an zerschossenen Körperteilen.
Kaum genesen, mussten sie zurück an die Front. Ihr Beifall drang über die Reichssender in die Wohnzimmer Nazideutschlands, unterlegt mit einem Musikteppich, der Hoffnung verbreiten sollte: »Ich weiß«, sang die schwedische Diseuse Zarah Leander, »es wird einmal ein Wunder gescheh’n«. Das Wunder, das Nazideutschland brauchte, wurde in Durchhaltesongs beschworen, mit den verstümmelten Kämpfern in Danzig als Chor im Hintergrund, der laut und über Radio hörbar mitsang. Hätte es schon Fernsehen gegeben, hätte jeder Kameraschwenk auf das Publikum, das sich unter weißen Verbänden an Kopf und Gliedern erkennbar mitgenommen verbarg und sich freute, vielleicht dazu beigetragen, den Krieg schneller zu beenden. Mitleid mit jenen, denen Beifall klatschen möglich war, weil ihnen beide Hände geblieben waren. Immerhin, »Lilly Marleen« wurde in den Gefechtspausen gemeinsam von Freund und Feind besungen. Es war die Nummer eins der Charts in den Wunschkonzerten der Soldatensender, gleich welcher Couleur und Sprache.
Unterhaltsame Rundfunkabende also, die davon ablenken sollten, dass die Endzeit des Nazireiches gekommen war. Nicht nur das eigene Land, halb Europa war zur zertrümmerten Hinterlassenschaft der Blitzkriege der Nazi-Wehrmacht geworden. Erobert in Feldzügen, die im Deutschen Reich bejubelt wurden. Dann kamen die Bombengeschwader der Alliierten, Rache für Coventry und London oder Rotterdam oder Stalin- und Leningrad. Es galt, für den Zivilisationsbruch des Nazireichs zu bezahlen. Aus den Ostgebieten begann die Flucht in Richtung Westen des Reiches. Der Zug aus Danzig, er rollte mit uns aus der Stadt, ehe sie von der Roten Armee eingenommen wurde. Vier Bordkarten für die letzte Fahrt des mit Flüchtlingen und Verwundeten überfüllten Kreuzfahrtschiffes »Gustloff«, für uns gebucht, blieben ungenutzt.
In Kürze feiere ich meinen 77.Geburtstag in Potsdam. Die Residenzstadt der Preußenkönige ist nun Alltag, und ich arbeite hier an meinem fünften Buch. Schlösser und Parkanlagen sind historische Kulisse und verbinden sich mit mancher Filmgeschichte, die hier gedreht wurde. Doch lässt sich bereits erkennen, dass sich erneut eine dramatische Zeitenwende ankündigt. Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht; 2015 überschritten innerhalb weniger Monate eine Million von ihnen die Grenze nach Deutschland. Ihre Ankunft spaltet das Land und lässt Ost und West wieder auseinanderdriften. Erneut entsteht auch eine erstarkende und extremistische politische Rechte. Sie nutzt und zitiert das Wörterbuch, das den Abschied der Deutschen als Kulturnation vorbereitet hat, sein Titel lautet »Mein Kampf«. Es darf wieder frei gedruckt und verkauft werden.
In Potsdam-Babelsberg haben an Sonn- und meist auch an Feiertagen in fußläufiger Entfernung von meinem Haus fünf Bäckereien geöffnet. Der Stadtteil verbreitet kleinstädtisches Flair. Doch wer Zeitung liest oder online im weltweiten Netz surft, empfindet diese Idylle vielleicht als unwirklich, als geschenkte Ruhe vor einem Sturm, der heraufzieht. Anschläge von Terrorgruppen in England, Frankreich, und erstmals in Berlin, ermunterten Reporter, Besucher von Weihnachtsmärkten als Helden des Alltags zu feiern. Die so Angesprochenen in »Tageschau« oder »heute« nickten zustimmend und gaben ihrer Entschlossenheit Ausdruck, sich von Terroristen nicht die Freude am Glühwein nehmen zu lassen. Um dann aus dem Off, im Bild groß die Helden des Alltags, die den roten, heißen Wein schlürfen und mit dem Satz verabschiedet werden, dem sie mit dem Weinglas am Mund nickend zustimmen, sich von »Terror nicht einschüchtern zu lassen«.
In Babelsberg sind erste Tropfen spürbar, die die weltpolitische Wetterwende ankündigen. Neben dem Bio-Bäcker hat ein Mann seinen Stammplatz, graues Haar, graues Gesicht, graue Jacke vor der Brust in der linken Hand hält er die Obdachlosenzeitung »Straßenfeger«. Der Mann steht etwa drei Meter neben dem Eingang eines Weberhäuschens, darin der Bäcker, der hier die besten Brötchen verkauft. Schnell reihen sich bis zu dreißig Leute vor dem niedrigen Häuschen. Der stetige Zustrom lässt die Schlange nicht kleiner werden. Mindestens zehn Minuten sind einzuplanen, bis man eintreten kann.
Im Verkaufsraum, dicht gedrängt, setzt sich die Schlange fort. Drei versierte Verkäuferinnen sorgen dafür, dass sie schnell aufrückt. Der Duft frischer Brötchen im Raum, die im hinteren Teil im modernen Ofen knusprig backen. Es sind vorwiegend Männer, die sich am Wochenende einfinden. Oft Väter oder Großväter, begleitet von ihren Kindern oder Enkeln, manchmal kaufen sie auch Kuchen für den Nachmittagskaffee. Alles bio.
Hier gibt es auch die Wochenendausgaben der Potsdamer Tageszeitungen. Aufmacher mit Schlagzeilen, die »Willkommenskultur« beschreiben oder Attacken auf Flüchtlinge oder Flüchtlingsheime, auf die Brandsätze geworfen wurden. Zeitungen, die ahnen lassen, dass die Idylle rund um das Backwaren-Paradies des Bio-Bäckers brüchig zu werden beginnt.
In Babelsberg erinnern die typischen geduckten Häuser an die böhmischen Spinner und Weber. Als evangelische Christen verfolgt, fanden sie Asyl in Brandenburg. Friedrich der Große baute für sie um 1750 die Häuser: Spitzdach, großer Garten, ein Nutztier, Kuh oder Schwein. Viele Weberhäuser stehen so fast unverändert seit 250 Jahren. Brandenburg und seine Einwanderungsgeschichte, Preußen und sein Königshaus: Seine Soldaten brauchten Uniformen. Die böhmischen Weber, Tuchmacher und Färber hatten gut zu tun. Das Toleranzedikt des Königs von Preußen garantierte jedem Neubrandenburger, nach seiner Fasson selig werden zu können.
Mit einer Laugenstange und fünf Schrippen für den Frühstückstisch verlasse ich die Bäckerei und gehe auf den Mann zu, der die aktuelle Ausgabe der Obdachlosenzeitung bereithält. Während er das Blatt herüberreicht, sagt er: »Du gut schlafen? Das gesund!« So begrüßen wir uns, freundliches Lächeln, zwei Euro von mir und von ihm die wortkarge Mahnung zur Güte meines Schlafes. Sie begleitet uns beide, seit ich mich einmal nach seinem Befinden erkundigt habe. »Wie geht’s?«, hatte ich gefragt. Ich habe zwar nicht erfahren, wie es geht, höre aber seither immer die gleiche Antwort: »Du gut schlafen?«
Der graue Mann, sichtlich erfreut über unseren Kontakt, trägt die Botschaft, dass der Blick über den Stadtteil Babelsberg hinaus in die Welt gehen sollte. Auch Potsdam will zweitausend Flüchtlinge aufnehmen. Mehr als tausend sind schon da. Die Fluchtwellen, die seit Jahren immer wieder heranrollen, haben die Außengrenzen Europas unterspült und schließlich wegbrechen lassen. Erneut werden Außensicherung und die Befestigung der Außengrenzen gefordert, statt sich der veränderten Wirklichkeit anzunehmen.
Der mit dem »Straßenfeger«, der dort jeden Sonntag steht, kam schon vor ein paar Jahren über Ungarn nach Deutschland. Seit dem Zusammenbruch des Sowjetstaates kamen in Abständen immer wieder ein paar Millionen Aussiedler zu uns. Mit dem Fall der Mauer und dem Ende der Teilung Europas war die erstarrte, in Ost und West geteilte Welt in Bewegung geraten. Menschen zog es von Ost nach West, manchmal auch umgekehrt. Sibirien, Kirgisien oder Kasachstan wurden auf der Weltkarte sichtbar, als Deutsche Volkszugehörige nach Westen aufbrachen. Ihn hatte es damals nach Deutschland verschlagen, als er halb so alt war wie jetzt. Sein Monopol als Verkäufer der Straßenzeitung in Babelsberg geht zu Ende. Ich zähle am Wochenende bereits drei neue Gesichter, die das Blatt verkaufen.
Auch in Babelsberg sind zunehmend Menschen erkennbar, die als Flüchtlinge gekommen sind. Bis sie ins Land kamen, gab es hier nur noch einen weiteren obdachlosen Mann, der durchaus zufrieden wirkt, wenn er durch das kleine Zentrum des Vorortes flaniert. Er war eines Tages einfach da, fortan gehörte er in das Viertel. Längst ist ihm ein Schlafplatz unter festem Dach angeboten, von dem er, wie es scheint, aber nur in Wintermonaten Gebrauch macht. Immer wieder ist freundlicher Umgang zu beobachten, wenn ihm mal ein bisschen Geld, mal etwas zu essen zugesteckt wird, und sich Zeit für einen Plausch findet. Er wurde sozusagen von Babelsberg adoptiert.
Im Sommer lebt er auf der nach Karl Liebknecht benannten Straße zwischen dem Fußballstadion »Karli« und dem alten Babelsberger Rathaus. Ob der obdachlose Mann von Karl Liebknecht weiß, der in Babelsberg seinen Wahlkreis hatte? Liebknecht gab 1914 eine von 14 Neinstimmen in der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion bei der zweiten Abstimmung über die Kriegskredite ab. 1919 wurde er wie Rosa Luxemburg in Berlin von rechten Freischärlern ermordet. Seitdem gilt der Stadtteil als links. »Pogida« in Potsdam, das rechtspopulistische Gegenstück zu Dresden, bekam hier keinen Stich.
Auf der Karl-Liebknecht-Straße, gut verpackt in Plastiktaschen und -tüten, parkt der Mann Hab und Gut unter einer Bank; ein Schlafsack liegt zusammengefaltet oben drauf. Sein Fahrrad mit ausgebautem Vorderrad lehnt an der Rückenlehne der Bank. Beide, der Mann mit dem »Straßenfeger« und der Obdachlose, gehören zu den Babelsbergern, die weniger sorgenfrei leben als viele, die es nach Babelsberg zieht und damit Potsdam in Brandenburg zur am schnellsten wachsenden Stadt des Landes machen.
Nur wenige Monate zuvor, als Flüchtlinge noch nicht Thema und Stadtgespräch waren, war es die Millionärsdichte in der Karl-Marx-Straße. Dort stehen die Villen einstiger Ufa-Stars der zwanziger und dreißiger Jahre. Bis heute wird über Rückgabe des ehemals auch jüdischen Besitzes verhandelt oder nach Nachkommen gefahndet, wenn die ermittelten ursprünglichen Besitzer die Nazis nicht überlebten. An einigen der bekanntesten Villen erinnern Tafeln an die Namen der Politiker der Alliierten, die nach der Kapitulation dort nächtigten und in Potsdam Hitlers Niederlage mit dem Dreimächtestatus besiegelten. Truman residierte in der Karl-Marx-Straße 2, Stalin in der Nr.27. Die Leiter der britischen Delegation wohnte in der heutigen Virchow-Straße. Später kam als Vierter im Bunde Frankreichs General Charles de Gaulle dazu. Der deutsche Trümmerhaufen wurde viergeteilt und den Alliierten Besatzungsmächten zugeordnet.
Potsdam war noch wenige Tage vor Kriegsende in der Nacht vom 14. auf den 15.April1945 Ziel britischer Bomber, die die Stadt mit ihrer tödlichen Last verwüsteten. Bis heute finden sich Blindgänger als Erbe des Zweiten Weltkrieges. Um sie zu entschärfen, werden immer wieder auf einigen Quadratkilometern Stadtgebiet zumeist einige tausend Menschen evakuiert und Altersheime oder Kliniken geleert. Die Villen am Griebnitzsee waren von Bomben weitgehend verschont geblieben. So wurden sie kurze Bleibe für Harry S.Truman oder Winston Churchill, dem noch im Juli 1945, nach verlorenen Unterhauswahlen, sein Nachfolger Clement Richard Attlee (Labour Party) folgte, und Josef Stalin, der solches nicht zu befürchten hatte. Nach dem Tag von Potsdam als Beginn des Dritten Reiches folgte nun, zwölf Jahre später, die Potsdamer Konferenz, auf der die Teilung Deutschlands beschlossen wurde.
Privater Reichtum wird heute auch in Babelsberg wieder gern zur Schau gestellt; auch am Griebnitzsee. Fünfundzwanzig Jahre nach dem fast lautlosen Ende der DDR kommen Rückkehrer aus dem Westen, die in den neuen Ländern ihren vergesellschafteten Besitz beanspruchen oder die Villen an den Seeufern aufkauften. Für die Stadtregierung Potsdams noch immer eine harte Nuss, die bislang nicht zu knacken war. Denn Dutzende von Anwälten sind damit beschäftigt und verdienen glänzend damit, für die neuen Besitzer der Seegrundstücke durchzusetzen, dass Spaziergänger keinen Zugang zum Uferweg erhalten. Die Stadtväter lernten, dass der Verweis auf das Grundgesetz, Artikel 14, wonach Eigentum verpflichte und sein Gebrauch zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen solle, nicht ausreichte, um die beliebte Wanderung an Sonn- und Feiertagen auf dem Uferweg am See weiter zu ermöglichen. In der DDR sicherten Grenzer den Uferweg, weil sie freies Schussfeld brauchten, um eine Flucht über den See nach Westen zu verhindern. Nun wird zögerlich nachgedacht, ob die im Grundgesetz erlaubte Enteignung zugunsten einer friedlichen, »dem Allgemeinwohl dienenden Nutzung« des Uferweges möglich, vielleicht sogar geboten ist.
Deutsche Geschichten der Nachwendezeit. Wer die Karl-Marx-Straße in Potsdam-Babelsberg entlangspaziert, kann hin und wieder an Gartentore genagelt oder an Zäune geheftet den Aufruf: »Freies Ufer!«, lesen. Es gab Demonstrationen am See für den freien Seezugang, bei denen gern auch »Wir sind das Volk« gerufen wurde. Erinnerung an Montagsdemonstrationen in Leipzig, ohne die die Mauer nicht gefallen wäre. Wie hätten die Menschen damals wissen sollen, als sie mutig die unblutige Revolte gegen den SED-Staat anführten, dass freier Zugang zu diesem und anderen gesperrten Seeufern nicht zur neuen Freiheit gehören sollte.
Anders damals, am 9.November1989: Ein Land konnte sich vor Freude kaum fassen: »History in the making«, auch am Grenzübergang Bornholmer Brücke in Berlin. Mit anderen dicht gedrängt, hoffte ich mit einem Team des ZDF auf Öffnung des Grenzübergangs, während die DDR-Grenzer, wie wir heute wissen, an diesem Übergang nach West-Berlin hektisch telefonierten. Sie suchten jemanden im Parteigefüge der SED, der ihnen hätte sagen können, was zu tun oder zu lassen sei. Ob oder wie sie sich dem Ansturm von Menschen und Trabis entgegenstellen sollten, die auf den Übergang zuhielten. Sie blieben ohne Antwort und machten auf. Sie hatten früher als andere wohl die Ahnung oder doch das sie anwehende Gefühl, die SED sei dabei, abzudanken.
Am selben Abend, als der Sprecher des Politbüros Günter Schabowski vor der internationalen Presse in Ost-Berlin diesen hingestotterten Satz verlieren sollte, der dann als Endlosschleife in die Abendprogramme von Hörfunk und Fernsehen geriet, dass »die Öffnung der Grenzen der DDR – wohl sofort (…) Reisefreiheit unverzüglich (…)«, und als gestammeltes Satzgefüge die Welt veränderte. Eine Erinnerung, die schnell verblassen sollte. So wie am Griebnitzsee der freie Uferweg, wo Anwaltskanzleien in Marsch gesetzt werden, um Eigentumsrechte durchzusetzen.
Gegen Mitternacht, am 9.November1989, waren die Grenzbäume hochgegangen, wurde der Grenzübergang freigegeben und wenige Monate später gab es die DDR nicht mehr. Schabowski und die Grenzer an der Bornholmer Brücke hatten Geschichte geschrieben. Sie hatten Anteil daran, dass Ossis und Wessis diese Nacht zum Tag machten. Der Zauber, der vom Fall der Mauer und dem Ende der Teilung ausging, hielt noch eine Weile. Davon ist nicht nur am Uferweg des Griebnitzsees nicht mehr viel zu spüren.
Es dauerte wenige Jahre, bis die Sparkonten eins zu eins in D-Mark umgewandelt waren, die Einheit als Sturzgeburt vollzogen war, die Sanierung der verfallenen Innenstädte in Gang gesetzt und der Solidarpakt Aufbau Ost unterschrieben war. Dann setzte Ernüchterung ein. Die letzten Brocken des antifaschistischen Schutzwalls, die Mauerspechte aus der Mauer gebrochen hatten, waren an Touristen verhökert, und die Erinnerung an die DDR wurde nostalgisch.
Unser Leben am Rande des Babelsberger Schlossparks, mit Sabine, meiner Frau, und Sohn Tom, von Weberhäuschen umgeben, die dem Viertel das Gesicht geben, in einer Stadt, die manches Mal erkennen lässt, dass Potsdam lange Kaderschmiede der DDR war. Wenige Minuten joggen zum Tiefen See, an dessen Ufer sich der nach englischem Vorbild angelegte Landschaftspark und das Babelsberger Schloss im Tudorstil vermählen, heute Teil des UNESCO-Welterbes. Zu DDR-Zeiten standen hier Mauer und Park unter strenger Bewachung, das Ufer war nicht zugänglich.
Heute kommen Schloss und Park Schritt für Schritt wieder dem nahe, was die berühmten Architekten und Gartengestalter Schinkel, Lenné und Pückler-Muskau vor knapp 180 Jahren entworfen haben. Ein Park, der mit Wasserspielen, Brunnen, künstlich angelegten Bächen und kleinen Seen kunstvoll angelegt war, und ein Schloss, dessen Außenhaut wieder erneuert ist und dessen Innenleben gerade restauriert wird. Mehr und mehr kommen Park und Schloss zurück auf Anfang.
Ein Wohn- und Lustschloss, das erneut zum Einzug einzuladen scheint, wie 1837, als es von Prinz Wilhelm, seit 1861 Wilhelm I., König von Preußen, und seiner Frau Augusta in Besitz genommen wurde. Der König wurde Jahre später höchst unwillig, nach der französischen Niederlage von 1871, in Versailles zum Kaiser des neu gegründeten Deutschen Reiches gekrönt. 1918 die Revanche, als dem Deutschen Reich die Kriegsfolgelasten des verlorenen Ersten Weltkrieges diktiert wurden. Weitere fünfzehn Jahre später brach der »Tag von Potsdam« an, als Nazis und das alte Preußen mit Handschlag das Dritte Reich begrüßten und Reichspräsident Hindenburg dem Reichskanzler Hitler seinen Segen gab. Zwölf Jahre später die Konferenz der Sieger in Potsdam. Hier ist Geschichte ganz nah. In dieser Kulisse wurde der Dramatiker Peter Weiss 1916 geboren. Ein halbes Jahrhundert später brachte er »Die Ermittlung« auf die Bühne, für die er die originalen Protokolle der Auschwitzprozesse zur Grundlage machte und den millionenfachen Mord der Nazis an den europäischen Juden dramatisierte. Damals stand das Stück in Westdeutschland am Anfang wachsender Scham über beispiellose deutsche Verbrechen.
Heute ist Babelsberg wieder Filmstadt, Teil der Landeshauptstadt Potsdam, die sich neu erfindet. Für manchen ist Potsdam der Vorgarten von Berlin, jedenfalls die am schnellsten wachsende Stadt in Brandenburg. Über 170000 Einwohner sind es heute, die Prognose weist weiter nach oben. Der ungebrochene Zuzug zumeist junger Familien sorgt dafür, dass jedes Grundstück bebaut, jeder Dachboden und jede Remise in Wohnraum verwandelt wird. Die zu DDR-Zeiten dahinsiechende Altstadt wurde restauriert, die Fassade des im Krieg teilzerstörten und 1959/60 gesprengten und abgerissenen Stadtschlosses steht wieder und bildet als neuer Landtag in alter Schönheit den Kern des wieder entstehenden alten Zentrums.
In Potsdam und in Babelsberg sind die Flüchtlinge im Alltag kaum auszumachen, nur für jene, die genauer hinschauen. Wie zu erwarten, sind eine Million Einwanderer oder Asylsuchende in einem Land mit 84 Millionen Einwohnern nicht so viel. Anzutreffen sind sie eher in den Warteräumen in Stadt und Land, in Schulen und Orten der Erwachsenenbildung, wo sie die Sprache lernen, die ihnen der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben im neuen Land werden soll.
Die Bilder in den digitalen Erlebnisräumen im Internet oder im Fernsehen schienen über Monate jeden Tag von nicht enden wollenden Menschenströmen zu erzählen. Angstmacherei und Hetze gegen alles Fremde haben Konjunktur. Überfremdungsängste, durch Fernsehbilder in den Nachrichten verstärkt, die bei vielen Menschen die Neigung zu gewalttätiger Abwehr aufkommen lassen. Angeheizt von rechtsextremen Verführern, stellen sich Junge und Alte denen entgegen, die durch die Hölle gehen mussten und hier auf Asyl und Sicherheit für ihre Familien hoffen. Hass und Verachtung, mit dem Vokabular der Straße oder aus dem Wörterbuch des »Nationalsozialistischen Untergrundes« abgeschrieben, an Hauswände geschmiert. So wird das »christliche Abendland« tatsächlich enteignet. Gäbe es nicht so viele, die dem nicht folgen wollen, es wäre nicht mehr mein Land. Was ist passiert, seit ich erleichtert die fröhliche Bereitschaft freiwilliger Helfer beobachten konnte und am Hauptbahnhof in München »Refugees welcome« prangte? Wie ist zu erklären, dass nicht die Überzeugung geblieben ist, der daraus erwachsenden Probleme Herr zu werden, sondern zunehmend Kleinmut, Abwehr und Bösartigkeit die öffentliche Debatte zu bestimmen begannen? Was bricht sich da erneut Bahn, was treibt Menschen an, das Netz mit Hassmails zu bestücken und den Flüchtlingen den Tod zu wünschen und im digitalen Netz den Satz zu schreiben: »Die Gleise nach Auschwitz liegen noch.«
Wo ist der Zusammenhang zwischen der Fremdenfeindlichkeit, wenn auch nicht nur, aber doch besonders sichtbar in Sachsen und Thüringen, und der kalten Abwehr des katholischen Polens, sich denen auszusetzen, die aus den zerbombten Städten Syriens fliehen und um Asyl bitten? Gemeinsames Erbe im abgeschotteten Osteuropa? Rechter Populismus auch in Westeuropa beginnt das grenzenlose Europa zu zerreißen. Großbritannien hisst die nationale Flagge und verlässt die Europäische Union.
Wer sind die Wutbürger in Dresden, die mit Tausenden anderen »Lügenpresse« skandieren? Oder Aufforderungen, das Schussfeld gegen Flüchtlinge an den Grenzen frei zu machen. Was lässt sich ablesen an dem Hass, der sich im Netz überschlägt? Was haben die Nachkriegsgenerationen versäumt, was blieb ungesagt? Was wurde vernachlässigt, als es darum ging oder doch gehen sollte, dem »Nie wieder« Statur zu geben? Fragen, die sich meinem Sohn, gerade im sechzehnten Lebensjahr, und den Enkeln stellen, die Antworten erwarten. So sitze ich in Babelsberg vor meinem Computer und frage nach, wo sich in meinem Leben Antworten finden lassen, auch im Zwielicht deutscher Geschichte.
2. … und nichts verschweigen
Der Taxifahrer hatte mich freundlich, aber auch ein wenig mitleidig angesehen. Er hatte mir Glück gewünscht. Ihm war anzusehen, dass er zu meinen Vaterfreuden wenig Zutrauen entwickelte. »Selten zu früh und nie zu spät«, lachte ich die eigene Besorgnis weg. Sein gemurmeltes »Bisschen spät, was?« hörte ich dennoch. Es hallte nach. Aber ich hatte vorher gewusst, dass ich künftig eher für den Großvater meines Sohnes gehalten werden würde. Allerdings stellte Tom die Sache immer richtig. Seine energische Korrektur: »Das ist mein Papa«, war mir seit seinem dritten Lebensjahr sicher. Die Klarstellung kam immer prompt und ohne Einschränkung. Erschrockene Entschuldigungen nahm er gar nicht wahr.
Ich stand am Eingang der Frauenklinik in Hannover, bezahlte das Taxi und nahm die Reisetasche, die mit Lektüre, Saft und Schokolade gefüllt war, und den Blumenstrauß. Im zweiten Stock am Bett von Sabine packte ich aus, suchte nach einer Vase. Und sofort war ich wieder eingehüllt von dem Gefühl großer Nähe zur Mutter unseres Kindes. Für sie und das Kind waren es Stunden harter Arbeit, bis Tom endlich mit warmem Wasser abgerieben und in ein flauschiges Tuch gehüllt, in ihre Arme gelegt werden konnte. Und ich? Ich suchte nach Taschentüchern, in die sich schluchzend und lachend unsere Freudentränen ergossen. Ich war bei der Geburt dabei und erlebte damit auch den Moment, in dem alle Spannungen abfallen: Das Kind ist da, gesund und wunderschön, späte Mutter und noch späterer Vater – alles geschenkt.
Dennoch hatte mir die späte Vaterschaft vor der Geburt schlaflose Nächte bereitet. Wie lange kann, darf, werde ich ihn und seine Mutter begleiten, war ich der eigenen Endlichkeit wieder näher gekommen? Also die Zigarette ausdrücken und in die Gewissheit verpacken, disziplinierter Nichtraucher zu werden. Es gelingt. Mit Toms Geburt verlängert sich als Nichtraucher mutmaßlich auch mein Leben, jedenfalls aber erweiterte es sich. Im Kindergarten, später in der Schule, öffnete Tom die Türen zu Menschen und Generationen, denen ich ohne ihn wohl kaum begegnet wäre.
Im Blick zurück auf die Zeit um Toms Geburtstag wird mir bewusst: Im November 2002 war alles schon erschreckend sichtbar, was ihn und uns alle begleiten sollte an Unruhe und Zwietracht und Schrecken und Krieg in der Welt. Dreizehn Jahre später organisiert er sich selbst den »sozialen Tag«, den er als Schüler in der siebten Klasse abzuleisten hat. Er suchte den Kontakt zu einer Flüchtlingsunterkunft. Ich gebe zu, dass ich berührt war und auch ein wenig stolz, als er uns mitteilte, er möchte sich an diesem Tag in einem Flüchtlingsheim nützlich machen.
Dann denke ich immer wieder zurück an die Zeit, als ich ungefähr in seinem Alter war, noch zeitlich ganz nah dem braunen Desaster. Also will ich schreibend versuchen, die Haltestellen der Nachkriegszeit noch einmal aufzusuchen, an denen ich damals genauso fragend stand und vergebens auf zufriedenstellende Antworten wartete. Vielleicht kann ich durch die Jahre meines Lebens pflügend erkennen, wo der Versuch meiner Generation offenbar zu früh endete, eigene Wege zu finden, die in eine friedliche Welt führen? Ist auch meine Generation gescheitert nach dem großen Krieg? Ob dafür ein Buch reichen wird?
Meine Erzählung beginnt ein Jahr vor Toms Geburt in New York, als die Welt aus den Fugen geriet: Flugzeuge, die in das World Trade Center gelenkt wurden und es zum Einsturz brachten. Ein Sturzflug zweier Passagierflugzeuge, gesteuert von terroristischer Verblendung, die keiner ihrer Passagiere und kaum einer in den Türmen des berstenden Wolkenkratzers überlebt. In den zerstörten Büros und vor den in der Brandhitze verformten und zerstörten Computern hatten New Yorks Finanzjongleure zuvor täglich Kurs auf die Börsen der Welt genommen. Fast zeitgleich der Angriff auf das Pentagon in Washington. Auch hier war ein Passagierflugzeug als Waffe in das Gebäude gelenkt worden. Massenmord an etwa dreitausend Menschen: der 11.September2001. Ein Tag, der die Welt veränderte. Oder brach sich nur Bahn, was sich längst angekündigt hatte?
Vor der New Yorker Börse in der Wallstreet die berühmte Skulptur des schnaubenden Bullen, ein kraftstrotzendes, stiernackiges Geschöpf. Als ich drei Jahre später als Diplomat in New York war, spazierte ich irgendwann mit dem kleinen Tom durch das Finanzviertel. Beeindruckt und zugleich staunend saß er müde unter dem Stier, unter dem Abbild dessen, was von hier ausgehende Kapitalströme anrichten können: gewaltige Gewinne oder gewaltige Verluste, die ganze Staaten in die Pleite reißen können.
Drei Tonnen bronzene Muskelmasse, spiegelblank geputzt, geschaffen von dem aus Sizilien stammenden, in New York lebenden Bildhauer Arturo Di Modica. Er hatte ihn über Nacht mit Hilfe eines Gabelstaplers vor die Börse gesetzt und das ohne Genehmigung der New Yorker Stadtverwaltung. Seitdem streicheln täglich Hunderte Hände den Leib des Urviechs blank, in dem sich die Börse spiegeln kann. Die Unterstützung der Stadtbevölkerung für seinen Verbleib an diesem Standort war massiv und erfolgreich. Keine andere Entscheidung wäre von den New Yorkern akzeptiert worden.