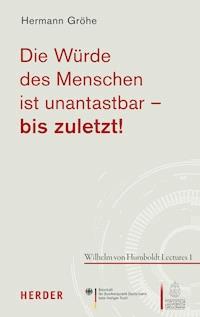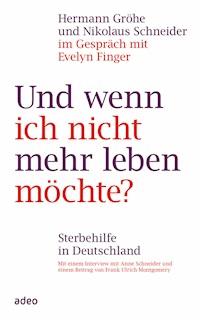
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: adeo
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Und wenn ich nicht mehr leben möchte, was dann?" Diese Frage beschäftigt viele Menschen und befeuert die aktuelle Debatte. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe lehnt jede organisierte Beihilfe zur Selbsttötung entschieden ab: "Unsere Rechtsordnung verpflichtet uns, Leben und Würde der Menschen zu schützen. Der Patientenwille gilt. Beihilfe zur Selbsttötung darf aber niemals Behandlungsvariante werden. Notwendig ist vielmehr der Ausbau der Palliativ- und Hospizversorgung." Auch Nikolaus Schneider hat als Theologe eine klare Meinung zum Thema: "Die Entscheidung über Leben und Sterben liegt nicht in unserer Hand - Gott hat in dieser Frage das letzte Wort." Damit schließt auch er die Hilfe zur Selbsttötung aus. Aber seine Frau Anne ist an Krebs erkrankt und er hat ihr versprochen, dass er sie in die Schweiz begleitet, wenn sie nicht mehr leben und Selbsttötungshilfe in Anspruch nehmen möchte. Auch wenn es seiner Überzeugung widerspricht. Er kann sie nicht alleine lassen - denn am Ende zählt für ihn nur die Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Und wenn ich nicht mehr leben möchte … was dann?
Hermann Gröhe und Nikolaus Schneider im Gespräch mit Evelyn Finger
Interview mit Anne Schneider
Wir brauchen keine Sterbehelfer – schon gar keine organisierten
Und wenn ich nicht mehr leben möchte … was dann?
Über das eigene Lebensende nachzudenken, liegt vielen fern. Es geht uns ja momentan gut, warum soll man sich dann mit derartigen Fragen beschäftigen? Ohnehin kann man nicht voraussehen, wie viel Zeit einem selbst noch bleibt.
Immer wieder erleben wir in unserem Umfeld, dass Menschen eine schlimme Diagnose bekommen: „Krebs“, „Alzheimer“, „MS“, um nur einige zu nennen. Begriffe, die uns erschaudern lassen. Vielleicht hat der eine oder andere auch schon am Bett eines Sterbenden gestanden und miterlebt, wenn die letzten Tage und Stunden anbrachen.
Wie wäre es, wenn ich selbst der- oder diejenige wäre, der plötzlich mit massiven Gesundheitsbeeinträchtigungen leben müsste? Wenn ich wüsste, dass ich mich in absehbarer Zukunft nicht mehr bewegen kann. Dass die Erkrankung, die man mir diagnostiziert hat, mit heftigen Schmerzen verbunden ist. Oder dass ich alles, was mir gesagt wird, oder was sich ereignet, gleich wieder vergessen habe. Wenn man mir prophezeit, dass ich irgendwann sogar meine Lebenspartnerin oder meinen langjährigen Ehemann nicht mehr erkenne. Dass wir beide jedenfalls die lange erwartete Rente nicht mehr zusammen genießen können. Das wäre schrecklich.
Würde ich mich in einer solchen Situation danach sehnen, mein Leben zu beenden, einfach Schluss zu machen? Wie könnte das gehen? Müsste ich mir dabei vielleicht sogar helfen lassen? Und wenn ja, von wem? Oder ist dies keine Option?
Was würden meine Angehörigen, meine Freunde zu solchen Überlegungen sagen? Würden sie mich verstehen? Würden sie mir helfen?
Und was wäre, wenn mich mein Partner, meine Freundin, mein Sohn oder meine Tochter darum bittet, ihm oder ihr beim Sterben zu helfen? Kann es ein Ausdruck von Zuneigung und Liebe sein, wenn ich einem Menschen, der danach verlangt, einen Becher mit einem Giftcocktail ans Bett stelle? Darf man jemandem einen derartigen letzten Wunsch abschlagen? Oder muss man es sogar?
Denn die Frage ist: Haben wir Menschen überhaupt das Recht dazu, uns zum Herren über Leben und Tod zu machen? Was sagt der Gesetzgeber dazu – und welche Perspektiven bietet in dieser Frage der christliche Glaube? Wie sieht es die Kirche?
Nikolaus Schneider, der viele Jahre innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland eine Führungsrolle innehatte, stand selbst schon mehrmals vor solchen existenziellen Fragen. Viele sterbende Menschen hat er als Seelsorger begleitet, ihnen zugehört oder die Hand gehalten.
Seine Frau Anne und er blieben von Leid nicht verschont: Schon früh verloren die beiden ihre Tochter Meike. Sie starb im Alter von 22 Jahren an Leukämie.
Dann erkrankte vor einem Jahr Anne Schneider an Krebs in einer besonders aggressiven Form. Und es wurde beiden sehr schnell klar: es kann sein, dass wir nicht mehr viel Zeit zusammen haben.
Der Rücktritt von Nikolaus Schneider von allen kirchlichen Ämtern hat viele überrascht. Mehr noch, dass er durch ein Interview in der Zeitung DIE ZEIT die Diskussion über Sterbehilfe mit seiner Frau öffentlich machte. Anne Schneider machte damals eindeutig klar: Wenn ich unter unheilbaren und unerträglichen Schmerzen leiden muss, werde ich Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Eine Position, die für Nikolaus Schneider nicht mit seinem christlichen Glauben vereinbar ist. Für Anne Schneider schon. Dennoch hat er ihr in dieser Situation versprochen, am Ende bei ihr zu bleiben, wenn sie sich beim Sterben helfen lassen will – um der Liebe willen.
Hermann Gröhe hat als Bundestagsabgeordneter, als Bundesgesundheitsminister und als Christ ebenfalls eine profilierte Meinung zum Thema. Für ihn ist klar, dass der Gesetzgeber tätig werden muss. Dass man das Feld nicht gewerbsmäßig organisierten Sterbehilfevereinen oder Ärzten überlassen kann, die Selbsttötungshilfe geschäftsmäßig anbieten.
In diesem Buch stellen sich Hermann Gröhe und Nikolaus Schneider den Fragen von Evelyn Finger (DIE ZEIT), die – unter bestimmten Voraussetzungen – zu den Befürwortern von Sterbehilfe gehört.
Am Ende kommt auch Anne Schneider im Gespräch zu Wort. Und der Vertreter der Deutschen Ärzteschaft, Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery macht klar, wie er die Sachlage sieht. Dass Ärzte für das Leben eintreten – und wo die Grenzen zu sehen sind, wenn es gilt, Menschen beim Sterben zu begleiten.
Ein Buch, das einlädt, sich zu den existenziellen Fragen des Lebens und Sterbens eine eigene Meinung zu bilden.
Hermann Gröhe und Nikolaus Schneider im Gespräch mit Evelyn Finger
Herr Schneider, Sie sind entschiedener Gegner des assistierten Suizids. Welches Argument für die Sterbehilfe finden Sie dennoch überzeugend?
Nikolaus Schneider: Als Gemeindepfarrer habe ich viele Menschen beim Sterben begleitet. Dabei hat mich am meisten bewegt, wenn Sterbende so heftige Schmerzen litten, dass sie einfach nicht mehr leben wollten. Das waren Gott sei Dank Ausnahmen, aber in solchen Fällen hatte ich volles Verständnis dafür, wenn einer sagte: Ich bestehe nur noch aus Schmerz; diesen Zustand kann ich nicht länger ertragen; ich will, dass er beendet wird.
Hat die Not der Sterbenden Sie dazu gebracht, dass Sie nicht nur den Sterbewunsch akzeptieren konnten, sondern auch die Bitte um Sterbehilfe?
Nikolaus Schneider: Wenn ich solches Leid erlebt habe, war ich auch als Pfarrer mit meinen Argumenten am Ende. Als Christ kämpfe ich bis zum Schluss für das Leben und darum, dass auch das Sterben als gutes Leben erlebt werden kann. Und auch in schwierigsten Lebenslagen habe ich immer darum gerungen, dass sterbewillige Menschen ihren Lebenswillen, ihre Freude am Leben wiedergewinnen. Aber in einigen harten Ausnahmefällen bin ich dann doch stumm geblieben, wenn die Bitte um Sterbehilfe ausgesprochen wurde.
Aus Mitleid?
Nikolaus Schneider: Und aus Barmherzigkeit. Aber auch, weil ich mit meinen Argumenten am Ende war. Was soll ich noch sagen, wenn jemand das Leben buchstäblich nicht mehr erträgt? Einen Menschen in einer solchen Situation nicht ernst zu nehmen, wäre für mich unchristlich.
Ihre krebskranke Frau hat sich gewünscht, dass Sie ihr notfalls beistehen, wenn sie Sterbehilfe braucht. Da sie selbst Theologin ist, argumentiert sie auch theologisch. Überzeugt Sie das?
Nikolaus Schneider: Meine Frau und ich sind uns in dieser Frage nicht einig, wir streiten darüber seit Langem. Sie hat vor allem ein Argument, mit dem ich mich wirklich rumschlage und das zu widerlegen mir bisher nicht gelungen ist. Sie sagt: „Das Leben ist für mich nicht nur Leben auf dieser Erde. Ich glaube an die Auferstehung, und das relativiert meine Zeit im Diesseits. Gott hat mir das Leben geschenkt, aber ich darf das Geschenk des Lebens auch an Gott zurückgeben, denn ich gehe fest davon aus, dass das nicht das Ende ist.“
Dem stimme ich im Grundsatz zu. Und doch kann ich den Suizid nicht befürworten. Denn ich meine: Menschen sollen das Geschenk des Lebens nicht eigenmächtig an Gott zurückgeben.
Herr Gröhe, sind Sie auch schon einmal in Zweifel geraten, ob Sterbehilfe nicht doch akzeptabel ist?
Hermann Gröhe: Wer wollte Schwerstkranken und Sterbenden nicht helfen! Meint Sterbehilfe Begleitung im Sterben – medizinisch, pflegerisch, seelsorglich – so bin ich unbedingt dafür, hier unsere Anstrengungen deutlich zu verstärken. Meint man aber Hilfe zum Sterben – Tötung auf Verlangen oder Hilfe zur Selbsttötung – lehne ich dies ab. Aber natürlich kenne auch ich Fälle schwersten Leids, die mich ganz leise werden lassen. Stets muss es um bestmögliche Hilfe gehen. Normen allein reichen nicht aus!
Und dennoch sind Sie als Abgeordneter auch für das Setzen von Normen zuständig. Was sagen Sie denjenigen Bürgern, die über ihr Ende selbst bestimmen wollen?
Hermann Gröhe: In unserer freiheitlichen Rechtsordnung ist das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen ein ganz starker Punkt. Deshalb kann ein Patient einer Therapie seine Zustimmung verweigern oder ihren Abbruch verlangen, verbindliche Vorgaben in einer Patientenverfügung machen oder eine Vertrauensperson mit einer Vorsorgevollmacht zu entsprechenden Entscheidungen ermächtigen. Auch ist die Selbsttötung straffrei – und damit auch der Versuch oder eine Beihilfehandlung.
Etwas ganz anderes aber ist das Verlangen, von einem anderen getötet zu werden.
Das heißt, Sie lehnen Tötung auf Verlangen ab?
Hermann Gröhe: Tötung auf Verlangen ist bei uns strafbar. § 216 Strafgesetzbuch regelt das, seit ein einheitliches Strafrecht in Deutschland gilt, also seit 1872.
Und es gibt keine parlamentarische Initiative, die dies ändern will. Ein ganz starker Konsens ist das! Wohin Aufweichungen in dieser Frage führen, sieht man in den Niederlanden und Belgien. Dort ist die aktive Tötung eines Menschen nicht mehr nur aufgrund des ausdrücklichen Willens eines erwachsenen Menschen möglich, sondern auch aufgrund eines von anderen angenommenen, sogenannten mutmaßlichen Willens oder aufgrund der Entscheidung von Minderjährigen.
Und aus den Niederlanden wird berichtet, dass es sogar zur aktiven Tötung schwerstbehinderter Neugeborener kommt.
Da unterstellen gesunde, leistungsstarke Menschen: Wenn dieses behinderte Kind einen Willen formulieren könnte, müsste es der sein, getötet zu werden, um sich – und seinen Angehörigen?! – das absehbare Leid durch seine Behinderung zu ersparen. Ich will Leiden, Schmerzen und Belastungen nicht verharmlosen, aber wenn wir das zum Gradmesser darüber machen, ob das Leben eines anderen noch lebenswert ist – da kommen wir auf eine sehr abschüssige, gefährliche Bahn.
Aber Selbstbestimmung ist ein hoher Wert in unserer Demokratie.
Hermann Gröhe: Das habe ich ja selbst betont. Dies gilt für unsere Rechtsordnung, aber auch für mich ganz persönlich. Aber zum einen zeigt die Entwicklung in den Niederlanden und Belgien, wie aus dem Ruf nach mehr Selbstbestimmung das Recht zur Entscheidung durch andere werden kann.
Zum anderen bleibt im Hinblick auf die Selbsttötung die Frage, ob aus dem Selbstbestimmungsrecht ein Anspruch auf Umsetzungshilfe durch die Gesellschaft folgt oder ob die Gesellschaft nicht stets die Auswirkungen auf andere mitbedenken muss.
Nicht zufällig führen wir diese Debatte gerade in Ländern, deren Rechtsordnung immer stärker vom Einzelnen her interpretiert wird. Insofern erleben wir einen Streit, der typisch ist für unsere westliche Zivilisation.
Was ist dieses Typische?
Hermann Gröhe: Das Denken vom Einzelnen her und von seiner persönlichen Freiheit. Und das finde ich richtig. Diese Wertschätzung des Einzelnen kommt ja, wenn ich das als Christ anmerken darf, ganz wesentlich vom Christentum her: Jeder ist für Gott wichtig, nicht erst das Kollektiv – ob Volk oder Kirche. Dieser Gedanke findet sich im Grundgesetz wieder: Jeder Mensch hat eine unabsprechbare Würde, unabhängig von seinem Geschlecht, seiner Gruppenzugehörigkeit, seiner Leistungsfähigkeit – wir werden sicher darauf noch zurückkommen. Dieses Denken vom Einzelnen her hat zu einer weltanschaulichen Vielfalt geführt. Das heißt im Hinblick auf die Medizin und ihre immer weiter fortschreitenden Möglichkeiten: Wir streiten im „Westen“ verstärkt über Gesetze, die die Selbstbestimmung gerade in der letzten Lebensphase sichern sollen. In anderen Kulturkreisen hat der Gedanke der Autonomie des Einzelnen nicht dieses Gewicht.
Herr Schneider, Sie haben sich gegen ein Amt und für einen Menschen entschieden – für Ihre Frau Anne. Und Sie haben diese Entscheidung öffentlich damit begründet, dass sie vom Ratsvorsitz der Evangelischen Kirche vorzeitig zurücktreten wollen, um Ihre krebskranke Frau zu begleiten. Das war im Sommer 2014. Wie ist es Ihnen seither ergangen?
Nikolaus Schneider: Ich war letzten Sommer als pensionierter Pfarrer und Präses „nur“ noch ehrenamtlich als Ratsvorsitzender der EKD tätig. Mein vorzeitiger Rücktritt von diesem Amt hat uns also keine finanziellen Probleme bereitet. Allerdings haben sich mein Lebensstil und mein Lebensalltag seither ziemlich verändert. Und ich kann sagen: Auch wenn ich es gelegentlich bedauere, öffentlich nicht mehr so viel „mitzumischen“, genieße ich die gewonnene Zeit für mich selbst, für meine Kinder und Enkel, aber vor allem für eine erfüllte Zweisamkeit mit meiner Frau. Der Zeitpunkt des Rücktritts war genau richtig gewählt: Es gab danach einige schwierige Phasen bei der Chemotherapie. Es war einfach gut, dass ich in dieser Zeit ganz für meine Frau da sein konnte und es keine Konkurrenz dienstlicher Termine gab. Und heute ganz wichtig: Bei meiner Frau ist zurzeit kein Krebs mehr nachweisbar. Chemotherapie, Operation, Bestrahlungen und auch die Gebete vieler Menschen haben uns die Aussicht auf noch einige gute gemeinsame Jahre geschenkt. Damals, im Sommer 2014, haben wir sehr viel Respekt und Zustimmung erfahren – auch für unsere unterschiedlichen Positionen zur Sterbehilfe. Wir hatten auch in den Jahren vor der Krebserkrankung meiner Frau nie verschwiegen, dass wir in dieser Sache nicht ganz einig sind.
Aber Sie haben Ihrer Frau versprochen, ihr im Notfall Sterbehilfe zu ermöglichen, das heißt, sie in die Schweiz zu begleiten – trotz Ihres eigenen theologischen Vorbehalts. Das hat eine Debatte in ganz Deutschland ausgelöst. Ihnen wurde vorgeworfen, von der offiziellen Position der EKD abzuweichen.
Nikolaus Schneider: Zunächst mal: Meine Frau und ich beurteilen einige Aspekte der Sterbehilfe theologisch und politisch unterschiedlich. Und diese theologischen und politischen Unterschiede haben wir in der Debatte durchgehalten – auch um deutlich zu machen, dass es nicht nur eine einzige mögliche christliche Position zu dem Thema gibt. Und dafür waren uns viele Kirchenmitglieder dankbar, das haben wir gespiegelt bekommen. Es gab aber auch die Kritik, mein öffentliches Versprechen, Anne zu begleiten, sei nicht hilfreich gewesen, weil ich die Position der EKD verwässert hätte. Das war höflich formuliert. Auf gut Deutsch hieß es: Was ich zur Sterbehilfe für Anne gesagt habe, stellt die gebotene christliche Positionierung infrage und verwirrt gläubige Menschen. Wir hätten also beide besser geschwiegen.
Und, hätten Sie?
Nikolaus Schneider: Natürlich nicht. Unser christlicher Glaube gibt uns keine ewig gültigen, eindeutigen und fraglosen Rezepte für Lebenskrisen und existenzielle Probleme. Den Wunsch danach kennen wir auch aus unserem persönlichen Leben. Dieser Wunsch ist bei einem solchen Thema ja auch nicht verwunderlich. Wenn es um Tod und Sterben geht, ist jeder Mensch früher oder später betroffen.
Viele befassen sich ungern mit den Themen „Tod und Sterben“, weil sie die nicht eindeutig und klar zu beantwortenden Fragen vermeiden wollen: Wie stelle ich mir mein eigenes Sterben vor? Wie wird das sein, wenn es mit mir zu Ende geht? Wie bereite ich mich darauf vor? Wie will ich sterben?
Trotzdem bleibt irdische Vergänglichkeit unser unausweichliches Schicksal. Jeder muss sterben. Und viele erleben im Laufe ihres Lebens das Sterben anderer: Bekannte, Arbeitskollegen, gute Freunde, entfernte Verwandte und Menschen, die einem sehr nahestehen – etwa die eigenen Eltern. Das Thema hat also großes emotionales Potenzial. Für eine Reihe von Menschen schwingt bei der Begegnung mit dem Tod Unverarbeitetes, Traumatisches mit. Anne und ich lösen also einiges aus und treffen auch auf Blockaden, wenn wir unser Sterben öffentlich thematisieren. Deshalb hat es mich auch nicht gewundert, dass es eine Diskussion gab. Die Heftigkeit, mit der sie geführt wurde, hat mich aber schon ein bisschen gewundert.
Und im Nachhinein, wie war das für Sie? Belastend oder entlastend?
Nikolaus Schneider: Ich finde es gut, dass wir uns mit diesem existenziellen Thema öffentlich und auch emotional auseinandersetzen. Wohltuend war an der öffentlichen Debatte, dass sie sehr ernsthaft geführt wurde: Sie war von gesprächsverhindernden Polemiken oder gar gesprächsvernichtenden Spitzen weitgehend frei.
Eine engagierte Debatte mit Gesprächspartnern, die den anderen ernst nehmen, mit Menschen, die auch ethisch oder theologisch begründet argumentieren – das finde ich wichtig, sinnvoll und gut. Über solchen Streit freue ich mich: wenn wir den Andersdenkenden nicht niedermachen, nicht polemisieren, sondern stattdessen bereit sind, genau hinzuhören. Und dabei auch Neues zu lernen.
Bitte sagen Sie doch noch etwas zu einigen konkreten Vorwürfen: In Internetforen gab es zum Beispiel die wiederkehrende Kritik, die private Abweichung von Ihrer prinzipiellen Überzeugung als Theologe sei typisch kirchliche Heuchelei. Also: Die moraltheologische Linie bleibt unangefochten, aber für sich selber, privat, hätte man es doch gerne anders.
Nikolaus Schneider: Das ist ein unsinniger Vorwurf, weil ich als Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland immer eine eigenverantwortlich handelnde Persönlichkeit bleibe. Und weil Anne und ich, sosehr wir beide auch über die Jahre unserer Ehe zusammengewachsen sind, in unseren ethischen und theologischen Positionen eigenständig bleiben. Es gehört nicht zu den Aufgaben eines Ratsvorsitzenden, seine Familienangehörigen auf seine eigenen theologischen Positionen festzulegen bzw. zu verpflichten. Heuchelei wäre es, wenn ich trotz meiner ablehnenden Haltung gegenüber Suizid und Suizidbeihilfe um das Gift oder um die Spritze für mein eigenes Sterben bäte. Insofern ist dieser Vorwurf, dass ich im Sinne meines Amtes anders denken und handeln müsste, völlig daneben.
Haben Sie Ihre Position angesichts der Diagnose Ihrer Frau wirklich gar nicht geändert?
Nikolaus Schneider: Ich habe schon immer gesagt: Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was ich als Theologe für mein eigenes Leben als richtig erachte und dem, was ich bereit bin als Seelsorger oder Begleiter für andere zu tun. Das ist eine Lebenshaltung, die aus meiner Sicht in der Seelsorge geboten ist.
Generell gilt: Im Zusammenleben mit anderen Menschen sind wir über so vieles verwundert oder irritiert. Manche Überzeugungen Dritter lehnen wir strikt ab – aber deshalb würden wir doch den Menschen nicht ablehnen. Das ist Toleranz: den anderen in seinem Anderssein zu respektieren ohne eigene Überzeugungen zu verleugnen. Das kann anstrengend sein. Und wenn dann eine berechtigte Anfrage, eine ernsthafte Infragestellung meiner Prinzipien auf mich zukommt, muss ich mir über meine Wertentscheidungen neu klar werden. Ich muss meine Begründungen auch um der Gemeinschaft mit anderen willen immer wieder selbstkritisch hinterfragen: Halten sie stand?
Offensichtlich haben Ihre Gründe gegen die sogenannte „Hilfe zur Selbsttötung“ nicht standgehalten, als die Bitte Ihrer Frau um Begleitung kam.
Nikolaus Schneider: Doch, das haben sie im Blick auf meine eigene Person und auf meinen Widerspruch gegen den Rechtsanspruch eines Menschen auf „Hilfe zur Selbsttötung“. Aber Ethik ist eben keine Mathematik. Da gibt es keine endgültige Formel, die Wahrheit garantiert. Nach dem Motto: Ich betrachte die Fakten und Zahlen und bekomme das absolut richtige Ergebnis. So funktioniert es bei existenziellen Fragen nicht. Man kann Grundsätze verteidigen, aber die Anwendung muss immer neu verantwortet werden – individuell, gesellschaftlich und historisch. Vor allem muss sie vor Gott verantwortet werden und vor den Menschen, die ich liebe und die mein Leben bereichern. Gelebte Ethik hat also mit Beziehung zu tun und muss immer wieder austariert werden. Dazu fordert uns die Dynamik des Lebens heraus – und darüber sollten wir froh sein. Das macht unsere Lebendigkeit aus.
Ich möchte noch einmal den Vorwurf der Heuchelei beleuchten. Es steckt ja darin eine gar nicht so unbillige Forderung, die da lautet: Wenn Sie als Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche im Privaten zu der Einsicht kommen, dass man zur Sterbehilfe tatsächlich auch anders stehen kann, und wenn Sie dieser anderen Position sogar soweit recht geben, dass Sie sie praktisch unterstützen – müssten Sie dann nicht die EKD-Position ändern wollen?
Nikolaus Schneider: Na gut. Lassen wir den Vorwurf stehen. Aber ganz grundsätzlich gilt doch: Ich bin mir bei jeder moralischen Position bewusst, dass sie nicht in Stein gemeißelt sein kann, sondern in den Lebenskonflikten immer fortzuschreiben ist. Und ich habe absoluten Respekt vor anderen theologischen Erkenntnissen, wenn ich nachvollziehen kann, dass sie biblisch und theologisch begründet und nicht etwa willkürlich sind – dass sie ein hohes Maß an ethischer Reflexion durchlaufen haben. Wenn ich diesen Respekt nicht habe, verhalte ich mich wie ein Inquisitor, der sich im Besitz der Wahrheit wähnt und für den es deshalb nur wahr und falsch gibt – ohne die Freiheit zur Selbstinfragestellung. Das wäre fundamentalistisch. Gott sei Dank versteht sich die EKD nicht wie ein fundamentalistischer Inquisitor. Und auch innerhalb der EKD leben wir bei vielen Fragen mit unterschiedlichen theologischen Positionen – wie auch beim assistierten Suizid – respektvoll und geschwisterlich zusammen. Im Übrigen gilt: Ich kann mit anderen Menschen nur dann in Frieden zusammenleben, wenn ich nicht erwarte, dass sie ganz genau so denken und fühlen wie ich. Das zu akzeptieren ist die Voraussetzung für Frieden und das Funktionieren einer Gesellschaft. Wer keinen Dissens ertragen kann, wird niemals friedensfähig sein.
Gilt das auch für eine Ehe? Oder muss man sich da einigen?
Nikolaus Schneider: Das gilt auch für die Ehe. In der Ehe kommt aber noch etwas Entscheidendes hinzu, das wichtiger ist als Toleranz: nämlich die Liebe. Und Liebe bedeutet eine Verbundenheit zu leben, die tiefer und entscheidender ist als die Logik aller Argumente.
Dabei sind Sie beide doch dafür bekannt, dass Sie als Paar gerne diskutieren, als Theologen auch gerne öffentlich streiten.
Nikolaus Schneider: Meine Streitlust ist dabei nicht ganz so ausgeprägt wie die meiner Frau. Ich glaube aber, dass unser öffentliches Streiten andere Menschen dazu anregt, ihre eigenen Antworten auf Lebens- und Glaubensfragen zu suchen und zu finden. Ich ringe natürlich darum, meine Frau zu überzeugen – wie sie es umgekehrt auch tut. Aber unsere Liebe schafft ein Miteinander, das uns über die Grenzen von Meinungsverschiedenheiten hinweg trägt. Wir orientieren uns an Paulus, der im ersten Korintherbrief formuliert: „Und wenn ich alle Erkenntnis hätte und alle Weisheit und allen Glauben, sodass ich Berge versetze, aber hätte der Liebe nicht, so wäre das alles nichts“ (vgl. 1. Kor. 13,2).
Herr Gröhe, warum ist das Thema „Sterbehilfe“ gerade jetzt so sehr in der Öffentlichkeit präsent? Hat die alternde Gesellschaft Angst vor einem langen Siechtum?
Hermann Gröhe: Angst vor dem Sterben gab es stets. Doch die Folgen des medizinischen Fortschritts und eine lange Zeit der einseitigen Ausrichtung medizinischen Handelns allein an der Lebensverlängerung haben die Angst hinzutreten lassen, gegen den eigenen Willen lebens- und leidensverlängernden Maßnahmen ausgesetzt zu sein.
Da sind wir doch heute längst weiter! Die Medizin zielt heute nicht mehr in dieser Weise auf Lebensverlängerung um jeden Preis; vielmehr geht es um den Erhalt von möglichst viel Lebensqualität auch am Lebensende. Und mit den Möglichkeiten der Palliativversorgung ist eine sehr weitgehende Freiheit von unerträglichen Schmerzen möglich.
Schließlich trägt nicht zuletzt die Hospizbewegung mit Tausenden, die sich ehrenamtlich engagieren, dazu bei, dass wir Menschen die Angst vor der Einsamkeit am Lebensende ein Stück weit nehmen können.
Diese Möglichkeiten der Sterbebegleitung gilt es auszubauen, bekannter zu machen, weiter zu verbessern.
Gerade auf den Intensivstationen werden Infarktpatienten oder Unfallopfer aber dem Tod oft regelrecht aus der Hand gerissen – ohne Rücksicht darauf, mit welchen teils extremen Beeinträchtigungen die solcherart Geretteten dann klarkommen müssen.
Hermann Gröhe: Das halte ich nun wirklich für ein Zerrbild, das unsere Ärztinnen und Ärzte nicht verdienen! Aus den Fehlern der Vergangenheit wurde gelernt, auch wenn dieser Lernprozess noch nicht abgeschlossen ist. Sicherlich kann der Ausbau der Palliativmedizin auch weiterhin zu einer selbstkritischen Reflexion der Medizin insgesamt über die Grundlagen und Grenzen des eigenen Tuns Wichtiges beitragen.