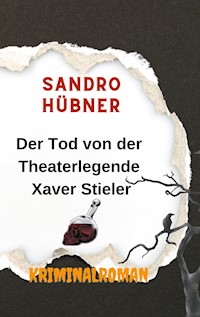Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Taschenbuch, enthält eine große Auswahl von spannenden Gruselgeschichten. Ein packender Gruselroman der Extra-Klasse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor:
Sandro Hübner, geboren am 07. August 1991 in Görlitz. Besuchte erfolgreich die Schule und widmete sich mit 10 Jahren Kurzgeschichten, Gedichten und Vorträgen die sehr umfangreich verfasst waren. Als er 17 Jahre alt war und sich als Schriftsteller die Zeit, für seinen Ersten Roman: SAD SONG - Trauriges Lied - nahm, machte ihm das Schreiben sehr großen Spaß. Sandro Hübner lebt in Berlin und arbeitet bereits an seinem nächsten Roman.
Vom Autor bereits erschienen: www.sandrohuebner.de
In dankbarer und liebevoller Erinnerung an meine liebe Mama
Alle Geschichten, wenn man sie
bis zum Ende erzählt,
hören mit dem Tode auf.
Wer Ihnen das vorenthält,
ist kein guter Erzähler.
E. Hemingway
Inhalt:
Spuren im Schnee
Die Beschwörung
Das Haus am Tümpel
Ein sonderbarer Fahrgast
Vor Sonnenaufgang
Gestrandet
Das ewige Grillfest
Reise in die Ewigkeit
Über den Tod hinaus
Letzte Nacht im Wald
Angst
Jenseits des Flusses
Der Tag ohne Gesetze
Abends im Grunewald
Heftige Schneefälle
Fahrerflucht
Der Traum des Fremden
Mein zweites Ich
Tornado in Atlanta
Die Spinne
Flucht vor der Bestie
Nachtschicht
Flugversuche eines Toten
Der Tote im Zug
Sturmesnacht
Der Waldspaziergang
Anmerkung des Autors
Spuren im Schnee
Fährt man von Norman etwa neunzig Meilen in Richtung Norden, so erreicht man ein Gebiet - zwischen dem großen Bären-See und dem Mackenzie gelegen - dessen Boden reiche Bleierze birgt. Es ist umgeben von den unendlich erscheinenden kanadischen Kiefern- und Tannenwäldern und bislang kaum mit der Zivilisation in Berührung geraten. 1957 wurde bei Sprengungsarbeiten, in der Nähe eines der Bleibergwerke, ein Labyrinth unterirdischer Höhlengänge freigelegt, an dem Wissenschaftler aus aller Welt reges Interesse zeigten.
Die bisherigen Forschungsergebnisse nannten nämlich den Beginn der Eiszeit als Zeitpunkt für das erste Auftreten menschlichen Lebens. Nun fand man jedoch Hinweise dafür, dass schon sehr viel früher dem Menschen ähnliche Lebewesen existiert haben mussten. Es wurde, neben einigen Knochen der am Ende der Kreidezeit aussterbenden Riesenreptilien, in einer Höhlung, die vor Urzeiten durch Erdrutsche hermetisch von der Außenwelt abgeschlossen worden war, das Skelett eines Wesens gefunden, das in vielerlei Hinsicht dem menschlichen Knochengerüst ähnelte.
Nach genauen Untersuchungen gab man bekannt, es handele sich hier um die Überreste eines Geschöpfes, das in seinen anatomischen Eigenschaften - wie z.B. seiner Schädelform - weitaus mehr als ein Affe den Menschen glich, seine Statur allerdings größer und kräftiger gewesen war. Das Alter des Skeletts schätzte man auf siebzig Millionen Jahre und dieses bedeutete, dass alle Aussagen, die Menschen als Untergruppe der Affen darstellten, hinfällig wurden. Ich wurde am 7. Januar 1958 als Ingenieur in die Gegend nördlich von Norman beordert, um dort Berechnungen über weitere Sprengungen anzustellen. Mein Quartier bezog ich in einer Siedlung, die zwei Meilen von dem Gebiet entfernt lag, in dem man vor einem halben Jahr die Höhlen entdeckt hatte. Es war eine ziemlich raue Landschaft. Man gab mir den Rat, mir noch vor meiner Abreise aus Toronto ein Jagdgewehr anzuschaffen, da es durchaus möglich sei, dass ich hier in den Wäldern auf Wölfe oder Bären stieß.
Die Mine konnte man nur über eine Schotterstraße erreichen, die jedoch, wie ich schon bald feststellte, durch tiefe Reifenspuren fast unbegehbar geworden war. Ich nahm mein Gewehr aus dem Ständer und zog die Pelzmütze ins Gesicht. In der Nacht zuvor war die Temperatur auf -4° F gesunken, ein lautloser Wind strich über die Wälder, so dass feiner Schneestaub von den Bäumen rieselte. Meine Schuhe hinterließen eine deutliche Spur auf der silbrig glänzenden Eisdecke. Obwohl ich mich dick eingemummt hatte, fror ich erbärmlich, denn ich war diese Kälte nicht gewohnt. Jerry, mein schwarzer Labrador, trottete an meiner Seite, während ich versuchte, mich durch Aufstampfen warm zu halten. Es schien, als wäre die Siedlung ausgestorben, kein Mensch begegnete mir. Nach einiger Zeit setzte heftiger Schneefall ein und die Flocken tanzten in Wirbeln vor meinen Augen. Schon bald war der Verlauf des Pfades unter der Schneedecke nur noch schlecht zu erkennen, ich sank mit jedem meiner Schritte tiefer ein und kam immer beschwerlicher voran. In dieser schneidend kalten Luft wurde das Gehen, auf dem nun in leichten Windungen ansteigenden Weg, zur Qual. Außerdem bewirkten die Reifenspuren, die jetzt vom Schnee verdeckt lagen, dass ich häufig stolperte und aufpassen musste, nicht zu stürzen. Je näher mein Ziel rückte, desto heftiger schneite es. Ich wunderte mich, dass mich noch immer keiner der Transportwagen überholt hatte, die die Arbeiter zu den Gruben brachten. Alle Geräusche wurden so gedämpft, dass ich nur ab und zu das Knirschen vernahm, das meine Schuhe verursachten, stießen sie gegen einen Widerstand.
Als ich die ersten Wegbiegungen hinter mir gelassen hatte, blieb der Hund auf einmal zurück und ich bemerkte, wie er die Schnauze hob, als hätte er eine Witterung aufgenommen. Gleich darauf trottete er jedoch wieder an meiner Seite, war aber unruhig geworden. Gelegentlich hob er den Kopf, um zitternd die Luft einzuziehen. Plötzlich fing er an zu knurren und ehe ich mich versah, war er schon ein gutes Stück vor mir. Ich rief ihn sofort zurück, doch er reagierte nicht. Im nächsten Moment war er hinter einer Wand von Schneeflocken verschwunden. Jetzt bereute ich, dass ich ihn nicht sofort an die Leine genommen hatte, als er unruhig geworden war. Ich rief erneut nach ihm und vernahm nun klägliches Jaulen aus einiger Entfernung. Es klang so erbärmlich, dass ich meine Schritte beschleunigte. Kurz darauf verstummte das Jaulen jedoch.
Ich nahm das Gewehr von der Schulter und begann zu laufen. Schon nach wenigen Schritten sah ich ein dunkles Knäuel am Wegesrand liegen. Obwohl immer noch absolute Stille herrschte, näherte ich mich nur vorsichtig der Stelle. Dann erkannte ich meinen Hund, er lag auf der Seite und regte sich nicht mehr. Während ich mich bückte, bemerkte ich, dass sein Körper in grausiger Weise zerfetzt worden war, so, als hätte ihn ein wildes Tier angefallen und getötet. Den Boden nach irgendwelchen Hinweisen absuchend, fiel mein Blick auf eine Anzahl tiefer Abdrücke im Schnee. Ich trat zurück, ergriff mein Gewehr mit beiden Händen, entsicherte es und spähte aufmerksam um mich. Mir war, als kauerte in einiger Entfernung ein Schatten, der sich träge bewegte. Gleich darauf sah ich, wie eine gewaltige Gestalt langsam näher kam. Erst glaubte ich in dem zottigen Wesen einen Bären zu erkennen, doch war etwas an seinen Bewegungen, das mich unsicher machte und für einen Augenblick zögern ließ. Meine Nerven waren bis zum Äußersten gespannt und ich merkte, wie meine Hände zitterten. Doch dann hob ich mein Gewehr, zielte und drückte dreimal kurz nacheinander ab. Als die Schüsse ertönten, wankte das Ungeheuer leicht, stürzte aber nicht zu Boden, sondern stieß nur wütendes Grunzen aus. Es schien einen Moment zu verharren, wandte sich dann jedoch blitzschnell um und floh. Zwar war mir das Wesen nicht so nah gekommen, dass ich es hätte genau identifizieren können, doch je ruhiger ich nun wurde, desto mehr bezweifelte ich, einen Bären vor mir gehabt zu haben. Noch größer wurde mein Zweifel, als ich mir die Tatsache vor Augen hielt, dass die Bestie, wie ein Mensch, in aufrechter Gangart geflohen war. Ich trat auf die Stelle zu, an der sie noch eben gestanden hatte. Eine Blutlache am Boden zeigte mir, dass meine Schüsse getroffen hatten.
Nun packte mich das Jagdfieber. Ich lud mein Gewehr nach und folgte den Spuren, die sich deutlich im Schnee abzeichneten. Das Wesen musste schwer verletzt sein, doch es schien über eine fast unheimliche Energie zu verfügen. Nachdem ich die Blutspur eine Weile verfolgt hatte, gewahrte ich, wie die Fährte eine scharfe Rechtsbiegung beschrieb und dann nichts mehr von ihr zu sehen war. Ich blieb stehen und verschnaufte ein wenig. Es hatte zwar aufgehört zu schneien, aber nun bemerkte ich, dass ich die Orientierung verloren hatte, als hätte ich mich mehrmals im Kreise bewegt. Doch der aufsteigende Ärger wurde sogleich durch das Gefühl verdrängt, in eine Falle geraten zu sein und ich sah mich um. Der mit Fichten bestandene Hang, vor mir, bildete eine finstere Grenze zwischen dem grauen Himmel und der Schneelandschaft und die Felsbrocken, die hier überall herum lagen, gaben dem Ort ein geradezu erdrückendes Aussehen. Einer der Baumgiganten, nur ein paar Schritte von mir entfernt, sah aus, als wolle er mit seinen schlangenhaften Wurzeln das Gestein sprengen. Und hinter jedem der Felsen konnte die Bestie lauern. Dann kam noch dieser üble Geruch hinzu, der jetzt immer deutlicher wurde. Es roch nach Verwesung, nach faulendem Fleisch. Plötzlich hörte ich über mir ein Geräusch. Zweige knackten und eine Wolke feinen Pulverschnees rieselte auf mich herab. Bevor ich aber nach oben blicken konnte, erhielt ich einen fürchterlichen Schlag auf den Kopf und sank in die Knie.
Als nächstes erinnerte ich mich, heftig geschüttelt zu werden. Ich schlug die Augen auf und erkannte einen Mann, der neben mir kniete und meinen Puls abtastete. Als er jedoch bemerkte, dass ich wieder zu mir kam, hob er meinen Oberkörper ein wenig an. Mein Schädel schmerzte zwar heftig, doch Ärgeres schien mir glücklicherweise nicht geschehen zu sein. Der Mann berichtete mir, dass er auf dem Weg zur Bleimine gewesen war, als er plötzlich, auf halber Strecke, den toten Hund und die Blutspur entdeckt hatte. Er hatte daraufhin die Fährte verfolgt und nach einigen hundert Yards eine zottige Gestalt am Boden hocken gesehen, die aber sofort geflohen war, als er sich der Stelle näherte. Und dort fand er mich bewusstlos im Schnee liegen. Da es inzwischen wieder schneite, konnten wir, so sehr wir auch suchten, keine Spuren mehr entdecken, denen wir weiter hätten folgen können.
Ich schulterte mein Gewehr und die schlimmsten Vermutungen quälten mich, als wir schließlich den Rückweg antraten.
Die Beschwörung
Er wollte es einfach nicht glauben, als er die Nachricht von ihrem Tode erhielt. Plötzlich sah er auch in seinem Leben keinen Sinn mehr. Bis er eines Tages auf das alte Zauberbuch stieß und das, was er dort las, erweckte neue Hoffnungen in ihm. In normalen Zeiten wäre ihm der Inhalt des Buches geradezu lächerlich vorgekommen. Doch die Verzweiflung, die schmerzvolle Trauer hatten seinen Geist so weit verwirrt, dass er nun den unmöglichsten Dingen zu vertrauen begann. So beschloss er, das Experiment zu wagen.
Er richtete sich peinlich genau nach den Anweisungen des Buches, obwohl es ihm manchmal undurchführbar schien. Am schwierigsten war es, die Utensilien zu beschaffen. Schließlich jedoch hatte er alles beisammen und konnte anfangen. Mit Beginn des Neumondes enthielt er sich, wie vorgeschrieben, jeglicher Gesellschaft und aß täglich nur eine spärliche Mahlzeit. Als aber das erste Mondviertel vorbei war, musste er nachts, an einem einsamen, verschwiegenen Ort, das Blutopfer darbringen. Er tat es, wie es das Ritual verlangte. Dem getöteten Schaf zog er das Fell ab und verbrannte den Leichnam. Gegen Sonnenaufgang verstreute er die Asche in alle vier Himmelsrichtungen.
Danach machte er sich an die Auswahl des Zauberstabes, wobei er besonders sorgfältig vorging. Zur vorbestimmten Stunde begab er sich in den Wald, um von einem Haselnussstrauch eine Gerte zu schneiden. Er schnitt sie mit demselben Messer, mit dem er zuvor sein Opfer geschlachtet hatte und an dem noch das getrocknete Blut klebte. Die Rute musste genau neunzehneinhalb Zoll lang sein. Am nächsten Tag ging er zu einem Schmied und ließ die beiden Enden der Haselnussgerte mit der Eisenklinge seines Messers beschlagen. Er verschaffte sich einen Magnetstein, erhitzte ihn und magnetisierte damit die metallenen Spitzen des Stabes. Natürlich vergaß er dabei nie die passenden Zaubersprüche zu rezitieren. Und als es Abend geworden war, trug er seinen Zauberstab, das Schaffell, einen Blutstein, zwei Kränze aus Eisenkraut und zwei Leuchter mit Kerzen aus Jungfernwachs zusammen. Dazu nahm er ein Feuerzeug, ein Gefäß aus gebranntem Ton, eine halbe Flasche hochprozentigen Branntwein mit Kampfer versetzt und vier Nägel vom Sarg seiner Geliebten. Mit diesen Gegenständen schlich er in das Zimmer, wo er sein Werk vollbringen wollte.
Als er dort angekommen war, begann er sofort den kabbalistischen Zauberkreis zu bilden. Das in Streifen geschnittene Schaffell legte er dafür zu einem Kreis und nagelte es mit den vier Sargnägeln auf den Dielenbrettern fest. Mit dem Blutstein ritzte er in den Kreis ein gleichseitiges Dreieck und schrieb das große A, das kleine e, ein kleines a und den Namen Jehova in das Dreieck. Dann trat er in den Kreis, stellte rechts die beiden Leuchter, links die Kränze aus Eisenkraut auf und zündete die Kerzen an. Vor seinen Füßen platzierte er das Tongefäß, füllte es mit Branntwein und entzündete es auch. Nun ergriff er seinen Zauberstab und sprach die vorgeschriebenen Beschwörungen.
Nachdem er geendet hatte, war allerdings noch immer nichts geschehen. Er wiederholte die Beschwörungszeremonie - jedoch vergeblich. Hatte er irgendetwas falsch gemacht? Entmutigt legte er den Zauberstab beiseite, schleppte sich ans offene Fenster und schaute hinunter auf die im Mondlicht liegende Parklandschaft. Es war eine ruhige, sternenklare Nacht. Aber was war das? Er hielt den Atem an und lauschte. Seltsames Geheul drang an sein Ohr und es klang, als käme es immer näher. Schon schien es für kurze Zeit über den Rhododendronbüschen zu schweben. Dann wurde es wieder still.
Bestimmt eine Eule, dachte er. Aber als er das Fenster schließen wollte, gewahrte er eine Gestalt, die vor dem Haus auf dem kurz geschorenen Rasen kauerte. Es war eine furchtbar dürre Gestalt, mit einem zerlumpten, grauen Gewand bekleidet. Sie blickte zu ihm empor und hob ihre Armen. Er sah, dass die Nägel an ihren Fingern entsetzlich lang waren und das Licht des Mondes durch sie hindurch schien. Plötzlich tauchte ein ähnliches, in Lumpen gekleidetes Wesen auf und dann noch ein weiteres. Immer mehr versammelten sich dort unten auf dem Rasen und alle bewegten sich mit gespenstischer Ruhe und warfen drohend Blicke zu ihm hinauf.
Da begriff er, was er angerichtet hatte: Er hatte die Toten aus ihren Gräbern heraufbeschworen, sie in ihrer ewigen Ruhe gestört.
Und während die grauen Gestalten in geschlossener Front auf das Haus zuwankten, schlug er mit der Faust wieder und wieder gegen seine Stirn und stieß dabei verzweifelte Schreie aus.
Das Haus am Tümpel
Er hatte das Haus während einer seiner sonntäglichen Wanderungen entdeckt. Es entsprach genau seinen Wünschen, ein solides altes Walmdachhaus.
In den letzten Jahren hatte er erfolgreich an der Börse spekuliert und nun endlich reichte das Geld für einen sorglosen Lebensabend. Aber ihm behagte das Leben in der Großstadt nicht und er hasste das Gedränge in den Straßen und den Gestank der Auspuffgase. Deshalb war er von der ursprünglichen Landschaft, die das Haus umgab, begeistert. Er erkundigte sich im nächsten Dorf, ob das Anwesen zu erwerben sei und erfuhr dabei, dass das Haus schon seit geraumer Zeit nicht mehr bewohnt wurde. Die Gemeinde hatte bisher vergeblich versucht den Besitz wieder zu verkaufen. Und nach kurzem Briefwechsel mit dem Makler, der das Anwesen verwaltete, beschloss er, das Haus so bald wie möglich zu besichtigen.
Er stellte seinen Daimler auf dem Parkplatz des Dorfgasthofes ab, öffnete das Handschuhfach und fischte den Schlüssel heraus, den ihm der Makler zugesandt hatte.
Seit Tagen war das Wetter unbeständig gewesen und nun kündeten die dunklen Wolken am Himmel ein Gewitter an. Skeptisch betrachtete er die Wolken, dann marschierte er los.
Zum Anwesen führte ein von Unkraut überwucherter Trampelpfad und nach etwa zehn Minuten hatte er schließlich sein Ziel erreicht.
Er blickte sich um. Der Wald hatte begonnen seine Schösslinge zwischen die alterskrummen Obstbäume zu streuen. Hinter dem Haus erstreckte sich eine Wiese auf der sich ein Tümpel hinter Schilf und Kalmus verbarg.
Er watete durch das Gras bis an das morastige Ufer des Tümpels. Zwei Weiden neigten sich hier, wie unter einer schweren Last, über Wasseroberfläche. Hingegen schienen vier dicht beisammen stehenden Birken mit allen Ästen und Zweigen davon fort zu streben, als wollten sie sich um keinen Preis der Welt in diesem Wasser spiegeln. Er bemerkte, wie Blasen durch die Algenschicht quollen und sich an der Wasseroberfläche zu phantastischen Gebilden vereinigten.
Inzwischen war es merklich kühler geworden. Der Wind strich singend über das Gras. Blitze erleuchteten den Himmel, begleitet von grollendem Donner. Nicht weit entfernt schlug plötzlich ein Blitz ein, worauf ein ohrenbetäubender Donnerschlag folgte. Vom Wald herüber erklang das Geräusch brechender Äste.
Erschrocken wich er einige Schritte vom Tümpel zurück und blickte schaudernd auf die Wasseroberfläche. Im Schein des Blitzes meinte er eine knotige Hand aus dem Wasser auftauchen zu sehen, so, als treibe es einen Ertrunkenen an die Oberfläche. Doch nun war sie verschwunden. Vielleicht ein modriger Ast, der wieder abgetaucht war.
Fröstelnd eilte er über die Wiese dem Hause zu. Es begann zu regnen.
Er kämpfte eine Weile mit dem widerspenstigen Türschloss, ehe die schwere Eichentür aufsprang. Durch die offene Tür sickerte nur schwaches Dämmerlicht. Er tastete nach dem Lichtschalter und atmete erleichtert auf, als er ihn gleich neben der Tür fand. Mehrfaches Klicken begleitete das Drehen des Schalters, es geschah jedoch nichts, der Raum blieb dunkel. Unsicher trat er einige Schritte vor.
Draußen peitschte der Wind den Regen vor sich her. Da dröhnte erneut ein Donnerschlag und die Haustür fiel krachend ins Schloss. Jetzt war es stockdunkel. Er begann schnell nach einem Zündholz zu suchen, dann jedoch entsann er sich der Lampe in seiner Jackentasche. Der Strahl seiner Taschenlampe erleuchtete eine Diele in deren Mitte eine Treppe in ein höher gelegenes Stockwerk führte.
Nachdem er die Räume des Erdgeschosses mit der Taschenlampe so gut wie möglich erkundet hatte, stieg er die Stufen nach oben. Bei seinem Rundgang entdeckte er eine Kammer in der eine bequem aussehende Couch an der Wand stand. Vor dem Fenster und am Boden der Kammer lagen zuhauf staubige Bücher herum. Erschöpft warf er sich auf die Couch und lauschte dem Heulen des Windes und dem Scharren der Äste am Dach des Hauses. Ohne es recht zu merken, döste er schließlich ein.
Er erwachte abrupt, sein Herz schlug heftig. Ein diffuses Leuchten in der Kammer hatte ihn anscheinend geweckt. Er erhob sich und blickte aus dem Fenster. Der Mond war zwischen den Wolken hervorgekommen und tauchte das Haus und die Landschaft in ein gespenstisch weißes Licht. Er erkannte den Tümpel.
Die Birken schienen noch enger zusammengerückt zu sein, wie ein Rudel Rehe bei drohender Gefahr. Da gewahrte er eine Bewegung am Ufer des Tümpels, als ob irgendetwas aus dem Wasser ins Trockene gelangen wollte. Nun begann es klare Konturen anzunehmen und er sah eine Gestalt, die sich vom Ufer entfernte und sich schleppend dem Hause näherte. Dann war sie verschwunden.
Er lauschte. Es war still, unheimliche still in dem schlafenden Haus, bis auf einmal leise, kaum vernehmbare Laute an sein Ohr drangen. Sie kamen offenbar von unten aus der Diele. Es dauerte eine Weile, bis sie deutlicher wurden, dann jedoch hörte er ein Geräusch, als würde ein nasser Schwamm ausgedrückt. Kurz darauf knarzten Treppenstufen und etwas erklomm ächzend Stufe um Stufe. Er hielt er den Atem an.
Plötzlich wurde die Tür aufgestoßen und ein entsetzlicher Gestank drang in die Kammer, eine schauderhafte Fäulniswolke hüllte ihn ein.
Er war so benommen, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Irgendetwas lauerte dort in der Dunkelheit auf ihn. Schritte schlurften und dann gewahrte er im Licht des Mondes eine gekrümmte, furchtbar dünne Gestalt, an der Kleider- und Hautfetzen herabhingen, suchend umhertasten.
In diesem Moment wich die Benommenheit von ihm und er stürzte vorwärts. Er hatte schon fast die Kammertür erreicht, als er über eines der herumliegenden Bücher stolperte, mit dem Kopf gegen die Wand schlug und bewusstlos liegen blieb.
Die Morgensonne blinkte durch das Fenster, als er mit brummendem Schädel erwachte. Geblendet kniff er die Augen zusammen. Weshalb nur lag er am Boden? Langsam kam die Erinnerung und er sah sich in der Kammer um. Hatte er geträumt? Kein Zeichen deutete auf einen nächtlichen Besucher hin. Doch dann bemerkte er die Wasserlache auf dem Treppenabsatz. Er schüttelte benommen den Kopf, raffte sich auf und taumelte die Treppe hinunter ins Freie. Sein Entschluss stand fest, er würde sich nach einem anderen und besseren Haus umsehen.
Da alle Bemühungen das alte Haus zu verkaufen gescheitert waren, beschloss der Gemeindevorstand das Gebäude abreißen zu lassen. Das Grundstück sollte entwässert und der Tümpel trockengelegt werden.
Beim Auspumpen des Tümpels, stießen die Arbeiter auf eine Leiche. Durch die lange Zeit, die der Tote im Wasser gelegen hatte - wohl durch Schlingpflanzen am Auftauchen gehindert - bot er einen schaurigen Anblick. Und während der Leichnam vorsichtig geborgen wurde, entdeckte man ein Buch im Schlamm, das auf wundersame Weise noch relativ gut erhalten war. Man konnte sogar auf dem verquollen Einband den lateinischen Titel „AMPHIBIORUM HOMINUM“ 1 entziffern. Darüber hinaus hatte das Wasser allerdings nur noch durchgeweichte, unleserliche Seiten übrig gelassen.
Später berichtete einer der Arbeiter, er hätte gesehen, wie der Leichnam wild gezuckt habe, als ihn die ersten Sonnenstrahlen trafen. Aber ein kräftiger Schluck aus der Schnapsflasche überzeugte den Mann, dass er sich wohl getäuscht haben musste.
1 Amphibische Männer (Männer, die an Land sowie im Wasser existieren können)
Ein sonderbarer Fahrgast
Es hatte schon sonderbar angefangen, denn seit unserer Abfahrt am frühen Morgen, schien nichts mehr zu klappen. Und im Laufe des Tages wurde es immer schlimmer, bis dann meine Frau und ich etwas erlebten, das alles andere in den Schatten stellte . . .
Am Nachmittag waren wir in einen Stau geraten und krochen jetzt seit drei Stunden im Schneckentempo über die Autobahn. Zehn nach sechs - meine Zunge klebte am Gaumen und mein Magen knurrte grimmig. „Wie weit ist es denn noch?"
Hannelore fingerte die Straßenkarte heraus und faltete sie auseinander. „Siebzig Kilometer werden es wohl noch sein." Sie steckte die Karte zurück ins Handschuhfach.
Das Geplärr aus dem Lautsprecher ging mir auf die Nerven und ich schaltete das Radio aus. Jetzt war nur noch das Brummen des Motors zu hören. Ich hielt es nicht länger aus: „Die nächste Abfahrt fahr ich runter. Ich hab mörderischen Hunger!"
„Mach, was du willst."
Aus den Augenwinkeln sah ich meine Frau gleichgültig die Achseln zucken. Sie murmelte etwas Unverständliches.
Ich schielte seitwärts über die Schulter, blinkte und ordnete mich rechts ein. „Mal sehen, ob wir nicht ein Gasthaus finden, wo wir was Ordentliches zum Futtern kriegen."
Die Autobahnausfahrt führte auf eine Landstraße, die sich kurvenreich durch die Landschaft schlängelte. Die dichten Eichen- und Buchenwälder zu beiden Seiten wurden nur gelegentlich durch Heideflächen und Maisfelder unterbrochen.
Ich raste in eine scharfe Linkskurve. „Verdammt!" Die Sonne schien jetzt genau von vorn. Ich klappte die Sonnenblende herunter, doch wie verhext schnellte sie wieder zurück.
„He, bist du verrückt geworden?" Hannelore starrte mich ängstlich an. „Halt an, Bernhard!"
„Was ist denn?" Ich stemmte meinen Fuß auf die Bremse. Die Reifen knirschten, der BMW schlitterte und brach quietschend nach links aus. Mit einem Ruck kam er zum Stehen.
„Hast du das Kind nicht gesehen?"
„Welches Kind denn?"
„Na, den Jungen am Straßenrand, in der Kurve. Beinahe hättest du ihn erwischt."
Ich blickte in den Rückspiegel. Tatsächlich! Ein stämmiger kleiner Kerl lehnte dort hinter uns an einem Weidezaun. Wie hätte ich den nur übersehen können? „Die Sonne . . .", stammelte ich. Ich legte den Rückwärtsgang ein und setzte zurück.