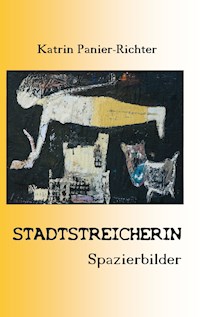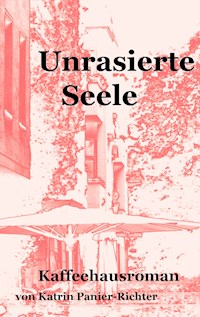
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mitten in der globalen Wirtschaftskrise eröffnet ein kleines, mutiges Café und verwandelt eine Berliner Seitenstraße in ein romantisches Pariser Gäßchen. „So etwas hat hier gefehlt.“, sagen alle und kommen in Scharen auf ihren neuen „Dorfplatz“. Rund um jenes Café versammeln sich lauter „Unrasierte Seelen“. Lernen Sie beim Lesen bitte kennen: Hilde und Frida, zwei seelenverwandte Frauen, wie sie einander auch vor hundert Jahren hätten begegnen können. Die Soßenprinzessin, das seitenverkehrte Ehepaar, den nicht ganz Anonymen Alkoholiker, Helena mit dem Zopf auf dem Kopf. Ismail und Lisbeth, die von der Liebe gefunden werden, als sie sie am wenigsten erwarten, den Widerstandskämpfer und noch viele andere mehr. Auf das überraschende Ende wären Sie nie im Leben gekommen, verspricht Ihnen Ihre Autorin Katrin Panier-Richter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Katrin Panier-Richter
»Unrasierte Seele«
Kaffeehausroman
Sommer & Herbst 2009 in Berlin überm Kaffeehaus
Books on Demand
Vorbemerkungen der Autorin
Erstens:
Die sogenannte Neue Deutsche - willkürlich herbeierfundene - Rechtschreibung wurde von der Autorin so fröhlich, frei wie grimmig ignoriert, erst recht während jener Textpassagen, in denen sie geradezu sinnentstellend gewirkt hätte.
Und zweitens:
Die Personen in diesem Buch, ihre Namen, ihre Geschichten und die Ansichten, die sie äußern, wurden von mir frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder bereits verstorbenen Menschen sind reiner Zufall und in keiner Weise beabsichtigt.
Katrin Panier-Richter, im Sommer 2009 in Berlin
Die Autorin
Katrin Panier-Richter lebt zurückgezogen in Berlin. Am liebsten spaziert sie unerkannt durch die Stadt und sitzt wahlweise in ihrem Lieblingscafé oder in ihrer Schreibwerkstatt.
Bisher erschienen von ihr:
Clara Felder: »Das schwächste Glied. Eine Geschichte aus dem Leben”,
>Books on Demand<, Norderstedt, 2003
»Sex gehört dazu. Geschichten vom Erwachsenwerden”,
>Schwarzkopf & Schwarzkopf<, Berlin, 2003
»Zu Hause ist, wo ich verliebt bin.
Ausländische Jugendliche in Deutschland erzählen”,
>Schwarzkopf & Schwarzkopf<, Berlin, 2004
»Die schlimmsten Gitter sitzen innen. Geschichten aus dem Frauenknast”,
>Schwarzkopf & Schwarzkopf<, Berlin, 2004
»Die dritte Haut. Geschichten von Wohnungslosigkeit in Deutschland”,
>Schwarzkopf & Schwarzkopf<, Berlin, 2006
»Mit einem Bein auf der Couch. Therapeutengeschichten”,
>Books on Demand<, Norderstedt, 2007
»Stadtstreicherin. Spazierbilder”,
>Books on Demand<, Norderstedt, 2008
»Mutspringerin. Reisebilder”,
>Books on Demand<, Norderstedt, 2008
»Briefschreiberin. Gedankenbilder”,
>Books on Demand<, Norderstedt, 2009
für Kirsten,
für meine geliebten Kinder Anne & Jan auf den Weg und für Ralf, meinen Herzensmann, der wieder einmal im entscheidenden Augenblick sagte:
Inhaltsverzeichnis
L
ATTE
M
ACCHIATO
E
SPRESSO
C
APPUCCINO
E
INSPÄNNER
G
ROSSER
B
RAUNER
F
RAPPÉ
M
ELANGE
V
ERLÄNGERTER
S
CHWARZER
K
AFFEE OHNE
Z
UCKER
I
RISH
C
OFFEE
E
ISKAFFEE
M
OKKA
M
ALZKAFFEE
H
EISSE
S
CHOKOLADE
D
OPPELTER
E
SPRESSO
S
CHOKOCINO
(C
APPUCINO MIT
S
CHOKOSIRUP
)
K
ÄNNCHEN
K
AFFEE
C
ARAMEL
M
ACCHIATO
(
MIT
K
ARAMELSIRUP
)
S
CHWARZER
T
EE
»D
ARJEELING
«
R
OOIBUSCH
»V
ANILLE
«
K
AMILLENTEE
M
ATETEE GRÜN
F
RÜCHTETEE
S
CHWARZER
T
EE
»A
SSAM
«
P
FEFFERMINZTEE
W
ERMUTTEE
A
NIS
-F
ENCHELTEE MIT
K
ÜMMEL
R
OOIBUSCH
»B
LUTORANGE
«
Y
OGI
-T
EE
B
RENNESSELTEE
S
CHWARZER
T
EE
»E
ARL
G
REY
«
H
AGEBUTTENTEE
G
RÜNER
T
EE
»J
ASMIN
«
W
EISSER
T
EE
G
EWÜRZTEE
»F
RAUENPOWER
«
L
IEBESZAUBERTEE MIT
M
ULTIVITAMIN
LATTE MACCHIATO
Wo waren eigentlich all die Leute, bevor es dieses kleine Café in unserer Straße gab?
Sie sitzt einfach nur da, schüttelt den Kopf und findet keine Antwort auf diese Frage. Wo, um alles in der Welt, sind sie gewesen davor? Saßen sie weinend allein vor ihren Fernsehern? Oder noch schlimmer: gleichgültig? Wer traurig ist, der lebt wenigstens noch. Gefühle sind Zeichen des Daseins. Die wahre Hölle besteht in innerer Leere, im Nichts-Mehr-Empfinden.
Wenn´s dir im Kopf und Herzen schwirrt, was willst du Bess´res haben. Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, der lasse sich begraben.
So ist es recht, denkt sie, ein neues Buch gleich mit Goethe anfangen. Da kann ich nichts falsch machen, dann bin ich von vornherein auf der sicheren Seite. Was für eine Ausgangsposition!
Hier in der Gegend gibt es eine Häuserzeile mit Kellerwohnungen. Zwei davon sind ganz besonders eindrucksvoll. Genau seitenverkehrt liegen sie einander gegenüber. Zwei Wohnzimmer, die eine Spiegelung des jeweils anderen Wohnzimmers sein könnten. Ein Sofa, ein niedriger Couchtisch, der Fernseher. Wand an Wand stehen sie, die beiden Geräte. Und die alten Leute auf den Polstern, jeden Abend pünktlich vor ihrer Mattscheibe, könnten einander anschauen, sie sitzen sich direkt gegenüber – wären da nicht die Trennwand und die beiden Fernseher, Rücken an Rücken. In der einen Wohnung sitzt eine Frau, um die siebzig. In der anderen ein etwa gleichaltriger Mann.
Manchmal scheint die Frau neben dem Flimmern ein Kreuzworträtsel zu lösen, manchmal der Mann vor seinem Bilderkasten aus einer Flasche Bier zu nippen. Sonst sitzen sie nur da und scheinen weiter nichts zu wünschen als so dazusitzen. Kennen sie sich, sind sie Nachbarn? Oder, was Frida beinahe noch schlimmer finden würde, sind sie gar ein Ehepaar? Ist die umgekehrte Wohnsituation in Wirklichkeit ein und dieselbe Wohnung, geräumig genug, daß jeder sein eigenes TV-Zimmer haben kann?
An jedem Abend, wenn sie daran vorüberspaziert, sieht Frida jene immer gleiche Szene, die ihr vorkommt wie ein Abbild unserer Zeit. Da sitzen wir, Wand an Wand, Rücken an Rücken, jeder vor seinem eigenen technischen Gerät. Wir schauen in eine Ferne, die es gar nicht gibt, hegen eine Stille, die gar keine ist, weil wir sie uns von vorsortierten Filmen stören lassen. Können sie überhaupt ruhig schlafen, diese beiden, wenn sie nur so sitzen, sich offenbar nicht bewegen und nicht miteinander reden? Fragt sich Frida immer wieder, wenn sie dort vorübergeht. Vielleicht haben sie Pillen zum Einschlafen, das kann gut sein, beinahe jeder Arzt verschreibt sie gern und oft. Ob sie sich aufraffen? Ob sie es eines Tages auch noch ins Café schaffen, diese beiden, wie vor ihnen so viele andere, die aus ihren Stuben heraus gekommen sind? Ist es so gewesen? Dann hätte Hildes Café etwas Revolutionäres bewirkt, jetzt schon, in so kurzer Zeit seines Bestehens.
Wo sind sie gewesen, die Leute, wenn nicht vor ihren Bildschirmen? Verirrten sie sich im Internet? Sprachen sie mit der Katze? Dem Hund, dem Wellensittich? Grübelten sie darüber nach, warum sie nicht die Kraft aufbrachten, jemanden zu sich einzuladen, oder warum keiner sie zu sich einlud? Fürchteten sie, jemandem zur Last zu fallen, wenn sie einfach so an einer Haustür klingelten? »Lieber nicht«, sagt die angeborene oder eingetrichterte Höflichkeit, und schon ist wieder ein Tag unwiederbringlicher Lebenszeit vorüber. Man steigt ins Bett mit dem Gefühl: Irgend etwas hat mir heute gefehlt. Der Tag war nicht ganz ausgefüllt. Ich habe gar nicht richtig gelebt. Und vom direkten Nachbarn bleiben nur störende, ärgerliche Geräusche, ein nicht gleichgeschaltetes Fernsehprogramm.
Wo also sind sie gewesen, all die Leute, die jetzt kichernd und schwatzend unter den beigefarbenen Leinenschirmen in der Sonne sitzen? Warteten sie auf etwas, irgend etwas, nicht wissend, was das wohl für sie sein könnte? Nun haben sie es jedenfalls gefunden, immerhin ein Teil von ihnen, immerhin vorläufig. So scheint es ihr, wenn sie das sieht. Tag für Tag sind die beiden Terrassen angefüllt mit Menschen. Plaudernden Menschen, Kaffee trinkenden Menschen, Kuchen essenden. Und sie selbst mittendrin. Mitten unter ihnen und doch ganz für sich allein. So gefällt ihr das. So hat sie es am liebsten.
Der Gedanke, daß die Leute einen Dorfplatz brauchen, der kommt ihr nicht zum ersten Mal. Aber nun ist sie doch erstaunt, überrascht von ihren Nachbarn. Die halten ihr Geld zusammen, die beäugen scheel eine neue Gastronomität, so hätte sie vermutet. Aber nein! Da sind sie. Alle. Oder fast alle. Und sie lächeln, scheinen großzügig, weltoffen, menschenfreundlich. Ihre unscheinbare Seitenstraße ist über Nacht zu einem romantischen Pariser Gäßchen geworden. Vier-, fünfstöckige, weiß und gelb getünchte, stuckverzierte Mietshäuser ringsum, gut, die stehen hier schon länger. Aber plötzlich haben sie sich verändert. Sie strahlen heller, umzingeln, beschützen ihr neues, uraltes Zentrum, das Café. Es wirkt, als hätte es schon immer da sein sollen. Als hätte nur jemand kommen müssen, es aus der Unsichtbarkeit herauszuheben. So entstehen Bücher, weiß sie. Oft und oft kam es ihr selber, dieses sichere Gefühl, ein Werk sei eigentlich immer schon da gewesen, sie hätte es nur durch ihr Schreiben aus der Unendlichkeit hervor zu holen brauchen. Sagen nicht Bildhauer Ähnliches über ihre Skulpturen? Maler über ihre Bilder. Musiker über ihre Kompositionen?!
Französische Lebensart in Berlin. Also doch! Es ist möglich. Wenn sie nur auch endlich bei ihr im Innern ankäme. Viel zu rasch noch stellt es sich ein, das diffus schlechte Gewissen. Wenn geschäftige Nachbarn in ihrer gewerkschaftlich vorgeschriebenen Mittagspause an ihr vorübereilen und sie mit Blicken streifen, die bei ihr — übersetzt in Worte, die das nagende Nörgeln unterm Nabel ihr diktieren — etwa so ankommen: »Na klar! Die wieder. Wo auch sonst! Wie immer hockt sie im Café, am hellerlichten Tage. Die muß ja Geld haben! Wo bekommt sie es eigentlich her? Das Herumsitzen und Kaffeetrinken wird ihr ja wohl kaum jemand bezahlen…«
Frida seufzt. Sie kennt das schon; und zur Genüge. Was sie da hört, was sie da aus den Köpfen der Anderen zu vernehmen glaubt, das sind ja ihre eigenen bloßliegenden Stellen. Das sind die schwachen Punkte, an denen sie bis jetzt noch nicht erstarken konnte. So sehr sie sich auch müht, es klopft und schwelt und puckert noch.
Haben gleichalte Pariser Lebenskünstlerinnen in hunderten Kaffeehäusern an der Seine das auch? Tief drinnen, unter ihren Fähnchen von Sommerkleidern und dramatisch schwarz umrandeten Augen? Oder sind sie von Geburt an frei davon; leben sie ab Start sorglos genießend im Heute, Hier und Jetzt? Zweites Frida-Seufzen in der selben Viertelstunde. Und ein Fünkchen Neid, falls es tatsächlich so sein sollte. Warum nur ist sie nicht dort zur Welt gekommen, sondern hier? Falls sie sich das ausgesucht haben sollte, griff sie ziemlich daneben. Doch halt! Wieso eigentlich?! Es gibt ja nun dieses kleine Café, das genauso heißt wie ihre Straße, und sie hat noch immer ihre Chance. Also Schultern zurück, Brust heraus, Nase ein wenig höher. Das Gefühl folgt der Position des Körpers.
»Na, wie geht´s dir heute?« fragt die Café-Chefin Hilde, die nicht gern Chefin genannt werden will.
»Hilde reicht vollkommen!« hat sie gleich zu Beginn ihrer Nachbarschaft klargestellt. Gleich an jenem Tag, als eröffnet wurde, und als Frida im Überschwang ihre Worte nicht sorgsam wählte; beziehungsweise, als sie sie ihrem eigenen Sinn für humorvollen Respekt folgen ließ. Der muß nicht der eines anderen Menschen sein, sie weiß schon. Also ohne »Chefin«, aber Hildes Frage ist ehrlich gemeint.
»Wie soll es mir schon gehen!« probt Frida spontan die Französin: »Wie immer. Heute Morgen habe ich einen neuen Bestseller fertig geschrieben. Danach übte ich eine Stunde Yoga, nippte etwas Wasser; und nun lasse ich meinen erschöpften jugendlichen Liebhaber noch ein wenig schlafen, um zu frühstücken! Einen Milchkaffee, bitte, und ein Stück deines herrlichen Rhabarber-Streuselkuchens.«
Hilde sagt nichts und geht in die Küche. Sie kennt das schon, und sie weiß, was von solchen Wesen zu halten ist. Die eigene Scheu großspurig übertönend wie lautes Pfeifen im dunklen Wald. Aber die macht das schon. Um Frida hat sie keine Angst. Die ist kein Blatt im Wind mehr, auch wenn sie auf Unkundige vielleicht so wirken mag. Diese Frau weiß genau, was sie will. Sie geht ihren Weg.
Wer wüßte das schließlich besser als sie, Hilde, ihre Seelenschwester.
ESPRESSO
Den Sommer genießen, so lange er da ist.
Jetzt, im Juli, wenn die Sonne scheint und die Terrassenplätze schon ab vormittags besetzt sind, meint sie, er würde nie enden. Dann dauert diese Jahreszeit ewig, und Frida kann sich nicht vorstellen, daß es aufhören, kälter werden könnte.
Im Winter sehnt sie sich dann zurück: »Ach, hätte ich doch! Hätte ich sie genossen, die warmen Wonnen, hätte ich mich in seine Arme begeben, des Augustes und jenes Mannes, und hätte ich alles andere losgelassen.«
Aber davor hat sie ja Angst. Sich ganz hinzugeben, den Kopf auszuschalten, die Welt, sich selber nicht länger kontrollieren zu wollen, was ja ohnehin nur eine Illusion ist. Also sieh hin, sagt sie sich. Sieh jetzt hin, in diesem Augenblick. Nimm die schönen Tage, wie sie dir geschenkt werden, gib den Druck auf, der von innen pressen will, laß dir Zeit. Sei eine Lebenskünstlerin in Ausbildung, lach dem Leben zu.
Das übt sie nun, in ihrer eigenen, auf sie persönlich zugeschnittenen Kaffeehaus-Therapie. Und sie macht kleine Fortschritte, sehr zu ihrem Vergnügen. Schon schaut sie mutwilliger drein, schon fühlt sie sinnlichere Lüftchen auf der Haut, zieht sich bunter und sorgfältiger ausgewählt am Morgen für den neuen Tag an.
Das Seidenkleid mit den großen blauen und roten Blumen darauf ist über hundert Jahre alt. Wer mag es wohl vor ihr getragen haben? So ähnlich wie sie jetzt in dem betagten Stöffchen sah auch eine Dame aus, die heute im Café saß, an einem einzelnen Tischchen hinter der großen Fensterscheibe, die bis zum Boden hinunter reicht.
Offensichtlich ging die Dame »konditern«, so hieß das früher beim Kaffeekränzchen ihrer Oma, von dem auch noch erzählt werden muß.
Jene Gästin also trug eine ähnlich bunte feine Bluse wie aus demselben Stoff, aus dem auch Fridas Uraltsommerkleid gemacht ist. Im Ausschnitt eine Perlenkette, den Rücken auf-, den Blick in eine unbekannte Ferne gerichtet, die außer ihr niemand erkennen konnte. So saß sie da, vor einer Tasse Kaffee und einem Stück Schwarzwälder Kirsch; ein Bild zum Abmalen oder Abfotografieren. Ein Werbeplakat fürs Café. Für solche Besucherinnen sind solche Orte gemacht. Oder für solche wie Frida, die noch übt. Die jetzt versucht, hier zu schreiben, Notizen auf einen Block wirft, und sich immer wieder ablenken läßt, sei es von ihrer eigenen Erscheinung.
Früher wußten sie jedenfalls besser, wie eine Frau ihre Reize unterstreicht, ohne sie zur Schau zu stellen. Das Dekolleté des Buntseidenen endet unterm Schlüsselbein, die Ärmel umspielen die Bizeps (Ha, Bizeps!) knapp überm Ellenbogen. Die Taille ist eng, da paßt nicht jedwede Figur hinein. Fridas schon. Sie hat auf sich acht gegeben. Sie ist rund und schmal zugleich. Nicht mehr wie ein ganz junges Mädchen, nein, das nicht. Jenen Konkurrenz machen wollen, das findet sie inzwischen reichlich albern.
Aber ihrem Körper sieht man an, daß er von seiner Bewohnerin geliebt wird. Der glatte Stoff legt sich kühlend um die Haut. Der weite Rock weht gerade so lang um die Waden, daß er Fridas Sünde verbirgt, die sie in diesem Sommer hier begeht. Es ist unaussprechlich. Untergang des Abendlandes! Gerade so, als hätte sie die Zähne nicht geputzt. Sie ist die einzige Frau in ganz Berlin, die sich in dieser Saison die Beine nicht rasiert hat! Manche meinen, »No Sex« sei das allerletzte Tabu in diesen Tagen. Andere wiederum halten Intimoperationen als Fernseh-live-Übertragungen dafür.
Nein, sagt Frida mit Überzeugung und aus eigener Erfahrung. Das ist es alles nicht. Aber gehen Sie mal im Sommer durch die Großstadt und tragen feinen dunklen Flaum an ihren Waden. Das ist unerforschtes Gebiet; eine Herausforderung für die moderne Frau. Ein hohes Risiko, ein Wagnis, das man einzugehen bereit sein, und für das Eine sehr, sehr stark sein muß. Frida fühlt sich unter manchen Blicken in der S-Bahn, als litte sie unter einer schweren Behinderung.
Wann und womit hat das eigentlich angefangen?
Früher gab es doch Aktfotografien in so begehrten Zeitschriften wie dem ostdeutschen »Magazin«. Auf denen räkelten sich die Modelle noch genau so, wie die Natur sie geschaffen hatte, mit Löckchen an den dafür vorgesehenen Stellen. Stolz und unbefangen stellten sie sich so zur Schau. Frida hätte niemals darüber nachgedacht, was daran so absurd sein sollte.
Bis zu jenem Abend, als sie ein neues rotes Ballkleid ihrer Freundin vorstellte: »Sieh mal, wie schön es ist.«
Die Vertraute taxierte Frida wohlwollend, aber streng und zeigte auf die Achselhöhlen: »Da mußt du aber noch ran!« Frida verstand nicht gleich.
»Ich bin Kosmetikerin. Ich kenne mich damit aus.« Aha. Das klang wie: »Ich habe doch die Bibel verfaßt, sie wurde mir vom Allerhöchsten eingegeben. Da mußt du dich schon daran halten.«
Es sei, wie es sei, das war jedenfalls der Moment, in dem Frida ihre Unschuld verlor. Hektisch ging sie einen Rasierer einkaufen, einen sogenannten Lady Shave, und die pubertäre Tochter samt Klassenkameradin halfen ihr dabei mit Rat und Tat. Überhaupt, die Jüngeren! Später sollten ausgerechnet sie es sein, die der Mutter vorwurfsvoll in grellen Kaufhaus-Umkleidekabinen die Leviten lasen: »Da hast du aber wieder einen gewaltigen Bären unter deinen Armen, Mama!«
Nichts war mehr so wie zuvor. Haare mußten ab — an den befohlenen Körperstellen — während sie an anderen nicht lang und dicht genug sein konnten. Shampoos werben gerne mit »Volumen«, Tönungen und Farben mit »Glanz, Feuchtigkeit und Fülle«. Stellen Sie sich diese Etiketten mal für eine Intimwäsche vor! »Kontrolle«, denkt Frida in ihrer Kaffeehaus-Therapiestunde. Es geht immer wieder nur um Kontrolle.
Alles wollen wir bestimmen, wir seltsamen Homo Kontrollusse: Da gehört kein Fell hin, dort angeblich jede Menge. Wer an den richtigen Stellen keines hat, dem wird eins eingepflanzt. »… und werden wir erst wissend sein, fügt sich uns die Natur.« schmetterten sie alle in dem guten alten DDR-Song. »Die Heimat hat sich schön gemacht, und Tau blitzt ihr im Haar / die Wellen spiegeln ihre Pracht, wie frohe Augen klar…«
Ein Spinnweb blitzt in Fridas Wadenhaar, und Rebellion läßt ihre Augen klar und froh leuchten. Sie mag den ganzen Zinnober nicht mehr einsehen, geschweige denn, mitmachen. Ihr Lady Shave setzt in der Duschkabine Kalkspuren an, unbenutzt, wie er jetzt ist.
Ja, es gehört Mut dazu, solcherart gegen den Strom zu schwimmen. Aber es stecken System und Absicht dahinter, eine stille Revolution. Eine einzelne Frau macht den Anfang!
Zuerst lassen wir unsere Körper in Ruhe, dann unseren Nächsten und schließlich die Mutter Erde, unseren Heimatplaneten. Frida braucht sich deswegen keiner Bewegung anzuschließen; Jeanne D‘Arc prescht einzeln vor.
Und so sitzt Frida im Café, die zarten Beine beflaumt; fast so wie die Fußballerwaden ihres Sohnes, nur eben in ihrem Seidenkleid, das er sicherlich nie tragen würde. Allein, sich so der Welt zu präsentieren, ist Programm. Sie braucht, weiß Gott, Courage. Und holt sich vorerst Kraft aus einem doppelten Espresso.
CAPPUCCINO
»Es wird mich so, in dieser Form, Gestalt und Zusammensetzung, nur ein einziges Mal geben und dann nie wieder!« überrascht Frida an diesem Morgen Hilde mit einer ihrer Einsichten.
Hilde ist daran gewöhnt und nickt. In Gedanken ist sie beim Gemüseschnippeln für das leichte Mittagessen, das sie wochentags im Café anbietet.
»Nein, wirklich!« läßt sich Frida nicht so leicht abwimmeln. »Ist dir eigentlich klar, was das heißt? Wir dürfen gar nichts künstlich zurückhalten von dem, was uns mitgegeben ist. Wir haben nicht das Recht, ängstlich zu zittern, aufzugeben, die Flinte ins Korn zu werfen. Wer sind wir, daß wir selbst entscheiden dürften, wie groß oder wie klein wir sein sollen.«
»Okay, eine Minute!« wischt Hilde sich die rot gespülten Hände vom Tomaten Waschen an ihrem bunten Sommerrock ab. Sie läßt sich auf der Kante eines Gartenstuhls nieder, schaut Frida in die Augen und signalisiert Aufmerksamkeit.
»Als meine Kinder klein waren«, spricht jene, also Frida, »da gab es mal so eine Szene am Küchentisch. Das Töchterchen war ganz verzagt und fürchtete sich vor ihrem ersten Zeugnis. Wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen, blies sie Trübsal. Ich kann es nicht, es ist zu schwer, ich habe Angst. Ihr Bruder, zwei Jahre nur älter als sie, drehte sich ganz zu ihr hin, strich ihr kurz über den zerbrechlichen Arm und sagte: ›Das ist eine Ohrfeige ins Gesicht Gottes, wenn du so redest.‹ Ist das nicht rätselhaft? Wir gaben den Geschwistern nichts Kirchlich-Religiöses mit, wir zwangen ihnen keinen Glauben auf. Sie waren klein und unerfahren, wie man von den Kindern sagt, und doch ließen sie manchmal eine Weisheit durchscheinen, die mich betroffen machte. Wo kommt das her? Und vor allem: Wenn ich es schon erkenne, was heißt das dann für mich?!«
Hilde nickt. »Ich weiß, was du meinst. Wüßte ich es nicht, wo hätte ich den Mut hernehmen sollen, mein Café zu eröffnen! Aber ich werde nicht bezahlt fürs Herumsitzen und Philosophieren. Nimm es mir nicht übel, ich muß arbeiten.«
Frida denkt an ein Gedicht von Erich Fried, das sie als Losung vorn in ihr aktuelles Tagebuch geschrieben hat: »Kleines Beispiel« heißt es, und es soll hier Eingang finden.
Auch ungelebtes Leben geht zu Ende. Zwar vielleicht langsamer, wie eine Batterie in einer Taschenlampe, die keiner benutzt. / Aber das hilft nicht viel. Wenn man (sagen wir einmal) diese Taschenlampe nach so- und so vielen Jahren anknipsen will, kommt kein Atemzug Licht mehr heraus. / Und wenn du sie aufmachst, findest du nur deine Knochen – und falls du Pech hast, auch diese schon ganz zerfressen. / Da hättest du genauso gut LEUCHTEN können.
Frida wünscht sich, zu leuchten, und sie möchte auch andere leuchten lassen, zum Beispiel Hilde mit ihrer Idee. Aber es fiel ihr nicht leicht, am Anfang. Sie wird es niemals vergessen, wie das entstand. Wo soll sie da überhaupt anfangen? Anfänge sind nicht klar umrissen, nicht exakt festzumachen, klar an Termin und Stunde. Hat es begonnen auf den Yoga-Matten, dicht nebeneinander und einander doch so fern, weil man den Nächsten nicht kennenlernt, wenn die Sprache ausgeschaltet ist und man nicht reden darf. Jedenfalls, Frida war schon länger dabei, als Hilde dazukam. Nun übten sie, atmeten, probierten, was die Körper sich entlocken lassen wollten. Plötzlich, eines Tages, etwas Neues. Yoga-Therapie, was ist das? Und wer dagegen sei, das nicht mit sich geschehen lassen wollte, der sollte es gleich sagen – oder für immer schweigen. Nein, jetzt übertreibt Frida, indem sie die alte Hochzeitsformel abruft. Ganz so streng war es nicht zugegangen. Aber doch, immerhin, stand die Frage im Raum, wer dafür sei und wer eben nicht. Es war nicht üblich, daß sich die Schüler vorlaut zu Wort meldeten, aber Frida mußte nun doch.
»Verzeihung, aber was ist das eigentlich? Worum geht es denn hier?«
Sie erntete eine Antwort, aber, was ihr im Rückblick noch wichtiger erschien, einen Blick von Hilde und ein Nicken.
»Ja, ich hätte das auch gern gewußt, bevor ich mich entscheide.«
War es dieser Augen-Blick, der die beiden Weiberseelen sich ineinander verzahnen ließ? Oder war es jener Weihnachtsabend, als Frida zum Lüften ihr Fenster öffnete und unten auf der Straße im Schnee Hilde stehen sah? Hilde, deren Herzensmann und eine Freundin.
»Ach, wohnst du hier?« fragte sie hinauf. Und Frida nickte hinunter.
»Und arbeitest du auch hier?« Ja, ein nächstes Nicken.
Sie arbeitete auch hier, und das immerhin schon neun Bücher lang. Wie sollte das denn gehen, oben eine Kreative, die die Stille braucht, und unten ein Dorfplatz, der, bevor er noch zum Leben erwacht, erst einmal erbaut werden muß! Das konnte eigentlich nicht gut gehen. Empfindsame Künstlerseele oben und lärmender Aufbruch darunter.
»Ich habe Angst.« gestand Frida Hilde.
»Ich auch.« antwortete diese schlicht.
Das gab Gesprächsbedarf. Worte vom Ende der Straße — an dem Hilde wohnte — an den Anfang der Straße, wo Frida vor sich hin blühte, und wo Hilde arbeiten wollte. Konnte das gut gehen? Wie sollte das funktionieren?
EINSPÄNNER
Als die Bohrhämmer das Haus zum Vibrieren bringen und Frida ihre eigenen Gedanken nicht mehr vernehmen kann, da beschließt sie, zu verreisen.
Natürlich ganz weit fort, in eine unerforschte Ferne, also nach Österreich. Es werden frische, feuchte April- und Maientage, dort, in jenem Gebirge, wo sie früher mit den Kindern Urlaub auf dem Bauernhof zelebriert hatte. Der Hof steht verwaist an seinem Hang, der alte Nußbaum, unter dem sie oft gesessen hatte, wurde längst gefällt. Nur die Luft ist noch dieselbe, und den schroffen Felsen ist des Menschen Treiben ohnehin egal. Sie haben ihren Platz gefunden, und von da weichen sie auch nicht. Still grüßen sie herüber und erinnern Frida an frühere Mutsprünge. Sie, die überaus Ängstliche, erklomm Dreitausender im Morgengrauen um des großen, großen Urvertrauens willen, das nur eine große, große Liebe schenkt.
Heute besteigt sie ganz bestimmt keinen Berg, aber ihr fällt etwas anderes ein. Es gibt hier ein Holzmuseum, neu gestaltet und mit einer aktuellen Ausstellung. Das möchte sie sich ansehen, schon um ihrer Bildung willen. Aber es kommt anders, wie so oft, und Frida erlebt einen kleinen Zauber in jener Schau mitten in der Steiermark, die nach dem Kalender zwar schon Frühling schreibt, aber noch im halben Winterschlaf des Hochgebirges steckt…
Sie tritt durch die Glastür und bleibt wie angewurzelt stehen. Was ist das? Die Räume voller Holz nehmen sie in den Arm, sie grüßen und empfangen sie freundlich. Überall helle Bretter, rundgeschliffene Kunst aus Buche, Spielzeuge aus Eiche, gemaserte Möbel, mahagonifarbene Fußbodendielen. Wie fremdgesteuert bittet Frida die Dame im Billetthäuschen um einen Schlüsselanhänger aus indischer Kirsche. Sie muß jetzt einfach etwas in der Hand halten, während sie sich Zeit nimmt für die nachgebauten Waldhütten, die Wandmosaike, den Schaukelstuhl aus einer Erle im ganzen Stück. »Es ist unmöglich, all diese Naturmaterialien in einem Haus zu versammeln,« denkt sie, »ohne die Geister des Waldes auch gleich mit einzuladen.« Wie mit Händen zu greifen sind die Unsichtbaren anwesend, und während sie ihren Handschmeichler festhält, nimmt sie deren Säuseln in sich auf. Es tut so wohl wie ein Bad in warmem Wasser oder wie das erste Hineinkriechen in eine Saunakabine nach einem langen, kalten Tag.
In Gesellschaft zweier kleiner Kinder hat sie mit den Kugeln auf einer Bahn gespielt, die bollernd über Schrägen, durch Labyrinthe und durchdacht komplizierte Konstruktionen laufen, um am Ende wieder in ihrem Ausgangsloch zu ruhen. Sie hat sich in das einfache und harte Leben früherer Waldarbeiter und ihrer Familien versenkt. Sie hat wie eine Fee in einer Laubhütte gehockt, im Schaukelstuhl entspannt, das Baum-Orakel befragt: Blind griff sie dazu in ein Loch in einem Baumstamm und zog »ihr« Holz hervor, die Zirbelkiefer. Einmal um den Stamm herum gehend und die Brille aufsetzend, las sie die Bedeutung:
Nicht, was wir sind und was wir tun ist wichtig, sondern einzig und allein, daß wir sind. Jeder ist gleich viel wert und hat selbstverständlich seinen Platz in der Welt! Viele Menschen strengen sich an und tun irgend etwas über die Maßen, weil sie hoffen, dann einmal etwas zu haben, womit sie ›sein‹ können. In Wirklichkeit sind die Gesetzmäßigkeiten aber genau umgekehrt: Man lernt sein eigenes Sein, so wie es ist, wertzuschätzen, dadurch findet man den Mut, es zu manifestieren und der Welt als seinen Beitrag anzubieten. Das heißt, man tut, was man ist, ganz egal, was andere dazu meinen, und schließlich ergibt sich das ›Haben‹ ganz von selbst. Der Knackpunkt liegt darin, auch die Seiten von sich anzunehmen, die sich nicht so edel, fähig und wunderbar darstellen. Wir alle haben negative Seiten, charakterliche Schwächen und Unausgewogenheiten. Sie sind ein Teil unseres Seins und der Weg, durch den wir wachsen.
Kluge Sätze, Lebensweisheiten, gehen ihr nicht immer ein. Manchmal ist sie genervt davon; zu oft schon hörte sie Belehrendes. Heute aber ist das anders. Als wäre sie ausgetrockneter Waldboden, übersät mit brüchigen braunen Fichtennadeln, fallen die Gedanken wie Morgentau in sie hinein und werden restlos aufgesaugt. Sie hatte gar nicht gewußt, daß sie so bedürftig, lechzend nach Trost gewesen war.
Wer ist wohl dieser Peter Salocher, der sich dieses Orakel ausgedacht hat, das sie jetzt so anspricht? Ein Heilkundler aus der hiesigen Gegend, ein Baum- und Menschenkenner, erfährt sie von der Kassendame, die ihr den handschmeichelnden indischen Schlüsselanhänger verkauft hat. Sie nimmt sich vor, ihn später im Internet zu googeln. Was sie im Innersten berührt, wird sofort weiter verfolgt. So hält sie es seit Jahren, und so hat sie sich ihren Weg gesucht, der durch Treffer und Fehlschläge, durch »trial and error«, Versuch und Irrtum, immer deutlicher zu sehen war. Das heißt aber nicht, daß das Suchen aufhört oder etwa leichter wird. Nur der Kern in ihr, der wurde stärker, stabilisiert durch neue, immer nächste Schichten von Erfahrungen wie die Jahresringe der Bäume, deutlich ablesbar auf all den Querschnitten und Baumscheiben, die im Holzmuseum abgebildet, ausgestellt, beschrieben sind.
Beinahe hat sie schon genug und ist müde, hungrig nun; will die Räume verlassen und die Eindrücke sortieren.
Da sieht sie das Foto der Lärche, liest die dazugehörige Beschreibung, sozusagen die Kurzbiografie dieses Baums:
Diese Lärche ist 158 Jahre alt. Sie stand bis zum Jahr 1980 inmitten einer Baumgruppe, also schattig, geschützt, umringt von älteren, stärkeren, größeren Artgenossen. Daher wuchs sie nur langsam, die Jahresringe liegen eng beieinander. Eines Tages wurde sie freigestellt, das heißt, die sie umgebenden Bäume wurden gefällt. Als die Lärche selbst im Alter von 164 Jahren der Axt zum Opfer fiel, zeigte sich, daß sie zu den 100 Prozent Masse in 158 Jahren in den letzten, freien sieben Jahren noch 53 Prozent zugelegt hatte. Die breiten Jahresringe machen dies deutlich…1
Die Betrachterin hält den Atem an. Was für ein Gleichnis! Wie in Trance verläßt sie das Museum durch die Glastür und tritt nach draußen, in einen regnerischen, kühlen Aprilnachmittag. Mit den zartesten Zweiglein, ihren Fingerknöcheln, umschließt sie den hölzernen Anhänger. Mit ihren Wurzeln stampft sie fest auf den Boden, ihre Krone reckt sie in die Frühlingsluft. Ja, sie hat verstanden. Auch sie trieb schließlich Äste, Knospen, Blüten, legte an eigener Substanz zu, erst nachdem sie ungeschützt und auf sich selbst besonnen stehen lernte. Ein Ring umschloß den anderen. Wo keine Haut war, wuchs ihr Rinde. Wie kam das, und wie geht es weiter?
Sie schüttelt ihr Laub und schaut sich nach Mittagessen um. Es scheint ihr, als ginge es nun wieder los.
________________________________________________________
1 Quelle (Text leicht verändert): Das Holzmuseum A-8862, St. Ruprecht, Steiermark
GROSSER BRAUNER
Wenn sie noch rechtzeitig zur Café-Eröffnung wieder in Berlin sein will, muß Frida allmählich an die Abreise aus der Steiermark denken.
Aber die fällt ihr eigenartig schwer. Die Versuchung ist groß, einfach hierzubleiben, abzuwarten, bis die letzte Lawine vom Sölkpaß heruntergekommen sein und damit offiziell das Frühjahr eröffnet wird — und dann vielleicht doch noch bergzusteigen. Feste Schuhe hat sie mit, und einen Hunger nach Zeitlosigkeit trägt sie auch in ihrer Brust.
Wie gut täte es ihr, in der ewigen Stille herumzuwandern, wo zu Hause gerade so das lärmende Leben tobt. Vielleicht käme ihr die Inspiration für einen Gruselkrimi, sie ist zur Zeit offen für alles literarisch Mögliche. Allein die Vorstellung, was oben in 1790 Metern Höhe geschehen könnte, wo die steilgewundene Paßstraße jedes Jahr sechs bis sieben Monate lang geschlossen wird. Das muß man sich mal vorstellen, als Großstädterin! Wenn man Berlin einmal so lange zu machen würde!
Der Trend scheint dahin zu gehen; die S-Bahn kollabiert bereits in jenen Tagen. Sie fährt nur noch unregelmäßig und mit einem Bruchteil ihrer normalen Wagenzahl. Vielleicht haben wir es dort auch bald so erholsam, so leise wie im österreichischen Hochgebirge, denkt Frida einen ziemlich unwahrscheinlichen, ihr aber doch sympathischen Gedanken. Ihr Herz hängt an Berlin, unbegreiflich genug für eine Ton-Empfindliche.
Noch ist sie aber hier, zu Füßen des Sölkpaß, der noch einen Monat lang tief schlafen wird. Von Oktober oder November bis zum Ende April totale Geräuschlosigkeit, von Menschen Unberührtheit. Wind fegt über die Gipfel, der Schnee türmt sich immer höher, seltsame, nie registrierte Tiere huschen durch die Senken und über die Hänge. Na ja, so kam Stephen King wohl auch auf seinen Roman »Shining«, in dem eine Kleinfamilie ein einsam gelegenes Berghotel bewacht, dort allmählich einschneit und — abgeschnitten von der Außenwelt — durchdreht. Diese winterliche Assoziation als Stoff für ein Buch gibt es also schon.
Alles gibt es schon, denkt Frida. Aber doch noch nicht von mir!
Da sie auf den Paß nicht hoch kann und auch sonst ein wenig unentschlossen ist, spaziert sie eben ein wenig durch die Täler. Sie findet Waldwege, die sie frappierend an ihre Heimat Thüringen erinnern. Manchmal hält sie im Gehen inne und erwartet gleich nach der nächsten Biegung den Berg, den Aussichtsturm, die kleine Jagdklause, die sie von dort so gut kennt. Die eine Gegend könnte auf der anderen liegen wie eine Schablone. Man fände keinen Unterschied. Manchmal zieht, so wie jetzt, eine Art Heimweh durch Fridas Gemüt, wenn sie solche Parallelwelten erkennt. Der alte Geheimrat würde sie verstehen. Goethe konnte auch nicht damit aufhören, die Mittelgebirgslandschaft von Weimar bis nach Ilmenau zu besingen.
Dort hat Frida übrigens auch ihren eigenen Baum! Erst neulich erfuhr sie es, fast zufällig, aus den Worten einer entfernten Verwandten. »Deine Oma hat doch diese Fichte gepflanzt, am Tag deiner Geburt…«
So bald sie kann, schaut sie sich diese Schwester an. Die selbe Anzahl an Jahren, und welcher Unterschied! Der Baum greift nach dem Himmel; er muß an die fünfzehn Meter hoch sein. So stark kann man also werden in einem halben Menschenleben, Bruchteil eines Baumlebens! Neben ihrer Fichte wirkt Frida wie eine Zwergin, zart und klein. Aber das macht gar nichts; allein der Gedanke tut schon gut. Daß es diese Kraft gibt, die parallel zu ihr gewachsen ist, und die ganz der Natur entspringt.
Nun gibt es ein Foto, Baum und Frau, das sie immer ansehen kann, wenn der Mut sie zu verlassen droht. Sie hat keinen Anlaß, aufzugeben; nicht, so lange irgendwo auf dieser Welt ihr solche dicken grünen Äste winken.
Irgendwann hat sie sich doch losgerissen von der ewigen auf den Ohren dröhnenden Stille der österreichischen Berge und fuhr nach Hause. Tschüß, liebe, vertraute Steiermark, ich komme wieder! Eines Tages. Ganz bestimmt. Jetzt wechsele ich erst einmal die Welten.
Der Gegensatz könnte nicht größer sein. Laute Musik, rote, beschriftete Luftballons mit dem Namen des Etablissements, Aufregung, Gelächter, Menschen über Menschen. Tobende Kinder, kreischende Babies, schwatzende Omis.
Und warum ist ihr nun gerade so, als würde sie ihr eigenes Café eröffnen?
Pünktlich zum festlichen Beginn trifft Frida wieder in Berlin ein, und da staunt sie über sich selbst. Wie kommt es nur, daß sie sich so verbunden fühlt; daß sie ein wenig weinen muß, als sie Hilde umarmt und beglückwünscht, und als sie stundenlang mitten unter den ersten Gästen hockt?! Sie empfindet es als einen großen Aufbruch oder Durchbruch, und das Motto »Kuchen, Küche, Nachbarschaft« scheint schon am ersten Tag ins Schwarze zu treffen.
Wo waren bloß all die Leute, bevor es dieses Café hier in ihrem Großstadtkiez gegeben hatte?
Und schon am allerersten Tag fällt an jedem Tischchen jener Satz, der zum heimlichen Motto dieses gastronomischmitmenschlichen Ladens werden soll: »So etwas, das hat hier gefehlt!«
Aber wieso hatte sein Fehlen dann denn niemand angemahnt; keiner laut gefordert? Wieso fehlt etwas, und es bricht keine Revolution aus, um es schnellstens zu bekommen?
Na, das kann sich Frida auch gleich selbst beantworten: Weil die Zeit erst reif sein muß. Weil erst jemand kommen muß, der richtig ist. Die richtige Frau zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle.
Das war Hilde, ganz eindeutig. Kaum jemals zuvor hatte Frida es so deutlich gesehen, wie ein Mensch sich einer Sache zur Verfügung stellt, und wie sich in der Folge alles logisch um ihn beziehungsweise um sie herum gruppiert und sichtbar wird. Es war nicht leicht, und Widerstände waren jeden Tag zu überwinden. Aber es fügte sich und wurde Wirklichkeit.
Weil Eine da stand und sich anbot. Dem Kaffeevertreter, den Hauseigentümern, den Bauarbeitern und Gewerken, einer unsichtbaren, ordnenden Kraft.
»Mach mal eine typische Handbewegung!« forderte Frida Hilde in diesen Wochen ab und zu auf.
Jene griff sich mit beiden Händen in die Haare, riß die Augen auf und lief willentlich rot an: »Oh Gott, oh Gott, meine Finanzen!« Sie schwammen stündlich fort und reichten irgendwie dann doch.
Und wie von Zauberhand entstand ein Ort, der einlud. Der schon einlud, als noch Gestrüpp entfernt wurde, mit Gummihandschuhen, denn über die Zeit hatte sich einiger Unrat im Vorgarten zur Straße angesammelt: Leere Bierflaschen, kaputte Blumentöpfe, Kinderhaarspangen, ein unbenutzter Schwangerschaftstest.
Egal in welcher Schöpfungsphase, Hilde sprach freundlich jeden an, der im Vorübergehen innehielt, neugierig stehen blieb und Fragen stellte. Ihr Kommunikationstalent färbte auch auf ihre Mitarbeiter ab.
Einmal wurde Frida von oben her, an ihrem offenen Fenster, Zeugin eines recht einseitigen Gesprächs. Eine ältere Dame mit Hund, die irgendwo in der Nachbarschaft wohnt, redete in einem langen Monolog zum Terrassenbauer, der an jenem Morgen hellgelbe Fußbodenfliesen verlegte, wo vor kurzem noch die Brennesseln allein geherrscht hatten: »Früher« sprach die Gnädigste, »früher war das hier ja ein Mach-Mit-Stützpunkt. Ich weiß nicht, ob Sie so etwas noch kennen, junger Mann. Dort konnten die Leute Gerätschaften und Werkzeug ausleihen, für ihre Hausgemeinschafts-Subbotniks. Das kommt aus dem Russischen, das werden Sie nicht mehr gelernt haben — ich noch nicht, aber meine Kinder und Enkelkinder, in der Schule — Subbotnik meint einen gemeinsamen Arbeitseinsatz am Samstag. Hinterher gab es meistens ein Fest, eine Party mit Grillen, Tanzen und Umfallen zum Schluß. Sonntags dann Katerfrühstück. Na ja, so ist das Leben, nicht wahr.« Sie schimpft kurz mit ihrem drahtigen Hund, der als Einziger unwirsch zu werden droht; dann spricht sie weiter: »Dann war das ja hier ein Schuhladen, aber ich sagen Ihnen, was für ein Zausel, der Inhaber! So unfreundlich, immer schlechte Laune. Also nein, so verbittert möchte ich nicht älter werden…«
Frida sitzt oben an ihrem Schreibtisch vor ihrem Tagebuch und fragt sich, ob sie noch zu ihren eigenen Gedanken kommt, oder ob sie lieber gleich mitschreiben soll. Sie kann sich sowieso auf nichts anderes konzentrieren, die Lady gibt sich keine Mühe, zu flüstern. Ganz im Gegenteil.