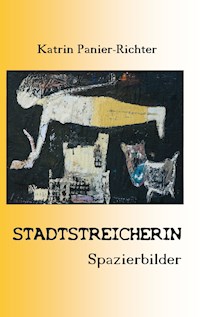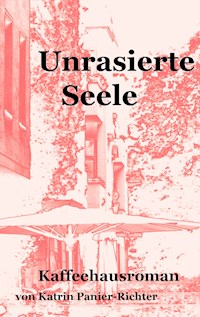Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Das klappt nie!", hatte die Autorin gedacht - und wurde eines Besseren belehrt. Diejenigen, zu denen wir uns auf die Couch legen, wenn sonst nichts mehr hilft, nahmen für Stunden auf dem dunkelbraunen Ledersofa am Kamin von Katrin Panier-Richter Platz. 18 Psychologen, Psychotherapeuten, Analytikerinnen zwischen 26 und 65 Jahren sprachen einmal nur von sich: Was sie ursprünglich dazu gebracht hat, Anderen Tag für Tag zuzuhören, von der aufwühlenden ersten Zeit, vom Zerbrechen und Neuformen ihrer Ideale; von dem, was ihr heute so notwendig gewordener Beruf mit ihnen selbst anstellt. Sie sind keine Götter, sondern Menschen wie du und ich, die nichts so sehr überraschen kann wie das Leben selbst. Jeder neue Klient, jeder lebendige Familienverband ist eine Herausforderung, wirft bislang fest gefügte Theorien über den Haufen. Ehrliche Erzählungen ohne jedes Fachchinesich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Katrin Panier-Richter wurde 1961 im Sternbild Wassermann in Thüringen geboren. Auf zunächst schnurgeradem Lebensweg studierte sie nach Schule und Abitur in Leipzig Journalistik, um sich danach beim Jugendradio DT 64 ihre ersten journalistischen Sporen zu verdienen. Mit 24 war sie Mutter zweier Kinder, mit 28 erlebte sie den Mauerfall in Berlin. Danach probierte sie vieles aus, Brüche zogen in ihr Leben ein. Seit 1993 arbeitet sie freiberuflich für Zeitungen, Hörfunk, Fernsehen. 1996 wurde sie »Brandenburgerin des Jahres« für ihr Rundfunk-Feature »Frauen im Stahl«. Ab 1997 moderierte sie zwei Jahre lang das »Erfurter Gespräch« im MDR-Fernsehen.
Bücher schreiben ist jedoch ihr Lebenstraum, und den verwirklicht sie seit 2000. Bisher erschienen im Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, Berlin: »Sex gehört dazu. Geschichten vom Erwachsenwerden« (2003), »Zu Hause ist, wo ich verliebt bin. Ausländische Jugendliche in Deutschland erzählen« (2004), »Die schlimmsten Gitter sitzen innen. Geschichten aus dem Frauenknast« (2004) und »Die dritte Haut. Geschichten von Wohnungslosigkeit in Deutschland« (2006).
Inhalt
Vorwort von Dr. Johannes Lindenmeyer
Vorwort der Autorin
Die Kindergärtnerin, Maria, 31
Weltreisen nach innen und nach außen, Ralf, 42
Eine Sehnsucht nach etwas, Regina, 37
Beulen und Schmetterlinge, Klaus, 54
Diese Kraft Leben, Anna, 41
Operation am offenen Herzen, Hans, 53
Helfersyndrom aus Begeisterung, Nina, 27
Das sind Helden, Björn, 40
Eine Verschwendung, Duna, 38
Der Übervater, Lena, 28
Zwischen zwei Stühlen, Marietta, 53
Wenn die Neugier weg ist, muss man aufhören, Werner, 49
Ein unsexy Beruf, Eva, 37
Ein Glückskind, Katharina, 26
Sich selbst treu sein, Mark, 42
Ich kann gut funktionieren, Clara, 27
Was ich meinen Patienten rate,muss ich auch selbst tun, Inga, 33
Der Dino, Felky, 65
Danksagung
Für meine Oma Clara
An sich
Sei dennoch unverzagt, gib dennoch unverloren,
weich keinem Glücke nicht, steh höher als der Neid,
vergnüge dich an dir und acht es für kein Leid
hat sich gleich wider dich Glück, Ort und Zeit verschworen.
Was dich betrübt und labt, halt alles für erkoren,
nimm dein Verhängnis an, lass alles unbereut,
tu, was getan muss sein, und eh mans dir gebeut*.
Was du noch hoffen kannst, das wird noch stets geboren.
Was klagt, was lobt man doch?! Sein Unglück und sein Glücke
ist ihm ein jeder selbst. Schau alle Sachen an:
DIES ALLES IST IN DIR! – Lass deinen eitlen Wahn.
Und eh du förder gehst, so geh in dich zurücke.
Wer sein selbst Meister ist und sich beherrschen kann,
dem ist die weite Welt und alles untertan.
Paul Fleming, 1609–1640
* gebietet, befohlen, angeschafft
Vorwort von Dr. Johannes Lindenmeyer, Direktor der salus Klinik Lindow
Die drei Teufelchen
In einer Psychotherapie herrscht eine künstliche, vor allem aber sehr einseitige Kommunikation: Der Patient erkundet sich selbst und versucht dadurch, Kontrolle über sein Leben (wieder)zugewinnen. Er kehrt gegenüber dem Therapeuten sein Innerstes nach außen und berichtet möglichst offen über seine intimsten Gefühle und Gedanken. Er steht im Mittelpunkt des Geschehens. Der Therapeut dagegen beschränkt sich auf Fragen und gelegentliche Hinweise. Seine Reaktionen, Gedanken und Gefühle bleiben insofern kontrolliert und strategisch, als er niemals einfach spontan oder ehrlich reagieren kann, sondern dabei immer das Wohl des Patienten im Auge behalten muss.
Was aber lässt Therapeuten diesen Beruf wählen? Was lässt sie dauerhaft Freude an dieser sie stark einschränkenden Interaktionsform finden? Wie erleben sie die Situation, als Angehörige der Mittelschicht, oftmals aus wohl-behütetem Elternhaus und dem akademischen Elfenbeinturm eines mehrjährigen Studiums der Medizin oder Psychologie heraus, plötzlich mit den Abgründen und dem Leid von sozial benachteiligten Menschen, mit Formen von Gewalt, Aggression oder Unrecht konfrontiert zu werden, für die ihre Fantasie nicht ausreicht? Wie können sie sich Menschen mitfühlend zuwenden, die ihnen zutiefst unsympathisch sind oder sie erschrecken? Wie gehen sie mit der Erfahrung um, trotz ihrer Bemühungen oftmals nicht helfen zu können, ja vielleicht sogar Undank oder Feindseligkeit ihrer Patienten zu ernten? Der berühmte Psychotherapieforscher Frederik Kanfer hat in diesem Zusammenhang drei Teufelchen ausgemacht, die einem Therapeuten als geheime Motivationsquelle ständig heimlich auf der Schulter sitzen und auch in Momenten größter Bedrängnis Ermutigung ins Ohr flüstern: a) das Bedürfnis nach Macht, b) Voyeurismus und c) Hoffnung auf Selbstheilung.
Zwar gibt es einen offiziellen Rahmen, in dem Therapeuten diese Themen mit Kollegen besprechen können: die vorgeschriebene Selbsterfahrung im Rahmen der Therapieausbildung und die sogenannte Supervision, bei der ein angehender Therapeut in der Behandlung durch einen erfahrenen Therapeuten (Supervisor) begleitet wird. Aber die Sprache dieser Veranstaltungen ist seltsam normiert und offiziell: Für alles gibt es bestimmte Fachtermini, und sobald diese benutzt werden, glauben alle, zu wissen, was gemeint ist. Je nach Therapierichtungen gibt es außerdem spezifische Vorstellungen darüber, was in diesem Zusammenhang richtig und falsch ist, dies hat ein angehender Therapeut zu lernen. In diesem Setting ist der Spielraum für Individualität somit stark begrenzt. Vor allem aber beschränkt sich dieser Austausch auf einen kleinen Kreis von therapeutischen Insidern, er ist nicht geeignet, das berufliche Erleben des Therapeuten dem Laien oder gar der Öffentlichkeit transparent zu machen. Entsprechend ranken sich die Mythen über die Person des Therapeuten zwischen den extremen Zerrbildern eines in jeder Hinsicht vorbildlichen Gurus und eines verschrobenen Zynikers.
Es ist das Verdienst von Katrin Panier-Richter, dass sie Therapeuten ein Forum geboten hat, außerhalb ihrer fachlichen Zwänge über sich nachzudenken und sich im wahrsten Sinne des Wortes frei zu reden. Sie stellt kaum Fragen, vor allem keine fachlichen Fragen, sondern schafft in ihrer Wohnung am Kaminfeuer bei einer Tasse Tee eine Atmosphäre, die zu einer persönlichen Selbstreflektion des therapeutischen Handelns einlädt. Sanft, aber stetig bewegt sie ihre Gesprächspartner dazu, sich ohne den Schutz von Fachbegriffen, Klischees oder therapeutischen Schulweisheiten einem breiten Publikum verständlich zu machen. Nur dadurch entsteht eine individuelle Auseinandersetzung mit der Entwicklung zum Therapeuten. Dazu kommt ihre schriftstellerische Begabung, aus den auf Tonband aufgenommenen Gesprächen jeweils einen roten Faden zu spinnen, indem sie die einzelnen, oftmals unfertigen Gedankengänge in eine sinnvolle Reihenfolge stellt und Unwesentliches weglässt. Es stimmt mich froh, dass ich Katrin Panier-Richter vor etwa zwei Jahren durch eine glückliche Fügung zu diesem Projekt ermutigen konnte. Das Ergebnis sind beeindruckende, vollkommen unterschiedliche, manchmal sogar gegensätzliche Dokumente der Selbsterklärung von Therapeuten. Nicht allen darin geäußerten Ansichten kann ich inhaltlich vollkommen zustimmen, aber ich verneige mich vor der Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit, mit der alle in diesem Buch zu Wort kommenden Therapeuten jeden Tag aufs Neue am Werk sind, um Menschen in seelischer Not wirksam zu helfen, sie zu verstehen und sich auf sie einzulassen.
Ich wünsche diesem Buch daher viele Leser:
—
angehende Therapeuten finden hier Ermutigung und Anregung für den oftmals steinigen Weg einer Therapieausbildung;
—
erfahrene Therapeuten, die sich ausgelaugt fühlen, können hier Kraft finden, wofür es sich lohnt, weiterzumachen;
—
Therapie-Ausbilder und Supervisoren finden hier reichhaltiges Material, um ihre »Schüler« noch besser zu verstehen;
—
und nicht zuletzt empfehle ich dieses Buch allen Patienten, die immer schon einmal wissen wollten, ob Therapeuten auch Menschen sind.
Dr. Johannes Lindenmeyer Lindow, den 27. Februar 2007
Vorwort der Autorin
Ein kleines Mädchen an der Hand einer älteren Frau. Die Nachbarn können beinahe die Uhr danach stellen. Jeden Morgen um die gleiche Zeit verlassen sie das Haus und treten ihre immer gleichen Gänge an, die den beiden Frauen – der älteren und der kleinen – jedoch nie langweilig werden. Zu viel haben sie einander zu erzählen, wenn sie zum Bäcker Langenberg um die Ecke und dann eine kleine Anhöhe hinauf wandern. Danach kommt der Fleischer Tröhße, gefolgt vom bunten Gemischtwarenladen, am Schaufenster des Spielzeuggeschäfts vorbei und hinein in die Gemüsehandlung, für die Enkelin eher der langweiligste Teil. Aber was ihr haften geblieben ist bis heute: Überall hatte man Zeit, wurde ein kurzer Schwatz gehalten, eine Wurstscheibe über die Theke gereicht, ein Extra-Brötchen geschenkt, eine Frage gestellt. War der Rundgang beendet, wusste man alle Neuigkeiten voneinander, hatte sich ausgesprochen, war wieder allein zu zweit und doch Teil eines größeren Ganzen, einer Gemeinschaft. Das thüringische »Gemähre«, das zelebriert wurde, sobald man einander auf der Straße, beim Einkaufen, begegnete, strengte manchmal an, reinigte aber doch – insgesamt gesehen – die Seele, und man fühlte sich aufgehoben. Als die kleine Enkelin damals war mir dies alles sehr vertraut. Aber was hätte meine Oma wohl dazu gesagt, wenn sie wüsste, dass an die Stelle des allgegenwärtigen Redeflusses professionelle Zuhörer treten würden? Anfang der Sechzigerjahre, als wir miteinander die Kleinstadt durchstreiften, gab es noch keine Psychologiepraxen an allen Ecken. Meiner Großmutter müsste ich wohl erst erklären, was das für ein Berufsstand ist, und wie es geschehen konnte, dass er so notwendig wurde, in so historisch kurzer Zeit. Ach, Oma, du clevere, warmherzige, starke Geschäftsfrau, hätte dir am Ende vielleicht sogar eine Therapie geholfen, damit du mir länger erhalten geblieben wärst als nur, bis ich sechzehn war?
Die Verkettungen und Vererbungen in unserer Frauenlinie kann ich nicht aufdröseln oder gänzlich analysieren. Es ist etwas unsichtbar weitergegeben worden; etwas, an dem auch ich zu tragen hatte. Die einzelnen Einflüsse sind schwer zu orten, es sei denn, in einem ganzen, großen Roman, einer Familiensaga, die noch zu schreiben sein wird. Jedenfalls, während der Tage, als die DDR starb, und als meine Oma schon über ein Jahrzehnt nicht mehr da war, entschloss ich mich zu einer viermonatigen stationären Psychotherapie. In einer Zeit, als die Therapeuten ebenso hilflos gewesen sein müssen wie wir Patienten, denke ich heute. Wozu sollten sie uns noch fit machen für eine Gesellschaft, die es ohnehin nicht mehr gab?! Und wie man jemanden fit machen sollte für eine Gesellschaft, die wir alle noch nicht kannten, das stand in den Sternen. Also wurde fröhlich vor sich hin therapiert, nach der heute umstrittenen Methode, einen Menschen zuerst in seine Einzelteile zu zerlegen, um ihn dann allmählich wieder zusammenzusetzen. Eine Methode, die mich diese Therapie eher überleben ließ, als dass sie mir wirklich weiterhalf, und die mich für lange Zeit von allem »Psychozeugs« kurieren sollte. Die »Tiefenheinis« oder »Seelenzergliederer« waren mir ein rotes Tuch. Dennoch: Meine Therapie damals, sie war ein erster Schritt auf einem Weg. Darum blicke ich heute auch gnädiger auf diese Zeit zurück. Was ich aber noch sehr gut weiß, das ist, wie peinlich mir das war, dass ich so eine Hilfe gebraucht und in Anspruch genommen hatte. Nur unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählte ich überhaupt irgendjemandem davon, dass ich eine Psychotherapie hinter mir hatte. Das Stigma »die ist verrückt« drohte von allen Seiten. Das hat sich rasch verändert. Wieder fünfzehn Jahre später sind Therapien nichts mehr, wofür sich jemand schämen muss. Manager lassen sich von Therapeuten coachen, ganze Firmen gehen zum psychologischen Wochenendseminar, Stars und TV-Prominenz sprechen ganz offen von ihren Therapeuten. Jeder weiß, wo es die kompetente Hilfe für die Seele gibt.
Als ich selbst noch einmal völlig unerwartet in eine persönliche Lebenskrise geriet, ließ ich mir von meiner Krankenkasse eine Liste aller niedergelassenen Psychotherapeuten in meinem Großstadtkiez schicken. Das war im Sommer 2005, und der Umschlag war dick. Zwischen 62 selbstständigen Seelensach-verständigen hätte ich wählen können. Aber schon die ersten Anrufe ernüchterten mich und zeigten mir: So einfach ist das auch wieder nicht. Wartezeiten von drei, vier Monaten bis zu einem halben Jahr waren üblich, und so lange hatte ich nicht Zeit. Also besann ich mich auf die Methoden meiner Oma, mit den Schwierigkeiten des Lebens umzugehen. Ihrem Rezept »mit den Leuten reden«, Freunde beanspruchen, viel und leidenschaftlich zu Fuß gehen, Tagebuch schreiben, fügte ich noch ein paar Zutaten aus meiner – und zugleich einer uralten – Ära bei: Yoga-Unterricht anfangen, Meditation üben, die Unsichtbaren um Hilfe bitten. So kam ich Schrittchen für Schrittchen durch den Knoten durch, der sich in meinem Leben gebildet hatte. Der Gedanke an die Psychologen ließ mich trotzdem nicht los. Was ist das für eine Zeit, in der wir leben, und in der sich ein ganzer explodierender Berufsstand gebildet hat, der nur fürs geduldige Zuhören da ist; der die Menschen wieder zu sich selbst zurückführen möchte, der professionelle Hilfestellung gibt, um unsere verwirrten Gemüter wieder zu beruhigen, zu heilen?! Je länger ich darüber nachdachte, umso mehr interessierten mich die Therapeuten selbst. Sie sind ja keine Götter, sondern auch nur Menschen, Zeitgenossen wie du und ich und meine Oma. Was laden sie sich da eigentlich auf? Wie geht es ihnen? Was haben sie wohl für Geschichten, und worunter leiden sie? An wen wenden sie sich, wenn der Liebeskummer kommt, der Lebensschmerz, die Sucht?
Ich lud sie ein auf meine braune Ledercouch am Kamin in meinem Wohnzimmer. Manchmal wurde auch ich eingeladen in schöne Psychotherapiepraxen oder Privaträume. Das Prinzip bei den Gesprächen, aus denen die Geschichten in diesem Buch hervorgingen, war jedoch immer gleich: Ich bot mich an, zuzuhören. Bei mir durften sie einmal von sich erzählen, die berufsmäßigen Helferinnen und Helfer. Sie verstanden es als eine ungewöhnliche Form der Selbsterfahrung. Mich trugen meine Neugier und mein künstlerischer Blick auf Menschen. So ist diese kostbare kleine Sammlung von Kurzbiografien und Erfahrungen entstanden, die eine Brücke zwischen Psychowissenschaft und Belletristik schlagen soll. Die Idee wurzelt in einem Abendessen mit dem salus-Klinkdirektor Dr. Johannes Lindenmeyer und wurde dann erst einmal in meinen Hinterkopf verbannt, wo sie geduldig auf ihre Aktivierung wartete. Nun war es so weit, sie meldete sich laut und unüberhörbar. Zuerst hatte ich nur über die erste Zeit, den Praxisschock schreiben wollen – jene Zeit, die wie keine andere im Leben eines Therapeuten alles durcheinanderwürfelt, woran er jemals geglaubt hatte, sowohl was seinen studierten Beruf betrifft, als auch was ihn selbst angeht, und das, was er oder sie jemals von sich angenommen hatte. Dann aber merkte ich sehr schnell, dass sich die Geschichten in jede Richtung ausdehnen wollten – und ich erlaubte es ihnen. Ich mochte dem Leben keinen festen Rahmen geben, den Menschen, die mir auf der Couch gegenübersaßen, keine Fesseln anlegen. So kam eins zum anderen; es wurde über Ost-West-Konflikte gesprochen, über kleine und größere Fluchten, über Kindheitstraumata, das Unbehagen aus der persönlichen und der globalen Geschichte. Ich fand es wunderbar, auf Männer und Frauen zu treffen, die sich wie ich ernsthaft selbst analysieren und immer wieder anhand neuer Lebenserfahrungen ehrlich überprüfen. Wer diesen Weg einmal beschritten hat, der kann damit nicht mehr aufhören. Das verbindet die Jünger der Psychoforschung mit uns Literaten und Schöpferischen aller Genres. Ich bin nicht die Erste, die auf die Parallele zwischen Psychotherapie und Kunst trifft. Es ist faszinierend, Gedanken auszutauschen zwischen den Fachgebieten. Es gab einen Abend, eine Nacht, bei mir am prasselnden Feuer, da saßen aus verschiedenen Generationen diskutierend beieinander: eine angehende Biologiedoktorin, ein Informatiker, ein Rundfunktechniker, ein Psychoanalytiker, eine Pfarrerin, ein Botanikprofessor, ein junger Mathematikstudent und ich, eine ausgebildete Journalistin, die aber wie eine Künstlerin denkt. Unser Gespräch war sendereif. Am Ende hatte ich den intensiven Eindruck: »Was, wenn wir Menschen alle das Ende eines Fadens in die Hand bekommen, den wir, jeder für sich, von unserem Ausgangspunkt – Mathematik, Physik, Theologie, Psychologie – her verfolgen, der uns über kurz oder lang aber alle zueinanderführt und – wenn wir nur lange genug gehen, denken, reden –, zu demselben Ziel …«
Psychologen, Psychoanalytikerinnen, Psychotherapeuten sind Menschen, die sehr genau über sich selbst, über die Welt, in der sie leben, über das, worunter diejenigen leiden, die zu ihnen kommen, denen sie helfen wollen, nachdenken. Einige von ihnen haben das laut getan, auf meiner Couch sozusagen, und ich durfte ihnen zuhören, ihre Geschichten aufschreiben. Ich habe nichts anderes getan als du, liebste Oma, auf unseren Rundgängen, in deinem Milchgeschäft, Tag für Tag. Ich denke mir, du hättest bestimmt eine gute Psychotherapeutin abgegeben, wenn ich dir auch erst hätte erklären müssen, was das überhaupt ist. Vielleicht hättest du gelacht: »So eine komplizierte Sache! Wozu soll man Geld dafür bezahlen, was man kostenlos haben kann. Reden und zuhören.«
Ach, Oma, ich weiß auch nicht so genau, wozu. Du hast mich damals gerettet, aber heute retten andere, und das ganze Retten hat sich verändert. Vielleicht würdest du alles besser verstehen, wenn du diese Geschichten gelesen hättest. Sie sind mir zugeflossen. Ich bin zutiefst dankbar dafür, dass mir wiederum so viel Vertrauen geschenkt wurde, so viel Rückenstärkung auch, denn die Arbeit an so einem Buch, die sich über Monate, Jahre zieht, kennt auch ziemlich dunkle Stunden und Selbstzweifel. Aber da ist es ein großer Vorteil, ausgerechnet mit Psychologen zusammenzuarbeiten. Sie wussten die richtigen Aufmunterungsworte, wenn ich drauf und dran war, das ganze Projekt aufzugeben, mehrere Kapitel aus dem Fenster oder in den Kamin zu schmeißen.
In jedem meiner bisherigen Bücher kommen Psychologen, Psychotherapeuten irgendwie vor. Man kann heutzutage nichts falsch machen, wenn man einen Psychologen zitiert, interviewt oder in eine Sendung einlädt. Er vermittelt immer ein sicheres Bescheidwisser-Gefühl. Ich bin sehr froh, dass sie hier mal selbst und sehr persönlich zu Wort kommen, die Spezialisten für das menschliche Wesen mit all seinen Schlaglöchern und Baustellen. Keine einzige dieser Begegnungen möchte ich missen, und ich hoffe, dass die Texte, gespickt mit meinen eigenen Gedankensplittern, ein größeres Ganzes ergeben. In der Hand habe ich das Gesamtbild nicht, ich als Autorin. So unfassbar wie unser Innenleben soll dieses Buch sein. Mag jeder für sich selbst daraus nehmen, was für ihn, für sie passt.
Ich selbst liebe das Leben, und das Leben liebt mich zurück. So viel kann ich darüber sagen. In Gedanken ergreife ich die Hand meiner Oma, wir gehen mit unseren Einkäufen zurück nach Hause, brauen uns einen fürchterlich starken schwarzen Tee, rösten wie früher Weißbrotscheiben direkt über der Gasflamme, bestreichen sie oben mit Butter und Salz, unten mit einer saftigen Knoblauchzehe und lesen einander die folgenden Geschichten vor.
Meinen allertiefsten, herzlichen Dank für alles, an euch alle.
Gleich zu Beginn ein Aufruf an meine Leserinnen und Leser: Wer von Ihnen kennt dieses Theaterstück? Ich habe Kulturredakteure, Fachleute, Theaterkenner befragt, und keiner konnte sich an die »Flugzeugentführung« erinnern, die kurz nach dem Mauerfall im Theater »Schmales Handtuch« in der Berliner Frankfurter Allee gegeben wurde, und die mich nachhaltig beeindruckt hat. Ein junger Mann entführt ein Linienflugzeug, und im Laufe der Geschichte stellt sich heraus, warum. Es geht ihm weder um Geld noch sonst um irgendwelche Vergünstigungen. Er will lediglich, dass eine Passagierin ein Fischbrötchen verspeist. Wie sich herausstellt, ist sie seine ehemalige Erzieherin aus dem Kinderheim, und damals hat sie ihn, den kleinen hilflosen Jungen, gefoltert, indem sie ihn zwang, Fischbrötchen zu essen, obwohl sie wusste, dass er sich vor nichts auf der Welt so sehr ekelte wie gerade vor Fischbrötchen. Nun rächt er sich. Das Flugzeug wird nicht eher landen, als bis die Frau sich das Weißgebäck mit Bismarckhering einverleibt haben wird. Eine Geschichte über das Elefantengedächtnis der menschlichen Seele. Selbst wenn wir verdrängen und verdrängen, was uns verletzt hat, wird nichts jemals wirklich vergessen, und es tritt wieder zutage, wenn wir es am wenigsten erwarten.
Die Flugzeugentführung mit Fischbrötchen fiel mir wieder ein, als ich Marias Geschichte von der Kindergärtnerin hörte. Maria ist eine zierliche, erst auf den zweiten Blick schöne junge Frau. Auf einer öffentlichen Lesung aus meinem noch nicht druckfertigen Manuskript darf ich auch ihren Text vorlesen, und er berührt spontan viele Menschen aus dem Publikum so sehr, dass sie mich hinterher nach Maria befragen und sie kennenlernen wollen. Das geht natürlich nicht; »Maria« ist ein Pseudonym – wie die meisten Vornamen in diesem Buch. Das muss man verstehen: Ein Patient oder Klient darf eigentlich überhaupt nichts Persönliches von seinem Therapeuten wissen. Umso dankenswerter ist die Bereitschaft und die Offenheit, mit der mir Intimes anvertraut wurde. So wie in der folgenden Geschichte von Maria und ihrem Trauma.
Die Kindergärtnerin
Maria, 31
Könnten Sie bitte laut und deutlich sprechen? Ich höre nämlich auf dem einen Ohr nichts und auf dem anderen auch nicht besonders gut. Ja, das mag vielleicht seltsam klingen, eine Psychologin, die schwerhörig ist und als Therapeutin arbeitet. Aber es geht. Ich konzentriere mich eben auf Gesichter, Mimik und kann von den Lippen lesen. Ich muss aber schon sehr genau hinschauen, um zu verstehen. Wobei – das könnte schon fast wieder ein Vorteil sein.
Während des Studiums der Psychologie war mir noch gar nicht ganz klar, was ich, wenn ich fertig bin, beruflich nun so ganz genau machen könnte. Das Psychologiestudium beinhaltet ja sehr viele Dinge, die meines Erachtens nur am Rande etwas mit Therapie zu tun haben: Statistik, Mathematik, Biologie und Medizin. Erst einmal hieß es für mich, das zum Teil recht unübersichtlich gestaltete Studium durchzuziehen. Erst gegen Ende meiner Studienzeit, nachdem ich ein längeres Praktikum in einer Suchtklinik absolviert hatte, konkretisierte sich mein Berufswunsch, eine Psychotherapeutin zu werden.
Ich denke nicht, dass Therapeuten stets perfekte Menschen sein müssen, aber irgendwie schon ein Vorbild. Nein, kein perfektes Vorbild, ein menschliches. Oft weiß ich gar nicht so genau, was Patienten in Therapeuten – in mir als Therapeutin – alles glauben, zu erkennen; was sie gut oder eher schlecht finden. Deshalb finde ich Rückmeldungen der Patienten einerseits insgesamt sehr wichtig, weil ich dann recht frühzeitig auf mögliche Probleme in der therapeutischen Beziehung zum Patienten hingewiesen werde. Auf der anderen Seite haben Rückmeldungen, wie ich sie kenne, in Zensurenform, auch etwas zum Teil für mich Unangenehmes. Ganz einfach, weil sie bei mir den Druck erhöhen, gut sein zu müssen und dabei doch eher momentane, emotional gefärbte Bestandsaufnahmen der eigenen Befindlichkeit darstellen.
In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an eine ältere Patientin, die früher einmal als Lehrausbilderin gearbeitet hatte, und die mich immer mit einer »Drei«, also nicht besonders zufriedenstellend, bewertete. Mir war nicht klar, wieso. Auf meine Nachfrage, was sie denn so unzufrieden mache, gab sie an, ich sei ihr nicht didaktisch genug. Ihrer Meinung nach müsse ich stärker pädagogisch arbeiten und das Wesentliche mehr herausstellen. Ich nahm die Kritik ernst und bereitete die nächste Therapiestunden noch besser vor; allein, diese Patientin nörgelte weiter. Erst in einem späteren Gespräch stellte sich heraus, dass sie sich in den Gruppentherapiestunden immer an ihre Zeit als Lehrausbilderin erinnert hatte. Es war ihr Job gewesen, den sie sehr gern ausgeübt hatte, dies jedoch aufgrund ihrer verschiedenen körperlichen und psychischen Erkrankungen nun nicht mehr konnte. Und die Trauer und Wut darüber projizierte sie auf mich, in Form von Abwertungen und Spott. Es ging demnach offenbar viel weniger um das, was sie da so kritisch sagte, als vielmehr um das zunächst noch Ungesagte; ihre Motive und die Ursachen, die eigentlich dahinter standen.
Solche Dinge lernt man im Laufe der eigenen Berufserfahrung, durch eigenen Schmerz.
Das kann man ganz am Anfang noch nicht wissen.
Wie bei mir alles anfing? Nun, meine Diplomarbeit schrieb ich ja bereits auf dem Gebiet der Sucht, und dafür ging ich dorthin, wo man viele Alkoholabhängige findet: vor die Kaufhalle, auf Bahnhöfe, wo sie standen und ihr Bier tranken. Ich sprach sie einfach an, ob sie bereit wären, ein paar Fragen zu beantworten. Und sie antworteten mir bereitwillig. Da habe ich gespürt, dass ich mit diesem Klientel ganz gut zurechtkommen kann. Und das waren dann auch meine ersten Kontakte mit dieser Krankheit, der Alkoholabhängigkeit.
Klar, das waren natürlich Menschen, die nicht gerade vorhatten, sich mithilfe von Therapeuten zu ändern. Da ging es um soziodemografische Daten, aber auch um Gefühle, Gedanken; um das Verlangen nach der Droge Alkohol. Ich fragte sie also zum Beispiel, woher sie kommen. Zeigte ihnen alkoholrelevante oder auch neutrale Bilder und fragte: »Welche Gedanken gehen Ihnen jetzt durch den Kopf, und wie sieht es jetzt mit dem Verlangen aus?«
Doch all das hatte an sich noch nichts wirklich Therapeutisches.
Der eigentliche Anfang meiner beruflichen Tätigkeit als Therapeutin war eine Gruppentherapiestunde in einer Suchtklinik. Das ging damals alles sehr schnell nach dem Studium. Ich bewarb mich blind auf eine Stelle als Psychologin, das Diplom hatte ich noch gar nicht, und selbst hatte ich auch noch keine Gruppe allein geführt. Der psychologische Leiter der Klinik empfing mich am ersten Tag und meinte, dass er mich ins »kalte Wasser« werfen würde, und schwimmen müsse ich allein. Ich solle einfach in den angewiesenen Raum hineingehen, zu diesen zwölf Patienten, deren Therapeut die Klinik kurzfristig verlassen hatte. Ein Dutzend Patienten, die ganz gespannt im Kreis saßen und auf mich warteten.
Mein neuer Chef meinte noch: »Und wenn Sie mit ihnen über die Butterpreise reden – Hauptsache, es gelingt Ihnen, eine Beziehung zu den Patienten aufzubauen.«
Mulmig war mir schon, aber ein Rückzieher kam für mich nicht infrage. Ich ging also rein und stellte mich den Leuten als deren neue Therapeutin vor; gab auch zu, dass es mein erster Job auf diesem Gebiet und ich noch ziemlich unerfahren sei. Über die Butterpreise zu reden – die ich im Übrigen noch nicht einmal gewusst hätte –, das war in dieser Stunde, wie auch in den vielen danach, nicht mehr nötig geworden. Das Eis brach auch so, ohne dass über Belangloses geredet werden musste.
Anfangs wurde mir von den Patienten sehr oft die Frage gestellt, wie alt ich überhaupt sei, wie lange ich schon arbeite und solche Dinge. Ich war schließlich gerade siebenundzwanzig und die meisten der Patienten oft doppelt so alt wie ich. Ich habe dann auch die Wahrheit gesagt, weil ich glaube, dass es nichts bringt, an dieser Stelle großen Raum für Spekulationen frei zu halten. Zumal ich ja sowieso nicht täuschen konnte und ohnehin nicht allzu erfahren aussah.
Mir fällt gerade auf, dass ich jetzt gar nicht mehr danach gefragt werde. Vielleicht wirke ich inzwischen etwas älter und reifer?
Na ja, ob man als junge Therapeutin von weitaus älteren Patienten akzeptiert wird, hat sicher nicht nur mit dem Alter, sondern gewiss auch mit der Ausstrahlung zu tun. Das hoffe ich jedenfalls. Und sicherlich auch damit, inwieweit es mir gelingt, deren Lebenserfahrung und Werte zu akzeptieren, zu schätzen und nicht zu sehr dogmatisch vorzugehen. Klappt sicherlich nicht immer. Neulich, da schrie mich ein emotional sehr instabiler Patient, den ich nur vom Sehen her kannte, aus meiner Vertretungsgruppe im Krisengespräch an. Er sei so wütend, dass er jetzt irgendwen zusammenschlagen könnte, brüllte er – und sprang dann plötzlich auf, im Begriff, hinauszurennen. Ich stellte mich ihm in den Weg, vor die Tür, wollte ihn abhalten vom Flüchten, wollte ihn beruhigen … Das hätte ins Auge gehen können, da er so stark emotional geladen war, dass es durchaus mich hätte treffen können. Ich konnte ihn dann doch dazu bewegen, sich wieder hinzusetzen und durchzuatmen – einfach, indem ich einen Stuhl nahm, mich nahe der Tür hinsetzte. Angst verspürte ich dabei nicht. In solchen Situationen bin ich meist sehr ruhig. Vielleicht, weil ich gespürt habe, dass ich etwas eigene Ruhe und Ausgeglichenheit auf den stark erregten Patienten übertragen kann? Den Umgang mit den Aggressionen der oft schwierigen, mehrfach gestörten oder einfach verbitterten Patienten finde ich nicht allzu leicht; auch, weil man manchmal Kränkungen erfährt, diese jedoch wohl kaum persönlich nehmen sollte. Theoretisch jedenfalls.
Schwierig ist meines Erachtens oft auch der Umgang mit narzisstischen Patienten, die annehmen, im Leben besonders viel mitgemacht zu haben, die auf der Karriereleiter schon hochgeklettert und dann wieder abgestürzt waren, und die vom Alter her mein Vater sein könnten. Diese haben dann gewiss ein Problem damit, wenn jemand, der so jung ist wie ich, vor ihnen sitzt. Die vielleicht denken: »Ach, Mädelchen, willst du nicht erst ein bisschen leben, bevor du jemandem wie mir etwas erklären willst?!«
Aber ich halte da meist nicht so sehr dagegen, weil ich mich nicht auf einen Machtkampf mit so jemandem einlassen will. Das würde die Fronten zwischen mir und dem Patienten nur verhärten oder sogar erst entstehen lassen. Stattdessen bestätige ich seinen Eindruck, nehme seine Gedanken versuchsweise vorweg und stimme dann erst einmal zu. So in dem Sinne: »Ja, sicher, Sie verfügen über weitaus mehr Lebenserfahrung als ich. Dass Sie skeptisch sind, kann ich gut verstehen; würde mir an Ihrer Stelle sicherlich genauso gehen. Kann auch wirklich sein, dass ich Ihnen gar nichts Neues beibringen kann. Aber ich will mich dennoch bemühen. Wollen wir es einfach miteinander versuchen?«
Also bestätigen und ein Angebot machen. Einen Versuch ist es wert, auch, wenn ich bisweilen etwas anderes denke als das, was ich ihm sage. Manchmal muss ich dann auch bewusst schauspielern, um den Kontakt zu einem besonders schwierigen Patienten aufbauen zu können. Das hätte ich früher nicht gedacht; ich nahm an, man müsse als Therapeut stets und besonders authentisch sein. Nur würde ich dann, so denke ich heute, gerade bei besonders schwierigen Patienten, wohl nur sehr schwer – vielleicht auch gar keine Arbeitsbeziehung aufbauen können.
Stichwort »Schauspielern«. Einmal saß mir ein ausgebildeter Schauspieler gegenüber, mit dem ich anfangs gar nicht gut zurechtkam. Alles, was ich sagte, hinterfragte er höchst theatralisch. Es war schon so ziemlich egal, was ich überhaupt fragte. Sämtliches kritisierte er in Grund und Boden in einer dramatisierenden, abwertenden und schließlich sogar beleidigenden Art und Weise. Irgendwann kochte ich innerlich. So endeten unsere Dispute schließlich damit, dass ich ihn letztlich aus dem Büro warf. Scheinbar ganz ruhig, aber innerlich schrecklich aufgeregt, da ich noch nie jemanden aus dem Zimmer geworfen hatte, mit der klaren Aufforderung: »So kann ich nicht mit Ihnen weiterreden; es bringt jetzt nichts. Gehen Sie jetzt bitte sofort aus meinem Büro!« Darüber war er offenbar total verblüfft, sodass er tatsächlich aufstand und widerspruchslos ging, und ich atmete erst mal tief durch.
Nach einer halben Stunde klopfte er wieder an. Da stand er vor mir und entschuldigte sich. Dies hätte ich ihm, der meinem Empfinden nach andere wissentlich kränkte und verletzte, nie zugetraut, und seit diesem Tag ging es deutlich besser in der Therapie mit ihm. Das hätte ich wiederum mir selbst auch nicht zugetraut.
Narzissmus – ja, das ist schon in etwa das, was man sich als Laie darunter vorstellt: ausgeprägte Selbstverliebtheit und Egoismus. Leute, die sich selbst in den Vordergrund stellen. Und die Menschen, von denen sie eine Gefahr wittern gegenüber ihrem eigenen Ego, entweder abwerten oder verspotten, also möglichst klein halten. Oder aber sie idealisieren die Menschen, von denen sie annehmen, sie seien auf gleicher Augenhöhe, und sie müssten zu ihnen aufschauen, zum Beispiel zu Therapeuten, die sie als Autorität akzeptieren. Und zu denen schauen sie dann auch auf. Wenn man sich diese Zusammenhänge ansieht, kann man vielleicht verstehen, weshalb man es als junge Therapeutin besonders schwer mit solchen Patienten haben kann.
Es kommt dann auch schon vor, dass ich nach der Arbeit in Gedanken jemanden mit »nach Hause nehme«. Wenn es 17 Uhr ist, ist mein Kopf oft unglaublich voll von den Inhalten der vier, fünf oder mehr intensiven Einzelgespräche, dazu noch Gruppenstunden, Vertretungsstunden und der »Schreibkram«. Manchmal überlagert sich dann alles und wirkt lange nach. Aber nach den 45 Kilometern heimwärts radeln habe ich das meiste schon weit hinter mir gelassen. Sehr wichtig finde ich auch fachlich hilfreiche und entlastende Gespräche mit meiner Supervisorin und Kollegen. So hat man trotz der persönlich sehr hohen Verantwortung nie das Gefühl, ganz allein in der Arbeit mit den Patienten zu stehen, kann die eigene Meinung hinterfragen und etwas Distanz zum Beispiel zu einem Konfliktgeschehen gewinnen.
Dennoch. Auf mein Privatleben hat mein Beruf natürlich auch Einfluss; auch, wenn ich die Psychotherapie zu Hause am liebsten ausblenden wollte. Aber ganz hinter mir lassen kann ich sie nicht. In meiner Partnerschaftsbeziehung möchte ich nicht Therapeutin sein; auch in der Verwandtschaft will ich keine therapeutischen Vorschläge machen müssen. Ich versuche, das eine vom anderen zu trennen, was mir manchmal selbst sehr schwerfällt. Besonders dann, wenn man selbst an die Grenzen psychischer Belastbarkeit gelangt. Vor allem damals, als der Verlobte meiner drei Jahre jüngeren Schwester als Berufssoldat im Mai 2003 in Afghanistan im Einsatz war, auf eine Panzermine fuhr und dabei getötet wurde. Damals hatte ich gerade erst ein paar Wochen meine neue Arbeitsstelle, und es war sehr schwer für mich, das alles zu ertragen. Meine Schwester zog für Monate zu mir, wollte nur, dass jemand da ist und bis in die Nacht hinein reden – oder, wenn es gar nicht mehr anders ging, mich vor Verzweiflung anschreien. Dabei stand auch noch der Vorwurf im Raum, ich sei doch Therapeutin, müsse doch schließlich auch ihr helfen können. Aber in diesen Momenten war ich nur noch Schwester und selbst schrecklich traurig, jemanden, den ich gemocht hatte, verloren zu haben; und jemanden, den ich lieb habe, so leiden zu sehen. Das hat mich schon ziemlich mitgenommen.
Ob ich es gut vor den Patienten verstecken konnte? Ich denke, ja. Auch wenn ich in dieser Zeit die Umwelt phasenweise nur noch wie »durch Watte« wahrgenommen habe. Und man ist dann oft verdammt dünnhäutig; kämpft mit den Tränen, wenn es um Themen wie Leben und Sterben geht. Einmal wurde ich in dieser Zeit als Diensthabende am Wochenende zu einer trauernden Krisenpatientin gerufen, die mir von ihrem 18-jährigen Sohn erzählte, der durch einen Unfall getötet worden war. Ich glaube, so schwer habe ich noch kein Gespräch empfunden. Es ist so, als ob man die eigene Befindlichkeit völlig abschalten muss, denn schließlich bin ich in dieser Situation Krisentherapeutin, und es geht nicht um mich. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Etwas in der Weise, dass ich das Geschehen entsetzlich finde, dass ich glaube, ihre Gefühle nachempfinden zu können und sie für ihren Mut lobe, hier zu sein, ihre Depression zu behandeln, um zu lernen, auch mit dem Verlust weiterzuleben, so verdammt hart das auch sein mag. Ich habe damals versucht, so gut, wie es mir möglich war, damit umzugehen, dass keiner meine Trauer merkt. Ich habe auch keinen Tag in der Arbeit gefehlt. Im Gegenteil: Das Reinknien in die Arbeit hat wenigstens noch abgelenkt. Ja, das war schon eine ziemlich schwere Zeit.
Ältere Schwester, Tochter, Freundin, das sind alles mir vertraute Rollen gewesen. Aber Therapeutin? Da musste ich erst »reinwachsen«. Manchmal reagieren Leute heute noch erstaunt, wenn sie hören, als was ich beruflich tätig bin. Und ich selbst musste mich auch erst daran gewöhnen. Ich weiß noch, wie ich am Anfang manchmal in den Einzelgesprächen quasi neben mir stand und dachte: »Wahnsinn! Jetzt sitzt du hier und sprichst mit deinem Patienten!« Es war schon irgendwie seltsam. Das, was ich mir nur sehr vage vorgestellt hatte, war wahr geworden. Und dass dies derart schnell gehen könnte, hätte ich zuvor nie geglaubt. Zuerst kam es mir etwas unwirklich vor; diese Phase hielt sogar eine ganze Weile an. Heute ist das zum Glück anders. Ich habe das Gefühl, in meinem Beruf angekommen zu sein.
Ich denke, man lernt mit jedem neuen Patienten hinzu, und vieles wird nach und nach einfacher. Was mir heutzutage manchmal noch schwerfällt, ist, dass ich mich ab und zu nicht genügend von meinen Patienten abgrenzen kann. Ich neige dazu, zu sehr emotional mitzugehen, Verständnis für ihre Bedürfnisse zu haben und sie dann in der Therapie zu sehr zu schonen. Das ist zwar angenehm für die Patienten, jedoch für deren Entwicklung ungünstig, weil es dann zu wenig Impulse für eine Veränderung gibt. Nun, so weit die Theorie. In der Praxis muss ich mir selbst bewusst machen, auf Spaltungen nicht einzugehen. Oder ich muss mir von meiner Supervisorin in Erinnerung rufen lassen, nicht schon wieder als Anwalt meiner Patienten aufzutreten, wenn sich zum Beispiel ein Patient über einen anderen Therapeuten beschwert oder irgendwelche Sonderregelungen haben will. Aber das kenne ich von mir, dass ich mich da manchmal spontan und ziemlich leidenschaftlich solidarisiere. Ich verstehe auch, dass ich dadurch manch anderen gegen mich aufbringe.
Kompliziert kann es auch dann werden, wenn Patienten für mich schwärmen oder sich sogar in mich verlieben. Manchmal stellt sich das ja erst zum Ende der Therapie so richtig heraus. Da kleben mal »Smileys« an meiner Bürotür, oder Patienten schreiben nach der Therapie lange Briefe oder rufen häufig an. Einmal war ein Patient besonders hartnäckig. Immer wieder schickte er Briefe und Karten mit Gedichten; rief an, um mich zum Kaffee einzuladen, bekundete mir seine ewige Liebe et cetera. Es schien nichts zu nützen, dass ich ihm sagte, dass ich dies nicht will. Ich versuchte dann, auf sehr förmliche und unaufgeregte Weise, ihm zu sagen, dass unser Kontakt sich nur auf kurze Nachbesprechungen, Fragen oder Krisen und Ähnliches beziehen kann, niemals auf Privates. Er konnte es einfach nicht verstehen. Wie auch! Schließlich hatte er zuvor in der Therapie meine ganze Aufmerksamkeit und zahlreiche positive Bestätigungen von mir bekommen. Und nun auf einmal gar nichts mehr. Da wurde er regelrecht zynisch, drohte, einen Rückfall zu bauen, um noch eine weitere Therapie machen zu können. Ich dachte bei mir, dass ich in diesem Fall alles tun würde, damit er nicht in meine Gruppe käme. Ich sagte ihm nur noch, dass ich unter diesen Bedingungen nicht mehr mit ihm darüber rede und legte auf. Offenbar hat es gewirkt, zumindest kam seitdem kein belästigender Anruf mehr. Nun, ich selbst nahm diese Erlebnisse zum Anlass, um mein eigenes Verhalten etwas mehr zu hinterfragen; um zu überlegen, welche Signale meinerseits möglicherweise von Patienten verzerrt wahrgenommen oder fehlinterpretiert werden könnten. Ich denke, dass es bisweilen schwierig sein kann, die Waage des optimalen Ausmaßes an Zuwendung und ausreichender Distanz zu halten.
Wir bekommen ja jeden Freitag die Rückmeldungen der Woche, eine Art Zensurenspiegel, oft mit Kommentaren der Patienten, die an einem Schwarzen Brett, öffentlich und für jeden lesbar, aushängen. Obwohl ich – bisher zumindest – gut abgeschnitten habe, empfinde ich dies als eine Art Pranger, was mich manchmal richtig unter Druck setzt.
Da kommen auch hin und wieder kleine Spitzen von Kollegen, die vielleicht lustig gemeint sein sollen. Beispielsweise, ob ich den Patienten Geld gebe, damit sie mich so toll bewerten. Das ist sicherlich scherzhaft gemeint, aber ein ernster Kern steckt dennoch drin. Und es fällt auf. Das muss ich aushalten lernen, auch, weil ich mich damit nicht wirklich wohlfühle. Ich finde es zwar schön, wenn Patienten meine Art der Therapie als hilfreich erleben, aber es muss doch nicht immer so herausgestellt werden! Das erinnert mich ein bisschen an früher, an meine Zeit im Leistungssport. Ich konnte ja ganz gut laufen, und ich kann mich auch anstrengen. Mein Trainer meinte nach den ersten beiden DDR-Spartakiade-Goldmedaillen über 800 und 1500 Meter zu mir, dass ich eigentlich kein Talent zum Laufen hätte. Aber ich könne mich quälen und hätte nur deshalb die Chance, zu gewinnen. Damals war ich 14 und wusste nicht so genau, wie ich diese Aussage bewerten sollte. Heute denke ich, dass eine solche Feststellung möglicherweise bei mir dazu geführt haben kann, dass ich meine eigene Leistungsfähigkeit, egal, in welchem Lebensbereich, ziemlich kritisch hinterfrage und ein gewisses Maß an persönlichem Engagement einfach bedingungslos voraussetze, immer unter der Annahme, dass ohne dies das Ergebnis weitaus schlechter wäre.
Später hatte ich schließlich eine ganze Kiste voller Medaillen; aber ständig zu hören von Lob, das empfand ich dann als zu viel des Guten. Ich glaube, dass ich jetzt ernst gemeintes und ehrliches Lob schon vertragen kann. Und auch selbst, zum Beispiel an meine Patienten, welches weitergeben kann. Da hat sich viel verändert.
Welchem Bild einer Therapeutin ich entsprechen möchte? Hm, schwer zu sagen.
Eine gewisse Seriosität sollte schon vorhanden sein, was sicherlich auch Auftreten oder die Kleidung beinhaltet. Ich möchte meinen Patienten vor allem aber Respekt und Achtung entgegenbringen. Ich glaube, das ist auch etwas, was Patienten schätzen. Natürlich darf auch gelacht werden; in einer humorvollen und warmherzigen Atmosphäre kann vieles auch viel leichter angenommen werden. Als Therapeutin darf man auch Fehler machen. So kann es durchaus sein, dass ich mich bei einem Patienten entschuldigen muss. Zum Beispiel, als ich einmal in meiner beruflichen Anfangszeit etwas in einer Gruppenstunde ansprach, was direkt mit einem bestimmten Patienten zusammenhing. Dieser war dann jedoch tief gekränkt, dass ich dies, ohne ihn zuvor zu fragen, vor den anderen angesprochen hatte. Ich hatte sein Einverständnis stillschweigend vorausgesetzt und somit einen klaren Fehler begangen, was ich auch sehr schnell selbst einsah. Es fiel mir dann auch nicht schwer, ihn um Verzeihung zu bitten.
Was mich eigentlich motiviert hat, diesen Beruf zu ergreifen? Nun, ich wollte Menschen in ihren Handlungen und Denkweisen besser verstehen, und ich wollte anderen Menschen helfen, die in eine Krise ihres Lebens geraten waren.
So, wie man mir auch einmal in einer Lebenskrise geholfen hat.
Damals war ich 18 Jahre alt, habe Leistungssport getrieben, war auch eine ziemlich erfolgreiche Mittelstreckenläuferin gewesen und hatte viele Medaillen gewonnen. Der Druck, die Schnellste und Beste zu sein, wie auch der Zwang, möglichst wenig zu wiegen, haben bei mir in eine Essstörung, eine Anorexie, geführt. Zuletzt wog ich nur noch 30 Kilo, stand kurz vor der Klinik und konnte auch nicht mehr rennen. Da half mir eine Therapie, um den Weg ins Leben zurückzufinden. Langsam, Schritt für Schritt. Was mir damals geholfen hat? Ich glaube, vor allem eine alternative Struktur und das Gefühl, verstanden und akzeptiert zu werden, so, wie man ist. Und zu schauen, was es sonst noch gibt; was das Leben wieder lebenswert macht, dass man wieder Freude empfinden und an alltäglichen Dingen des Lebens wieder teilhaben kann. Und dass man natürlich essen muss, wenn man leben will. Und dafür habe ich mich entschieden: Leben.
Deshalb denke ich, dass eine Therapie ganzheitlich, inklusive direkt an den Symptomen, arbeiten sollte. Als ich vorhin hierherfuhr, zu dir, kam ich an diesem Stadtpark vorbei, da fanden auch nach der »Wende« die ersten gesamtdeutschen Meisterschaften im Crosslauf statt. Das war mein letzter Wettkampf, den hatte ich auch noch mal gewonnen. Das sind Erinnerungen, die bleiben, wie die Fotos und Medaillen aus jener Zeit. Aber das ist jetzt alles vorbei.
Ob Psychologen alle ihr eigenes »Trauma« haben? Wer weiß. Nachgesagt wird es uns ja wohl. Aber vielleicht sollte man eher fragen: Welcher Mensch hat denn keins?!
Meines ist vielleicht die schlechte Behandlung durch meine Kindergärtnerin, die, wie alle anderen auch, nicht gewusst hatte, dass ich ziemlich schlecht höre. Konnte sie auch nicht, da ich ja schließlich sprechen konnte; das war übrigens auch für die Ärzte ein großes Rätsel. Dies kann für mich jedoch keine Entschuldigung sein. Mein Nichtreagieren wurde von ihr als Trotz und Widerwillen oder Ignoranz interpretiert, und sie strafte mit den ihr möglichen Mitteln: Anschreien, Einsperren, Aussperren, Durchschütteln oder zum Essen zwingen. Das ging über ein paar Jahre so. Irgendwann habe ich sie nur noch gehasst; vielleicht ist das Wort auch zu groß, aber da hat mich offenbar mein Kindheitstrauma am Wickel.
Und das konnte ich am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit als Psychologin im Umgang mit übermäßig kritischen, sehr fordernden, in meinen Augen »emotional kühlen« Frauen – vielleicht auch Männern – sicherlich noch nicht so genau orten: »Ach, da handelt es sich wieder um die Kindergärtnerin! Das ist also mehr mein Problem als das des Patienten.« Diese Dinge musste ich lernen, das eine vom anderen zu unterscheiden. Inzwischen, so denke ich, kann ich gelassener mit solchen Empfindungen umgehen und meine Erfahrungen im Umgang mit Patienten konstruktiver nutzen.
Das habe ich mir auch von älteren und erfahrenen Therapeuten abgeschaut. Dass man nicht gegen alles und jeden kämpfen und sich verteidigen muss, wenn einem etwas, von Patienten zum Beispiel, vorgeworfen wird und man sich verletzt fühlt. Besser den Ärger und die Skepsis aufgreifen und damit arbeiten. Das ist sicherlich weitaus fruchtbringender, und man bietet auch weniger Angriffsfläche. Manchmal habe ich dann aber auch das Gefühl, nun ganz im Gegensatz dazu, den interpersonellen Konflikten bisweilen etwas aus dem Wege zu gehen. Doch ohne durchaus auch konflikthafte und streitbare Impulse keine Veränderung. Das wäre so ein Punkt, an dem ich unbedingt noch arbeiten muss.
Den jeweils optimalen Weg zu finden, damit ich Menschen motivieren und letztlich helfen kann, ist eigentlich mein Ziel. Ich glaube, das kann ich gut hier in meinem Beruf lernen und anwenden. Und lernen zu arbeiten, ohne sich dabei selbst zu vergessen, mit meinen Eigenheiten – als Mensch.
Man bleibt dran am Thema.
»Mama, das kannst du nicht schreiben!«, sagt meine Tochter streng. »Dann nimmt dich keiner mehr ernst.« Gerade habe ich ihr erzählt, dass ich meinen Bruder aus einem früheren Leben getroffen habe. Dieser Eindruck entstammt keiner Religion oder spirituellen Überzeugung. Nichts Esoterisches. Einfach ein sicheres Gefühl, irgendwo tief drinnen, unter meinem Bauchnabel. Es stellte sich sofort ein, als ich Ralf auf mich zukommen sah. »Ich kenne ihn.« Und er »kannte« mich, wie sich später herausstellen sollte. Dabei waren wir uns nie zuvor begegnet, jedenfalls in diesem Leben nicht. Da ist kein Zweifel möglich.
Meine Freundin Blanka teilt Männer ein in »Vater«-männer, »Bruder«-männer und – na ja, die anderen eben, die erotisch summenden Männer. Warum fällt mir das gerade jetzt ein? Ralf scheint gerade vom Einkaufen zu kommen, wie er da alterslos jung und fröhlich winkend auf mich zu federt. Ich stehe wartend im Eingang des Altbaus am Berliner Prenzlauer Berg, direkt gegenüber der geschichtsträchtigen Kirche, die in meiner Biografie auch einmal eine Rolle gespielt hat. Jetzt freue ich mich, dass er »es« wirklich ist, mein Gesprächspartner. Psychotherapeut mit eigener Praxis, in die Models, Ärzte, Studenten und Wirtschaftskapitäne gleichermaßen kommen. Vertraut und unglaublich sympathisch ist mir Ralf mit seinen schwarzen Augen und der jungenhaft-weisen Aura. Ein Bruder-Mann, kein Zweifel.
Ohne ihn würde ich nie in den engen Fahrstuhl steigen, der uns in die gemütliche Dachwohnung voller Nischen, Podeste und gekrönt von zwei Wintergärten bringt. Mit ihm fühle ich mich sicher. Der Mann hat Stil, und auch das verbindet uns. Ich liebe unaufdringliche Gentlemen. Wir nehmen Platz am Esstisch, wegen der sachlicheren Atmosphäre da. Wie wir einander gegenübersitzen, könnten wir auch ein dichtendes Geschwisterpaar aus dem 18. Jahrhundert sein. Sorry, Töchterlein, das Bild ist zu klar, um unerwähnt zu bleiben. Zwei zarte Seelen auf einer Großstadtinsel. Mein Mikrofon wirke »wie eine Waffe« auf ihn, sagt Ralf ohne Vorwurf. Er findet Wege, es aus seinem Blickfeld auszuschneiden; das Gerät zu ignorieren. So driften wir in ein Gespräch.
Weltreisen nach innen und nach außen
Ralf, 42
Tja, was hat dazu geführt, dass ich kein Poet geworden bin, sondern ein Psychotherapeut? Ehrlich gesagt, nur ein Kreuz im Vorlesungsverzeichnis, in dieser Anmeldephase. Ursprünglich wollte ich eigentlich Biologe werden, Spezialisierungsrichtung Botanik. Ich hatte vorbereitend darauf sogar eine Gartenbaulehre gemacht und wollte dann über ein praktisches Gartenbauingenieursstudium zum Biologiestudium kommen. Irgendwie sah ich immer meine Erfüllung in der Beschäftigung mit Pflanzen. Mir wurde aber klar, wenn ich in diesem Beruf Fuß fassen wollte, hieße das auch: Reisen, begrenzt natürlich auf den riesigen Raum des sozialistischen Wirtschaftssystems. Die interessantesten Naturgebiete hätten für mich in Sibirien, in der Sowjetunion, gelegen, also musste ich zunächst Russisch lernen, über das hauptsächlich die Verständigung lief. Aufbauend auf den intensiven Russisch-Schulunterricht begann ich also Sprachen zu studieren, Russisch und Englisch, immer noch mit Blick auf die Biologie, bin dann aber immer mehr von meinem Weg abgekommen. Einfach auch dadurch, dass ich in die unterschiedlichen Kulturen hineingezogen wurde, in die Verschiedenartigkeit von Menschen. So begann mich die Psyche mehr und mehr zu interessieren, das, was zwischen Menschen abläuft. Und dann kam sowieso alles anders: Ich flüchtete nämlich ein Jahr vor dem Mauerfall aus der DDR in die Bundesrepublik, nach Hamburg. Über die vielfältigen Gründe sage ich später noch etwas. Und dort, im Westen, hörte ich dann so ziemlich als Erstes: »Mit Sprachen kann man kein Geld verdienen, und schon gar nicht mit Russisch.« Ich war vierundzwanzig und bekam natürlich einen Schreck. »Oh, Mist, was mache ich denn jetzt?« Ich war schon zu weit weg von der Biologie, und meine Sprachen wurden entwertet. Meine Zukunftspläne, die ich bis dahin gehabt hatte, waren zerplatzt, und der plötzliche Zusammenfall meiner inneren Neigungen mit den vielen äußeren Umsetzungsmöglichkeiten verwirrte mich. Eine Entscheidung zugunsten einer dieser vielen Möglichkeiten hätte einen Verzicht auf den Vorteil der jeweils nicht getroffenen Entscheidung zur Folge gehabt. Und irgendwann lag dann eben dieses Uni-Formular vor mir, und ich schaute es an: »Wie, ich soll jetzt sagen, was ich studieren will, von diesen dreißig, vierzig Fächern?« Was für eine unglaubliche Auswahl!
Und ich war so ein Allrounder, ein Multitalent. Ich hätte alles Mögliche studieren können – und am liebsten auch wollen. Aber aus Kräftegründen ging das natürlich nicht, also ging ich ganz naiv die Liste durch – weil ich Mathe gehasst habe –, nach dem Hauptkriterium: »irgendein Studium ohne Mathematik «. Na ja, und wahrscheinlich ganz instinktiv machte ich dann mein Kreuz bei »Psychologie«. Mit Menschen konnte ich ganz gut reden, dachte ich. Als würde das Psychologiestudium nur aus Reden und Gesprächsführungskursen bestehen. Also ziemlich unreflektiert entschied ich mich. Um dann recht schnell hinten rüber zu kippen, als mir klar wurde: Das war eines der härtesten Studien, die ich mir überhaupt hätte aussuchen können – und von wegen »ohne Mathematik«! Ein Hauptbestandteil bei Psychologie ist ja die Statistik. Also genau das, was ich ganz bestimmt nicht wollte, damit haben sie mich im Grundstudium zugeschüttet. Das alles muss man vor der ungeheuren Komplexität eines Menschenlebens verstehen, das versucht, sich auf allen Ebenen gleichzeitig in einer völlig fremden Welt einzugliedern. Ich weiß gar nicht, ob das heute überhaupt noch jemand versteht, was das hieß, parallel Wohnungsprobleme, beruflichen Einstieg und extrem ungewohnte Gepflogenheiten im gesellschaftlichen Umgang zu lösen, gewissermaßen in einem frei gewählten Exil wirklich auch anzukommen. Aber wie auch immer, ich begann also mit meinem Psychologiestudium und nahm die ganze Statistik eben mit in Kauf.
Ich kann es gut verstehen, dass er völlig andere Erwartungen hatte: Ran an den Patienten, sechs Jahre lang Gespräche führen, Charaktere kennenlernen und erforschen, Menschenkenntnis erwerben. Dass es nicht ansatzweise so war, hat ihn regelrecht krank gemacht.
Ich habe mich wirklich durch existenzielle seelische Krisen gewälzt. Habe jahrelang nur Verständnisfragen gestellt: »Leute, was macht ihr hier eigentlich?« Das ging so weit, dass ich schon Kopfschmerzen bekam, wenn ich die Uni bloß sah. Also, ich reagierte schon psychosomatisch. Das war meine Angst vor diesem mit Mathematik überfrachteten Grundaufbau dieses Studiums. Du konntest dich ja nicht mal davor drücken, denn wenn du das nicht verstanden hattest, verstandest du die darauf aufbauenden Fächer ebenfalls nicht.
Mir ging es ja nicht alleine so. Wir haben alle zusammen gejammert und uns mehr in der Cafeteria getroffen als im Hörsaal. Das führte dazu, dass wir die Statistik wiederholen mussten, bis wir durch die Prüfung durch waren, bis wir durch dieses Nadelöhr endlich durch waren. Aber irgendwie habe ich es dann doch geschafft. Allerdings nur über eine Ruhepause. Ich bin nämlich nach Australien gegangen.
In Gedanken hänge ich immer noch an Ralfs Ausreise aus der DDR. Ich frage ihn nach den Umständen – die in allen Einzelheiten ein Drittel seiner Memoiren füllen würden. Trotzdem: Irgendwie muss ich das für mein besseres Verständnis klären, bevor wir uns gemeinsam auf die große Reise nach down under machen.
Meine Flucht aus der DDR war auf gar keinen Fall in erster Linie politisch motiviert.
Ich bin ein Mensch, der einfach gern reist und entdeckt. Ich hatte schon so viel gesehen, mehrmals den gesamten Ostblock, dass ich eines Tages gesagt habe: »Das hängt mir zum Halse raus, so schön es auch in Polen, Bulgarien, in der Tschechoslowakei ist. Jetzt möchte ich mal etwas anderes sehen.« Für andere Leute war das bestimmt nicht nachvollziehbar. Leute, die vielleicht auch gern mal in die Sowjetunion gefahren und damit zufrieden gewesen wären, aber weder Zeit, Gelegenheit noch Kraft investieren wollten, so eine Reise zu organisieren. Ich habe einfach fleißig immer meine Anträge abgegeben und konnte das über das Reisebüro »Jugendtourist« auch alles machen. Dadurch habe ich schon zu Ostzeiten irre viel gesehen und vor allem auch erlebt. Und das ist so ein entscheidender Punkt. Denn heute, rückblickend, muss ich leider sagen: Ich bin inzwischen Weltreisender. Von der Südsee über Asien bis Südafrika war ich quasi überall, aber ich erlebe es nicht mehr so. Irgendetwas fehlt. Früher habe ich die Reisen intensivst erlebt, wahrscheinlich auch, weil sie einen hohen Wert hatten. Die Freude darüber, eine bekommen zu haben, oder zwei im Jahr. Das war alles mit langen Vorbereitungen verbunden, dann mit Eintauchen in eine fremde Kultur; mit einer Nicht-Diskriminierung von fremden Kulturen, mit einem Sich-Annähern an andere Lebensstile. Ich habe vielleicht sogar die Sprache gelernt, damit ich mich verständigen konnte. Und das ist heute alles nicht mehr so. Heute ist es eine Draufsicht; wahrscheinlich auch, weil man als Angehöriger der Ersten Welt, mit einer starken Währung in der Tasche, in die Dritte Welt fährt und nicht mehr so sehr auf den direkten Kontakt mit den Menschen angewiesen ist.
Ich kann nur hoffen, dass Ralf die Geschichte seiner DDR-Flucht irgendwann einmal aufschreibt, denn allein die Szene, wie seine Mutter reagiert hat, als er sie aus Hamburg anrief, um ihr zu verkünden, er sei nun auf der anderen Seite, die ist filmreif. Paradoxerweise zitierte sie ihn nämlich »sofort nach Hause zu mir, zum Kaffeetrinken. Es gibt Pflaumenkuchen.« Selbst Mutter eines 24‑Jährigen würde ich die Hand für mich nicht ins Feuer legen, wären das mein Sohn und dieselbe Situation gewesen. Kein Mensch konnte ja ahnen, dass Ralf schon Weihnachten ein Jahr später wieder zum Kaffee zu Hause bei Muttern sitzen würde. Nun aber Australien. Wieso ausgerechnet so weit weg fliegen, nur um der Statistik im Psychologiestudium zu entfliehen?
Es war ja nicht nur die Statistik. Das, was mir zum Hals raushing und mir unglaublichen Stress gemacht hat, war ja so vielschichtig. Dieses Zusammenge-würfeltsein von Ost und West, zum Beispiel. Das war ja etwas, das kaum vergleichbar gewesen ist mit irgendetwas davor oder danach in beiden deutschen Teilstaaten. Damit als angehender Psychologe klarzukommen, das verlangte mir schon einiges ab. Dieses sich Zusammenraufen und einander Beäugen: Wer spricht wie? Was meint er, wenn er das so sagt? Wie wir in unserer Generation ein und denselben Gegenstand vor abweichendem biografischem Hintergrund verschieden be-deuteten, das war sehr spannend, sehr nervenaufreibend und führte häufig auch zu Missverständnissen. Den Grund dafür sehe ich in stilistisch und emotional unterschiedlichem Gebrauch von Wörtern.
Ein Beispiel: die 68er-Bewegung. Die Westler sprachen laufend davon, und dann geriet ich auch in so eine Post-68er-Bewegung hinein, die Seminare be-streikte, Methoden bekriegte, Lehrkräfte anzweifelte – und ich wusste teilweise gar nicht: »Was wollen die eigentlich?!« Ich saß in völlig überfüllten Hörsälen, die vielleicht für zwanzig, dreißig Leute konzipiert waren, aber plötzlich um die zweihundert Studenten fassen mussten. Für mich als Ex-DDR-Bürger war das ein Schock, wie man so Unterricht betreiben konnte. Dass auch nicht alle am Punkt A gemeinsam starteten und am Punkt Z gemeinsam ankamen, als komplette Seminargruppe, sondern dass die Leute ständig wechselten und unterschiedlich lange brauchten für ihr Studium. Auf einmal vertrat ich in den Augen einiger Kommilitonen eine »konservative« Meinung und konnte emotional noch gar nicht erfassen, was das überhaupt heißen sollte. Intellektuell war mir das klar, aber ich verstand einfach nicht, weshalb man Menschen so unterschiedlich kategorisieren sollte. Diese ewige Einordnung: »Du bist links, du bist rechts, du bist extra rechts, weil du das-und-das gesagt hast«, die ging mir maßlos auf die Nerven. Ich konnte diese enorme Diskriminierung und Unterscheidung untereinander in Gruppen, und Grüppchen vom Gefühl her überhaupt nicht nachvollziehen.
Und so entstand ein unglaublicher Stresspegel in mir, der nichts mit dem eigentlichen Studiengegenstand zu tun hatte. Dieser enorme Existenzdruck auch, allein schon bei der Wohnungssuche auf einem überfüllten Markt. Und bevor ich das benennen konnte, was ich da im Grunde gefühlt hatte – Existenzangst nämlich, die ich vorher überhaupt nicht gekannt hatte –, da vergingen zwei Jahre. Na ja, und aus diesem ganzen Tohuwabohu heraus habe ich nach zwei Studienjahren entschieden: »Ich halte das nicht mehr aus. Ich muss hier weg!«
Nicht sofort nach Australien, erfahre ich, sondern erst einmal wieder zurück, nach Ostberlin, an die Humboldt-Universität. Während der Wendewirren schrieb Ralf sich dort für Psychologie und parallel für Medizin ein und erlebte ein wesentlich geordneteres Studieren als im Westen. Nach drei weiteren Semestern beschloss er dann für sich den Wechsel des Horizonts.
Mir war einfach alles zu viel. Die beiden Studiengänge, die Wende, die Konfusion der zwei deutschen Staaten untereinander. Das war ja alles in Bewegung, im Fluss, in einer Wahnsinns-Energie. Und da dachte ich: »Weg hier! Und möglichst weit weg.« Ich wollte eigentlich nach Neuseeland oder Südafrika, wo ich sogar schon einen Studienplatz hatte. Ich bin extra noch an die Uni gegangen, habe einen Englisch- und Holländisch-Kurs gemacht, um dort alles verstehen zu können. Danach absolvierte ich sogar einen sogenannten Toefle-Test, die Grundvoraussetzung, um in angloamerikanischen Ländern studieren zu dürfen. Diesen Test habe ich als Ex-DDR-Bürger sehr gut hin-bekommen. Ich hatte die volle Punktzahl und bekam meinen Studienplatz in Kapstadt. Ich war sehr glücklich. Allerdings war das kurz nach der Beendigung des Apartheidsregimes, und es gab plötzlich Rassenunruhen. Mir wurde empfohlen, mich nach einer Alternative umzuschauen, weil keiner mehr für meine Sicherheit garantieren konnte. Ich konnte das gut verstehen, weil das Land jetzt im Aufbruch war und dessen Zukunft ungewiss. So wurde es dann Sydney in Australien. Innerhalb einer halben Woche klappte das mit diesem neuen Studienplatz. Und das war auch keine große Aktion: Entscheidend waren der Toefle-Test und Geld. Geld im Sinne von exorbitant hohen Studiengebühren pro Semester. Irgendwie war es völlig verrückt, weil dieses Schul- und Studiensystem wiederum in vielen Bereichen dem DDR-Studiensystem sehr glich. Straffe Führung, Disziplin, begrenzte Auswahl an Fächern pro Semester, dafür aber strukturiert und in die Tiefe gehend. Es mag auch mit daran gelegen haben, jedenfalls kam ich dort unten dann erst zur Ruhe. Erst in Sydney habe ich die Wiedervereinigung verkraftet und aus dem Abstand heraus so halbwegs verstanden. Und das Chaos ordnete sich langsam.
Immer, wenn meine westdeutschen Freunde mich heute belehren: »Nun mach aber mal halblang! Den Osten und den Westen gibt es doch heute gar nicht mehr!«, dann stößt mir etwas bitter auf. Ralf erinnert mich wieder daran, dass da etwas sehr Einschneidendes, Elementares für die verletzliche menschliche Seele geschehen ist, das erst einmal verkraftet werden muss. Ein Prozess, der bei vielen Menschen möglicherweise immer noch nicht abgeschlossen ist. Kann jemand, der in Bayern oder im Saarland ohne große Brüche gelebt hat, da überhaupt mitreden? Es berührt so viele Themen, Eigenschaften und Ebenen. Ralf und mich wundert es jedenfalls nicht, dass die gegenseitige Annäherung immer noch im Gange ist.
Wir waren in Australien eine Gruppe aus Ostdeutschen und Westdeutschen, die miteinander eine Wiedervereinigung im Kleinen geprobt haben. Schon dadurch, dass wir zusammen wohnten, morgens über den Flur liefen und furzten; dass wir viel redeten und uns auf neutralem Boden befanden, das hat uns geholfen, einander besser kennenzulernen und zu sehen: So verschieden sind wir ja gar nicht. Aber wir waren uns auch darin einig: »So zehn, fünfzehn, zwanzig Jahre wird es wohl locker dauern, bis aus Ost und West ein Ganzes werden wird.«
Und so erlebe ich das jetzt: dass wir miteinander, durch die gemeinsamen Schwierigkeiten, heute in etwas Neues hineinwachsen.