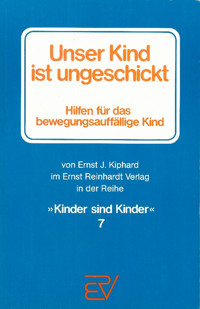
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Kinder sind Kinder
- Sprache: Deutsch
Es gibt eine ganze Reihe von Fachbüchern über Bewegungsstörungen bei Kindern. Sie sind jedoch für Eltern im allgemeinen weder zugänglich noch verständlich. In dieser Elternfibel wird auf schwierige Fachausdrücke verzichtet. Statt dessen sollen die Probleme des Kindes anhand von Beispielen verdeutlicht werden. Vor allem geht es darum aufzuzeigen, was man gegen Bewegungsstörungen tun, welche konkreten Hilfen man anbieten kann. So ist es das Anliegen des Autors, durch verständliche Informationen mehr Verständnis für die Schwierigkeiten des bewegungsauffälligen Kindes zu erreichen. Das gilt in erster Linie für die Eltern als diejenigen, welche zuerst mit den Problemen ihrer Kinder konfrontiert werden. In zweiter Linie geht es darum, Erzieher und Lehrer zu informieren, damit der Lebensweg dieser Kinder nicht zu einem Leidensweg wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 91
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ernst J. Kiphard
Unser Kind ist ungeschickt
Ernst J. Kiphard
Unser Kind ist ungeschickt
Hilfen für das bewegungsauffällige Kind
Vierte, aktualisierte Auflage
Ernst Reinhardt Verlag München Basel
Prof. Dr. Ernst J. Kiphard, Dipl.-SportlehrerGinnheimer Sladtweg 119, 60431 Frankfurt
Cip-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Kiphard, Ernst J.:
Unser Kind ist ungeschickt : Hilfen für das bewegungsauffällige Kind / Ernst J. Kiphard. – 4., aktualisierte Aufl. – München; Basel : E. Reinhardt, 1996
(Kinder sind Kinder ; Bd. 7)
ISBN 3-497-01404-4
NE: GT
ISSN 0720-8707
© 1996 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt, GmbH & Co, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in Germany
Inhalt
1.Einleitung
2.Wie sich Ungeschicklichkeit zeigt
2.1.Bewegungsentwicklungsverzögerung
2.2.Mangel an Bewegungskontrolle
2.3.Das schlaffe Kind
2.4.Das steife Kind
2.5.Das verspannte Kind
2.6.Das zappelige Kind
3.Welche Ursachen zugrunde liegen können
4.Folgen und Auswirkungen - und was man dagegen tun kann
5.Wie man Ungeschicklichkeit feststellt
6.Harald fürchtet sich vorm Sportunterricht
7.Unser Max traut sich nichts zu
8.Luise, das Heimkind
9.Heiner hat eine 5 im Turnen
10.Warum Reinhard plötzlich so ungeschickt ist
11.Warum Annegret eine so schlechte Schrift hat
12.Ferdinand ist Linkshänder
13.Irmgard hat Augenbewegungsprobleme
14.Klaus-Dieter kann nicht stillsitzen
15.Warum ist Andreas nur so unpraktisch?
16.Ungeschick als Ursache für Verhaltensstörungen
17.Wie Eltern ihren Kindern helfen können
18.Ein kleines Übungsprogramm
Übungsanregungen für 2jährige
Übungsanregungen für 3jährige
Übungsanregungen für 4jährige
Übungsanregungen für 5jährige
Übungsanregungen für 6jährige
Übungsanregungen für 7jährige
Übungsanregungen für 8jährige
Übungsanregungen für 9jährige
Übungsanregungen für 10jährige
Weiterführende Literatur
Hersteller und Vertriebe von Geräten
1 Einleitung
Es gibt eine ganze Reihe von Fachbüchern über Bewegungsstörungen bei Kindern. Sie sind jedoch leider für Eltern im allgemeinen weder zugänglich noch verständlich. Das darin gebrauchte Vokabular, das zumeist lateinischen oder griechischen Ursprungs ist, setzt Fachkenntnisse voraus, wie sie nur bei Experten zu erwarten sind. Da wird, statt von Bewegung, von Motorik gesprochen, und die Fachleute heißen dementsprechend Motologen, Motopäden, Motopädagogen oder Mototherapeuten.
In dieser Elternfibel wird auf schwierige Fachausdrücke verzichtet. Statt dessen sollen die Probleme des ungeschickten Kindes anhand von Beispielen verdeutlicht werden. Vor allem geht es darum, aufzuzeigen, was man dagegen tun, welche konkreten Hilfen man anbieten kann.
Fragen wir uns aber zunächst einmal, was unter Bewegungsungeschick zu verstehen ist und welche Ursachen dabei eine Rolle spielen. Auch soll aufgezeigt werden, welche Folgen und Auswirkungen die Ungeschicklichkeit für die Entwicklung des Kindes haben kann. Und schließlich wird es Eltern interessieren, wie man Bewegungsstörungen erkennen kann und welche Fachleute dabei zu Rate gezogen werden können.
Am Schluß des Büchleins findet der Leser altersbezogene Übungsvorschläge für die häusliche Situation mit Hinweisen auf einfach herzustellende Materialien und Geräte.
So ist es das Anliegen des Autors, durch entsprechende Information mehr Verständnis für die Probleme des bewegungsauffälligen Kindes zu erreichen. Das gilt in erster Linie für Eltern als diejenigen, welche zuerst mit den Problemen ihrer Kinder konfrontiert werden. In zweiter Linie geht es darum, Erzieher und Lehrer zu informieren, um auch sie zum Anwalt dieser Kinder zu machen, damit ihr Lebensweg aufgrund einer mehr oder weniger ausgeprägten Bewegungsbeeinträchtigung nicht zu einem Leidensweg wird.
2 Wie sich Ungeschicklichkeit zeigt
2.1.Bewegungsentwicklungsverzögerung
Ungeschickte Kinder bleiben in ihrer Bewegungsentwicklung hinter der Altersnorm zurück. Sie lernen verspätet laufen, manchmal erst mit 1½ Jahren oder später. Vor allem bleiben sie länger als andere Kinder gleichen Alters unsicher bei ihren Unternehmungen innerhalb der elterlichen Wohnung. Sie haben beispielsweise Angst, auf Stühle oder Leitern zu klettern. Beim Treppensteigen halten sie sich viel länger als ihre Altersgenossen am Geländer fest. Sie gebrauchen dabei lange Zeit hindurch ihre Füße nicht im Wechsel, sondern setzen immer das gleiche Bein vor und ziehen das andere nach. So vollzieht sich die motorische (bewegungsmäßige) Umwelteroberung insgesamt langsamer als bei anderen Kindern.
2.2.Mangel an Bewegungskontrolle
Wenn ein Kind Schwierigkeiten hat, seinen Körper im Gleichgewicht zu halten und seine Bewegungen zu kontrollieren und zu steuern, dann sagt man: dieses Kind ist ungeschickt. Es wird beispielsweise öfter beim Laufen stolpern und hinfallen, als das andere Kinder im gleichen Alter tun.
Man bezeichnet solchermaßen ungeschickte Kinder auch als koordinationsgestört. Unter Koordination versteht der Fachmann das Zusammenwirken von Nerven und Muskeln bei einer Bewegung. Diese Fähigkeit ist beim Kind altersabhängig. Ein jüngeres Kind ist noch nicht in der Lage, seine Muskeln so fein abgestimmt, d. h. koordiniert zu gebrauchen, wie das einem älteren Kind bereits möglich ist.
Beim ungeschickten Kind ist die Bewegungskoordination jedoch gestört. Seinen motorischen Unternehmungen haftet etwas Tapsiges, Steifes, Eckiges an. Manche dieser Kinder sind schwerfällig, plump, unbeholfen und umständlich. Andere wieder bewegen sich fahrig und hastig und sind nie richtig bei der Sache. Im einzelnen kommen folgende Erscheinungen vor:
2.3.Das schlaffe Kind
Müttern fällt zuweilen schon im Babyalter die muskuläre Schlaffheit ihres Kindes auf. Es ist kraftlos und wabbelig wie Pudding und wirkt dadurch träge und faul. Für den gewissenhaften Kinderarzt ist dieses Erscheinungsbild Anlaß zu einer genauen körperlichen und neurologischen Untersuchung.
Es gibt aber auch Kinder, bei denen dieser Kraftmangel nur gering ist und deshalb lange unerkannt bleibt. Er fällt erst auf, wenn sie beim Hüpfen und Springen Schwierigkeiten haben. Ihnen mangelt es an Schnellkraft. Auch beim Laufen fehlt es oft an Spritziekeit. Sie sind in allem langsam und lahm.
2.4.Das steife Kind
Steifheit, Staksigkeit und Tolpatschigkeit sind geradezu typische Zeichen des kindlichen Ungeschicks. Die Bewegungen solcher Kinder verlaufen kantig, eckig, holperig, linkisch und ruckhaft, mit abrupten Übergängen. Man sieht das vor allem beim Laufen, Springen, Werfen, Klettern, d. h. bei allen großräumigen Bewegungsvollzügen. Steife Kinder verfügen – anders als das schlaffe Kind – über genügend Kraft. Es fehlt ihnen aber an Gelenkigkeit, Gewandtheit und Wendigkeit. Ihre Bewegungen sind nicht flüssig und abgerundet. Sie sind, statt durch Weichheit, durch Härte und Eckigkeit gekennzeichnet.
2.5.Das verspannte Kind
Die höchste Form der Verspanntheit ist die Verkrampfung, wobei man unwillkürlich an Spastiker denkt. Während schwere Spastik schon im Säuglingsalter deutlich erkennbar ist, gibt es eine leichte Form, die sogenannte Minimalspastik. Sie wird leider leicht übersehen. Mitunter zeigt sie sich erst, wenn das Kind Treppen steigt, auf einem Bein hüpft oder schnell zu rennen versucht und sich dabei besondere Mühe geben will.
Im Schulalter fallen diese Kinder durch Verkrampfungen beim Halten des Schreibstiftes auf. Durch das starke Anpressen der Finger werden die Fingerkuppen ganz weiß. Der Schreibdruck nimmt ständig zu. Die Schrift will nur langsam vorangehen. Das Kind kommt beim Diktatschreiben in Zeitnot, wodurch es sich nur noch mehr verkrampft. Verspannung ist somit letztlich auch Ausdruck von Ängsten und Hemmungen. So ist das ungeschickte Kind häufig auch ein zaghaftes, unsicheres und ängstliches Kind. Körperliches und Seelisches beeinflussen sich hier gegenseitig.
2.6.Das zappelige Kind
Wir alle kennen sie: diese von innerer Unruhe getriebenen, rastlosen und »wibbeligen« Kinder. Sie sind ständig in Bewegung, können nicht stillsitzen und scharren beim Sitzen mit den Füßen unruhig über den Boden. Der stuhlkippelnde »Zappelphilipp« ist seit dem Struwwelpeter-Buch allgemein bekannt. Die nervöse Bewegungsunruhe ist ein pädagogisches Problem von höchster Brisanz, an dem oft Eltern und Erzieher gleichermaßen verzweifeln. Es wird deshalb in einem gesonderten Kapitel (»Klaus-Dieter kann nicht stillsitzen«) noch darauf eingegangen.
Das unruhige Kind zeigt, wenn man von seiner Zappeligkeit einmal absieht, keine so deutlichen Bewegungsauffälligkeiten, wie wir das von anderen Erscheinungsbildern der Ungeschicklichkeit her kennen. Es ist im allgemeinen flink und wendig und klettert gewandt überall herum. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß diesen Kindern die »Feinsteuerung« ihrer Bewegungen schwerfällt. Das zeigt sich z. B. beim Balancieren, beim Trampolinspringen und vor allem auch bei handgeschicklichen Leistungen, so beim Basteln, Malen, Ausschneiden usw. Man spricht hier von einer feinmotorischen Koordinationsstörung.
Manche dieser nervlich »überdrehten« Zappelphilippe leiden außerdem an eigenartigen Zuckungen, die nicht ihrem Willen unterworfen sind. Selten handelt es sich dabei um Tics. Während die zuckenden Bewegungen beim Tic immer in gleicher Weise ablaufen, treten hier die Zuckungen unregelmäßig und an verschiedenen Körperteilen auf. Man kennt Gesichtszuckungen (unwillkürliches Grimassieren), aber auch in den Arm- und Schulterbereich förmlich einschießende unkontrollierte Impulse. Letztere ähneln manchmal den beim Veitstanz auftretenden Extrabewegungen. Obwohl sie im Grunde nichts mit dem eigentlichen Bewegungsablauf zu tun haben, können sie die motorische Koordination doch erheblich stören. Ähnlich verhält es sich mit leichten unbeabsichtigten Gliederverdrehungen und wurmartig gewundenen, zähflüssigen Extrabewegungen, die – wie die Zukkungen auch – die mimische Muskulatur des Gesichts nicht verschonen.
3. Welche Ursachen zugrunde liegen können
Wie das Beispiel des verspannten Kindes gezeigt hat, wirken oft körperliche und seelische Ursachen zusammen. Zaghaft-ängstliches Verhalten hindert das Kind daran, seinen Körper und seine Hände umwelterobernd zu gebrauchen. Und wenn es sich tatsächlich überwindet und trotz seiner Angst einen Versuch wagt und z. B. über einen Balken oder eine Mauer balanciert, so wirkt sich seine starke Muskelverspannung behindernd aus. Hier liegt die Ursache des Bewegungsungeschicks im Psychischen begründet. Vielleicht hat das Kind früher einmal schmerzliche Erfahrungen gemacht, ist irgendwo heruntergefallen oder von anderen gehänselt oder ausgelacht worden.
Wie die später noch zu schildernden Fallberichte zeigen werden, gibt es weitere Gründe für die Entstehung der Ungeschicklichkeit im Kindesalter. Selbstverständlich wirken sich längere Krankheiten, Heimaufenthalte oder andere ungünstige soziale Situationen negativ auf die Bewegungsentwicklung aus. Es fehlt dann an altersgemäßer Auseinandersetzung mit der Umwelt über entsprechende Bewegungserfahrungen. Auch können im Einzelfall Begabungsmängel eine Rolle spielen, welche in körperlichen Krisenzeiten (Längenschub) noch verstärkt werden können.
Als organische Ursache für Bewegungsmängel sind häufig leichte, oft unerkannte Funktionsstörungen des Gehirns verantwortlich zu machen. Solche leichten Beeinträchtigungen der Gehirnfunktion können durch medikamentöse oder andere Einwirkungen während der Schwangerschaft bzw. durch Sauerstoffmangel bei der Geburt entstehen oder durch eine im ersten Lebensjahr durchgemachte Infektion mit begleitender Hirnentzündung verursacht werden. Die Diagnose MCD (Minimale Cerebrale Dysfunktion) stützt sich allerdings oftmals mehr auf vage Vermutungen als auf konkrete neurologische Befunde.
Funktionsstörungen des kindlichen Gehirns beschränken sich im wesentlichen auf die älteren Stammhirnanteile. Da zumeist keine Schädigung der Hirnrinde zugrundeliegt, erleidet die Intelligenz dieser Kinder im allgemeinen keine Einbuße. Bei an sich guten geistigen Fähigkeiten leiden sie aber an Lern- und Verhaltensstörungen. Ihre geringe Konzentration, ihre Ablenkbarkeit und schnelle Ermüdbarkeit, gepaart mit schlechter Gefühlssteuerung und Verhaltenskontrolle, läßt sie oft in der Schule versagen und zum Problemkind werden.
Wir erkennen aus dem bisher Gesagten schon den Zusammenhang zwischen Bewegungsstörungen, Lern- und Verhaltensstörungen. Als Grundursache sind häufig hirnorganische Funktionsbeeinträchtigungen, sogenannte cerebrale Integrationsstörungen anzunehmen. Sie werden verstärkt durch ungünstige Umwelteinwirkungen wie Unverständnis, Überforderung, ungerechte Strafen usw.





























