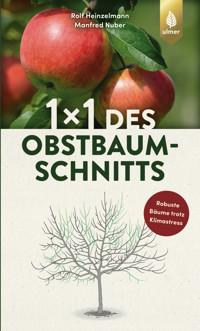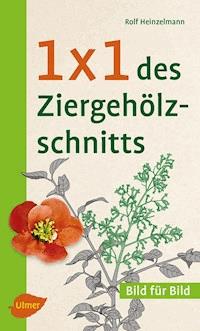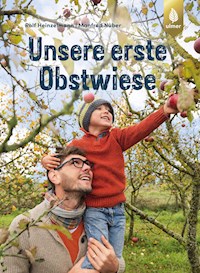
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Eugen Ulmer
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ein Leitfaden zur Bewirtschaftung: Sie sind plötzlich Besitzer einer Obstwiese und wissen nicht was Sie damit anfangen sollen? Dann hilft Ihnen dieses Buch garantiert weiter! Das Buch möchte Familien, die sich für eine Obstwiese interessieren und Menschen die eine Obstwiese / ein Obstgrundstück geerbt haben und damit überfordert sind, abholen, fachlich begleiten und motivieren. Die Autoren zeigen im Buch auf, was für eine erfüllende Aufgabe es sein kann, eine Obstwiese als Kulturlandschaft zu erhalten - auch im Hinblick auf die Themen Biodiversität, Sortenerhaltung und Klimawandel. Gleichzeitig bietet das Buch wichtige Anregungen und Tipps zur Bewirtschaftung. Vom Obstbaumschnitt, der Ernte und Verwertung bis hin zur Wiesenpflege und Sortenkunde gibt das Buch wertvolle Einblicke in eine spannende Aufgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Rolf Heinzelmann | Manfred Nuber
UNSERE ERSTE
OBSTWIESE
Nachhaltig bewirtschaftenund Vielfalt erleben
Auf die Obstwiese, fertig, los!
Obstwiesen sind nicht nur in vielen Regionen Baden-Württembergs ein prägendes Landschaftselement. Sie repräsentieren ein Stück Heimat und über die Hälfte der Flächen ist in privater Hand.
Nachdem der wirtschaftliche Nutzen mehr und mehr in den Hintergrund getreten ist, sind die Obstwiesen in unserer heutigen, oft hektischen Zeit zunehmend zur Last geworden und das Wissen zur Bewirtschaftung ging langsam verloren.
In den letzten Jahren ist das Interesse an der Erhaltung dieser wertvollen Flächen in unserer Kulturlandschaft allerdings wieder deutlich gewachsen. Viele Menschen entdecken die Obstwiese als sinnvolle Freizeitbeschäftigung und als Möglichkeit, nachhaltig etwas für Natur und Umwelt zu tun. Der hohe Freizeit- und Erholungswert verbunden mit körperlicher Betätigung an der frischen Luft, spielt dabei eine ebenso große Rolle wie das Ernten von eigenem Obst für eine gesunde Ernährung.
Obstwiesen sind Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten und weisen eine große Sorten- und Artenvielfalt auf. Der hohe ökologische Wert basiert auf robusten und wenig pflegebedürftigen Sorten, die auch als Genreservoir zu sehen sind. Bei extensiver Nutzung des Unterwuchses zeigen sich häufig blütenbunte Wiesen und sorgen für ein abwechslungsreiches Landschaftsbild.
Schon heute, aber auch in den kommenden Jahren werden nicht wenige Obstgrundstücke an die nächste Generation weitergegeben und treffen häufig auf völlig ahnungslose, wenig begeisterte Erben. Die überlassene Obstreihe, das geerbte Obstwiesle wird eher als Last, denn als eine echte Chance gesehen. Ziel dieses Buches ist es daher Menschen, die eher zufällig oder sogar unfreiwillig an ein Obstgrundstück kommen, davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, die Flächen nicht nur zu behalten, sondern auch zu erhalten und zu bewirtschaften.
Wir zeigen Ihnen, dass es neben dem positiven Nutzen für Natur, Umwelt und Erholung auch handfeste Argumente für die Eigennutzung gibt. Vom Obstbaumschnitt, über die Pflege der Wiese bis hin zur Ernte und Verwertung werden Schritt für Schritt Fragen beantwortet und Anregungen gegeben. Leicht verständliche und gut umsetzbare Tipps helfen Ihnen, Ihre Obstwiese fachgerecht zu bewirtschaften.
Viel Spaß mit Ihrem Obstwiesle!
Rolf Heinzelmann und Manfred Nuber
Gut zu wissen
Früher wurden Obstwiesen gepflanzt, um den oft kargen Speiseplan aufzubessern. Im Laufe der Zeit veränderte sich ihre Nutzung.
Was sind Obstwiesen?
Wie sind sie entstanden?
Definition Streuobstwiese
Schützen durch Nützen
Naturschutzfachliche Wertigkeit
Grundsätzliche Überlegungen
Selbstversorgung mit gesunden Lebensmitteln
Fit durch Bewegung
Sinnvolle Freizeitbeschäftigung
Praxis
Erst die Pflicht, dann das Vergnügen – lernen Sie Ihre Obstwiese und wichtige Pflegemaßnahmen kennen, damit Sie bald leckere Früchte ernten können.
Beurteilung Baumbestand
Bestandsaufnahme
Obstarten
Sortenbestimmung
Neupflanzungen
Jung- neben Altbaum
Klima und Kleinklima
Bodenverhältnisse und Nährstoffversorgung
Unterlagen und Sorten
Baumpflanzung
Veredelungen
Kombination von Unterlage und Sorte
Pfropfen hinter die Rinde
Kopulation
Schnittmaßnahmen
Pflanzschnitt
Erziehungsschnitt
Erhaltungsschnitt
Habitatbäume
Erneuerungsschnitt
Schnittzeitpunkt
Blumenwiese anlegen und pflegen
Artenreiche Blumenwiese
Blumenwiese anlegen
Mähen
Mulchen
Beweiden
Bienenweiden
Baumgesundheit
Beurteilung der Vitalität
Vorbeugende Maßnahmen
Krankheiten und Schädlinge
Nützlingsförderung
Arbeitswerkzeuge
Leitern
Schnittwerkzeuge
Mähgeräte
Arbeitssicherheit
Rat und Tat
Nur auf den ersten Blick haben die praxisnahen Tipps zu Versicherung & Co. nichts mit der Bewirtschaftung von Obstbaumwiesen zu tun.
Versicherungen
Unfallversicherung
Haftpflichtversicherung
Recht
Nachbarrecht
Naturschutzrecht und Schutzstatus
Bewirtschaftungs- und Pflegepflicht
Fachberatung
Landratsämter
Verbände und Vereine
LOGL – Geprüfter Obst- und Gartenfachwart®
Fortbildungsmaßnahmen
Service
Bezugsquellen, Berufsgenossenschaft
Fördermöglichkeiten
Fachbegriffe
Sorten
Gut zu wissen
Obstwiesen wurden von unseren Vorfahren gepflanzt, um den früher oft kargen Speiseplan aufzubessern und für eine vielfältigere und gesündere Ernährung zu sorgen. Dabei spielte nicht nur der Direktverzehr als Tafelobst eine Rolle, sondern auch verschiedene Verwertungsprodukte. Die Selbstversorgung war vorherrschend und erst als sich der Erwerbsanbau mehr und mehr entwickelte, veränderte sich auch die Nutzung der Obstwiese.
Was sind Obstwiesen?
Vereinfacht erklärt, handelt es sich um großkronige Obstbäume verschiedener Arten und Sorten, die in Abständen auf einer Wiese stehen. Die meist hochstämmigen Bäume verschiedenen Alters sind als Individuum klar erkennbar und wirken auf der Fläche wie willkürlich verstreut – daher der Name Streuobstwiese.
Wie sind sie entstanden?
Im Untergrund früherer Pfahlbauten an den Ufern von Alpenseen wurden Reste vom Holzäpfelchen (Malus sylvestris) gefunden: Die Pfahlbauäpfel waren kleinfruchtig und bedingt durch viel Gerbsäure herbsauer. Diese Wildform hat mit der Entstehung unserer heutigen Kultursorten so gut wie nichts zu tun. Ihre Ahnen (Kaukasusapfel, Altaiapfel) stammen ursprünglich aus dem Kaukasus (Asien) und aus ihnen entstanden durch fortwährende Auslese und letztlich Züchtung unsere Apfelsorten. Möglicherweise enthält aber die eine oder andere gerbsäurehaltige Mostobstorte auch einen kleinen Anteil der damaligen Wildformen.
Die Römer bauten in ihrer Heimat vorwiegend wärmebedürftige Obstgehölze wie Oliven an, dies war nördlich der Alpen klimatisch nicht möglich. Aber die bereits bekannte Technik des Okulierens und das Pfropfen kamen über die Perser, Griechen und Römer zu uns und ließen sich auch auf andere Baumarten übertragen. Die Kunst des Veredelns war für die Entwicklung des Obstbaus in unseren Gefilden eine wichtige Grundvoraussetzung.
In frühalemannischen Reihengräbern bei Oberflacht/Tuttlingen aus dem 6./7. Jh. wurden als Grabbeigabe Samen von Birne, Apfel, Pflaume, Schlehe, Süßkirsche, Walnuss, Haselnuss und Mehlbeere gefunden. Bereits aus dem 8. Jh. stammen Aufzeichnungen über größere Hausgärten mit mehreren Obstbäumen. Im frühen Mittelalter fand man in den Siedlungen Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Kirschen und oft einen markanten Nussbaum in der Dorfmitte. Die Obstbäume standen oft unmittelbar bei den Häusern, so war es leichter Obstdiebstahl zu verhindern. Viele Bewohner mittelalterlicher Siedlungen waren Bauern; sogenannte Ackerbürger. Sie besaßen zudem Getreideäcker, Obst- und Weingärten vor den Toren der Stadt, aus denen nach und nach die ersten Streuobstgürtel um die Dörfer und Städte entstanden.
Die Klöster waren für die Entwicklung des Obstbaus von besonders großer Bedeutung. So hatten viele Klöster neben dem Gemüseanbau und der Teichwirtschaft häufig weitläufige Obstgärten mit verschiedenen Obstarten. Pflanzpläne des Klosters St. Gallen aus dem 9. Jh. enthielten schon mehrere verschiedene Arten- und Sortenbeschreibungen. Auch im Hoch- und Spätmittelalter waren die Klöster etwa der Zisterzienser oder Benediktiner (z. B. Hildegard von Bingen) Förderer des Obstbaus.
Wein war im Mittelalter für die Menschen im Christentum von großer Bedeutung. Der Transport über weitere Strecken aber war problematisch und der Kauf für die meisten zu teuer. Daher wurde auch in ungünstigeren Lagen Weinbau betrieben, was teilweise an noch verbliebenen Weinbergmauern in Südhanglage zu erkennen ist. Im 19. Jh. entstanden aus Weinbergen zunehmend Obstbaumflächen. Auslöser dafür war die Einschleppung von Echtem und Falschem Mehltau (Oidium und Peronospora) als klassische Pilzkrankheiten an der Weinrebe sowie die Verbreitung der Reblaus, welche ganze Weinberge absterben ließ.
Siedlungen wurden traditionell mit Obstwiesen umgeben. Daher der Name Streuobstgürtel.
Die weitere Ausdehnung des Obstbaus wurde durch die Landesherren gefördert. So gab es z. B. in Württemberg Erlasse, entlang der Straßen vermehrt Obstbäume zu pflanzen, da Acker- und Wiesenflächen dafür zu kostbar erschienen. Restbestände der nebenbei schattenspendenden Straßenbepflanzungen mit vornehmlich starkwüchsigen Birnen- und Apfelhochstämmen kann man heute noch antreffen.
Die Bevölkerung wuchs stetig und die Ackergrundstücke wurden, auch durch die Realteilung, immer kleiner. Daher war eine Doppelnutzung (oben Bäume mit Obstertrag, unten Äcker mit Getreide oder Feldfrüchten) notwendig und sinnvoll. Damit wirkten sich auch Wetterkapriolen nicht mehr so stark aus. Zum Beispiel war ein nasser Sommer zwar schlecht für den Weizen im Unterwuchs, aber förderlich für das Fruchtwachstum der Obstbäume. Komplettausfälle der Ernte konnten vermieden werden.
Durch Verbote der Waldweidenutzung und die Zunahme der Milchviehwirtschaft setzten sich als Unternutzung vermehrt Wiesen durch. Man benötigte Frischfutter und Heu, um die Fütterung der Milchkühe zu gewährleisten. Die ehemaligen Baumäcker wurden mit Gras angesät. So entstanden nach und nach unsere typischen Obstwiesen.
Bedingt durch die weitere Bevölkerungszunahme vervielfachten sich, besonders um die Städte herum, die Obstbaumflächen. Im Jahre 1837 fand der erste Baumwartekurs durch Eduard Lucas in Stuttgart/Hohenheim statt. Zunehmend waren Wanderlehrer in ganz Deutschland unterwegs und gaben ihr Wissen weiter. 1860 gründete Lucas in Privatinitiative das damals weithin bekannte „Pomologische Institut“ in Reutlingen als obst- und gartenbauliche Lehranstalt. Auch zahlreiche Obstfachbücher stammen aus seiner Feder. Die Folge dieser intensiven Bildungsarbeit war die Gründung erster Obstbauvereine im Land: 1880 schlossen sich die Obstbauvereine zum Württembergischen Obstbauverein zusammen und 1886 folgte der Badische Landesobstbauverband. 1900 gab es bereits 1123 Gemeinde- und 31 Bezirksbaumwarte. Weitere Obstbauvereine wurden gegründet und die Obstwiesen dehnten sich aus und bildeten größere, zusammenhängende Flächen. 1938 zählte man in Baden-Württemberg etwa 26 Millionen Obstbäume.
Plantagen mit kleinbleibenden Apfelbäumen sind wirtschaftlicher zu bearbeiten. Allerdings sind sie weniger wertvoll für das Landschaftsbild und die Ökologie.
Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich der Intensivobstbau. Die großkronigen Bäume wurden nach und nach durch leichter zu pflegende und dadurch wirtschaftlichere, kleinkronige Bäume ersetzt. Dies gipfelte im Jahr 1957 im Generalobstbauplan, durch den mit staatlichen Beihilfen etwa 60 000 ha Streuobst gerodet, und dafür vermehrt Gemeinschaftsobstanlagen und Niederstammflächen angelegt wurden. Charakteristisch war die Pflanzung in Reihen mit Fahrgassen, um die Bewirtschaftung zu erleichtern. Neue, schwach wachsende Unterlagen fanden Verwendung und reduzierten Schritt für Schritt die Wuchsstärke der Obstbäume. Hierdurch veränderte sich neben dem Landschaftsbild auch die Sortenvielfalt erheblich.
Viele Streuobstflächen fielen Siedlungsflächen und dem Straßenbau zum Opfer. Etliche Bestände wurden mangels Wirtschaftlichkeit nicht mehr gepflegt und zugunsten einer großflächigen, baumfreien, landwirtschaftlichen Acker- oder Wiesennutzung gerodet. Obstbaumzählungen zeigten diesen Negativtrend auf: Während es 1965 noch 18 Millionen Bäume gab, waren es 1990 nur noch 11 Millionen. Im Jahr 2005 gab das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) eine erneute Untersuchung in Auftrag, bei der etwa neun Millionen Bäume erfasst wurden. Diese Zahl dürfte mittlerweile noch weiter gesunken sein, denn viele alte Bäume sterben derzeit ab und die Neupflanzungen wurden nicht ausreichend gepflegt, sodass in den kommenden Jahren weitere drastische Verluste zu erwarten sind.
Die größte Verbreitung hat der Apfel auf unseren Obstwiesen, gefolgt von Birne und verschiedenen Steinobstarten. Walnüsse, Speierling, Mispel und verschiedene Wildobstarten sind ebenfalls im Streuobstbereich anzutreffen.
Definition Streuobstwiese
Der Begriff Streuobstwiese wurde wegen des zunehmenden Intensivobstbaus zur Unterscheidung der Anbauweisen geprägt. Über eine eindeutige Definition der Kulturlandschaft Streuobstwiese gehen die Meinungen der Experten auseinander. Obstbauliche Fachverbände und Naturschutzverbände führten zu diesem Thema viele Gespräche, die letztlich kein eindeutiges Ergebnis hervorbrachten. Vertreter der Naturschutzverbände wollten die Definition zum Beispiel an der Stammhöhe und am Verzicht bestimmter Pflanzenschutzmaßnahmen festmachen. Die Fachverbände wiederum orientierten sich am Ist-Zustand und an der Art und Weise der Bewirtschaftung, die überwiegend vorherrscht.
Eine entscheidende Rolle spielt, ob das Obst überwiegend für die Saftproduktion verwendet wird, oder auch als Tafelobst. Zur Saftproduktion können die Früchte vom Boden aufgelesen werden, bei der Verwendung als Tafelobst muss man die Früchte aus der Krone pflücken. Allein hieraus ergibt sich die Situation, dass sowohl Hoch- als auch Halbstämme ihre Berechtigung haben und in den Obstwiesen vorkommen. Gemeinsam mit den landwirtschaftlichen Fachverbänden und den Kreisfachberatern der Landkreise hat der LOGL (Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg e. V.) obenstehende Definition erarbeitet, die in vielen Fachkreisen Anerkennung findet.
LOGL-Definition Streuobst
Streuobstbau ist eine Form des naturverträglichen Obstbaus, bei dem großteils starkwüchsige, hochstämmige und großkronige Obstbäume, in weiträumigen Abständen mit maximal 150 Bäumen je Hektar, meist auf Dauergrünland stehen. Charakteristisch für Streuobstbestände ist die regelmäßige Unternutzung als Dauergrünland. Daneben gibt es Streuobstäcker mit ackerbaulicher oder gärtnerischer Unternutzung, Streuobstalleen, sonstige linienförmige Anpflanzungen sowie Einzelbäume. Häufig sind die Streuobstbestände aus Obstbäumen verschiedener Arten und Sorten, Alters- und Größenklassen zusammengesetzt.
Besonders am Albtrauf, wie hier in Weilheim an der Teck (Baden-Württemberg), sind noch großflächige Obstwiesenbestände vorhanden.
Schützen durch Nützen
Streuobstwiesen prägen, insbesondere in bestimmten Regionen, große Teile unserer Kulturlandschaft und sind Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten, die unmittelbar von dieser Bewirtschaftungsform als „Kulturfolger“ abhängig sind. Daher führt das Unterlassen der klassischen Kulturmaßnahmen wie Pflanzung und Pflege zwangsläufig zum Verschwinden dieser Kulturlandschaft und damit verschwindet auch deren ökologische Wertigkeit. Zum Erhalt von Obstbaumbeständen ist folglich eine fachgerechte Bewirtschaftung zwingend notwendig.
Heute spielt neben der ökologischen Bedeutung die Selbstversorgung wieder eine größere Rolle. Allerdings bei Weitem nicht mehr mit der dringenden Notwendigkeit bzw. Abhängigkeit wie vor und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Neben dem massiven Flächenverbrauch durch Straßenbau, Industrieanlagen und Ausweisung von Baugebieten ist dies der Hauptgrund, warum sowohl die Anzahl der Bäume als auch der Pflegezustand kontinuierlich abnehmen. Aber nicht nur der schlechte Pflegezustand der Altbäume gefährdet die Bestände, auch dringend erforderliche Neupflanzungen erreichen aufgrund der fehlenden Pflege nur selten das Ertragsalter und so auch längerfristig gesehen keine naturschutzfachliche Wertigkeit.
Das Wissen rund um die Themen Obst und Garten sowie um die Zusammenhänge zwischen Wachsen, Pflegen und Ernten gehen mehr und mehr verloren. Der nächste Supermarkt ist nah und Garten und Natur werden häufig nur noch als nette Dekoration wahrgenommen und nicht als mögliche „Produktionsfläche“ von obst- und gartenbaulichen Erzeugnissen für den Eigenverbrauch. Neben der fehlenden Wirtschaftlichkeit sind in erster Linie die mangelnden Fachkenntnisse vieler (angehender) Obstbaumbesitzer Schuld an der Misere.
Der Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg (LOGL) steuert diesem „Pflegenotstand“ unter anderem durch die Ausbildung zum LOGL – Geprüften Obst- und Gartenfachwart® entgegen (Kapitel Rat und Tat). Ein wichtiger Aspekt dieser Ausbildung ist es, die Begeisterung für den (Streu-)Obstbau zu wecken und die Motivation für die Obstbaumpflege zu steigern. Denn nur was man versteht und wertschätzt, möchte man auch erhalten und nur wer versteht, was die Menschen bewegt, kann sie ebenfalls bewegen.
Die derzeit verbreitete neue Landlust sogenannter „Stadtmenschen“ ist stark von Nostalgie geprägt. Viele Menschen aus Ballungsgebieten haben den Bezug zur Landwirtschaft verloren und hängen einer ländlichen Idylle nach, die so gar nicht (mehr) existiert. Die Entfremdung zwischen den Erzeugern landwirtschaftlicher Produkte und Verbrauchern ist so groß wie nie. Dieser momentane Trend gesteigerter Aufmerksamkeit für „nostalgische“ Landwirtschaft birgt allerdings auch eine große Chance: Menschen nämlich wieder für das Thema Obstwiesen neu zu begeistern. Nur sollten die Informationen und Gedanken auf nachvollziehbaren Fakten beruhen, sonst verschwindet das Interesse so schnell wie es gekommen ist.
Spannend an einer Obstwiese ist, dass die beiden wertvollen Elemente Obstbaum und Wiese eine noch wertvollere Einheit bilden. Während das Nutzen der Früchte noch gut vorstellbar ist, wird es bei der Blumenwiese jedoch schon schwieriger. Die hohe Wertigkeit einer artenreichen Blumenwiese auch für Pflanzen, Tiere und Insekten wird Ihnen erst richtig bewusst, wenn Sie mehr verständliche Informationen hierzu erhalten. Wir wollen Ihnen diese Zusammenhänge spannend vermitteln und Sie werden sehen, wie bei Ihnen die Begeisterung für das Beobachten, Riechen und Schmecken immer mehr zunimmt!
Die Kombination aus Bewegung an frischer Luft und der Möglichkeit, gesunde Früchte und deren Produkte zu genießen sowie der sportliche Aspekt als Triebfeder eines jeden Hobbys sind nicht zu unterschätzen. Dabei sind bei der Obstwiesenbewirtschaftung einige Aspekte von Bedeutung:
Kenntnisse über Obstarten und -sorten
Inhaltsstoffe, Geschmack, Verwertbarkeit, Anfälligkeit für Krankheiten und Schädlinge und Wärmebedürftigkeit sind sehr unterschiedlich. Hat man eine Obstwiese übernommen, ist eine kundige Person, die einem bei der Arten- und Sortenbestimmung behilflich ist, sehr gefragt. So kann man beurteilen, ob möglicherweise Umveredelungen oder zusätzliche Neupflanzungen sinnvoll sind. Welche Schätze verbergen sich in meiner Baumreihe? Bevorzugen Sie robuste und wenig pflegebedürftige Sorten. Auch die Wahl alter, historischer Sorten hat Bedeutung für die Erhaltung des Genreservoirs und allgemein für die Sortenerhaltung.
Sinn und Zweck von Baumschnittmaßnahmen
Wenn Sie Ihre Bäume fachgerecht schneiden, können Sie Ihren Ertrag sichern oder sogar steigern. Wie Sie beim Schnitt am besten vorgehen, lernen Sie bei Schnittkursen der Obst- und Gartenbauvereine.
Veredeln von Ertragsbäumen
Das Veredeln von Obstbäumen im Ertragsalter ist ein spannendes Thema und eine gute Möglichkeit, schnell Früchte von den gewünschten Sorten zu bekommen.
Apfelsaft und Gärmost aus eigener Herstellung
Der erste selbst gemachte Apfelsaft aus eigenen Früchten schmeckt besonders gut. Kinder zapfen sehr gerne selbst aus der Bag-in-Box. Gelingt ein schmackhafter Gärmost, der auch bei Gästen oder als Mitbringsel ankommt, ist das eine wohlverdiente Bestätigung und motiviert dazu, die eigenen Bäume weiter zu pflegen.
Handpressen eignen sich für die sortenreine Herstellung von Fruchtsäften und zu Demonstrations- und Schulungszwecken.
Naturbeobachtung an den Bäumen und auf der Wiese
Das erste Meisenpaar brütet im aufgehängten Nistkasten, ein selbst gepflückter Blumenstrauß zeigt die Vielfalt der Wiese, Honig- und Wildbienen summen in der Luft, die Obstbäume stehen in voller Blüte und Fledermäuse flattern in der Dämmerung zwischen den Bäumen. Beobachten Sie all das und Sie werden merken, dass sich Ihnen kaum eine bessere Entspannung bietet.
Für Ihre Kinder kann die Obstwiese ein Abenteuerspielplatz, aber auch ein „Klassenzimmer im Grünen“ sein. Sie werden kaum bessere Bedingungen finden, um mit dem Nachwuchs die natürlichen Zusammenhänge durch die Jahreszeiten zu beobachten. Oder wissen Sie ganz genau, welche Schritte notwendig sind, um Apfelsaft selbst herzustellen, oder dass man die Früchte nicht nur vom Baum essen, sondern ganz unterschiedlich verwerten kann?
Natürlich bieten unsere Obstwiesen durch die landschaftsprägenden Bäume und das artenreiche Grünland auch eine optische Augenweide. Durch die überwiegend extensive Nutzung des Unterwuchses prägen blütenbunte Wiesen häufig das Bild der Obstwiesen. Blühende Landschaften erfreuen Leib und Seele und bieten eine unschätzbar attraktive Naherholung.
Obstbäume und Wiese binden eine Menge CO2 und produzieren als grüne Lunge frische Luft zum Atmen. Der Nutzen ist auch unmittelbar durch Klima- bzw. Kleinklimaverbesserung sowie Boden- und Grundwasserschutz erklärbar.
Je mehr man sich mit den unterschiedlichen Aspekten der Obstwiese auseinandersetzt und weiterbildet, umso spannender und fesselnder wird dieses Thema. Wenn sich nach und nach Ihre verwilderte Obstwiese wieder in eine wertvolle Kulturlandschaft zurückverwandelt und die Obstbäume so wie Sie es wollten, auf Schnitt- und Pflegemaßnahmen reagieren, ist das äußerst befriedigend. Wenn neu gepflanzte Obstbäume zum ersten Mal Früchte tragen und man diese stolz genießen kann, dann macht das einfach Spaß. Auch der Austausch eigener Erfahrungen mit Gleichgesinnten bei Seminaren und Fachvorträgen kann sehr motivierend sein.
Naturschutzfachliche Wertigkeit
Die naturschutzfachliche Wertigkeit hängt maßgeblich damit zusammen, dass sowohl die artenreiche Blumenwiese als auch die Obstbäume selbst mit ihren Blüten, Blättern, Früchten (auch Fallobst) und ihrer Borke einen wertvollen Lebensraum für viele Tiere und Insekten bieten. Die Kombination aus artenreichem Grünland und alten Bäumen ist für viele Arten optimal, die sich als sogenannte Kulturfolger angesiedelt haben. Kulturfolger passen sich ganz speziell an einen Lebensraum an und reagieren empfindlich, wenn bestimmte Voraussetzungen geändert werden.
Unsere Obstwiesen (Obstbäume auf Grünland) weisen, wie Wissenschaftler festgestellt haben, eine deutliche Ähnlichkeit mit „steppenartigen Urlandschaften“, also Bäumen und Grasland auf. Man geht davon aus, dass die Landschaft in Mitteleuropa ohne das Zutun des Menschen nicht überall von einem dichten Waldteppich bedeckt war, sondern aufgrund verschiedener Pflanzenfresser (Wildrinder, Wildpferde, Rothirsche etc.) auch deutliche Offenlandstrukturen aufzuweisen hatte. Für viele Arten, insbesondere Vögel, sind diese halboffenen, „savannenartigen“ Strukturen auch heute noch geradezu ideal.
Die Kulturlandschaft Obstwiese ist durch bestimmte Zugvogelarten wie Mönchsgrasmücke und Neuntöter zudem mit anderen Landschaften ähnlicher Ausprägung verbunden und damit ein Teil eines internationalen Biotopverbunds. Deutlich südlicher gelegene Landschaften wie z. B. Olivenhaine in Süditalien, beweidete Steineichen- und Korkwälder in Andalusien und Portugal oder sogar Savannen im noch weiter südlich gelegenen Afrika stellen ähnliche Lebensräume dar.
Der Neuntöter wohnt in Hecken genauso gerne wie auf der Obstwiese.
Für den Steinkauz sind alte, dicke Stämme mit passenden Höhlungen wichtig.
Viele Tagfalter, wie hier das „Landkärtchen“ profitieren von blühenden Wiesen.
Bitte nicht sofort entfernen: Abgestorbene dicke Äste oder Stämme sind besonders wertvoll, vor allem wenn sie voll besonnt sind.
Auf verschiedenen Ebenen findet im Biotop Obstwiese pulsierendes Leben statt. Sämtliche Lebewesen treten dabei miteinander in Verbindung. Diese Wechselbeziehungen sind sehr vielfältig und gehen vom Geben und Nehmen bis hin zum Fressen und Gefressen werden.
Honigbienen, Hummeln und Wildbienen befruchten die Blüten der Obstbäume und bekommen dafür Nektar und Blütenpollen. Die entstehenden Früchte dienen wiederum vielen Organismen als Nahrung.
Auf verschiedenen Ebenen finden wir also verschiedene Organismen, die miteinander in Wechselbeziehungen stehen. Flechten und Moose an den Bäumen sowie Blätter, Blüten und Früchte, die als Lebensraum oder zur Ernährung dienen. Blattläuse saugen an den Blättern und Florfliegenlarven oder Marienkäfer fressen wiederum die Läuse.
Auch das Grünland als Blumenwiese zeigt eine ausgeprägte „Schichtung“ mit verschiedenen Lebensbereichen. Wenn wir heute vom Insektensterben reden, dann gewinnt das artenreiche Grünland als Basis für ein vielfältiges Insektenparadies immer mehr an Bedeutung. Artenreiche Blumenwiesen sind Lebensgrundlage für viele Arten von Kleinstlebewesen, die wiederum als Nahrung für weitere Arten dienen.
Die Blütenschicht bietet vielen blütenbesuchenden Insekten wie Bienen, Wildbienen, Fliegen und Schmetterlingen einen reich gedeckten Tisch und Insektenfresser profitieren davon. In der Blatt- und Stängelschicht tummeln sich Heuschrecken, Käfer, Schmetterlingsraupen, Blattwanzen und Zikaden. Netzspinnen und andere Räuber lauern dort auf Beute. In der Streuschicht krabbeln Asseln, Ameisen, Spinnen und Schnecken. In der Wurzel- oder Bodenschicht findet man Regenwürmer, Larven von Käfern und Schmetterlingen, Ameisen, aber auch Pilze, Algen und Bakterien.
Motivation durch Information
Nur wenn Sie sich fortlaufend informieren, werden Sie dauerhaft motiviert sein, um Ihre Obstwiese langfristig erfolgreich zu bewirtschaften. Sichern Sie sich deshalb den Zugang zu möglichst vielen Informationsquellen und bleiben Sie mit anderen Bewirtschaftern und Beratern im Kontakt.
Umso wichtiger ist die Erkenntnis, dass dieser extrem vielfältige Lebensraum als Kulturlandschaft nur erhalten werden kann, wenn das Grünland entsprechend seiner Nutzungsmöglichkeiten auch gepflegt wird. Blumenwiesen bleiben nur dann artenreich, wenn sie regelmäßig, in der Regel zweimal im Jahr, gemäht werden (Heu- und Öhmdschnitt).
Im Baum selbst können Säugetiere, Vögel, Insekten, Spinnentiere aber auch Moose, Flechten, Algen und Pilze leben. Insbesondere Apfelbäume neigen zur Höhlenbildung, mit denen sie durchaus noch mehrere Jahre leben können. In keinem Fall dürfen diese Höhlen mit Beton oder sonstigen Materialien ausgefüllt oder zugenagelt werden, das schadet dem Baum und zerstört wertvolle Lebensräume. Baumhöhlen bieten Nistmöglichkeiten für verschiedene Höhlenbrüter, Totholzstrukturen sind für bestimmte Käferarten Lebensraum, der mitunter auch von Wildbienenarten als Nachmieter genutzt wird.
Totholz hat allerdings nur einen naturschutzfachlichen Wert, wenn es wenigsten armdick ist und sonnig steht. Dieses erwünschte Totholz kann aber nur entstehen, wenn ein Obstbaum ein hohes Lebensalter erreicht. Und das geschieht wiederum nur durch Pflanzung und kontinuierliche Pflege der Obstbäume. Nur so erhalten wir letztlich diesen Lebensraum.
In unseren Streuobstbeständen leben mehrere, europaweit geschützte Vogelarten. Hierzu gehört u. a. der Grauspecht als Höhlenbrüter, der sich von Wiesenameisen ernährt. Wendehals und Mittelspecht brauchen ähnliche Lebensbedingungen. Halsbandschnäpper, Rotkopfwürger und Neuntöter profitieren von der reichen Insektenwelt.
Lichte Bestände mit rauborkiger Rinde auf Grünland sind somit geradezu ideal für viele Säugetiere, Vögel, Echsen, Amphibien, Insekten und Spinnentiere. Jeder, der den Lebensraum Obstbaumwiese durch regelmäßige Nutzung und Pflege erhält, leistet einen unschätzbaren Beitrag zum Erhalt bzw. zur künftigen Schaffung eines der wertvollsten Lebensräume in ganz Mitteleuropa. So schließt sich letztlich der Kreis und die Vorgabe „Schützen durch Nützen“ wird selbsterklärend.