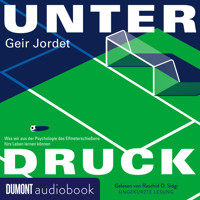14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wer schon mal ein Elfmeterschießen bei einem großen Fußballturnier verfolgt hat, weiß: Es gibt für Profifußballer*innen wohl kaum eine größere Drucksituation. Hier wird über Sieg oder Niederlage entschieden und Geschichte geschrieben. Hier werden Held*innen geboren – und begraben. Prof. Geir Jordet erforscht das Phänomen des Elfmeterschießens seit 20 Jahren und hat u. a. schon das DFB-Team beraten. Doch die Psychologie des Elfmeterschießens ist nicht nur für Fußballfans interessant! Sie verrät uns einiges über den richtigen Umgang mit Stresssituationen in unserem Alltag. Anhand von Fallstudien und am Beispiel berühmter Elfmeterschießen erklärt Jordet nicht nur, warum David Beckham so häufig übers Tor schoss und was das Elfmetergeheimnis der norwegischen Frauen-Nationalmannschaft ist, sondern er zeigt auch, wie es uns allen gelingen kann, Stresssituationen souverän zu meistern und im entscheidenden Moment abzuliefern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Abliefern, wenn es drauf ankommt
Wer schon mal ein Elfmeterschießen bei einem großen Fußballturnier verfolgt hat, weiß: es gibt in der Welt des Sports wohl kaum eine größere Drucksituation. Hier wird über Sieg oder Niederlage entschieden, hier werden Idole geboren – und begraben.
© Jimi Sweet
Geir Jordet ist Professor an der Norwegian School of Sport Sciences, wo er Sportpsychologie lehrt. Als Berater arbeitete er für viele Fußballverbände und europäische Spitzenclubs. Seine Forschung wird in führenden sportwissenschaftlichen und psychologischen Fachzeitschriften veröffentlicht. Darüber hinaus schreibt er für zahlreiche Medien, darunter die New York Times, das Wall Street Journal, die London Times, der Guardian, die BBC und DER SPIEGEL.
Geir Jordet
UNTER DRUCK
Was wir aus der Psychologiedes Elfmeterschießensfürs Leben lernen können
Aus dem Englischen vonUlrike Becker, Sven Dörper undThomas Wollermann
Die englische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel ›Pressure‹
bei New River Books, London.
© Geir Jordet, 2024
International Rights Management:
Susanna Lea Associates on behalf of New River Books
E-Book 2024
© 2024 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Ulrike Becker, Sven Dörper, Thomas Wollermann
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © Malika Favre
E-Book Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-7558-1051-3
www.dumont-buchverlag.de
Für Yanique
VORWORT
Ein Elfmeterschießen bedeutet den größtmöglichen Druck im Leben eines Fußballers. Elfmeter sind Kopfsache, keine Frage der Technik.
Beim Elfmeter wird deutlich, wie mentale Faktoren die spielerischen Fähigkeiten beeinträchtigen können. Als Harry Kane bei der Weltmeisterschaft 2022 im Spiel gegen Frankreich seinen Elfmeter für England nicht verwandelte, hätte ich verstanden, wenn der Torwart gehalten hätte. Aber Kane schoss einfach am Tor vorbei. Das zeigt, was für ein Druck auf ihm lastete.
Beim Elfmeter müssen die Spieler sich, so gut es geht, von der Außenwelt abschotten. Das Spektakel um sie herum darf sie bei der Aufgabe, die vor ihnen liegt, nicht beeinflussen. Äußere Faktoren verstärken den inneren Druck. Nur wenn man sich unter Kontrolle hat, kann man sich auf das konzentrieren, was man vorhat.
Aber man kann nie wissen. Ein Elfmeter ist immer ein Pokerspiel.
Ich kann es nicht haben, wenn der Torwart herauskommt und sich vor den Ball stellt. Mittlerweile gibt es eine Regel, die dem Torhüter verbietet, sich wie ein Clown aufzuführen. Aber auf der Torlinie kann er machen, was er will. Ich finde es gut, wenn er versucht, Einfluss zu nehmen. Das gehört zur emotionalen Intensität der Situation dazu, das wollen die Leute sehen.
Mit meinen Mannschaften habe ich Elfmeterschießen trainiert. Es war Bestandteil des Trainings. Nicht andauernd, aber ab und zu. Dabei habe ich versucht, das gleiche Level an Konzentration herzustellen wie im Spiel. Belohnungen waren hilfreich: Wenn ein Preis winkt, ist man fokussierter.
In der Pause vor einem Elfmeterschießen ist gute Organisation alles. Ich habe mich immer bemüht, die Namen der Schützen schon frühzeitig festzulegen. Dann wurde die Reihenfolge besprochen. Manchmal sagt ein Spieler vielleicht: »Ich mach’ den letzten.« Ich sage aber: »Nein, du übernimmst den zweiten!« So was muss der Trainer entscheiden.
Gleichzeitig habe ich versucht, die Spieler in ihrer Entschlossenheit und ihrem Glauben an sich selbst zu bestärken. Ich habe ihnen erklärt: Das ist jetzt unsere Chance, denen zu zeigen, dass wir mental stärker sind. Konzentriert euch ganz auf das, was jetzt ansteht. Vergesst, was war, jetzt zählt nur der Moment.
In meiner Zeit bei Arsenal habe ich an 15 Elfmeterschießen teilgenommen. Die ersten beiden habe ich gewonnen, dann vier in Folge verloren, aber von den letzten neun wieder acht gewonnen. Ich hatte nie so genau darüber nachgedacht, aber Geir Jordet hat mich daran erinnert.
Heutzutage hat sich unsere Nutzung von Daten und Analysen komplett verändert. Zu meiner Zeit als Spieler haben wir uns nicht angeschaut, wie die Gegner Elfmeter schießen. Man wusste vielleicht, wer der wichtigste Elfmeterschütze der Mannschaft war, aber um die anderen hat man sich nicht gekümmert. Wir hatten auch keine speziellen Torwarttrainer. Heute haben wir viel mehr Informationen. Manchmal sehen wir gar nicht mehr, was direkt vor unseren Augen los ist. Es kann passieren, dass wir in ein Denkmuster verfallen, in dem das Elfmeterschießen kaum eine Rolle spielt. Wir konzentrieren uns eher auf andere Aspekte des Spiels. Aber die Spieler müssen sich darüber im Klaren sein, dass ein Elfmeter über große Triumphe oder bittere Niederlagen entscheiden kann. Viel öfter, als man denkt.
Elfmeterschießen sind wichtig und werden in Zukunft noch wichtiger werden. Die FIFA hat die Anzahl der WM-Teilnehmer von 32 auf 48 erhöht. Das bedeutet eine K.-o.-Runde mehr, also auch mehr potenzielle Elfmeterschießen. Und ab 2025 werden wir eine Club-WM mit 32 Teams austragen. Auch dort werden Spiele durch Elfmeterschießen entschieden werden. Wir müssen uns also ernsthaft mit diesem Aspekt des Spiels auseinandersetzen, und das tut Geir Jordet in diesem Buch.
Roberto Baggio sagt, er denke noch heute an seinen verschossenen Elfmeter bei der WM 1994. Das lehrt uns eins: Gute Vorbereitung lohnt sich.
Arsène Wenger, Direktor für globale Fußballförderung bei der FIFA und ehemaliger Trainer des FC Arsenal (1996–2018) März 2024
EINLEITUNG
»Nur große Spielerinnen und Spieler können Elfmeter verschießen, weil unbedeutende gar nicht erst antreten.«Ante Milicic, Trainer der australischen Frauenelf, 2019
Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie sind 23 und haben eine einzige Chance. Einen einzigen Schuss, bei dem die ganze Welt zuschaut. Treffen Sie, haben Sie nur geschafft, was alle erwartet haben. Im besten Fall ernten Sie ein anerkennendes Kopfnicken. Aber wenn Sie versagen, zerstören Sie die Träume von Millionen von Menschen, inklusive die Ihrer Mitspieler, Verwandten und Freunde.
Beim letzten Mal, als Sie in dieser Situation waren, haben Sie versagt. Die Folgen waren verheerend. Aber letztendlich hat man Ihnen verziehen. Versagen Sie jetzt wieder, wird es niemand vergessen. Es wird für immer ein Teil von Ihnen sein. Ihr Name wird für immer zum Synonym für diesen Moment des Scheiterns werden.
Hinzu kommt, dass Sie erschöpft sind. Sie haben gerade zwei Stunden harte körperliche Anstrengung hinter sich, und das am Ende eines vollen Monats im Dauereinsatz mit Ihrem Team.
Wenn Sie sich für Ihren Schuss bereit machen, steht ein Gegner vor Ihnen und lächelt. Es folgen gemeine Worte und verstörende Gesten, die alle nur eins zum Ziel haben: in Ihren Kopf zu kommen, Sie zu verunsichern, Ihre schlimmsten Ängste zu wecken und Sie aus der Ruhe zu bringen.
Und noch eine letzte Sache: Dies ist eine Situation, auf die Sie und Ihr Team nicht vorbereitet sind. Sie müssen ohne Probe direkt auf die Bühne. Warum? Weil Ihr Chef nicht glaubt, dass man so etwas trainieren kann.
Ihnen ist schlecht. Sie haben Angst.
Willkommen beim Elfmeterschießen.
Als Kylian Mbappé am 18. Dezember 2022 vom Mittelkreis zum Elfmeterpunkt ging, war genau das seine Lage. Es war das WM-Endspiel zwischen seiner Mannschaft, Frankreich, und Argentinien.
Es wäre nicht übertrieben zu behaupten, dass alle Menschen, die er kannte, ihm in diesem Moment zusahen. 1,5 Milliarden Menschen saßen vor dem Fernseher.1
Allein in Frankreich schauten 29 Millionen zu, ein neuer Rekord.2
Mbappé trat gegen Argentiniens Torhüter Emi Martínez an, im Weltfußball berühmt-berüchtigt für seinen Trashtalk und seine Störversuche gegenüber gegnerischen Elfmeterschützen. Dazu war die französische Mannschaft jämmerlich unvorbereitet – ihr Coach hatte mehrfach erklärt, er halte es für unmöglich, Elfmeterschießen zu trainieren.
Das letzte Mal war Mbappé für Frankreich im Achtelfinale der Europameisterschaft 2020, die im Jahr 2021 ausgetragen wurde, bei einem Elfmeterschießen angetreten. Damals trafen alle gegnerischen Spieler aus dem Schweizer Team und auch alle Mannschaftskameraden von Mbappé, doch er selbst verschoss. Die Nachwehen waren äußerst unschön. Man gab ihm die Schuld an der Niederlage. Die Fans stellten seinen Charakter infrage: Er sei ein Egoist, nur auf sich selbst bedacht, kein Teamplayer. Es hieß, er sei nicht engagiert genug. Er wurde rassistisch beleidigt. Schließlich traf er sich mit dem Präsidenten des französischen Fußballverbands, um über seinen möglichen Rückzug aus der Nationalmannschaft zu sprechen. Er spielte weiter, aber an seinem Beispiel wurde schmerzhaft deutlich, welche Folgen ein Schuss bei einem Elfmeterschießen haben kann.
Ein Jahr später fand er sich erneut am Elfmeterpunkt wieder. Diesmal stand noch mehr auf dem Spiel. Es ging um den Weltmeistertitel. Mbappé war Frankreichs größter Star, derjenige, von dem alle erwarteten, dass er traf.
Er hatte alles zu verlieren.
Elfmeter haben mich schon immer fasziniert. Genauer gesagt, vergebene Elfmeter. Der Gedanke, etwas schaffen zu müssen, das eigentlich alle für machbar halten, dann daran zu scheitern, und dieses Scheitern hat Auswirkungen auf alle um einen herum … das ist ein Szenario, das mir schon immer außerordentlich erschreckend vorgekommen ist. Aus meiner Faszination wurde Besessenheit, als ich selbst mit dem Fußballspielen anfing. Obwohl ich als Jugendlicher ganz ordentlich spielte, etliche Tore verbuchen konnte und oft Kapitän meiner Mannschaften war, fürchtete ich mich vor Elfmetern. Ich meldete mich nie freiwillig als Schütze. Zweimal allerdings kam ich nicht drum herum.
Beim ersten Mal war ich 15 und spielte ein Testspiel für die Osloer Regionalmannschaft. Seit Jahren hatte ich davon geträumt, in dieser Mannschaft zu spielen. Einmal war ich im Probetraining schon gescheitert, deshalb war ich vor diesem Testspiel nervöser denn je.
Es schien allerdings nicht aufzufallen – jedenfalls nicht am Anfang. Ich spielte das Spiel meines Lebens. Dribbling, Zuspiel, alles klappte perfekt. Ich schoss sogar ein schönes Tor.
Dann gab es Elfmeter für uns.
Ich ging beiseite, so wie immer. Sollten andere sich darum kümmern. Aber der Coach sah das anders. »Geir Jordet wird schießen!«
Mir war gar nicht klar gewesen, dass der Trainer meinen Namen kannte; das war also schon mal etwas, einerseits. Andererseits … einen Elfmeter übernehmen? Ich? Ausgerechnet in diesem Spiel? Angst überkam mich. Doch was blieb mir übrig. Ich schnappte mir also den Ball.
Meine Hände zitterten so stark, dass ich ihn kaum festhalten und auf dem Punkt platzieren konnte. Ich ging ein paar Schritte zurück, ohne irgendeinen Plan, was ich vorhatte. Immerhin gelang es mir, ein Ziel ins Auge zu fassen. Daran erinnere ich mich glasklar – ich zielte auf die rechte Ecke, knapp neben den Innenpfosten. So schnell ich konnte, nahm ich Anlauf und schoss. Der Ball rollte langsam ins Netz.
Erleichterung. Ich hatte getroffen. Meine Mitspieler waren glücklich, der Trainer schien beeindruckt. Aber da war etwas, das nur ich wusste. Der Ball war knapp neben dem linken Pfosten ins Tor gerollt – genau auf der anderen Seite. Ich hatte mein eigentliches Ziel um etwa sieben Meter verfehlt. Ein reiner Glückstreffer.
Das zweite Mal musste ich bei einem Elfmeterschießen ran. Ich war 17 und spielte beim damals größten internationalen Jugendfußballturnier der Welt mit, dem Norway Cup. Ich gehörte zu einem guten U19-Team mit mehreren norwegischen Jugendspielern, die in internationalen Vereinen spielten. Wir rechneten uns Chancen auf den Turniersieg aus, schafften es auch mühelos ins Achtelfinale und strotzten vor Selbstbewusstsein. Aber die Partie ging in die Verlängerung und dann ins Elfmeterschießen. Ich vergab, und wir schieden aus.
Ein kleiner Trost war, dass noch jemand aus meiner Mannschaft seinen Elfmeter verschossen hatte, noch dazu ein viel erfahrenerer Spieler als ich, der sich vermutlich noch mehr für unsere Niederlage verantwortlich fühlte. Trotzdem war es für mich der Sommer, in dem ich die Träume meiner Mitspieler und Freunde hatte platzen lassen. Denn so fühlt es sich an, wenn man beim Elfmeterschießen nicht trifft. Danach habe ich nie wieder einen Elfmeter geschossen.
Mein Interesse an dem Thema ließ allerdings nicht nach. Im Gegenteil, diese ganz eigene intensive Dramatik des Elfmeterschießens faszinierte mich immer stärker. Im Sommer 2004, als ich gerade meine Promotion in Psychologie und Fußballwissenschaft abgeschlossen hatte und darauf wartete, meinen ersten Job als Wissenschaftler anzutreten, fand in Portugal die Europameisterschaft der Männer statt. Den meisten dürfte dieses Turnier im Gedächtnis geblieben sein, weil ein absoluter Außenseiter es gewonnen hat: Griechenland siegte im Endspiel mit 1:0 gegen die Gastgeber. Für mich markiert dieses Turnier den Anfangspunkt meiner Forschung über die Psychologie des Elfmeterschießens.
Im Viertelfinale der Europameisterschaft 2004 gab es zwei dramatische Elfmeterschießen. Im ersten schlug Portugal England mit 6:5. Zwei Tage später besiegten die Niederlande Schweden mit 5:4. Alle Welt sprach von David Beckham, dem zu der Zeit wohl prominentesten Fußballer überhaupt. Beckham wurde im Elfmeterschießen gegen Portugal als Erster vorgeschickt. Ricardo, der portugiesische Keeper, ging Beckham vor dem Schuss bis zum Elfmeterpunkt entgegen, gestikulierte und redete auf ihn ein. Ein paar Sekunden später schoss Beckham den Ball ein oder zwei Meter über die Latte – ein totaler Fehlschuss. Ich sah die Liveübertragung im Fernsehen und traute meinen Augen nicht. Aber es war ja nichts Neues. Ein Superstar zu sein, ist beim Elfmeterschießen ein Nachteil. Der Druck, der auf einem liegt, ist viel größer als bei anderen Spielern. Und so wird aus einem Ausnahmefußballer urplötzlich ein gewöhnlicher Spieler.
Norwegen ist ein kleines Land, und damals gab es nicht besonders viele Forschende, die sich auf die Psychologie des Fußballs spezialisiert hatten, deshalb rief mich am Tag nach dem Match ein norwegischer Radiosender an und bat mich um ein Interview über das Elfmeterschießen vom Vortag. Direkt bevor wir auf Sendung gingen, informierte mich der Moderator, dass noch ein weiterer Gast an unserem Gespräch teilnehmen würde, zugeschaltet aus einem anderen Studio. Es war Henning Berg. Oh, okay. Berg war in Norwegen enorm bekannt. Er hatte gerade eine äußerst erfolgreiche Spielerkarriere beendet: Hundert Länderspieleinsätze, zwei Weltmeisterschaftsteilnahmen. Und er hatte für Manchester United 66 Spiele in der englischen Premier League absolviert.
Ich war in der Sendung als Erster dran. »Wie kann es sein, dass einer wie Beckham verschießt?«, lautete die Frage. Ich lieferte einige meiner vorgefertigten psychologischen Beobachtungen und Theorien: »Der Druck auf Beckham ist enorm. Er ist im internationalen Fußball ein absoluter Superstar. Alle erwarten, dass er trifft. Vermutlich hat er sich zu viele Gedanken über seinen Schuss gemacht und …«
Eine laute Stimme schnitt mir scharf das Wort ab.
»Unsinn! Vollkommener Quatsch!«
Das war Henning Berg.
»Ich habe drei Jahre mit Beckham gespielt«, fuhr Berg fort. »Ich kenne ihn sehr gut. Er ist mental absolut stark. Sein Fehlschuss hatte mit Druck rein gar nichts zu tun.«
Ich war so verblüfft, dass ich gar nicht mehr hörte, was er sonst noch sagte. Bergs Kompetenz – oder seine Selbstgewissheit – anzuzweifeln, kam natürlich nicht infrage. Ich hatte ihm nichts entgegenzusetzen und sagte danach kaum noch ein Wort. Als ich das Aufnahmestudio verließ, war ich ziemlich kleinlaut.
Aber auch entschlossen. Trotz Bergs Frontalangriff war ich überzeugt, dass es beim Elfmeterschießen in durchaus relevantem Ausmaß auch um Druck und den Umgang mit diesem Druck geht und dass jedes Elfmeterschießen eine psychologische Dimension hat, die Beachtung verdient. Jedenfalls wurde mir klar, dass ich tiefer in das Thema einsteigen wollte. Und so begann eine Zeit intensiver Recherche. Ich besorgte mir die vorhandenen Studien – und stellte fest, dass die meisten auf Laborversuchen mit Studierenden basierten, die bei einem simulierten Elfmeterschießen antraten. Was sollte das? Wie will man den tatsächlichen Druck beim entscheidenden Elfmeter in einem wichtigen Spiel bei einem Laborversuch auch nur annähernd simulieren? Mir war klar, dass ich mich auf das konzentrieren musste, was im echten Leben bei einem Elfmeterschießen passierte. Mein Interesse wurde bald zur Mission. Ich schaute mir Videos an, las Memoiren und Interviews, betrachtete die Dramen und die Emotionen der echten Elfmeter-Situationen und suchte nach Verhaltensweisen, die von Bedeutung sein könnten. Ich fragte mich: Was unterschied die Spielerinnen und Spieler, die ihre Schüsse verwandelt hatten, von denjenigen, die sie vergeben hatten?
Es schien ganz sicher nützlich, das herauszufinden. Bei den Weltmeisterschaften der Männer sind seit 1974, als diese Methode zur Siegerermittlung bei einem auch nach Verlängerung ausgeglichenen Spielstand eingeführt wurde, insgesamt 35 Spiele durch Elfmeterschießen entschieden worden. Das bedeutet, bei 20 Prozent beziehungsweise einem von fünf K.-o.-Spielen bei einer Weltmeisterschaft kommt es zum Elfmeterschießen. Bei Europameisterschaften ist die Zahl noch höher (26 Prozent), und bei der Copa América beträgt sie sogar 30 Prozent. Bei den Frauen sind es 11 Prozent der WM-Spiele, 15 Prozent der EM-Spiele und 30 Prozent der Spiele bei der Copa América Feminina. Das heißt, jedes Team, das an einem dieser Turniere teilnimmt und Ambitionen auf den Titel hat, sollte darauf vorbereitet sein, zu mindestens einem Elfmeterschießen antreten zu müssen; alles andere wäre äußerst naiv.
Und was die Häufigkeit von Strafstößen innerhalb der regulären Spielzeit betrifft, so kommt es bei 27 Prozent der Spiele in den großen europäischen Fußball-Ligen der Männer zu mindestens einem Elfmeter.3 Angesichts der Tatsache, dass über die Hälfte aller Fußballspiele entweder unentschieden oder mit nur einem Tor Abstand ausgeht, dürfte klar sein, dass so ein Strafstoß in den meisten Fällen den Spielausgang maßgeblich beeinflussen wird.4 Den Elfmeter in all seinen Dimensionen besser zu verstehen, kann also durchaus hilfreich sein.
Meinen ersten Durchbruch hatte ich, nachdem ich im Herbst 2004 meine Stelle an der Universität von Groningen angetreten hatte. Historisch haben die Niederlande und England bei Elfmeterschießen ähnliche Erfahrungen gemacht: Für beide Länder sind sie oft traumatisch und schmerzhaft verlaufen. Bis zur EM 2004 waren die Niederlande an vier wichtigen Elfmeterschießen beteiligt: bei den Europameisterschaften 1992, 1996 und 2000 sowie bei der Weltmeisterschaft 1998. Sie verloren alle vier. Die bitterste Niederlage war vermutlich die bei der EM 2000, als das Land Gastgeber war. Die Mannschaft traf im Halbfinale in der Amsterdam Arena auf Italien. In der regulären Spielzeit vergab die holländische Mannschaft zwei Strafstöße, es blieb beim 0:0, und die Partie ging ins Elfmeterschießen. Drei von vier niederländischen Schützen konnten ihre Elfmeter nicht verwandeln. Italien gewann mit sicherem Vorsprung. Als die niederländische Mannschaft dann bei der Europameisterschaft 2004 im Viertelfinale das Elfmeterschießen gegen die Schweden gewann, kam das für die begeisterte Fußballnation einer Erlösung gleich.
Schon ehe ich meine Stelle antrat, hatte ich darüber nachgedacht, mit meinen niederländischen Kolleginnen und Kollegen ein Studienprojekt zum Thema Elfmeter ins Leben zu rufen. Bei meiner Ankunft stellte sich heraus, dass einer der neuen Kollegen, Chris Visscher, über Beziehungen zur niederländischen Nationalelf verfügte. Und ich selbst kannte zufällig ein paar der schwedischen Spieler, die an dem besagten Elfmeterschießen teilgenommen hatten. Ich dachte, vielleicht könnte ich sie dazu bringen, mir von ihrer Erfahrung zu erzählen. Es dauerte lange und erforderte viel Überredungskunst, aber schließlich bekamen wir Interviewtermine mit Spielern aus beiden Teams, und ich konnte genug Material sammeln, um in einer so noch nie durchgeführten Studie zu untersuchen, wie die Spieler zweier erstklassiger Mannschaften die Konfrontation mit dem Gegner bei einem Elfmeterschießen erlebt hatten.
Mir war schnell klar, dass ein Elfmeterschießen im Fußball ein ideales Setting für die Untersuchung von Performance und Leistung unter Druck darstellt. Noch dazu eines, das große Vorteile bietet. Erstens entsteht dabei etwas, das sich im Laborversuch nicht simulieren lässt und dessen Erzeugung bei gewöhnlichen Probanden auch nicht zu verantworten wäre – nämlich ein hohes Ausmaß an echtem, real existierendem Stress. Anders ausgedrückt: Hier können wir die Auswirkungen von psychischem Druck quasi in freier Wildbahn beobachten, dort, wo er unmittelbar auftritt und erforscht werden kann.
Ein zweiter Vorteil besteht darin, dass wir anhand des Elfmeterschießens die Auswirkungen solchen Drucks auf leistungsstarke Spitzensportler und Spitzensportlerinnen untersuchen können, also eine exklusive Gruppe von Menschen, die wir für eine gewöhnliche Laborstudie kaum rekrutieren könnten.
Und drittens mag der Ausgang eines einzelnen Strafstoßes oder eines Elfmeterschießens zwar simpel und klar sein – verwandelt oder vergeben, gewonnen oder verloren –, doch die kognitiven, emotionalen, sozialen, technischen und taktischen Variablen um dieses Ereignis herum sind unglaublich komplex und liefern uns umfassende, erhellende Erkenntnisse über das menschliche Verhalten unter psychischem Druck.
Die Jahre in den Niederlanden waren für mich der Anfang einer anhaltenden Leidenschaft, die zur Veröffentlichung diverser Studien zum Thema Elfmeterschießen geführt hat. Im Laufe der Zeit habe ich über 30 Topspieler und -spielerinnen ausführlich zu ihren Gedanken, Gefühlen und Erfahrungen beim Elfmeter befragt und die Videoaufzeichnungen von über 2000 Strafstößen en détail ausgewertet. Und ich hatte Gelegenheit, durch Gespräche mit mehr als 20 Elitemannschaften meine Thesen in der Praxis zu überprüfen: mit der deutschen Nationalelf der Männer (WM 2022), dem Frauenteam von Großbritannien/England (Olympische Spiele 2020), der niederländischen Elf (WM der Männer 2006), den norwegischen Nationalteams der Männer und der Frauen (immer wieder im Laufe der letzten 10 Jahre), etlichen Clubs aus der Premier League sowie aus anderen europäischen Top-Ligen.
In diesem Buch stelle ich nun die Highlights meiner Forschungen vor. Ich erkläre, wie psychischer Druck entsteht, wie er sich beim Elfmeterschießen äußert und wie die besten (und einige der schlechtesten) Elfmeterschützinnen und -schützen der Welt in dieser Situation, die zu den stressigsten im Sport überhaupt gehört, zurechtkommen und sich behaupten. Meine Forschungsarbeit bezieht sich überwiegend auf Männer. Das liegt daran, dass die Geschichte des Frauenfußballs nur lückenhaft auf Video festgehalten wurde und die Datenlage in diesem Bereich generell dürftig ist. Das wird sich hoffentlich in Zukunft ändern.
Aber natürlich dreht sich dieses Buch nicht ausschließlich um Fußballerinnen und Fußballer und ihre Elfmeter, sondern auch um unsere Erfahrung und unser Verhalten in Stresssituationen im Allgemeinen. Wie wir sehen werden, geht es beim Umgang von Elfmeterschützen und -schützinnen mit dem Druck, der auf ihnen lastet, nicht nur um die körperliche Aktion, einen Ball ins Ziel zu treten. Ehrlich gesagt, interessiert mich der Elfmeter an sich gar nicht so sehr. Was nach dem Schuss mit dem Ball passiert, steht hier nicht im Fokus. Vielmehr interessiert mich, was vor dem Schuss geschieht, was Spielerinnen und Spieler denken und fühlen, was sie tun, wie sie mit anderen umgehen und kommunizieren. Denn darin liegt die Magie. Und genau dort gibt es auch für uns viel zu lernen. Nicht viele von uns werden je vor der Aufgabe stehen, bei einer Weltmeisterschaft einen Elfmeter für unser Land im Tor versenken zu müssen. Aber wir alle werden im Leben immer wieder in stressige Situationen geraten, und es kann uns nur nützen, wenn wir uns dafür wappnen und wissen, was wir tun können, um auch großem Druck standzuhalten, unsere Angst vor dem Scheitern zu überwinden und sie vielleicht sogar in Erfolge umzumünzen.
Für mich ist diese Forschung zu einer lebenslangen Mission geworden, aber so weit wäre es vielleicht nie gekommen, wäre Henning Berg mich damals im Radio nicht so scharf angegangen. Genau zehn Jahre nach dieser für mich denkwürdigen Sendung schloss sich der Kreis. Am 1. Juni 2014 schlug Legia Warschau im letzten Spiel der Saison Lech Posen mit 2:0 und wurde damit in der Saison 2013/2014 Meister der Ekstraklasa, der höchsten polnischen Fußball-Liga. Ich war im Stadion dabei und fand mich nach dem Spiel in der Kabine wieder, um mit den Spielern und meinen Freunden Pål Arne Johansen und Kaz Sokołowski, den Trainern von Legia Warschau, den Sieg zu feiern. Und mit ihrem Boss, dem Cheftrainer … Henning Berg. Im Jahr darauf gewann Legia Warschau den polnischen Fußballpokal. Am dramatischsten war das Viertelfinale, das Henning Bergs Team durch ein eingangs sehr gutes Elfmeterschießen für sich entschied.
Bei dem eingangs erwähnten Elfmeterschießen im WM-Endspiel 2022 trat Kylian Mbappé nicht nur als erster Schütze für Frankreich an, sondern er schoss auch zwei aus dem Spiel heraus gegebene Elfmeter – den ersten 10 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit, den zweiten 2 Minuten vor Ende der Verlängerung. Beide Male ging es um alles oder nichts, ein Fehlschuss hätte mit ziemlicher Sicherheit die Niederlage Frankreichs bedeutet. Das ist der Elfmeter: eine eigentlich geringfügige Handlung mit Riesenwirkung, die folglich mit einem immensen psychischen Druck verbunden ist.
Auch wenn Frankreich am Ende verloren hat: Mbappé traf in allen 3 Fällen und lieferte damit eine der außergewöhnlichsten Leistungen ab, die man im Fußball je gesehen hat.
Was hatte er bei diesen Schüssen gegenüber dem Vorjahr anders gemacht?
Diese Frage ist in diesem Buch mein Thema.
KAPITEL 1
Den Druck spüren
»Strafstöße sehen ganz einfach aus, deshalb sind sie so schwierig.«Johan Cruyff
Das Elfmeterschießen wurde 1970 von der FIFA als offizielles Verfahren zur Ermittlung eines Siegerteams bei unentschiedenen Fußballspielen in K.-o.-Systemen eingeführt. Anfangs ging es dabei zwangsläufig rau und ungeschliffen zu. Die Elfmeterschützen hatten nicht gelernt, wie sie sich in dieser ungewohnten Situation verhalten oder nicht verhalten sollten. Auch die Schiedsrichter waren noch unerfahren und entsprechend lasch in ihrer Kontrolle. Sieht man sich heute Aufnahmen dieser frühen Elfmeterschießen an, wirken sie oft holprig und plump – aber irgendwie auch magisch, vor allem, wenn man zur Psychologie dahinter forscht. Hier ist Leistung unter Druck in Reinform zu erleben.
Nehmen wir zum Beispiel das Elfmeterschießen zwischen Arsenal und Valencia im Endspiel des Europapokals der Pokalsieger von 1980.1 Nach Ende der Verlängerung stand es immer noch 0:0, und folglich gab es zum ersten Mal in einem großen europäischen Clubwettbewerb ein Elfmeterschießen.
Valencia schickte natürlich als Ersten seinen zuverlässigsten Elfmeterschützen ins Rennen. Das war Mario Kempes, ein Superstar des Fußballs, der 1978 mit Argentinien als einer der Top-Torschützen des Turniers Weltmeister geworden war. Er hatte bei der WM sechs Tore erzielt, zwei davon im Finale gegen die Niederlande, und war zu Südamerikas Fußballer des Jahres gekürt worden. Kempes vergab den Elfmeter. Zum ersten Mal wurde damals eine Fußballlegende vor den Augen der Welt durch das grausame Spektakel eines Elfmeterschießens ihrer Würde beraubt. Es sollte nicht das letzte Mal sein.
Nach den ersten fünf Schüssen für jede Mannschaft stand es kurz darauf weiterhin unentschieden, und nun machte sich Verwirrung breit. Niemand schien genau zu wissen, wie weiter. Sollten die ersten fünf Schützen der jeweiligen Mannschaft erneut antreten? Oder waren jetzt die übrigen Spieler an der Reihe? Während die Torhüter darüber diskutierten, liefen die Trainerteams zum Schiedsrichter und baten um Aufklärung. Weitere Spieler mussten schießen, lautete die Anweisung.
Valencia war an der Reihe und verwandelte den sechsten Schuss. Für Arsenal trat als Nächstes der damals 22-jährige Graham Rix an, der schon im Spiel eine gute Leistung gezeigt hatte. Rix musste treffen, um Arsenal im Spiel zu halten. Traf er nicht, gehörte der Pokal Valencia.
Rix betrat den Strafraum mit der Attitüde von jemandem, dem es nicht schnell genug gehen konnte. Beim Positionieren des Balls schaute er Valencias Keeper Carlos Pereira im Tor an und gab sich frech, indem er einen Schuss mit dem Innenrist antäuschte, noch ehe der Ball lag. Auf dem Video wirkt der Witz heute irgendwie komisch und irgendwie auch nicht; hauptsächlich drückt sich darin Nervosität aus. Natürlich. Alle waren nervös, und jeder zeigte es auf seine Weise.
Rix trat dann nur wenige Schritte hinter den Ball zurück und nahm unmittelbar nach dem Freigabepfiff des Schiedsrichters Anlauf. Sein Schuss war nicht schlecht, doch der Torhüter sprang in die richtige Ecke und hielt den Ball relativ mühelos. Arsenal war besiegt – die erste Mannschaft, die den besonderen Schmerz einer Europapokal-Finalniederlage im Elfmeterschießen zu spüren bekam. Während die jubelnden Spieler von Valencia herbeistürmten, um ihren Torhüter zu feiern, stand Rix nur wie angewurzelt da, die Stutzen auf die Knöchel gerutscht, vornübergebeugt angesichts dieser völlig neuen Art der Demütigung.
Spulen wir ein bisschen vor, ins Jahr 1984, und schauen uns das Elfmeterschießen im Endspiel des UEFA-Pokals (heute der Europa League) zwischen Tottenham Hotspur und Anderlecht an. Nach heutigen Maßstäben erscheint es unfassbar, wie ungeduldig und gehetzt die Spieler wirken. Neun der zehn Elfmeterschützen reagieren auf den Freigabepfiff des Schiedsrichters, als wäre es der Startschuss bei einem Rennen. Da dieser Schiedsrichter schon pfeift, sobald die Spieler den Ball abgelegt haben und ein paar Schritte zurückgegangen sind, warten sie überhaupt nicht, nicht einmal eine Sekunde, um sich zu sammeln, ehe sie Anlauf nehmen. Noch dazu drehen vier der fünf Tottenham-Spieler dem Torhüter den Rücken zu, während sie vom Ball weggehen. Dadurch erzeugt der Freigabepfiff bei ihnen eine einzige schnelle, flüssige und mit Sicherheit schwer zu koordinierende Bewegungsabfolge: Gehen, Umdrehen, Anlaufen, Schießen. Der einzige Schütze von Tottenham, der dem Torwart nicht den Rücken zukehrt, ist Gary Stevens, und der nimmt schon Anlauf, noch ehe der Pfiff verklungen ist, sodass es aussieht, als reagiere der Schiedsrichter auf ihn statt umgekehrt. Stevens wird zum einzigen Spieler in der Geschichte des Elfmeterschießens bei wichtigen Partien, der den Ball im selben Moment tritt, in dem der Schiedsrichter pfeift. Er trifft, und Jacques Munaron, der belgische Torhüter, erhebt verständlicherweise erbittert Einspruch, allerdings ohne Erfolg.
Die belgischen Spieler sind ebenfalls schnell, wenn auch nicht ganz so schnell wie die Engländer. Der Einzige, der sich bei diesem Duell wenigstens ein bisschen Zeit lässt, ist Enzo Scifo. Er ist erst 18 Jahre alt, wirkt aber vor seinem Anlauf unglaublich gefasst. Die eine Sekunde, die er nach dem Pfiff abwartet, fühlt sich im Vergleich zu den anderen wie eine Ewigkeit an. Scifo hat damals noch eine beeindruckende Karriere vor sich, in deren Verlauf er 84 Länderspieleinsätze für Belgien absolvieren wird. Diesmal allerdings gewinnt Tottenham das Elfmeterschießen mit 4:3 und darf den Pokal in Empfang nehmen.
Oder spulen wir noch einmal zurück und schauen uns an, wie der Deutsche Uli Stielike im Elfmeterschießen beim WM-Halbfinale Bundesrepublik Deutschland gegen Frankreich 1982 in Sevilla seinen Strafstoß ausführt. Es ist das erste WM-Spiel überhaupt, das durch Elfmeterschießen entschieden wird, und damit auch das erste Mal, dass sich dieses besondere Drama vor den Augen der ganzen Welt abspielt.
Beide Teams sind nach 120 Minuten hartem Kampf um den Einzug ins Finale erschöpft. (Frankreich hatte in der Verlängerung schon mit 3:1 geführt, aber Deutschland hat noch zum 3:3 ausgeglichen.) Die Spieler haben sich im Mittelkreis verteilt, keine Spur von der Schulter-an-Schulter-Formation der Mannschaften, die wir heutzutage beim Elfmeterschießen gewohnt sind; alle sitzen oder liegen am Boden. Niemand macht Anstalten, sich warm zu halten, niemand gibt sich Mühe, einsatzbereit oder kampflustig zu wirken. Alle geben sich einfach ihrer Erschöpfung hin.
Uli Stielike ist der dritte Elfmeterschütze für die bundesdeutsche Mannschaft, und der sechste insgesamt. Bislang hat keiner verschossen. Als Stielike zum Ball geht, wirkt er kein bisschen selbstbewusst. Auch er reagiert schnell auf den Freigabepfiff, nähert sich dann aber dem Ball relativ langsam, die Augen auf den Torwart gerichtet. Beim letzten Schritt senkt er den Blick und liefert einen mittelhohen Schuss ab, der aber nur ein, zwei Meter links vom Torwart landet.
Gehalten. Ja – ein Deutscher hat einen Elfmeter verschossen. Kosten Sie den Moment aus, denn das wird 34 Jahre lang nicht wieder passieren, jedenfalls nicht bei einem wichtigen Turnier.
Aber bleiben wir bei Stielike. Noch ehe der Torhüter nach seinem Sprung zur Seite wieder ganz gelandet ist, sinkt Stielike schon auf die Knie und schlägt sich die Hände vors Gesicht. Dann gibt er sich einer Mischung aus Scham und Schwerkraft hin, fällt flach auf den Rasen und rollt sich in seinem Schmerz zu einer Kugel zusammen. Zehn volle Sekunden liegt er so neben der Strafstoßmarke, bis sein eigener Torwart Harald »Toni«Schumacher zu ihm geht, ihn buchstäblich vom Boden aufhebt und ihn mehr oder weniger wegschleppt. Pierre Littbarski, der nächste Schütze für die Deutschen, nimmt den immer noch verstörten Stielike in den Arm, um ihn zu trösten.
Unterdessen tritt aus dem französischen Team Didier Six an, um seinen Elfmeter zu treten – und auch er vergibt. Doch das sieht das Fernsehpublikum gar nicht, weil die Kamera noch auf Littbarski und Stielike hält. Die Zuschauer*innen bekommen den Fehlschuss von Six nur durch Littbarskis enthusiastische Reaktion darauf mit. Was sie dann allerdings sehen, noch ehe die Bilder von Six’ Fehlschuss wiederholt werden, ist Six, der ebenfalls zu Boden sinkt, das Gesicht in den Händen vergräbt und sich im Torraum zusammenrollt. Auch Six bleibt 10–15 Sekunden lang so liegen, ehe sein Torwart ihn zum Aufstehen drängt und er wieder auf die Beine kommt. Doch er schafft es nicht aus dem Strafraum hinaus. Er bleibt mit gebeugtem Oberkörper stehen und schaut zu, wie Littbarski den Ball oben in die rechte Ecke drischt. Stielike hingegen liegt für den Rest des Elfmeterschießens zusammengekrümmt weiter oben auf dem Spielfeld, die Hände vor dem Gesicht, und linst nur ab und zu durch die Finger, um zu sehen, was passiert. Schließlich vergibt Frankreich erneut einen Elfmeter und Deutschland gewinnt, aber die Bilder von Stielikes und Six’ Leiden und ihre heftigen Reaktionen bleiben im Gedächtnis. Für Six, der damals nicht nur verschossen, sondern auch das Spiel verloren hat, war das Trauma von Sevilla noch lange nicht vorbei: »Ich hatte Schwierigkeiten, einen Job zu finden, denn alle sagten: ›Der ist psychisch labil.‹ Und alles nur wegen dieses einen verschossenen Elfmeters.«2
Was die Welt schnell aus diesen schmerzhaften Bildern lernte, war, dass ein Elfmeterschießen ein Ungeheuer ist, das keine Gnade kennt. Es gab neuerdings ein Format, das in Sekundenschnelle Männer in Mäuschen, Superstars in Sündenböcke und hochkarätige Sportler in ein Häufchen Elend verwandeln konnte.
Stielike und Six waren mit die Ersten, die nach einem Fehlschuss bei einem Elfmeterschießen intensive Scham zeigten, aber sie waren keineswegs die Letzten. Für meine Analysen in diesem Buch habe ich Videomaterial von jedem einzelnen Elfmeter (718 Schüsse insgesamt) aus allen Elfmeterschießen bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und Champions-League-Spielen der Männer von 1970 bis 2023 zusammengetragen. Die Aufnahmen zeigen, dass 53 Prozent der Spieler, die ihren Elfmeter vergaben, sich ähnlich verhielten wie Stielike und Six, sich klein machten, zu Boden sanken, das Gesicht in den Händen vergruben oder auf dem Rückweg in den Mittelkreis den Blick gesenkt hielten und ihre Teamkameraden nicht anschauten.
Ein Elfmeterschießen ist unerbittlich und schonungslos. Aus den zur Schau gestellten Emotionen nach dem Schuss wird deutlich, dass die Reaktion eines Sportlers auf die Begegnung mit diesem Ungeheuer stark davon abhängt, wie er mit dem Druck umgeht – ob er damit zurechtkommt oder davon erstickt wird.
»Choking« im Fußball
Im Hochleistungssport gibt es für das so genannte »Choking«, das plötzliche Versagen unter Druck, jede Menge Beispiele, doch die eindrücklichsten finden sich in Einzelsportarten: der Golfer Jean van de Velde, der bei den British Open 1999 am achtzehnten und letzten Loch einen Vorsprung von drei Schlägen verspielte; die Tennisspielerin Jana Novotná, die 1993 im Finale von Wimbledon noch gegen Steffi Graf verlor, nachdem sie im letzten Satz bereits mit 4:1 geführt hatte; die australische Schwimmerin Cate Campbell, die im 100 Meter Freistil 2016 bei den Olympischen Spielen als haushohe Favoritin ins Rennen ging und nur Fünfte wurde. »Wahrscheinlich der größte Choke in der olympischen Geschichte«, mutmaßte Campbell hinterher selbst.
Beispiele für Choking in Mannschaftssportarten wie Fußball zu erkennen, ist nicht ganz so einfach. Teams, die in den wichtigsten Momenten im großen Stil einbrechen, sind definitiv nicht die schwächsten: der AC Milan, der 2005 im Champions-League-Finale in Istanbul eine 3:0 Halbzeitführung nicht halten konnte und dann im anschließenden Elfmeterschießen unterlag; Bayern München, die im Champions-League-Finale 1999 nach 90 Minuten mit 1:0 vorne lagen, drei Minuten später aber mit 1:2 verloren; Brasilien, das bei der WM 2014 als Gastgeberland mit 1:7 vernichtend geschlagen wurde, als es um den Einzug ins Finale ging. Bei all diesen Beispielen könnte es sich aber statt um Choking auch einfach um herausragende Leistungen der jeweiligen Gegner gehandelt haben – Liverpool, Manchester United und Deutschland.
Elfmeter allerdings sind sowohl im regulären Spielverlauf als auch in spielentscheidenden Shootouts der Moment, in dem sich Fußball plötzlich dem Einzelsport annähert – sie bedeuten eine direkte Eins-zu-eins-Begegnung, wobei der größere Druck auf dem Schützen liegt. Etwa 80 Prozent der im Spiel gegebenen Elfmeter werden verwandelt. Wie wir noch sehen werden, gibt es dabei jedoch große individuelle Abweichungen, und bei Elfmeterschießen in hochkarätigen Turnieren sinkt diese Prozentzahl drastisch. Trotzdem herrscht, wenn der Spieler auf den Punkt zugeht, die Erwartung, dass er treffen wird. Die Chancen scheinen gut für ihn zu stehen. Ich hatte das Glück, Eliteteams beim Elfmetertraining zusehen zu dürfen, und ich kann sagen, dass dort jedes Mal das Gleiche passiert. Fast alle Schüsse werden verwandelt. Genauer gesagt, wenn ungefähr 20 Spieler antreten und jeder einen Schuss hat, dann gehen oft genug 19 oder 20 Bälle ins Tor. Rein technisch gesehen, ohne Druck, ohne Publikum, ist Elfmeterschießen nicht besonders schwer. Kommen aber ein volles Stadion, eine Fernsehübertragung, gravierende Konsequenzen bei Versagen und entsprechender Druck hinzu, sieht die Sache gleich völlig anders aus, und wie sonst nie beim Fußball steigt das Risiko eines plötzlichen Versagens in ungeahnte Höhen.
Nur damit eins klar ist: Nicht jeder vergebene Elfmeter ist ein Fall von Choking. Manche Schüsse werden einfach gut gehalten, oder es ist Pech im Spiel, oder der Schütze schießt ausnahmsweise schlecht, ohne dass Angst oder Nervosität eine entscheidende Rolle spielen. (Das war im Wesentlichen Hennings Bergs These über Beckhams vergebenen Elfmeter bei der EM 2004, auch wenn ich bis heute anderer Meinung bin.) Ein Elfmeter kann ein überraschend komplexes Ereignis sein, mit vielen Schichten, die man sorgfältig unterscheiden und analysieren sollte, ehe man Schlüsse über Ursache und Wirkung zieht. Trotzdem ist klar, dass Strafstöße und Elfmeterschießen ein einzigartiges Szenario darstellen, anhand dessen sich die Auswirkungen von akutem Stress und Nervosität auf unsere Leistung gut beobachten lassen. Und diese Auswirkungen sind nicht unbedingt schön.
Akuter Stress
An einem gewöhnlichen Sommertag werden in München und Umgebung etwa 20 Menschen mit Herz-Kreislauf-Symptomen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall in Krankenhäuser eingeliefert. Am 30. Juni 2006 jedoch stieg diese Zahl auf mehr als das Dreifache, da waren es 64. Was war an diesem besonderen Dienstag anders? Nun, mindestens eine Sache: Es war der Tag, an dem das Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft zwischen Deutschland und Argentinien durch Elfmeterschießen entschieden wurde.
Herz-Kreislauf-Notfälle schossen in diesem Sommer an allen sieben Tagen, an denen Deutschland spielte, in die Höhe: 43 Fälle während der Eröffnungspartie gegen Costa Rica, 49 beim Gruppenspiel gegen das Nachbarland Polen. Aber während des Matches mit dem Elfmeterschießen (das Deutschland, wie nicht anders zu erwarten war, gewonnen hat) waren die Zahlen am höchsten.3
Das ist keineswegs nur ein deutsches Phänomen. Als die Niederlande bei der Fußballeuropameisterschaft 1996 das Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen Frankreich verloren, starben dort sogar 14 Menschen mehr als sonst an Herzinfarkt oder Schlaganfall.4 Über 20 weitere Studien dokumentieren ähnlich tödliche Auswirkungen überall auf der Welt – allein das Zuschauen bei einem aufregenden Spiel kann verheerende Folgen haben.5 Beim Lesen solcher Studien fragt man sich, ob das Anschauen von wichtigen Spielentscheidungen durch Elfmeterschießen nicht als Extremsport klassifiziert werden sollte.
Und wenn allein das Zuschauen bei so einem Ereignis derartige Folgen haben kann, wie viel Stress erleben dann erst diejenigen, die daran beteiligt sind? Spielerinnen und Spieler, die bei Elfmeterschießen Strafstöße ausgeführt haben, liefern manchmal sehr aufschlussreiche Beschreibungen ihrer Gefühle in der Situation. Der Engländer Stuart Pearce, der beim Shootout im Halbfinale der Weltmeisterschaft 1990 gegen Deutschland einen Elfmeter trat und vergab, drückte es so aus: »Man braucht nichts weiter zu tun als 50 Meter zu gehen, einen Elfmeter zu schießen und zu treffen. Das ist der schlimmste Teil, dieser verfluchte Gang von der Mittellinie zum Punkt. Wieso muss man da hinten stehen, so weit weg? Weiß der Himmel, welcher Sadist sich das ausgedacht hat. Eindeutig jemand, der noch nie in dieser Lage gewesen ist, denn es ist nervenaufreibend, es steigert die Anspannung ins Unermessliche.«6
Einer der Spieler, die ich zu ihrer Erfahrung im Elfmeterschießen bei einem EM-Spiel interviewt habe, erzählte etwas Ähnliches. Er sagte, die Nervosität habe ihn beinahe überwältigt: »Als wir im Mittelkreis standen, wurde ich unglaublich nervös. Ich dachte, man kann bestimmt im Fernsehen sehen, wie meine Knie zittern, so aufgeregt war ich.«7
Manchmal gibt es während eines Elfmeterschießens Bilder vom Geschehen im Mittelkreis, die den akuten Stress der Spieler und Spielerinnen in dieser Phase sehr schön illustrieren. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist der brasilianische Spieler Marcelo. Er ist ein sehr erfahrener, äußerst erfolgreicher Fußballer – 386 offizielle Spiele für Real Madrid, 58 Einsätze in der Nationalelf seines Landes. Und doch ähnelt seine Körpersprache, wenn er bei einem Elfmeterschießen im Mittelkreis steht, der eines verschreckten Kindes. Als die brasilianische Mannschaft im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2014 zum Elfmeterschießen gegen Chile antritt, stehen alle brasilianischen Spieler sichtlich unter Druck, aber Marcelo sticht dennoch heraus. Ein Foto zeigt, wie er sich in diesem Moment des extremen Stresses mit beiden Händen an den Hosenbeinen der Mitspieler, die rechts und links neben ihm stehen, festhält.
Auch auf der Vereinsebene, als Spieler für Real Madrid, kann man bei Marcelo ein ähnliches Verhalten beobachten, und zwar beim Elfmeterschießen in einem Champions-League-Spiel der Saison 2011/ 2012. Dieses Mal hält er, während er auf dem Boden hockt, zur Beruhigung den Oberschenkel seines Teamkollegen Pepe umklammert.
Die meisten Menschen können das vermutlich nachvollziehen. Berührung ist tröstlich, und unter Stress fühlt man sich oft sicherer, wenn man sich an etwas festhalten kann. Mich zum Beispiel beruhigt es, bei Vorträgen oder wenn ich zu einem großen Publikum sprechen muss – Situationen, die mich regelmäßig unter Druck setzen –, eine Diaprojektor-Fernbedienung in der Hand zu halten. Ob Fernbedienung oder Pepes Bein – es kommt wahrscheinlich aufs Gleiche heraus.
Wenn wir unter großem Druck stehen – und das gilt nicht nur für Elfmeterschützen und -schützinnen, sondern für uns alle –, erhöht sich unsere Herzfrequenz, unser Atem geht schneller, unsere Muskeln verspannen sich und im Bauch flattern Schmetterlinge herum. Druck löst, ebenso wie Bedrohung, eine Kaskade psycho-physiologischer Prozesse aus: Unsere Adrenalindrüsen schicken Cortisol in den Blutkreislauf;8 unsere Pupillen weiten sich, um mehr Licht hereinzulassen, während unser Gesichtsfeld am Rand verschwimmt und unsere Wahrnehmung sich verengt, womöglich bis hin zum »Tunnelblick«;9 auch unser Gehörsinn verändert sich, es fühlt sich fast so an, als hätten wir etwas auf den Ohren, und manchmal fällt es schwer, den Ursprung bestimmter Geräusche zu identifizieren;10 unsere Aufmerksamkeit wird auf das gelenkt, was wir für die Ursache des Stresses halten, unser Arbeitsgedächtnis und unsere geistige Wendigkeit sind beeinträchtigt, wir sind starr fokussiert.11
Manche dieser Prozesse wirken sich positiv auf unsere Leistungsfähigkeit aus. Die Kanalisierung von Aufmerksamkeit und Kraft kann zum Beispiel nützlich sein, denn es gibt eindeutig Anlässe, bei denen weniger Ablenkung von Vorteil ist. Doch das kann sich auch ins Gegenteil verkehren und weniger hilfreiche Folgen haben: ein unzureichendes Situationsbewusstsein, mangelndes Urteilsvermögen, mehr kognitive Fehleinschätzungen, erhöhte Risikobereitschaft und Einbußen in der Feinmotorik.12
Solche Stressreaktionen sind universelle menschliche Verhaltensweisen, anzutreffen vermutlich in allen Hochdrucksituationen, sei es der Antritt zum Elfmeterschießen im Halbfinale einer Weltmeisterschaft, der Weg auf die Theaterbühne am Premierenabend oder das Aufstehen an der Hochzeitstafel des besten Freundes, um eine Rede zu halten. Leider sind wir noch nicht in der Lage, Spielerinnen und Spielern, die sich auf einen wichtigen Elfmeter vorbereiten, psychophysische Messgeräte umzuschnallen. Ihre Gedanken und Gefühle jedoch haben wir systematisch aufgezeichnet. Was wissen wir also genau über den Druck, den ein Elfmeterschütze oder eine Elfmeterschützin an der Strafstoßmarke empfindet?
In unseren Interviews mit den 10 Spielern, die beim Elfmeterschießen im Viertelfinale der Europameisterschaft 2004 zwischen Schweden und den Niederlanden dabei waren, haben wir eine Liste von 24 Gefühlslagen vorgegeben, von denen 14 positiv und 10 negativ konnotiert waren. Die Teilnehmer sollten sich an das Elfmeterschießen erinnern und diejenigen Gefühle aus der Liste auswählen, die auf sie zutrafen.13 Obwohl die Spieler auch positive Gefühle erlebt hatten (am häufigsten, nämlich achtmal, wurde Entschlossenheit genannt), war das allgemein vorherrschende Gefühl das der Angst. Tatsächlich war sie die einzige Emotion auf unserer Liste, die alle 10 Spieler nannten. Wenig überraschend.
Bei genauerer Betrachtung stellte sich allerdings heraus, dass die Angst kein stabiler Faktor war, der während des gesamten Elfmeterschießens andauerte.14 Vielmehr veränderte sie sich ständig, kam und ging, je nachdem, wie das Shootout verlief. Ein Spieler sagte, seine Angsterfahrung sei am Anfang am stärksten gewesen: »Da war ich am nervösesten, zwischen dem ersten und dem zweiten Schuss. Ja. Am nervösesten. Auf jeden Fall. Ganz klar. Ohne Zweifel.« Doch die Angst ließ nach, sobald einer seiner Mitspieler verschoss: »Zuerst war ich sauer und enttäuscht, aber dann ging die Nervosität weg. Ich wurde viel ruhiger.«
Interessanterweise berichteten mehrere Spieler, ihre Angst sei im Mittelkreis größer gewesen als beim Gang zum Elfmeterpunkt. Das Warten und Zuschauen, während andere Spieler schossen, und die damit einhergehende Machtlosigkeit wurden als sehr belastend empfunden: »Wenn ein Gegner oder einer von uns schießt, ist die Anspannung bei uns viel größer als beim Schützen selbst. Weil wir nichts machen können.« Das Bedrohliche am Elfmeterschießen ist für diese Spieler zum großen Teil diese Kombination: womöglich schlimme Folgen, wenn es schiefgeht, aber wenig Möglichkeiten, den Ausgang zu beeinflussen.
In unseren Interviews gaben drei Spieler ausdrücklich an, dass ihre Angst auf dem Weg vom Mittelkreis zur Strafstoßmarke langsam, aber sicher abnahm: »Als das Elfmeterschießen losging, war ich echt gestresst. Ich zitterte sogar. Als ich zum Ball ging, war das vorbei.« Wenn die Angst beim Gang zum Punkt nachließ, lag das vermutlich daran, dass die Spieler in dem Moment tatsächlich etwas tun konnten. Ihr Einsatz hatte begonnen, jetzt konnten sie sich auf das konzentrieren, was ihnen vertraut war: den Ball nehmen und versuchen, ihn ins Netz zu schießen. Zwar waren die meisten auch beim Gang zum Punkt noch nervös, aber anders als Stuart Pearce bezeichneten sie diesen Teil nicht als den stressigsten. Das Angstempfinden während des eigenen Auftritts ist offenbar von Spieler zu Spieler unterschiedlicher, als man denken könnte.
Die Aussagen der Spieler passen zu den führenden Theorien über Angst im Sport, nach denen diese Angst kurz vor dem Wettkampf am stärksten ist und nachlässt, sobald der Wettkampf begonnen hat.15 Sobald die Spieler den Elfmeterpunkt erreicht hatten, verschwand die Beklommenheit, denn sie waren damit beschäftigt, sich zu konzentrieren und die Aufgabe in den Blick zu nehmen. Zwei Spieler gaben an, sie müssten erst das richtige Gefühl haben, ehe sie den Schuss ausführten: »Ich schoss erst, wenn ich bereit war. So viel Zeit muss man sich lassen. Das richtige Gefühl war für mich sehr wichtig.« Vier Spieler sagten sogar, sie seien am Elfmeterpunkt ganz ruhig gewesen (»Ich war ruhig, ich dachte nur, schieß ihn einfach rein, ganz entspannt«), während zwei andere eindeutig Angst empfanden: »Wenn du auf den Punkt zugehst, ist alles okay, aber sobald du dir den Ball zurechtlegst, kriegst du dieses besondere Gefühl im ganzen Körper.« Wieder zwei andere meinten, ihre Angst sei immer mehr abgeflaut, je näher sie dem Punkt kamen: »Irgendwann habe ich den Ball hingelegt, und alles fiel von mir ab. Kurz vorher war ich noch total nervös und angespannt.«
Angst ist eine normale Reaktion auf Leistungsdruck. Bei der Frage, inwieweit sie die Leistung beeinträchtigt, kommt es auf zwei Dinge an: Wie deutet man sie und was macht man daraus? Später werde ich zeigen, wie Spitzensportler*innen, vor allem Elfmeterschützen und -schützinnen, es schaffen, ihre Angst in den Griff zu bekommen und dadurch bessere Leistungen zu erzielen. Doch vorher sollten wir uns anschauen, was passiert, wenn Elfmeterschützen und -schützinnen sich von ihrer Angst überwältigen lassen.
Overthinking – zu viel nachgedacht
Im Elfmeterschießen des EM-Finales 2020 in Wembley stand Marcus Rashford vom englischen Team dem italienischen Torhüter Gianluigi Donnarumma gegenüber. Rashford hatte mit Sicherheit keine Ahnung, dass er gleich einen Rekord aufstellen würde. Nachdem der Schiedsrichter gepfiffen hatte, stand der englische Spieler 11 Sekunden lang still, ehe er in Richtung Ball loslief. Bei keinem der 718 Elfmeter bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und in der Champions League der Männer seit 1976 hat irgendein anderer Spieler und auch keine Spielerin vor dem Schuss so lange gezögert.