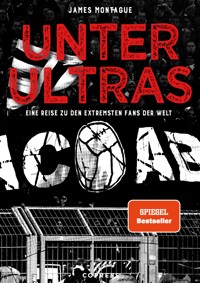
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Copress Sport
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Für die einen sind Ultras eine Fan-Bewegung, für die anderen gleichzusetzen mit rechtsradikalen Hooligans – aber was stimmt? James Montague ist tief in die Ultra-Szene in den unterschiedlichsten Ländern eingetaucht und mit einem Erlebnisbericht zurückgekehrt, den es so noch nie gab. Er analysiert, wie aus lokalen Fans ein weltweites Phänomen wurde, das heute nicht nur Fußballclubs, sondern oft auch Politik und Gesellschaft massiv beeinflusst. Man muss selbst kein Fan sein, um von »Unter Ultras« gefesselt zu werden. Die unerwarteten Einblicke, die Montague in eine der weltweit größten Subkulturen ermöglicht, sind für jeden politisch interessierten Leser höchst lesenswert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 667
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UNTERULTRAS
JAMES MONTAGUE
UNTERULTRAS
EINE REISE ZU DEN EXTREMSTEN FANS DER WELT
Übersetzt aus dem Englischen von Sven Scheer
COPRESS
IMPRESSUM
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Copress Verlag erschienenen Printausgabe (ISBN 978-3-7679-1269-4).
Copyright © James Montague, 2020
Titel der Originalausgabe: 13:12: AMONG THE ULTRAS by Ebury Press, an imprint of Ebury Publishing. Ebury Publishing is part of the Penguin Random House group of companies.
Umschlagfoto: imago images (www.imago-images.de)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2020 der deutschen Ausgabe
Copress Verlag in der Stiebner Verlag GmbH, Grünwald
Alle Rechte vorbehalten. Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages.
Übersetzung aus dem Englischen: Sven Scheer
Satz und Redaktion der deutschen Printausgabe:
Stiebner Verlag, Grünwald
ISBN 978-3-7679-2094-1
www.copress.de
Für Mila und Mitra, jederzeit
»In einem Universum, das sich ausdehnt,gehört die Zeit den Verstoßenen.Jene, die einst die Vorstädte menschlicher Ächtung bewohnten,finden sich schließlich in der Metropole wieder,ohne dass sie die Adresse gewechselt hätten.«
Quentin Crisp, Aus dem Leben eines englischen Exzentrikers
INHALT
Zu diesem Buch
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Kroatien
Teil eins: Los Primeros Hinchas
Uruguay
Argentinien
Brasilien
Teil zwei: Kein Gesicht, kein Name
Italien
Serbien
Griechenland und Mazedonien
Albanien und Kosovo
Teil drei: Gegen den modernen Fussball
Ukraine
Deutschland
Schweden
Teil vier: Die neue alte Welt
Türkei
Vereinigte Staaten
Indonesien
Danksagung
Zu diesem Buch
Um den Teil des Spiels, der mich stets am meisten interessiert hat, ranken sich zugleich die meisten Missverständnisse: die Fans, oder genauer, die Ultras, die Hooligans, die barras bravas, die torcidas, die Fanatiker oder wie auch immer die leidenschaftlichsten und extremsten unter den Anhängern in ihrer jeweiligen Heimat auch genannt werden. Schon in jungen Jahren wurde ich von der Gefahr und dem Rätsel angezogen. Es war eine verführerische und extreme Kultur. Der Blick auf jenen Bereich hinter dem Tor und die unwiderstehliche von ihm ausgehende Anziehungskraft war, als würde man ein Magic-Eye-Bild betrachten. Entweder man sah das, was darin verborgen war, oder nicht.
Allerdings ist das eine Welt, die mich niemals wirklich als einen der ihren akzeptieren wird. Journalisten sind für sie genauso sehr ihr Feind wie die Polizei. Organisierte Fangruppen begegnen jedem, der über sie schreiben will, mit Misstrauen. Das entschied in gewissen Ausmaß darüber, welche Szenen und welche Orte in diesem Buch vorkommen. Den Szenen, zu denen ich keinen Zugang bekam, habe ich kein eigenes Kapitel gewidmet. Viele Versuche blieben vergeblich, aus dem Grund findet man in diesem Buch nicht mehr über Russland, Polen und Ägypten. Wenn der problematische Zugang selbst von Interesse war, wie in Marokko, habe ich das aufgenommen.
Doch nach und nach haben die einzelnen Akteure und Gruppen mir Zutritt zu ihrer Welt gewährt. Das führte zu einer Reihe moralischer Fragen. Häufig hatte ich es mit Menschen zu tun, mit deren Ansichten ich nicht übereinstimme und deren Aussagen manchem Leser bei der Lektüre Bauchschmerzen bereiten werden. Ich habe Geschichten von Gewalt und Rassismus gehört und sie oft selbst erlebt. Gebe ich dem Rechtsextremismus und dem organisierten Verbrechen eine Plattform, indem ich über sie schreibe? Rechtfertige ich die Ansichten dieser Menschen, indem ich wiedergebe, was sie mir erzählt haben? Doch um die Welt zu verstehen, müssen wir wissen, wie sie ist, nicht wie wir sie uns wünschen, auch wenn manche Menschen zusammenzucken werden. In meinen Augen ist das die einzige Möglichkeit, um zu begreifen, wie diese riesige Subkultur entstanden ist und wieso sie agiert, wie sie agiert.
Eine andere moralische Frage war die Identifizierbarkeit meiner Gesprächspartner. Die meisten von ihnen haben gebeten, nur unter Pseudonym zitiert zu werden, da ihre Auskünfte mir gegenüber sie in Gefahr bringen könnten. Dieser Bitte bin ich nachgekommen. Eine Ausnahme bilden diejenigen meiner Gesprächspartner, die derart öffentlich auftreten, dass sie in ihren Heimatländern beinahe schon so etwas wie Berühmtheiten sind. Moralische Erwägungen standen für mich bei der Arbeit stets im Vordergrund. Diese innere Stimme hat es mir, so hoffe ich, ermöglicht, getreu alles wiederzugeben, was ich gesehen und gehört habe, und es zugleich in den jeweiligen gesellschaftlichen und politischen Kontext einzubetten. Meiner Ansicht nach sollten Sie, die Leser, sich selbst eine Meinung bilden können zu dem, was ich erlebt und hier festgehalten habe.
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Im vergangenen Jahr, als der Sommer vom Herbst abgelöst wurde und sich die Arbeit an Unter Ultras dem Ende zuneigte, beschäftigte mich vor allem eine Frage: Wie sieht die Zukunft der Ultras aus? Wie sieht die Zukunft einer Subkultur aus, die sich in einer Zeit der Konformität und des Überwachungskapitalismus ihres Widerspruchsgeists und ihrer Anonymität rühmt? Letzten Endes war ich optimistisch. Bei allen Problemen, auf die ich gestoßen war – insbesondere die Nähe der Ultras zur rechtsextremen Szene und zum organisierten Verbrechen in manchen Teilen der Welt –,gab die Bewegung Hunderttausenden, wenn nicht sogar Millionen Menschen auf allen Kontinenten ein Gefühl der Heimat und der Identität. Die Szene besaß politische Macht und sorgte im Idealfall für Veränderungen zum Guten. Natürlich passt die anarchische Freiheit der Ultras nicht zu dem Geschäftsmodell des globalisierten Fußballs, der ein keimfreies Unterhaltungsprodukt erschaffen und verkaufen will. Doch wie mir ein deutscher Ultra bei den Recherchen zu dem Buch erzählte, hat die Szene für sich selbst und ihr Überleben »zu Kämpfen gelernt«.
Und dann kam Corona.
Die letzten Spiele vor dem Lockdown sah ich in England. Ich war für ein Wochenende nach Hause geflogen, wo ich mit drei befreundeten Fans von Roter Stern Belgrad – zwei von ihnen Mitglieder der Delije – bei empfindlicher Kälte einem trostlosen 0:0 zwischen Millwall und Birmingham beiwohnte. In Serbien ist die britische Sitcom »Only Fools and Horses«, die in Südostlondon unweit der Heimstätte von Millwall spielt, äußerst populär, und so hatten die drei unbedingt fahren wollen und sich auch nicht von meinem Einwand beirren lassen, dass überhaupt nicht klar sei, ob Del Boy nun eigentlich für Millwall oder für Charlton Athletic war. Tags darauf machten wir uns in den Londoner Norden auf, wo Arsenal in der Europa League gegen Olympiakos spielte. Die Ultras von Roter Stern und Olympiakos verbindet eine innige Freundschaft, die vor allem auf dem gemeinsamen christlich-orthodoxen Glauben gründet. Die zahlreich anwesenden Gate-7-Ultras empfingen ihre serbischen Gäste mit offenen Armen, mir dagegen begegneten sie eher misstrauisch.
Das Spiel endete auf spektakuläre Weise mit dem Siegtreffer durch Youssef El-Arabi in der letzten Minute der Verlängerung. Doch im Rückblick ist nicht das der erinnerungswürdigste Moment des Abends. Stattdessen geht mir nun nicht mehr das Bild des rundlichen Olympiakos-Eigners Evangelos Marinakis aus dem Sinn, wie er über das Spielfeld watschelte und die Fans seiner Mannschaft abklatschte. Zehn Tage darauf wurde bei ihm das neuartige Coronavirus festgestellt. Für mich war das der Moment, in dem eine weit entfernt scheinende globale Pandemie vor meiner Haustür ankam.
Innerhalb weniger Wochen verschwand der Fußball. Weltweit wurde der Spielbetrieb der Ligen eingestellt. Bei der Rückkehr nach einigen Monate wurde hinter verschlossenen Toren gespielt. Allerdings gab es mehrere bemerkenswerte Ausnahmen. Belarus machte weiter, als wäre nichts geschehen. In Bulgarien kehrten die Ultras zu den Spielen zurück. Im Juni ließ Serbien beim Pokal-Halbfinale zwischen Roter Stern und Partizan 16.000 Zuschauer zu, allerdings wurden auch dort die Fans wieder ausgeschlossen, als die Infektionszahlen durch die Decke schossen. Doch der überwiegende Teil der Stadien blieb leer. Ein verbreiteter, ursprünglich dem legendären Celtics-Coach Jock Stein zugeschriebener Spruch unter Ultras und sonstigen organisierten Fangruppierungen lautet: »Ohne die Fans ist der Fußball nichts.« Diese Weisheit wurde nun einer ultimativen Prüfung unterzogen. Mehr als das: Das Ganze war eine existenzielle Krise. Stimmt es? Ist der Fußball ohne Fans tatsächlich nichts? Und falls der Sport auch ohne sie überleben sollte, würde dann bei einer Rückkehr der Fans in die Stadien die gesamte Subkultur strengen Regeln unterworfen, die sie schließlich zum Verschwinden bringen würden, wie es in den 1990er-Jahren in England geschehen ist?
Doch zunächst standen dringlichere Probleme an. Die Ultra-Kultur reicht weit über die Stadien hinaus und engagiert sich seit Langem in Krisenzeiten in den Gemeinden vor Ort. In Deutschland wurden die Ultra-Gruppen besonders aktiv. Laut dem Journalisten Felix Tamsut, der in seiner Twitter-Timeline (@ftamsut) die Ultra-Aktionen in der Corona-Krise zusammentrug, sammelte bei Borussia Dortmund The Unity (ebenso wie die Desperados und Jubos) Lebensmittel und verteilte sie an Bedürftige der Stadt. Bei Hansa Rostock organisierten die Suptras (ein Kofferwort aus »Supporters« und »Ultras«) eine Blutspendeaktion. Die Ultras Frankfurt sammelten Geld für die örtliche Tafel. Die Weekend Brothers beim VfL Wolfsburg gründeten eine eigene Tafel. Darüber hinaus gab es Solidaritätsaktionen für andere curve, etwa durch die Ultras Nürnberg, die knapp 16.000 Euro an die Curva Nord Brescia im europäischen Corona-Hotspot Lombardei spendeten. Die womöglich beeindruckendste Aktion starteten die Ultras von Brescias Erzrivalen Atalanta aus Bergamo, die halfen, ein Feldlazarett für die unzähligen Infizierten der Stadt zu errichten. In Kroatien, Marokko, Spanien, Frankreich, Israel und anderen Ländern gab es zahllose weitere Aktionen. Und die Liste wird bis heute länger.
Als der Fußball nach drei Monaten ohne Fans zurückkehrte, erschienen die Spiele derart leblos, dass Zuschauergeräusche eingespielt wurden, um die von den Ultras geschaffene Atmosphäre zu imitieren. Manche Vereine füllten die Tribünen mit Pappfiguren der Anhänger. Die Fernsehsender erkannten, dass ihr Produkt nunmehr weniger wert war, und so machten sie überall in Europa Abstriche an ihren TV-Deals mit den Ligen. Corona tötete nicht etwa die Fankultur, sondern demonstrierte die Bedeutung der Ultras für das Spiel und die lokale Gemeinschaft.
Doch selbstverständlich gab es auch weniger selbstlose Tendenzen. Die organisierte Kampfszene machte auch in der Krise anscheinend unverändert weiter. So fand etwa im August ein berühmt-berüchtigt gewordenes nächtliches Match 100 gegen 120 zwischen den Firms von Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt statt (zwei Minuten, 30 Sekunden, Sieg für Frankfurt).
Corona wird nicht so bald verschwinden. Bisher hat die globale Pandemie vor allem gezeigt, wie wichtig die organisierte Fankultur ist. Doch so kann es nicht auf ewig weitergehen. Die Bewegung muss wiederbelebt werden durch die Erfahrung, der sie ihre Lebenskraft verdankt: das kollektive Erlebnis, seine Mannschaft 90 Minuten im Stadion spielen zu sehen. Wie sieht also die Zukunft der Ultras aus? Wie die übrige Gesellschaft werden sie sich an die Situation anpassen müssen. Doch die Szene hat sich als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen. Sie weiß, um ihr eigenes Überleben zu kämpfen.
James MontagueIstanbul, September 2020
»Ich bin dir nicht böse wegen dem, was du über mich geschrieben hast. Du musstest dich auf andere Geschichten verlassen, und ich weiß nicht, ob überhaupt irgendjemand irgendetwas Gutes über mich für wahr halten würde.«
Billy the Kid
Kroatien
SPLIT
Zuerst kam das Feuer, dann brach die Hölle los. Dichte, ätzende Rauchschwaden verschlangen uns, bissen in den Augen und brannten mit ihrem unverkennbaren metallischen Aroma auf der Zunge. Einige Momente lang sah man kaum die eigene Hand vor Augen, zugleich hallten ohrenbetäubende Schlachtrufe durch den Dunst. Tausende Fans brannten rote Bengalos ab, warfen Rauchbomben und hüpften im Gleichtakt auf und ab. Die Nordtribüne des Poljud-Stadions, Heimat der Torcida-Ultras bei Hajduk Split, bebte. Zu unseren Füßen trennte ein schmaler Spalt zwei mächtige Tribünenteile, und die Betonstufen schwangen wie bei einem Erdbeben.
Langsam zog die Dunstwolke von der Nordtribüne hinab auf das Spielfeld. Junge, mit Sturmhauben maskierte Männer enterten den Metallzaun und warfen ihre Bengalos Richtung Rasen. Die Fackeln zeichneten einen verblassenden Bogen an den dämmrigen Abendhimmel, um sodann am Rand des Spielfelds zu landen, auf dem das heißblütigste Derby des kroatischen Fußballs, das Ewige Duell zwischen Hajduk Split und Dinamo Zagreb, bereits in vollem Gange war. Mehrere Bengalos loderten auf den Sitzen der Nordtribüne weiter und entzündeten ein Feuer, ohne dass Panik ausgebrochen wäre. Die Menge wich lediglich ein paar Meter zurück, ohne die um sich greifenden Flammen und die schmelzenden Sitze weiter zu beachten. Ein Löschwagen jagte um den Platz, und zwei Feuerwehrleute kletterten mit einem Schlauch auf die Tribüne, um die Gefahr zu beseitigen.
Dem Schiedsrichter blieb nichts anderes übrig, als die Partie zu unterbrechen. Das Spiel war ohnehin nur Nebensache, und das nicht nur, weil Dinamo den Titel in der Saison 2018/19 bereits so gut wie in der Tasche hatte. Das Team hatte zehn der vorangegangenen elf Meisterschaften gewonnen, dagegen lag Hajduks letzter Titelgewinn bereits knapp 15 Jahre zurück. Nein, im Mittelpunkt standen allein die Show und die Botschaft. Die 1950 gegründete Torcida ist die älteste Fanorganisation Europas. Ihr Einfluss ist immens. Indessen die Spieler noch darauf warteten, dass der künstliche Nebel sich verzog, reckten die Mitglieder der Torcida auf der Nordtribüne und die Fans auf der Osttribüne einander den rechten Arm zum wechselweisen Gruß entgegen, begleitet von Gesängen zur Melodie des Triumphmarsches aus Verdis Oper Aida. Ganz vorn standen die Capos mit dem Gesicht zur Nordtribüne und dem Rücken zum Spielfeld, das Megafon in Händen, und dirigierten die Tausende Stimmen, die überwiegend wüste Schmähparolen auf die Rivalen aus der Hauptstadt schmetterten.
»Tötet, tötet, tötet die Purgera«, beleidigten die Torcidas die Gäste mit dem dalmatinischen Slang-Begriff für die Zagreber.
Dinamo, und Zagreb allgemein, wurde für die Torcida aus einer ganzen Reihe komplizierter historischer Gründe zum Erzrivalen. Zur Zeit des ehemaligen Jugoslawiens hatte die Rivalität einen weit verbreiteten, doch mehr oder weniger harmlosen Grund, nämlich den Neid und das Gefühl der Benachteiligung der Menschen fern der Hauptstadt ihrer Teilrepublik. Doch nach dem 1995 zu Ende gegangenen kroatischen Unabhängigkeitskrieg und der Auflösung Jugoslawiens avancierten Dinamo und Hajduk zu den beiden größten Mannschaften der neugegründeten unabhängigen Liga. Partien gegen die alten Belgrader Feinde – Roter Stern und Partizan – standen nicht länger auf dem Spielplan. Also gingen die beiden Lager aufeinander los.
Der kleine, nur wenige Hundert Mann starke schwarze Block der Dinamo-Ultras von den Bad Blue Boys war in einen abgelegenen Teil des Poljud-Stadions weit oben auf der Westtribüne verbannt worden, durch leere Sitzreihen weiträumig vom Rest der Arena isoliert. Die Show gehörte der Torcida. Fahnen wurden von den oberen Sitzreihen nach unten durchgereicht, und auf den Sitzen lagen kleine Plastikbögen in Rot oder Blau bereit für eine weit im Voraus geplante Zettel-Choreo. Niemand wusste, was sie zeigen würde, doch allein durch seine Anwesenheit erklärte man sich stillschweigend mit jeder Botschaft einverstanden. Ein riesiges Banner aus Kunststoff wurde von unten nach oben entrollt, und binnen weniger Augenblicke wurde es darunter heiß und stickig. Jedem Einzelnen war in diesem kollektiven Theaterstück eine Rolle zugedacht. Doch erst nach dem Spiel sah ich auf einer Fotografie, was die Choreografie eigentlich zeigte: das überlebensgroße Bild eines Fans mit nach vorn gereckten Armen, in den Händen einen Schal in Rot und Blauviolett, den Farben der Torcida. Darunter zog sich über die gesamte Breite der Nordtribüne ein einziges Wort in riesigen weißen Buchstaben: »ULTRAS«.
Was sehen Sie, wenn Sie ein Fußballspiel sehen? Sehen Sie ein Mannschaftsschauspiel vor sich ablaufen? Sehen Sie einzelne Spieler, die ihr einzigartiges Können vorführen? Sehen Sie ein Schachspiel, beherrscht von Zahlen, Taktiken und Mustern? Es gibt keine richtige oder falsche Antwort, und Millionen Menschen rund um den Globus werden das Spiel auf eine ganz andere Weise als Sie sehen. Unmittelbar hinter den Begrenzungen des Spielfelds jedoch, auf den Rängen hinter den Toren, herrscht noch einmal ein vollkommen anderes Verständnis vom Fußball für das eine Subkultur steht, die seit Mitte des 20. Jahrhunderts das Antlitz und die Atmosphäre des Fußballs wesentlich prägt: die Ultras.
Dennoch wissen wir so gut wie nichts über diese Fangruppierungen, deren Rauchschwaden die Stadien einhüllen. Als eigenständige Kultur haben sie ihre eigenen Regeln und Normen entwickelt. Sie führen ein Leben außerhalb des Gesetzes oder geraten zumindest ständig in Konflikt damit. Sie kommunizieren mittels spektakulärer Inszenierungen: riesiger Banner, farbenfroher Choreografien, politischer Parolen, Rauchschwaden, Ehrenbezeugungen, Schmähungen, Gewaltausbrüchen und Gedenkbotschaften. Sie sind gegen die Autoritäten und hegen ein unversöhnliches Misstrauen gegen Polizei und Medien. Sie kämpfen gegen die Kommerzialisierung des Sports und die Kriminalisierung ihrer Brüder. Und sie verfügen über ein internationales Netz der Freundschaften und Feindschaften, einen eigenen Ehrencode und eine ausgeprägte Solidarität.
Der Fußball und das Fußballbusiness sind allgegenwärtig. Ein Milliardenpublikum verfolgt das Geschehen auf und neben dem Rasen und saugt noch die winzigsten Meldungen auf, die auch nur entfernt den Sport betreffen. Noch über das kleinste Detail auf dem Platz wird genauestens berichtet, genauso wie über das Leben der Spieler, die zu Stars eines globalen Entertainmentprodukts aufgebaut werden. Jede Regung von Klubbesitzern, Trainern, Managern und Verantwortlichen wird wie unter dem Mikroskop analysiert. Doch die Fans? Die Ultras? In einem Sport, in dem wir über jeden alles wissen, sind sie weitgehend ein Geheimnis geblieben. Gegeißelt als bedrohliche Fremde, verteidigen sie ihre hart errungene Anonymität und ihren Außenseiterstatus. Es gibt sie auf allen Kontinenten, auch wenn ihre Ansichten und Weltanschauungen unterschiedlich sind. Gibt es überhaupt die Definition, was oder wer »die Ultras« sind? So sichtbar sie sein mögen, sind die Ultras stets ein Rätsel geblieben.
Split ist eine alte Stadt an Kroatiens karstiger Küste, 400 Kilometer und rund fünf Stunden Fahrt von Zagreb entfernt. Im Lauf der Jahrhunderte sind viele Mächte durch die Stadt oder an ihr vorbei gezogen: Römer, Griechen, Byzantiner, Osmanen, Venezianer, Italiener, Faschisten und Kommunisten. Split pflegt seine dalmatinische und kroatische Identität und hat einen entschiedenen Widerstand gegen alle Auswärtigen entwickelt. Es gibt in der Stadt sogar einen eigenen Begriff dafür, dišpet, eine Haltung des Trotzes ungeachtet aller Konsequenzen. »Dišpet heißt, gegen alles und jeden zu sein«, erklärte mir ein Mitglied der Torcida. Split besitzt dišpet. Dalmatien besitzt dišpet. Und auch die Torcida und die Ultras besitzen dišpet. Als Hajduk 1911 gegründet wurde, bezogen sich die Gründer des Vereins mit dem Namen auf die Heiducken, christliche Aufständische in der Art Robin Hoods, die sich ab dem 16. Jahrhundert gegen die osmanische Herrschaft in Europa auflehnten.1 Im Zweiten Weltkrieg wurde das Königreich Jugoslawien 1941 besetzt, und Split geriet unter italienisches Kommando. Hajduk jedoch widersetzte sich lukrativen Angeboten zur Teilnahme an der Serie A, die 1926 vom faschistischen Regime des Diktators Benito Mussolini als nationale Liga etabliert worden war. Nachdem die Italiener Split an die Partisanen verloren hatten, besetzte kurz darauf die deutsche Wehrmacht die Stadt. Unter der Herrschaft der mit den Nationalsozialisten verbündeten Ustascha-Bewegung wurde der Unabhängige Staat Kroatien als deutscher Vasallenstaat gegründet und eine kroatische Fußballliga ins Leben gerufen. Doch Hajduk verweigerte abermals die Teilnahme. Stattdessen gingen die Mitglieder des Vereins geschlossen zu den kommunistischen Partisanen, die unter Josip Broz Titos Führung gegen die Faschisten kämpften. Die Mannschaft wurde zu einer Art Balkan-Propagandaversion der Harlem Globetrotters und trat in Kroatien, Italien und dem Mittleren Osten zu Freundschaftsspielen gegen Gegner aus Reihen der Alliierten an, um auf die Misere des Landes aufmerksam zu machen. Tito war beeindruckt und bot dem Verein an, als offizielle jugoslawische Armeemannschaft nach Belgrad umzuziehen. Doch auch Tito kassierte eine Abfuhr.2
Nach dem Krieg gründete Tito in Belgrad mit Partizan kurzerhand seine eigene Armeemannschaft. Hajduk wurde wieder in Split sesshaft und entwickelte sich zu einem bedeutenden Symbol der kroatischen Identität. Allerdings war der Begriff der nationalen Identität höchst umstritten. Als Tito Jugoslawien als sozialistischen Bundesstaat von sechs Teilrepubliken wiederauferstehen ließ, wollte er die regionalen Unterschiede in einem sozialistischen Ganzen aufgehen lassen. Dass ausgerechnet Fußballfans den schlafenden und gefährlichen Nationalismus wecken könnten, ahnten wohl nur wenige der Machthaber, als die Hajduk-Anhänger sich nach der WM 1950 in Brasilien, an der Jugoslawien teilgenommen hatte, anschickten, mit einer neuartigen Fanorganisation den Gesängen und der Leidenschaft der brasilianischen torcida-Fangruppierungen nachzueifern. Laut einer Gründungslegende erzählten Seeleute von der Insel Korčula nach ihrer Rückkehr von der WM nach Split unvorstellbar klingende Geschichten von den brasilianischen Fans, die mit Musikinstrumenten, Leuchtfeuern und Cleverness ihrer Mannschaft einen Vorteil verschafft hätten. Wahrscheinlicher jedoch ist, dass die jugoslawischen Spieler selbst von ihren Eindrücken berichtet haben.
Der jugoslawischen Mannschaft, die zuvor, 1948, bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille gewonnen hatte, gehörten fünf Hajduk-Spieler an, darunter der junge Torhüter Vladimir Beara. Als Lew Jaschin 1963 den Ballon d’Or erhielt, erklärte er in seiner Dankrede, er sei überhaupt nicht der beste Spieler der Welt. Er sei noch nicht einmal der beste Torwart der Welt. Diese Ehre gebühre Beara.3 Auch wenn die enttäuschten Jugoslawen bei der WM 1950 von Brasilien aus dem Turnier geworfen wurden, waren sie von den Zuschauern tief beeindruckt. 142.000 Menschen waren zu dem Spiel ins Maracanã von Rio geströmt. In Europa war es bis dahin üblich, dass die kaum organisierten Fans ihre Mannschaft auf eher beschauliche Art unterstützten. Doch nun lieferten Beara und sein Hajduk-Teamkamerad Bernard Vukas einer Gruppe von in Zagreb studierenden Hajduk-Fans unfassbare Berichte von dem, was sie im Maracanã gesehen und gehört hatten. Beara beschrieb bildlich den fremdartigen Sound, für den die torcida in den Stadien sorgte: »Sie waren wie eine Maschine, die für ihr Heimatland und ihre Nationalmannschaft stampfte.«4
Die Hajduk-Fans beschlossen, genau dasselbe zu versuchen. »Den Ausschlag gegeben hat ganz sicher das, was wir ihnen erzählt haben. Das kann gar nicht anders sein, denn sie wussten nicht, dass es so etwas wie die torcida überhaupt geben konnte.«5
Hajduks Splits Torcida wurde just in dem Moment gegründet, da für ein ganz besonderes Spiel eine ganz besondere Atmosphäre vonnöten war, vier Monate nach Jugoslawiens Niederlage gegen Brasilien am anderen Ende der Welt. Am vorletzten Spieltag der ersten jugoslawischen Liga musste Hajduk gegen Roter Stern Belgrad antreten. Mit einem Sieg hätte der Verein seinen allerersten Titel so gut wie sicher gehabt. Die Torcida-Anführer rüsteten ihre Mitglieder mit »Schulglocken, Trompeten, Rasseln und Pfeifen [aus] und bestiegen mit ihnen den Zug nach Split«6. Am 28. Oktober 1950 wurde die Torcida offiziell gegründet. Unterstützt von lokalen Funktionären der Kommunistischen Partei suchten Hunderte Torcida-Mitglieder das Mannschaftshotel von Roter Stern auf und brachten den Spielern ein Ständchen, »ein mitreißendes Konzert, bei dem sie ihren Instrumenten schrille Töne entlockten und damit die Vorbereitung des Gegners störten«7. Rund 20.000 Fans quetschten sich am 29. Oktober in das Stadion Stari plac im Zentrum von Split, um das Spiel auf dem Ascheplatz zu verfolgen. Zunächst wurde der Torcida und ihren Instrumenten der Eintritt verweigert, doch dann schaltete sich Hajduks Präsident (ein hochrangiger Funktionär der Kommunistischen Partei) ein. In einer örtlichen Parteizeitung hieß es, das Stadion »glich einem Hexenkessel. Die Schlacht auf dem Spielfeld nahm begleitet von der frenetischen Unterstützung der Zuschauer ihren Lauf … Alle – die Spieler auf dem Feld und die Zuschauer auf den Tribünen – kämpften Seite an Seite.«8
Der Torcida gelang es tatsächlich, die fiebrige Atmosphäre Brasiliens zu kopieren. Doch die Sache lief aus dem Ruder. Mitten im Spiel schlug ein Hajduk-Spieler dem Kapitän von Roter Stern ins Gesicht, und als Hajduk kurz vor Schluss den 2:1-Siegtreffer erzielte – und damit den Titel so gut wie in der Tasche hatte –, stürmten die Zuschauer das Feld. (Letztlich sollte Hajduk als einzige Mannschaft der jugoslawischen Geschichte ungeschlagen Meister werden.) Am Abend feierte die Torcida in der Altstadt, und ein Mitglied verlas vor der Menge einen Nachruf auf Roter Stern Belgrad. In Belgrad wurde das Spektakel verurteilt, und eine Zeitung beklagte den »Höllenlärm« der Torcida und dass die Gruppe an »unzivilisierten und obszönen Vorfällen«9 beteiligt gewesen sei. Die Kommunistische Partei war erschrocken über das unverhüllt kroatische Gebaren der Torcida und fürchtete, dadurch könnten nationalistische Tendenzen geschürt werden, zumal die faschistische Ustascha erst fünf Jahre zuvor besiegt worden war. Sie griff zu rabiaten Maßnahmen. Drei der Torcida-Gründer wurden aus der Partei ausgeschlossen. Der Schiffsjunge Vjenceslav Žuvela von der Insel Korčula, der maßgeblich an der Gründung beteiligt gewesen war, wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, allerdings wurde die Strafe im Nachhinein auf drei Monate reduziert. Hajduk durfte 50 Jahre lang das rot-weiße Schachbrettmuster der kroatischen Flagge nicht in seinem Vereinswappen verwenden. Die Torcida erlebte nur dieses eine Spiel, dann wurde sie verboten. Doch so kurzlebig die Torcida auch war, als Europas erste organisierte Fanvereinigung entfaltete sie eine enorme Wirkung. Hajduk Split war seinem dišpet-Ruf wieder einmal gerecht geworden. Ein rebellischer Klub für eine rebellische Stadt.
Nach Titos Tod 1980 zerfiel Jugoslawien und steuerte in einer zehnjährigen Abwärtsspirale auf einen grausamen ethnisch-nationalistischen Krieg zu, derweil die Torcida als Stimme des Nationalismus in Split ein Comeback feierte. Auch in den anderen jugoslawischen Republiken entstanden neue Fanclubs, wesentlich beeinflusst von den italienischen Ultra-Gruppen, die jenseits der Adria ihre Hochzeit erlebten. Jede einzelne der neuen Gruppen kündigte bereits den zerstörerischen Nationalismus an, der am Horizont aufzog. Begegnungen von Dinamo oder Hajduk gegen Roter Stern Belgrad endeten oftmals mit Krawallen, bei denen die jeweiligen Ultras in vorderster Front standen.
Nach dem Unabhängigkeitskrieg trat Dinamo Zagreb an die Stelle von Roter Stern als Hajduks Erzrivale. Der neue, nationalistische Präsident des Landes, Franjo Tuđman, wollte Dinamo Zagreb zum nationalen Aushängeschild machen. Allerdings war ihm der Name »Dinamo« als zu kommunistisch verhasst, und so wurde der Klub kurzzeitig in Croatia Zagreb umbenannt.10 Im Februar 2000, zwei Monate nach Tuđmans Tod, kehrte der Verein zu seinem alten Namen Dinamo zurück. In den Nullerjahren leitete Zdravko Mamić die Geschicke des Vereins, ein korrupter Funktionär, der lange den kroatischen Fußball kontrollierte und sich bis heute in Bosnien-Herzegowina dem Zugriff der kroatischen Justiz entzieht, nachdem er in Abwesenheit wegen Veruntreuung und Steuerhinterziehung verurteilt wurde.11 Hajduks Ultras hatten die Proteste gegen ihn und seine Helfershelfer im kroatischen Fußball angeführt. Bei der EM 2016 hatten Torcida-Mitglieder aus Protest gegen den kroatischen Fußballverband HNS in St. Etienne Bengalos auf das Spielfeld geworfen, dabei hatte Kroatien in Führung gelegen. Nach der Partie war es unter den kroatischen Fans zu Schlägereien gekommen.12 Vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Italien 2015 war ein riesiges Hakenkreuz auf den Rasen des Poljud-Stadions gemalt worden, obwohl das Spiel aufgrund rassistischer Sprechchöre bei einem vorangegangenen Spiel ohnehin schon vor leeren Rängen stattfinden musste.13 Vermutlich hatte der Verband in Zagreb mit der Aktion noch stärker in Verlegenheit gebracht werden sollen. Mamić war sogar in die Adria gestoßen worden, als er auf der vor Split gelegenen Insel Brač aus einem schicken Restaurant gekommen war. Dass der Angreifer der Torcida angehört hatte, war nicht bewiesen worden, dennoch kritisierte Mamić die Gruppe kurz darauf in einem in den sozialen Medien veröffentlichten Brief. »Ihr könnt euch nur hinter dem Wort ›Torcida‹ verstecken und so tun, als ob ihr Helden wäret. Doch als Hajduk ausgenommen wurde, habt ihr kein Wort gesagt.«14
Mamić spielte in seinem Post auf das Jahr 2011 an, als Hajduk nach Jahren des Missmanagements und der Korruption beinahe in die Insolvenz geschlittert wäre. Allerdings erwähnte er nicht, dass die Torcida mit einem Mamićs Profitmaximierung entgegengesetzten Modell zur Rettung des Klubs beigetragen hatte. Eine Gesellschaft namens Naš Hajduk (»Unser Hajduk«) war gegründet worden, um den Klub nach strengen, demokratisch überwachten Grundsätzen zu führen. Die Torcida erwarb Anteile des Vereins, bis sie über annähernd 25 Prozent verfügte und damit eine Kontrollfunktion ausüben konnte.
Der Leiter von Naš Hajduk und Hajduk-Fan Ivan Rilov sagte: »Das einzige Ziel, die einzige Absicht war, ein Modell durchzusetzen, das eine demokratische und transparente Führung gewährleistet. Der Aufsichtsrat wird demokratisch gewählt. Dann wählt der Aufsichtsrat den Vorstandsvorsitzenden, und der Vorstandsvorsitzende leitet den Verein.« Die Torcida hatte kein Interesse daran, selbst den Verein zu führen. Die Fanbasis sollte lediglich das letzte Wort haben, wer das tat. Rilov strich die Ehrenhaftigkeit der Fans heraus: »Letzten Sommer gab es hier in der Nähe von Split einen großen Brand. Und wer war ganz vorn dabei, um den Menschen zu helfen? Torcida. Als es vor ein paar Jahren in Nordkroatien große Überschwemmungen gab, waren die Torcida-Mitglieder sofort vor Ort. Wenn in Split ein Krankenhaus Blutspenden braucht, stehen die Torcida-Mitglieder als erste auf der Matte.«
Das neue Modell funktioniert. Inzwischen zählt die Gesellschaft 40.000 zahlende Mitglieder. Rilov erhält E-Mails und Briefe aus aller Welt, nicht nur von Fußballfans, sondern auch von Menschenrechtsaktivisten und -anwälten, die Naš Hajduk als ein rares – noch dazu erfolgreiches – kroatisches Modell ansehen, das für andere zum Beispiel werden sollte. Auch wenn es bisher dennoch nicht zu einem Meistertitel gelangt hat. Gleichzeitig zeigt die Geschichte die Janusköpfigkeit der Ultra-Bewegung. Rilov sagte: »In Split sind wir immer gegen etwas. Das ist nicht unbedingt gesund, aber manchmal kann das auch ganz nützlich sein.«
Vor dem Derby versammelten sich die Torcida-Mitglieder auf einem Platz unweit der Altstadt und erfreuten sich am Bier und ihren Gesängen. Eine wichtige Aufgabe lag bereits hinter ihnen. Sie hatten an ZOB und Bahnhof die Ausweise aller Ankommenden überprüft, damit nicht etwa einer der Bad Boys Blue auf diesem Weg in die Stadt gelangte. Von dem Platz führte der Weg nach Norden, vorbei am alten Stadion Stari plac, vorbei am Hauptquartier der Torcida, vorbei an den Grillständen mit ćevapčići, bis man zu einem kleinen Park kam, von wo man den Ausblick auf das prachtvolle Poljud-Stadion am Adriaufer genießen konnte. Das Stadion mit seinem muschelartig zweigeteilten Dach wurde von Boris Magaš entworfen und gilt als eine der letzten Perlen der jugoslawischen Architektur. Als Zeugnis des vor Titos Tod herrschenden jugoslawischen Utopismus wurde es kürzlich in einer Ausstellung im New York Museum of Modern Art präsentiert.15
Sämtliche Gebäude, Hochhäuser, Läden und Einkaufszentren auf dem Weg zum Stadion waren nicht nur mit Hajduk-Graffiti, sondern auch mit rechtsextremen Symbolen übersät, mit Hakenkreuzen, dem keltischen Kreuz, faschistischen Zahlencodes. Auf eine Wand war Nazi Ragazzi (italienisch für »Nazi-Jungen«) aufgesprüht. Hajduk mochte eine antifaschistische Tradition haben,doch im 21. Jahrhundert ist alles ein wenig komplizierter geworden. Wie viele Kroaten steht auch ein beträchtlicher Anteil der Torcida-Mitglieder der Ustascha aus nationalsozialistischer Zeit wieder wohlwollend gegenüber. Immer wieder kann man die Ustascha-Parole »Za dom spremni« (»Für die Heimat – Bereit!«) vernehmen, das kroatische Pendant zu »Sieg Heil« – insbesondere rund um das Gedenken an die Operation Sturm, die entscheidende Offensive des »Vaterländischen Krieges« für Kroatiens Unabhängigkeit, bei der Hunderte Zivilisten starben und mindestens 200.000 Serben in Todesangst flohen.16 In Kroatien wird die Operation von vielen gefeiert, in Serbien dagegen als im Grunde ungesühnt gebliebenes Kriegsverbrechen verurteilt. Ante Gotovina, einer der verantwortlichen Kommandanten, wurde zunächst vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (UN-Kriegsverbrechertribunal) zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt, doch in der Berufungsverhandlung freigesprochen. Laut einem Ex-Torcida-Mitglied bieten die Gesänge zu Verdis »Triumphmarsch« mit dem wechselseitigen Gruß von Nord- und Westtribüne immer wieder einen willkommenen Vorwand für den Hitlergruß, da man anschließend jegliche Absicht glaubhaft abstreiten kann.
Polizisten tasteten an den Stadiontoren die Besucher grob ab. Auf der zur Haupthalle hinaufführenden Treppe sammelten mit Eimern ausgestattete Torcida-Mitglieder Spenden. Normalerweise wurde damit die Choreo finanziert, doch an diesem Tag war das Geld für eine ehemalige Klublegende gedacht. Der Mann war krank und mittellos. Die Torcida wollte 1.000 Euro zusammenbekommen, damit er dennoch Anteile am Verein erwerben konnte. Trotz der Durchsuchungen durch die Polizei waren Hunderte Bengalos ins Stadion gelangt. Nach der Choreo, nach dem Rauch und dem Feuer, stand schließlich noch ein Fußballspiel an. Es endete mit einem tristen 1:0-Sieg für Dinamo Zagreb. Der aufregendste Moment auf dem Spielfeld war noch, als Hajduks Mijo Caktaš mit einem Ellbogenschlag eine Rudelbildung sämtlicher 22 Spieler auslöste. Auch nach dem Schlusspfiff gingen die Gesänge weiter: gegen Mamić, gegen Zagreb, gegen den HNS, gegen die Serben. Gesänge gegen alles. Mit der Nordtribüne hatte die Torcida sich einen Freiraum geschaffen, dessen Regeln allein sie bestimmte. Zugleich war das, was man hier erlebte, eine flüchtige Erfahrung. Von der Choreografie über die Gesänge und Banner bis zu den Klagen über das Kapital und den Forderungen nach Gerechtigkeit war alles real. Doch kaum war die Show vorbei, trat Saison für Saison, Spieltag für Spieltag eine andere, neue Show an ihre Stelle. Jede Aktion war bereits Vergangenheit, kaum dass sie begonnen hatte. Doch jede würde eine Spur zurücklassen, den Hauch einer Erinnerung im kollektiven Gedächtnis. Wie die versteinerten Überreste eines urzeitlichen Tieres, das vergangen und vergessen sein mochte, doch dessen Umrisse sich für immer dem Gestein eingeprägt haben.
TEIL EINS:LOS PRIMEROS HINCHAS
»Sind Sie schon jemals in einem leeren Stadion gewesen? Machen Sie einmal die Probe. Stellen Sie sich mitten auf den Platz und lauschen Sie genau. Es gibt nichts volleres als ein leeres Stadion. Es gibt nichts lauteres als die Ränge, auf denen niemand steht.«
Eduardo Galeano, Der Ball ist rund und Tore lauern überall
1
Uruguay
MONTEVIDEO
Vor dem Estadio Centenario wartete nicht eine Menschenseele, dennoch öffnete das Museo del Fútbol um Punkt 10 Uhr seine Pforten. Das Stadion war 1930 für die allererste WM-Endrunde erbaut worden und hatte schon bessere Tage gesehen, doch aus der Nähe war es nach wie vor ein architektonisches Wunderwerk mit seinem geflügelten, einhundert Meter hohen Art-Deco-Turm La Torre de los Homenajes und dem abgesenkten Spielfeld in der Betonschüssel. Die Fertigstellung des Stadions hatte sich wegen sintflutartiger Regenfälle verzögert, sodass die ersten WM-Partien in anderen Stadien hatten stattfinden müssen. Doch einige Wochen nach dem geplanten Termin war es schließlich fertig, und so konnten noch eine Handvoll Gruppenspiele, beide Halbfinals und das erste WM-Finale der Geschichte zwischen Uruguay und Argentinien hier ausgetragen werden. Mehr als 60.000 Zuschauer – darunter rund 20.000 per Schiff über den Río de la Plata gekommene Gästefans – sahen den 4:2-Sieg Uruguays, nachdem das Team zur Pause noch 1:2 zurückgelegen hatte.
Dass ein Land mit gerade einmal 1,75 Millionen Einwohnern (wie Uruguay 1930) Weltmeister wird, ist normalerweise in etwa so wahrscheinlich wie ein Lottogewinn. In diesem Fall jedoch nicht. Uruguays Fußball konnte in den zurückliegenden mehr als 90 Jahren außergewöhnliche Erfolge feiern, eine Geschichte, die das Museo del Fútbol auf zwei Stockwerken des Stadionturms genauer präsentiert. Unzählige Vitrinen voller Fotografien und Devotionalien führen anschaulich vor Augen, wie ein winziges Land einen derart überproportionalen Einfluss auf die Geschichte einer weltumspannenden Sportart gewinnen konnte. In einem flachen Glaskasten im Erdgeschoss befindet sich ein zerrissenes, fadenscheiniges Exemplar der blau-weiß gestreiften Flagge Uruguays mit der charakteristischen, auf den Sonnengott der Inkas zurückgehende Maisonne in der linken oberen Ecke; eben diese Flagge hatte bei den Olympischen Spielen von Paris 1924 geweht, bei denen das uruguayische Team Gold gewann. Im Obergeschoss sind die Schuhe ausgestellt, mit denen der Mittelfeldspieler Roberto Figueroa bei den Olympischen Spielen von Amsterdam 1928 bei dem 2:1-Sieg über Argentinien im Final-Wiederholungsspiel traf.
Das Herzstück des Museums bildet ein gewaltiges zeitgenössisches Gemälde, das Vergangenheit und Gegenwart der Celeste verbindet. »Los 23 Orientales« (»Die 23 aus dem Osten«) wurde von dem uruguayischen Künstler Santiago Vecino zur WM 2018 in Russland gemalt. Das einen auf zwei Meter große Querformat gleicht einem modernen Historiengemälde. Egidio Arévalo Rios stemmt nach dem Triumph 2011 die Copa América in die Höhe, die Uruguay insgesamt bereits 15 Mal gewonnen hat, häufiger als jedes sonstige südamerikanische Land. Rechts präsentiert eine vorwärts gebeugte Figur, vermutlich Edinson Cavani, den Jules-Rimet-Pokal, den Uruguay nach 1930 ein zweites Mal 1950 durch den berühmten Triumph über Brasilien vor 200.000 Fans im Maracanã-Stadion gewann. Links wird Alvaro Pereira von zwei Mannschaftskameraden gestützt, nachdem er bei der WM 2014 in der Partie gegen England durch einen Knietreffer Raheem Sterlings ausgeknockt worden war. Uruguay entschied die Partie mit 2:1 für sich; beide Treffer erzielte Luis Suárez, aktuell der unbestritten größte Star des uruguayischen Fußballs. Selbstverständlich ist er es, der im Zentrum des Bildes die himmelblaue Fahne hält. Im Hintergrund sitzt Mannschaftskapitän Diego Godin aus unerfindlichen Gründen auf einem Schimmel, in der Hand ein mittelalterlich anmutendes blaues Banner mit vier goldenen Sternen für Uruguays zwei WM-Titel und die beiden Olympiasiege. Im Hintergrund ragen der Eiffelturm, die Erlöserstatue, das Estadio Centenario und die Moskauer Basilius-Kathedrale in den Himmel.
Lässt man das Gemälde hinter sich, folgt am Ende eines Seitenganges ein Tribut an einem Mann, dem in der Geschichte des Fußballs eine ganz andere, doch keineswegs weniger bedeutsame Rolle zukommt. Die gerahmte, im Lauf der Zeit leicht grünlich ausgeblichene Fotografie zeigt einen kräftigen Mann mittleren Alters in dreiteiligem Anzug mit Krawatte. Die Enden seines ausladenden Schnurrbarts neigen sich nach unten, sein Kinnbart ist graugesprenkelt. Das Porträt von 1905 ist leicht zu übersehen. Es zeigt Prudencio Miguel Reyes. Reyes war weder aktiver Fußballer, noch bekleidete er in einem uruguayischen Verein oder im nationalen Verband ein hohes Amt. Der Sattler war für den wenige Jahre zuvor in Montevideo gegründeten criollo (»kreolischen«) Club Nacional de Football tätig, den ersten Verein des Landes, bei dem Uruguayer, nicht Engländer, das Sagen hatten. Seine Funktion an Spieltagen war ebenso praktisch wie notwendig: Als hinchador oblag es ihm, vor und während des Spiels die schweren Lederbälle aufzupumpen. Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts war er aus dem Estadio Gran Parque Central nicht wegzudenken. Und er war anders als die anderen im Stadion.
Zu jener Zeit galt der Fußball in Uruguay als Kunstform, die man wie eine Oper oder ein Theaterstück genoss. Matches beim Fußball, Tennis, Polo oder sogar Kricket glichen sich mehr oder weniger. Die in Festtagsgarderobe gekleideten Zuschauer verfolgten das Geschehen im – laut Nacionals Comision de Historia y Estadistica – »klassischen angelsächsischen Stil«. Auf den Holztribünen des Parque Central ging es bei den Spielen ordentlich und gesittet zu, »das Publikum bewahrte bei den Partien eine gewisse Ernsthaftigkeit«17, außer bei einem Treffer, doch selbst dann »beschränkte sich die Beteiligung auf gedämpften Applaus oder einen Ausruf der Freude oder Enttäuschung«18.
Reyes war das vollkommene Gegenteil. Soweit bekannt, war er außerhalb des Parque Central ein stiller und zurückhaltender Mann. Doch sobald er im Stadion seinen Platz am Spielfeldrand einnahm und der Schiedsrichter die Partie anpfiff, war er wie ausgewechselt. Musste er nicht gerade einen Ball aufpumpen, tigerte er an der Seitenlinie auf und ab und feuerte die Spieler lauthals an, um sich im nächsten Moment an die Zuschauer zu wenden und sie nicht minder lautstark aufzufordern, in seine Anfeuerungen einzustimmen, bis sie schließlich von ihm angeleitet im Chor »Nacional vor, Nacional vor, Nacional vor« skandierten und die Mannschaft nach vorn peitschten. Bei den ersten Spielen reagierten die Menschen verblüfft. Die Reporter berichteten über Nacionals El Hincha Pelotas, den Ballaufpumper, der ebenso viel zum Spektakel beitrug wie das Spiel selbst. Unbeirrt brüllte und rannte er weiter, bis er die Zuschauer auf seiner Seite hatte. Mit jedem Heimspiel schlossen sich mehr Anhänger dem Beispiel des »feisten Reyes« mit den »Salamifingern« an, wie ihn der berühmte uruguayische Autor Diego Lucero einmal beschrieb. Etwas Derartiges hatte bis dahin noch niemand gesehen. Unter dem Eindruck von Reyes begannen auch die Gästefans,ihre Mannschaft mit Sprechchören anzufeuern, um anschließend die neue Form des Supports im eigenen Stadion zu übernehmen. Der Verein bemerkt in seiner offiziellen Geschichte zu Reyes: »Bald wurden die Nacional-Anhänger, die am lautesten schrien, als hincha bezeichnet. Später dann ging der Begriff auch auf die Fans der anderen Vereine über, überquerte den Río de la Plata und ging schließlich um die ganze Welt.«
Heute werden verrückte Fußballfans in der gesamten spanischsprachigen Welt als hinchas bezeichnet. Prudencio Miguel Reyes hat niemals eine WM oder eine olympische Medaille gewonnen und starb weitgehend vergessen im Februar 1948. Noch nicht einmal seine Grabstätte ist bekannt. Doch seine bis dahin unbekannte Form der Unterstützung der eigenen Mannschaft erwies sich als revolutionär. Sie trug maßgeblich dazu bei, die imaginäre vierte Wand der Fußballbühne zu durchbrechen, und veränderte dauerhaft das Verhältnis zwischen Zuschauern und Spielern. Die Fans verharrten nicht länger in der Passivität. Sie waren von der Kette gelassen und verbreiteten den Virus ihrer Leidenschaft. Prudencio Miguel Reyes war der Patient null: der erste barra brava, der erste torcedore, der erste Ultra, der erste Fan, El Primer Hincha.
Ich hatte mir Mikael größer vorgestellt. Wir hatten uns mehrere Wochen auf WhatsApp über unsere bevorstehende Reise ausgetauscht, und vereinbart, uns im 12.000 Kilometer entfernten Montevideo zu treffen, um den uruguayischen clásico zwischen Nacional und Peñarol zu verfolgen. Mikael ist einer der bestvernetzten Protagonisten der europäischen Ultra-Szene, ein Schwede, der zu Beginn der 1990er-Jahre bei seinem Klub Hammarby die erste Ultra-Gruppierung des Landes gegründet hatte. Auch wenn sein Herz Hammarby gehört, war ihm stets bewusst gewesen, dass die Welt sehr viel größer ist. Er hatte mir erzählt, wie er 1978 als Neunjähriger gebannt das WM-Finale zwischen Argentinien und den Niederlanden verfolgt hatte – nicht etwa wegen des Spiels, sondern wegen des blau-weißen Konfettigestöbers, das von den Rängen auf den Rasen des Estadio Monumental in Buenos Aires niederging. Eine solche Atmosphäre hatte er irgendwie auch in Hammarby erschaffen wollen. Er war um die Welt gereist, ausgiebig in andere Fußballkulturen eingetaucht und mit seinen Eindrücken im Gepäck nach Schweden zurückgekehrt. Tiefe Freundschaften verbanden ihn unter anderem mit den Roma-Ultras, denen von Rapid Wien oder den Griechen von Panathinaikos. Doch der eigentliche Grund für unseren Kontakt war, dass er ein Jahr unter den argentinischen barras bravas verbracht hatte, insbesondere bei der barra der Boca Juniors, der womöglich berüchtigsten Fangruppierung der Welt, La Doce (»Die Zwölf«), die ihren Namen der Tatsache verdankt, dass sie Bocas zwölfter Mann ist.
Die Grundpfeiler der globalen Ultra-Bewegung sind einerseits Vertrauen, andererseits Misstrauen. Kein Ultra vertraut einem Journalisten, doch unter den Gruppierungen besteht weltweit ein inoffizieller Ehrenkodex. Sofern sich jemand für einen verbürgt, stehen einem alle Türen offen. Wenn nicht, bleiben sie verschlossen. Wie bei den europäischen Ultras und Hooligans war es auch bei den barras bravas außerordentlich schwierig, Gesprächspartner zu finden. Diese organisierten Fangruppierungen werden oftmals als die südamerikanische Variante der Ultras bezeichnet. Ihre ersten Vorläufer tauchten in den 1920er-Jahren in Argentinien auf und breiteten sich von dort schon bald über den gesamten spanischsprachigen Subkontinent aus. In den barras versammeln sich die heißblütigsten hinchas eines Vereins, ihnen verdankt sich die einzigartige Atmosphäre in den südamerikanischen Stadien, die weltweit ihresgleichen sucht und den Stadionbesuch zu einem einzigartigen Erlebnis macht. Doch zugleich haben die barras auch eine finstere und gewalttätige Seite und den Schritt von der ritualisierten Fußballgewalt zum organisierten Verbrechen vollzogen. In Argentinien und Uruguay kontrollieren die äußerst mächtigen barras sämtliche Geschäfte rund um das Stadion, von den Parkplätzen über Tickets und Drogen bis zu den Imbiss- und Fanartikelständen. Die Begegnung Nacional gegen Peñarol gehört zu den größten clásicos Südamerikas – und zu den gewalttätigsten. Doch während in Argentinien die Gewalt derart eskaliert war, dass seit sechs Jahren keine Auswärtsfans mehr zugelassen waren, konnte Nacionals barra La Banda del Parque das Spiel vor Ort im Stadion verfolgen. Mikael würde mein Fremdenführer, Mittelsmann und, so hatte ich gedacht, Bodyguard sein.
Mikael ging auf die 50 zu und war rund 30 Zentimeter kleiner als ich. Er hatte einen langen Pferdeschwanz und einen Rauschebart. Sein hellblaues West-Ham-United-Shirt mit dem Aufdruck »Cockney Rejects« verdeckte nur unzureichend seine Tattoos. Gleich mehrere zogen sich über Hals und Nacken, darunter ein großer rosa Kussmund. An anderen Stellen seines Körpers hatte er – neben Hammarby, natürlich – die Klubs verewigt, zu denen er im Lauf der Jahre freundschaftliche Bande geknüpft hatte und die ihn bei seinen Besuchen am meisten beeindruckt hatten: Roma, Rapid Wien und natürlich die Boca Juniors. Ein Tattoo am Bein zeigte Andy Capp, einen politisch inkorrekten britischen Cartoonhelden, der weltweit zu einem Symbol der Ultra-Bewegung avanciert ist. Über Mikaels Bauchpartie zog sich in großen Lettern der Schriftzug ULTRAS.
»Hey, Kumpel«, begrüßte er mich herzlich und mit leichtem Cockney-Akzent. Ein Freund hatte sich dafür verbürgt, dass er kein Psychopath war. Genau genommen war er ein pazifistischer, Death Metal hörender Ultra, der kein Interesse an der gewaltsamen Seite der Szene hatte. Er hatte schlechte Neuigkeiten für mich. Der uruguayische clásico war von einem Tag auf den anderen abgeblasen worden. Und La Banda del Parque hatte dringendere Probleme. »Einer der Anführer der barra sitzt im Knast, weil er jemanden umgebracht haben soll«, teilte Mikael mir nüchtern mit. Er zweifelte an dem Vorwurf. »Ich vermute mal, es geht um Macht und Geld, wie immer in Südamerika.«
Der Fall war entsetzlich. Sechs Wochen zuvor waren die Leichen von zwei Männern – Mitglieder von La Banda del Parque – in einem ausgebrannten VW-Lieferwagen im Stadtbezirk Tres Ombues gefunden worden. Einen Monat darauf waren drei andere Mitglieder der barra verhaftet worden, einer von ihnen auf dem Flughafen von Montevideo, als er von Nacionals Copa-Libertadores-Auswärtsspiel bei Atlético Mineiro aus Brasilien zurückgekehrt war. Zu Beginn der gerichtlichen Anhörungen hatte einer der Anwälte der Angeklagten erklärt, dass sein Mandant von Nacional pro Spiel 40.000 uruguayische Pesos (gut 830 Euro) erhalte – dafür, dass er Banner und Trommeln organisiere und die hinchas in Zaum halte.19 Der Verein stritt das ab, dennoch war das ein Skandal, weil sich viele Uruguayer in ihrer Vermutung bestätigt sahen, dass die Klubs sich nach wie vor mit Jobs und Tickets das Wohlwollen der barras erkauften. Uruguay ist das wohlhabendste und sicherste Land Südamerikas, dennoch sind auch dort in und vor den Stadien Dutzende Menschen gestorben. Eine Zäsur hatten die Schüsse auf zwei Peñarol-Fans vor dem clásico 2016 dargestellt. Einer von ihnen hatte eine Niere verloren, der andere war einen Monat darauf seinen Verletzungen erlegen. Die Liga war unterbrochen und ein Dutzend Mitglieder von La Banda del Parque verhaftet worden. Der darauffolgende clásico im Centenario war kurzfristig abgesagt worden, da Mitglieder von Peñarols Barra Amsterdam Gasflaschen auf Polizisten geworfen hatten; es hatte 150 Verhaftungen gegeben. Die Regierung hatte ein entschiedenes Vorgehen gegen die Vereine angekündigt, sollten diese weiterhin enge Beziehungen zu den barras pflegen. Die Polizei wiederum hatte erklärt, keine Beamten mehr in die Stadien zu entsenden; die Vereine sollten selbst für die Sicherheit aufkommen. Wie die Ermittlungen in dem Fall der beiden Leichen in dem ausgebrannten Transporter zeigten, pflegten die Vereine dennoch weiterhin enge Beziehungen zu den barras. Vor dem uruguayischen Parlament warnte der Sicherheitsbeauftragte des nationalen Fußballverbands, Rafael Peña, die barras seien zu »wahrhaften Kartellen geworden, die sich sogar Kämpfe wegen ihrer Reviere und der kriminellen Machenschaften, in die sie verwickelt sind, liefern«. Jeder Versuch, gegen ihre Geschäfte vorzugehen, würde »immer und ausnahmslos Erpressungen nach sich ziehen«.20
Die Nacional-Fans hingegen suchten, wie immer, Zuflucht zu einer Verschwörungstheorie. Die offizielle (und einigermaßen haarsträubende) Begründung des Verbands für die Verschiebung des anstehenden clásico lautete, dass vier Nacional-Fans, darunter ein zehnjähriges Mädchen, am Verbandssitz gegen die Schiedsrichterleistung bei der vorangegangenen Begegnung protestiert hatten. Nach Überzeugung der Fans zeigte das nur die verzweifelte Suche des Verbands nach einem Vorwand, um die Austragung des clásico an jenem Wochenende zu verhindern, in erster Linie, da Peñarol in der Copa Libertadores das letzte und entscheidende Gruppenspiel gegen Flamengo aus Brasilien bevorstand. Peñarol sollte nun in einem halbleeren Estadio Centenario gegen River Plate Montevideo spielen und Nacional später am Abend im Parque Central gegen Progreso. Es war dunkel und schüttete wie aus Kübeln, als Mikael und ich am Stadion ankamen. Hier hatte das allererste WM-Spiel der Geschichte stattgefunden: USA gegen Belgien (parallel zu der Partie Frankreich gegen Mexiko im mittlerweile abgerissenen Estadio Pocitos, Peñarols einstiger Heimat). Mikael verfügte über einen schier unerschöpflichen Vorrat an Hammarby-Stickern, mit denen er Laternenmasten und Straßenschilder pflasterte: »Barra Brava Hammarby«, »Love Football, Hate Cops« und Andy Capp im grün-weißen Dress von Hammarby. Ein einsamer Posaunist spielte sich vor der Westtribüne, dem Revier von La Banda del Parque, warm. Die Mitglieder der barra zogen mit Trommeln und anderen Schlaginstrumenten in ihren Block ein. Lediglich der untere, nicht überdachte Rang war gefüllt. Dutzende blau-weiß-rote Banner und Fahnen trugen etwa die Aufschrift »Nacional, wir geben unser Leben für dich« oder wurden von einem überdimensionalen Hanfblatt und dem kreisförmigen Schriftzug Piedras Blancas (»Weiße Steine«, ein Stadtteil Montevideos) geschmückt, außerdem zog sich ein Banner mit der Aufschrift »La Primer Hinchada del Mundo« (»Die erste Fangruppe der Welt«) auf halber Höhe über die gesamte Breite des Ranges. Die Fans begannen zu singen und zu hüpfen und hörten nicht mehr auf, noch nicht einmal in der Halbzeitpause, als ihr Team bereits 3:0 führte. Im Mittelkreis wartete der Schiedsrichter auf zwei Bereitschaftspolizisten in voller Montur mit Helmen und Schilden, die die Spieler und Unparteiischen vom Feld geleiteten, obwohl nichts auf mögliche Krawalle hindeutete. Pablo von Nacionals vereinseigenem TV-Sender erklärte, dass schon seit Monaten Spannungen in der Luft lägen, daher wolle man kein Risiko eingehen.
Die Partie endete 4:0, und die kleine Kohorte der La Banda del Parque sang auch nach dem Schlusspfiff unentwegt weiter.
Wohlan, Trikolore,
Heute müssen wir gewinnen.
El Primer Hincha,
Er kam, um euch zu unterstützen.
Mir ist vollkommen gleich,
Wo ihr spielt,
Denn wo auch immer ihr seid,
Werde ich euch unterstützen.
Nacional, ich gehe überall mit euch hin.
Nacional, ich will euch als Champions sehen.
Im Estadio Gran Parque Central wurde nicht nur der Begriff des hincha geboren, der Ort war auch der Schauplatz einer Reihe bedeutender und gelegentlich makabrer Momente der uruguayischen Geschichte. Nacionals verantwortlicher Historiker Ignacio Pou erklärte mir auf dem Rasen des nunmehr leeren Parque Central: »Miguel Reyes’ Geist spukt hier noch herum. So wie viele andere Geister.« Das Stadion sei an eben der Stelle errichtet worden, an der 1811 der Revolutionsheld und Unabhängigkeitskämpfer José Gervasio Artigas, der sein Leben dem Kampf gegen das koloniale Streben Spaniens, Portugals und Großbritanniens gewidmet hatte, zum Führer der Uruguayer ausgerufen worden war. Nacional hatte bei der Gründung 1899 die von Artigas populär gemachten Farben Blau, Weiß und Rot übernommen und damit den Grundstein für die ewige Rivalität mit Peñarol gelegt.
In dem Buch Golazo erklärt der uruguayische Autor Andreas Campomar: »Mein Vater war Fan von Nacional, die in dem Blau, Rot, Weiß unseres nationalen Befreiungshelden José Artigas aufliefen. Dagegen schloss ich mich Peñarol an, einem Arbeiterverein, der im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts als Central Uruguay Railway Cricket Club gegründet wurde.« Laut Campomar hüllten sich die Nacional-Anhänger in ihr vermeintlich einzigartiges Uruguayertum und verhöhnten Peñarol als Klub der Ausgeschlossenen und Einwanderer. »So kam es zu Peñarols Spitznamen mangare merda (›Scheißefresser‹).« Peñarols Fans erledigten die Jobs, die sonst niemand machen wollte, und entschärften die gegen sie gerichteten dünkelhaften Spitzen, indem sie sich diese kurzerhand aneigneten.
Im April 1920 duellierten sich in dem Stadion der vormalige uruguayische Präsident José Batlle y Ordóñez und der Journalist und Politiker Washington Beltrán. Batlle hatte in seinen beiden Amtszeiten entscheidend an der Einführung eines Sozialstaats in Uruguay mitgewirkt und insbesondere Arbeiterrechte durchgesetzt. Doch in einem Schmähkommentar hatte Beltrán ihn als »Meister des Betrugs« bezeichnet. Batlle verlangte, die Geschichte mithilfe eines Duells im Parque Central zu klären, und Beltrán ließ sich darauf ein. Die New York Times berichtete: »Die Duellanten trafen sich in strömendem Regen auf einem Fußballfeld. Wegen des Regens behielten beide ihre Hüte auf, doch Beltrán tauschte seinen Strohhut gegen ein Modell aus Filz, damit die Voraussetzungen für beide gleich waren.« Der Hutwechsel sollte Beltrán nichts nützen. Beide verfehlten mit dem ersten Schuss den anderen, doch »bevor Beltrán ein zweites Mal feuern konnte, wurde er von einer Kugel aus Batlles Pistole getroffen und sank tödlich verwundet zu Boden«.21
Zwei Jahre zuvor hatte sich die wohl bemerkenswerteste Geschichte zugetragen. In ihrem Mittelpunkt stand einer von Nacionals größten Spielern. Abdón Porte war ein harter, doch zugleich kultivierter Mittelläufer und von 1911 bis 1918 sieben Saisons lang Nacionals Kapitän. Wegen seiner indigenen Herkunft erhielt er den Spitznamen El Indio, doch während im brasilianischen und argentinischen Fußball der Zeit noch komplizierte ethnische Hierarchien herrschten, stand Porte in Uruguay der Weg nach ganz oben offen. Er absolvierte mehr als 200 Partien und wurde viermal Meister. Doch 1918 erlitt er im clásico gegen Peñarol eine schwere Knieverletzung. Da Auswechslungen noch nicht erlaubt waren, wurde Porte einfach nach vorne beordert. Nacional siegte mit 4:2, allerdings erholte Porte sich nie mehr vollständig von der Verletzung und Nacional musste ihn ersetzen. Das letzte Mal lief er bei einem 3:1-Sieg gegen Charley auf. Trotz einer guten Leistung betrat Abdón Porte später am Abend ein allerletztes Mal den Rasen des inzwischen stillen und dunklen Parque Central, stapfte zum Mittelkreis und schoss sich mit einem Revolver ins Herz. Man fand ihn am folgenden Morgen, zwei Abschiedsbriefe in seinem Hut. Der eine lautete:
Nacional,
Obwohl zu Staub verwandelt,
Und im Staub auf ewig geliebt,
Werde ich nie auch nur einen Moment vergessen,
Wie sehr ich dich geliebt habe.
Leb wohl.22
Die uruguayischen Profis erschienen geschlossen bei Portes Beerdigung, und der Trauerzug soll eine Länge von 15 Kilometern gehabt haben. Mehr als 100 Jahre danach schmückte sein Gesicht ein Banner auf der nach ihm benannten Westtribüne des Parque Central, zusammen mit dem Schriftzug Por la Sangre de Abdón (»Für Abdóns Blut«). Porte ist zu einem Symbol für die bedingungslose Hingabe geworden, die von den Zuschauern erwartet wird.
Der Fußball trug entscheidend zur Entwicklung der uruguayischen Identität bei. So ließ das Land zum Beispiel laut Pou als erstes in Südamerika ausdrücklich »dunkelhäutige Spieler im Fußball« zu. Das kleine Land war durch Sklaverei und die Einwanderungswellen aus Europa ausgesprochen multikulturell, zugleich war es umgeben von weit mächtigeren Nachbarn mit kolonialen Ambitionen. Pou sagte: »Fußball war der Kitt, der die Nation vereinte. Als vergleichsweise junges Land waren wir zwischen Brasilien und Argentinien eingeklemmt. Doch Fußball? Durch ihn hatten wir das erste Mal das Gefühl, dass es etwas gibt, was unser ist. […] Er veränderte die uruguayische Gesellschaft.«
Die meisten Darstellungen des uruguayischen Fußballs konzentrieren sich durchaus zurecht auf seine außerordentlichen Erfolge und auf die Stars, die er hervorgebracht hat. Weit weniger Platz wird der Suche nach Erklärungen für das Phänomen des Publikums eingeräumt, der Frage also, wieso in Uruguay eine derart unzweifelhafte Leidenschaft für das Spiel herrscht. Als Pou und die übrigen Mitglieder von Nacionals historischer Kommission sich vor einigen Jahren auf die Suche nach vergessenen Geschichten der Vereinshistorie machten, entdeckten sie Zeitungsausschnitte, Fotografien und Notizen zu Miguel Reyes’ Auftritten am Spielfeldrand. Auf einer berühmten Fotografie der aus elf Nacional-Spielern bestehenden Nationalmannschaft von 1914 ist nur eine weitere Person zu sehen – Miguel Reyes, buchstäblich der zwölfte Mann. Sigmund Freud stellte in seiner Abhandlung Massenpsychologie und Ich-Analyse von 1921 dar, dass in der Masse die unbewussten Triebe von Gruppen von Individuen mit ähnlichen Interessen, die durch ein Liebesobjekt zusammengehalten werden, freigesetzt werden können. Häufig ersetze ein charismatischer Führer die Fähigkeit des Individuums, sein Es – den niederen, instinktiven Teil der Persönlichkeit – zu regulieren. Reyes war Nacionals kollektives Es. Sein Auftreten war ansteckend, wie Pou erkannte. »Was uns stolz macht, ist die Tatsache, dass er der erste Fußballfan war, der so etwas gespürt hat, der vor Begeisterung gebebt hat. Der das Spiel gelebt hat.« Pou ergänzte, es mache »einen Riesenunterschied, ob man einen Film schaut oder in ihm mitspielt«.
Eine halbstündige Autofahrt brachte mich vom Stadion zu Ernesto Reyes. Auf einem alten, mit grünem Filz bezogenen Spieltisch breitete er die Handvoll braunstichiger Fotos aus, die er von seinem Urgroßvater besaß. »Hier, das ist er mit meiner Urgroßmutter. Sie hatten fünf Kinder«, sagte er. Das Foto war beinahe vollständig verblichen. Er legte ein anderes daneben: Miguel Reyes und seine Frau an ihrem Hochzeitstag. »Miguel war verwitwet, darum trug meine Urgroßmutter Schwarz«, kommentierte er. In dem kleinen Spielzimmer befand sich alles, was von Prudencio Miguel Reyes noch vorhanden war und was man über ihn wusste. Auch das Foto, das ich bereits aus dem Museo del Fútbol kannte, hing dort. Es gab Rechnungen seines Ledergeschäfts. Ein paar Briefe. Abgerissene Eintrittskarten von Nacional-Spielen. Ein Büchlein, in dem er die Ergebnisse sämtlicher Begegnungen von Nacional und Peñarol aufgelistet hatte, beginnend mit einem 2:0-Sieg von Peñarol am 15. Juli 1900. Eine Mate-Kalebasse mit seinem Monogramm. Das war alles. Alles, was man über Prudencio Miguel Reyes’ Leben weiß, passte in einen Schuhkarton.
Ernesto nannte Miguel Reyes’ Geschichte eine verschwindende Legende. Reyes war verhältnismäßig jung gestorben und hatte seine Witwe mit den fünf Kindern zurückgelassen. Doch niemand wusste, wie oder wo er gestorben war. Ernesto fragte mich: »Wie viel wissen Sie über Ihren Urgroßvater? Wir kannten nur die Geschichte unserer Urgroßmutter und dass sie es als Witwe irgendwie schaffte, ihre fünf Kinder durchzubringen.« Auch Ernesto und seine beiden Brüder waren mit einem leidenschaftlichen Fan in der Familie aufgewachsen. Ihr verstorbener Vater war besessen von Nacional gewesen. »Er war superfanatisch«, sagte Ernesto. Irgendwann hatten seine Söhne ihn nicht mehr ins Stadion begleiten können, da er andauernd Streit mit anderen Fans angefangen hatte. Eine Farbaufnahme des Vaters hing neben einem Bild von Miguel Reyes. Der Vater stand lächelnd und mit ausgebreiteten Armen in Nacionals Trophäenraum. Ernesto schilderte mir, wie er einmal mit seinem Vater ein Nacional-Spiel besucht hatte und der Vater in eine erbitterte Auseinandersetzung mit anderen hinchas geraten war. Die Sache sei eskaliert, und sein Vater habe die Uhr abgenommen, ein unmissverständliches Zeichen, dass es ernst wurde. »Das war bei einem Freundschaftsspiel zwischen Nacional A und Nacional B!« Ernesto lachte. »Und es endete mit einer Schlägerei zwischen meinem Vater und anderen Nacional-Fans.«
In der Familie hieß es, dass, was auch immer Prudencio Miguel Reyes gepackt hatte, auch Ernestos Vater befallen habe. Dass man es »im Blut« habe. Ernesto erklärte: »Es überspringt immer eine Generation.« Sein Großvater, Miguel Reyes’ Sohn, war ein zurückhaltender Mann gewesen, hatte Klarinette gespielt und sich kaum für Fußball interessiert. Doch Ernestos Vater war mit Leib und Seele hincha gewesen. Ernesto mochte Fußball und sympathisierte mit Nacional, doch der Sport war ihm und auch seinen beiden Brüdern nicht übermäßig wichtig. Ihre Kinder dagegen waren glühende Nacional-Fans. Über seinen Sohn sagte Ernesto: »Er ist Mitglied der barra, steht bei der Fahne. Sogar zum Basketball geht er. Er ist echt verrückt.« Auch seine älteste Tochter hatte das Virus erwischt. »Sie hat das Gen, aber wir haben dem ein Ende gesetzt, weil sie eine Frau ist«, sagte er und fügte rasch hinzu, dass das nichts mit Diskriminierung zu tun habe. Sie wüssten einfach, wie gefährlich es in der barra sein könne. »Ich weiß, dass das diskriminierend ist, ja, aber damals war eine Frau in einer barra einfach nicht gern gesehen. Heute ist das anders.«
Die Reyes hatten sich schon immer gefragt, wieso ihre Familie in jeder zweiten Generation von dieser unbezähmbaren Nacional-Leidenschaft befallen wurde. Prudencio Miguel Reyes war die Antwort gewesen. Über sein Leben wussten sie nach wie vor so gut wie nichts. Er war zu einer Sagengestalt geworden, dem Helden einer nicht belegten Ursprungslegende. Beim Abschied sagte Ernesto: »Wenn wir das Wort hincha hören, ist das für uns jedes Mal etwas Besonderes.« Ihm war zu Ohren gekommen, dass sich in Argentinien sogar zwei Vereine darüber stritten, wer den Begriff hincha ursprünglich aus Uruguay importiert habe, Huracán oder Racing. »Das macht uns stolz.« Die Nachfahren von Prudencio Miguel Reyes hatten seinen Mythos zum Teil ihrer Familiengeschichte gemacht, so wie La Banda del Parque ihn zum Teil ihrer Geschichte gemacht hatte.
Am folgenden Tag sollten Mikael und ich endlich La Banda del Parque treffen. Mikael erhielt eine Nachricht, dass ein Santino uns abholen werde. Er sei von kräftiger Statur, mit kurzgeschorenen Haaren und würde laut und schnell sprechen. Bis dahin war La Banda del Parque für uns nur eine Schimäre gewesen. Die Verhaftung ihres Anführers hatte ihnen zugesetzt, doch Mikael hatte ein wenig herumtelefoniert. Am Abend würde Nacional spielen, allerdings nicht Fußball, sondern Basketball, gegen Aguada in der brandneuen Antel Arena. Wie bei den europäischen Ultras spielte es keine Rolle, ob der eigene Verein im Fußball, Basketball, Wasserpolo oder Frauenvolleyball antrat: Die Farben waren dieselben, und ein Spiel war ein Spiel. Es würde eine entrada geben, also den traditionellen Umzug der barra zur Halle, auf dem sie zumeist unter Einsatz von Feuerwerkskörpern, Bengalos, Rauchbomben und Trommeln ihre Banner präsentierten. Am frühen Abend holte Santino uns mit dem Auto ab. Er trug einen blauen Nacional-Hoodie. Mit donnernder Stimme sagte er, dass er Anwalt sei. Er redete in einem Höllentempo und nahm die Kurven ein bisschen zu rasant. Die Reifen quietschten. Er war schon seit Langem bei La Banda del Parque aktiv, doch was genau er da machte, wurde nicht klar. »Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon«, sagte er. Er durfte sich auf dem Vereinsgelände und im Stadion frei bewegen, momentan konnte er allerdings bei Spielen seines Vereins nicht dabei sein, und zwar unabhängig von der Sportart. Durch seinen Beruf hatte er mehr als einmal den Kopf aus der Schlinge ziehen können, doch als bei einer Leibesvisitation eine Pistole bei ihm gefunden und er verhaftet worden war, hatte auch er nichts machen können. Er brachte uns zu einem über und über mit Nacional-Graffiti bemalten Skatepark in der Nähe des Parque Central. Rund 50 Mitglieder der barra bereiteten sich auf die entrada vor. Fast ausschließlich junge Männer. All die Gesichter und Namen verwirrten mich. Irgendjemand drückte mir Haschischkugeln in die Hand, offenbar das einzige, was es umsonst und im Übermaß gab. Marihuana war 2013 in Uruguay legalisiert worden, außerdem war ein Höchstpreis festgelegt worden, wodurch quasi über Nacht der illegale Markt trockengelegt worden war.
»Dies ist die barra, und etwas anderes gibt es nicht«, sagte Mateo, ein kräftig gebauter Mann mit einer Basecap mit der Aufschrift »Winner«. Er sei ein bekanntes Mitglied der Banda del Parque, erklärte er mir, und gerade aus dem Gefängnis entlassen worden.
»Wieso warst du im Gefängnis?«, wollte ich wissen.
»Ich habe auf zwei Peñarol-Fans geschossen«, erwiderte er und formte beide Hände zu Pistolen. Er holte sein Handy hervor und zeigte mir Fotos von sich in der Zelle. Auf den meisten hatte er die Finger lächelnd zum Victory-Zeichen gespreizt. Sein Freund Martin war ebenfalls gerade erst aus dem Gefängnis entlassen worden, nachdem er neun Jahre wegen bewaffneten Raubes gesessen hatte. Er hatte ein steifes Bein. Alle waren auf Crack oder Kokain. Einer aus der barra





























