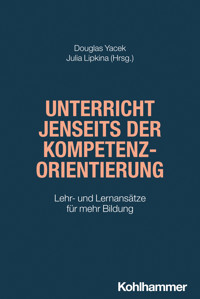
Unterricht jenseits der Kompetenzorientierung E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Wie der Unterricht heutzutage auszusehen hat, wird von einem neuen Paradigma bestimmt. Gemäß den Ansprüchen der Kompetenzorientierung werden LehrerInnen damit beauftragt, ihren Fokus auf die Förderung von fach- und lebensrelevanten Kompetenzen zu lenken. Trotz des unleugbaren Erfolgs dieses Paradigmas zieht es eine beunruhigende Folge nach sich: Jene Lehr- und Lernansätze, welche die Möglichkeiten des Unterrichts umfangreicher auffassen als die Vermittlung nützlicher Skills und Problemlösungsstrategien, werden aus der Schule konsequent verdrängt. Dieser Band erkundet Bildungsansätze jenseits der Kompetenzorientierung, um eine umfassende Vision des Bildungspotenzials der Schule darzustellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
1 Kompetenzorientierung und die Eklipse des schulischen Bildungspotenzials. Eine Einleitung
Teil I: Das umfassende Bildungspotenzial der Schule
2 Erziehender Unterricht mit Bildungsanspruch
3 Unterrichten mit Deeper Learning
4 Von der Entdeckung der Resonanzpädagogik
5 Schule als paradoxer Inklusionsraum. Umrisse einer konstellativen Bildungspraxis
Teil II: Lehr- und Lernansätze jenseits der Kompetenzorientierung
6 Demokratiebildung jenseits der Kompetenzorientierung?
7 Kontroverse Themen unterrichten – Über die Bildung von Welt- und Menschenbildern
8 Müll – Welterfahrung und Verhaltensänderungen durch Umweltbildung. Potentiale einer Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Lernorten
9 Kontrafaktizität und Kontingenz. Zum Konstitutionsproblem der Unterrichtsforschung
10 Transformationen im Unterricht? Bildende Erfahrungen im Unterricht empirisch erforschen
Verzeichnisse
Die Autorinnen und Autoren
Die Herausgebenden
Dr. Douglas Yacek ist Dozent für Ethik und Interkulturelle Kompetenz an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW sowie wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dortmund.
Dr. Julia Lipkina ist Erziehungswissenschaftlerin, Pädagogin und Coach und arbeitet derzeit als pädagogische Mitarbeiterin beim Bildungswerk in Bad Homburg.
Douglas Yacek, Julia Lipkina (Hrsg.)
Unterricht jenseits der Kompetenzorientierung
Lehr- und Lernansätze für mehr Bildung
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-043645-9
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-043646-6epub: ISBN 978-3-17-043647-3
1 Kompetenzorientierung und die Eklipse des schulischen Bildungspotenzials. Eine Einleitung
Douglas Yacek & Julia Lipkina
Wie der Unterricht heutzutage auszusehen hat, wird maßgeblich von einem neuen Paradigma pädagogischen Denkens bestimmt (vgl. Klieme, 2003; Weinert, 2001). Gemäß den Anforderungen und Ansprüchen des kompetenzorientierten Unterrichts werden Lehrer*innen damit beauftragt, fach- und lebensrelevante Fähigkeiten und Kenntnisse im Klassenzimmer zu fördern, die den Lernenden zur Bewältigung komplexer Problemstellungen im Leben und Beruf verhelfen sollen. Solche Kompetenzen umfassen komplexe Dispositionen zum Denken und Handeln, die über einen engen Zusammenhang mit der Handlungsfähigkeit und dem strategischen Entscheidungsvermögen des Individuums verfügen sollen. Kompetenzen begleiten und, im besten Fall, bereichern das (spätere) Handeln der Lernenden, sodass ihre gemeinsamen ebenso wie individuellen Vorhaben in wirksame Problemlösestrategien und Kooperationsformen gelenkt werden können (vgl. Klieme, 2003, S. 72). Zu entwickeln sind deshalb nicht nur Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen, sondern auch überfachliche Kompetenzen, welche die sozialen, emotionalen, politischen und kommunikativen Handlungsdomänen des Einzelnen betreffen (vgl. Rohlfs, Harring & Palentien, 2014).
Die Überzeugungskraft und Attraktivität dieser pädagogischen Zielorientierung ist kaum zu leugnen. Eine allzu inhaltsorientierte Ausrichtung des Lehrens und Lernens sorgt – wie zurecht argumentiert wurde – häufig für lebensferne Unterrichtsgestaltung auf der pädagogischen Ebene und Fetischisierungen kultureller Bildungsgüter auf der curricularen Ebene (vgl. Fuhrmann, 2000; Wirsing, 2012). So kann man sehr gut die indessen weit verbreitete Haltung nachvollziehen, dass pädagogische und curriculare Entscheidungen insbesondere anhand derjenigen Begründungsverfahren getroffen werden sollen, welche die lebenspraktische Nützlichkeit des fachlichen Lernens sowie dessen Lebensweltbezug fokussieren. Diese Haltung unterstützt nicht nur eine enge Verknüpfung der Schul- und Alltagserfahrung. Die Vorstellung von vielseitig fähigen und tüchtigen Bürger*innen, die durch eine kompetenzorientierte Bildung auf die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen vorbereitet sind, scheint nicht nur zeitgemäß, sondern auch dringend nötig.
Zugleich kann man in Frage stellen, ob diese gravierende Umorientierung des pädagogischen Denkens und Handelns nicht doch auch Engführungen und Beschränkungen des pädagogischen Blicks mit sich trägt (vgl. Zierer, 2012; Gruschka, 2016, 2012). Der Kompetenzbegriff selbst vermittelt einen unleugbar technokratischen Tenor, der insbesondere im Bildungsbereich mit Argwohn zu betrachten ist. Der Wille zur Kompetenz ist mit dem allgegenwärtigen Streben nach Effizienz und Produktivität eng verwoben, das ein charakteristisches Leitmotiv der rationalisierten Spätmoderne darstellt. Die Gefahr einer Zusammenführung von Bildung und Technokratie besteht in einer zu eng gestrickten Auffassung des kompetent Handelnden bzw. des Lernenden selbst, der zum gelungenen Umgang mit Anderen über ein breites Spektrum an affektiven, kognitiven und ethischen Dispositionen verfügen muss, nicht nur über zweckrational begründete Handlungsstrategien.
Die Rhetorik der Kompetenzorientierung hängt außerdem oft – trotz ihrer behaupteten Distanzierung von der Normativität des klassischen Bildungsdenkens – mit einer stark wertenden Ideologie der Bildung zusammen, die ebenso einer Hinterfragung würdig ist. Exemplarisch zeigt sich dies an den Ausführungen der Kultusministerkonferenz im strategischen Weißbuch zur Bildung in der digitalen Welt (KMK, 2016). Die Einleitung dieses Strategiepapiers fing mit einer Argumentation an, welche auf ganz typische Weise eine kompetenzlogische Darstellung des schulischen Bildungsauftrags aufweist. Dabei kann eine merkliche Eingrenzung desselben beobachtet werden:
»Die fortschreitende Digitalisierung ist zum festen Bestandteil unserer Lebens-, Berufs- und Arbeitswelt geworden. Digitale Medien wie Tablets, Smartphones und Whiteboards halten seit längerem Einzug in unsere Schulen und Hochschulen; sie gehören zum Alltag der Auszubildenden in Verwaltungen und Unternehmen. Digitale Medien halten ein großes Potential zur Gestaltung neuer Lehr- und Lernprozesse bereit, wenn wir allein an die Möglichkeiten zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern denken. Über welche Kompetenzen müssen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene verfügen, um künftigen Anforderungen der digitalen Welt zu genügen? Und welche Konsequenzen hat das für Lehrpläne, Lernumgebungen, Lernprozesse oder die Lehrerbildung? Die Gestaltungsmöglichkeiten in der digitalen Welt von morgen sind eng damit verknüpft, wie wir heute junge Menschen in Schulen, in der Berufsausbildung und in den Hochschulen darauf vorbereiten. Dazu bedarf es klar formulierter Ziele und einer gemeinsamen inhaltlichen Ausrichtung« (ebd., S. 3).
Diese Stellungnahme der KMK ist so verständlich wie – zumindest prima vista – überzeugend. Niemand will bestreiten, dass junge Menschen auf diejenigen Aufgabenstellungen und Probleme einer digital vernetzten Welt vorbereitet sein sollten, die sie nach der Schulzeit erwarten. Diese Problemstellungen sind komplex und sie betreffen in manchen Fällen sogar die Zukunftsfähigkeit der westlichen, demokratischen Lebensform (Stichwort: Klimawandel und Globalisierung). Problematisch ist nicht die Zielsetzung selbst, sondern eher das Bildungsverständnis, das schulische Bildung auf diese alleinige Zielsetzung reduziert. Diesem Bildungsverständnis zufolge verwandelt sich schulische Bildung in ein dezidiertes Projekt der Ausstattung. Denn der Auftrag der kompetenzorientierten Bildung ist es, Schülerinnen und Schüler mit angemessenen Formen des Wissens und Könnens zu versehen, die sie auf Erfolge im Rahmen persönlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen vorbereiten sollen. Bildung wird somit als eine Ausrüstung gegenüber diesen (drohenden) Herausforderungen aufgefasst, mit denen junge Menschen konfrontiert werden. Zugespitzt kann man sagen, Bildung wird in diesem Sinne krisendiagnostisch begründet und dient in erster Linie dem Zweck der Krisenbewältigung (vgl. auch Hamborg, 2020). Im klassischen Sinne stellt Bildung jedoch einen Eigenwert dar und muss jenseits materieller Nützlichkeit gedacht werden – ebenso beinhaltet sie die Fähigkeit der Distanz und Kritik zu gesellschaftlichen Erwartungen.
Es sollte aus dieser Sicht nicht überraschen, dass die »Herausforderungen des 21. Jahrhunderts«, die »Anforderungen einer interkulturellen Gesellschaft« oder die »Verantwortlichkeiten einer sich rasch verändernden digitalen Welt« so oft als Schlüsselphrasen in den Argumentationen der Kompetenz-Befürworter auftauchen, wie oben bereits zu sehen ist. Obwohl diese Schwerpunktverlagerung in der Begründung und Auffassung pädagogischer Arbeit bereits einen erheblichen Einfluss auf vielerlei Facetten des schulischen Alltags ausübt, kann ihr Wirkungshorizont exemplarisch an der Verwandlung des Begriffs und Handlungsfeldes des Fachs deutlich nachgezeichnet werden. Denn die Fächer, mit denen sich Schülerinnen und Schüler in der Schule tagtäglich beschäftigen, werden durch die Brille der Kompetenzorientierung zu einer Art Technologie, einem Instrumentum, um ein Etwas außerhalb von ihnen zu erzielen – ein Problem zu lösen, eine Herausforderung zu überwinden, eine Komplexität zu verstehen. Die Fächer machen kompetente Menschen, so lautet die These: darin liegt ihre Begründung und zunehmend auch ihre inhaltliche Ausrichtung. Sie stellen in erster Linie Ressourcen bereit, um eine erfolgreiche Bildungs- oder Berufslaufbahn zu gestalten, sich an politischen Prozessen kompetent zu beteiligen, oder mit den Erneuerungen und Aufgaben der neuen digitalen Kultur Schritt zu halten.
Auch hier soll nicht bestritten werden, dass die verschiedenen Unterrichtsfächer Möglichkeiten bieten, um Kompetenzen zu vermitteln. Das Problem ist vielmehr die Reduktion fachlicher Bildung auf die Ausstattung junger Menschen mit funktional-instrumentellen Kompetenzen bzw. die Reduktion des Fachs selbst auf ein Instrumentum zur Bewältigung realer Problemstellungen und Herausforderungen. Denn Unterrichtsfächer umfassen jenseits dieses Vermögens reichhaltige, geschichtsträchtige und komplexe Formen gemeinsamen Lebens und Strebens, deren Sinn und Wert in erster Linie darin besteht, den Erfahrungshorizont der Lernenden in mannigfaltiger Weise zu bereichern. Sie verfügen über fesselnde disziplinäre Geschichten und spannende Persönlichkeiten, einzigartige Formen der Verständigung und der zwischenmenschlichen Beziehung, gemeinsame Werte, Tugenden und Ideale sowie neue Möglichkeiten der ästhetischen Wertschätzung und Würdigung, die bisher übersehenen oder missverstandenen Domänen der Erfahrung Farbe und Leben verleihen können. Es sind ebendiese lebensweltlichen, zwischenmenschlichen, ethischen und ästhetischen Aspekte der Unterrichtsfächer, welche die Sinnhaftigkeit der fachlichen Wissensaneignung überhaupt erst rechtfertigen. Der Schulalltag ist letztlich mit dem Lernen in Fächern statt mit dem Auswendiglernen von Werbespots oder dem Lesen von Nachrichten ausgefüllt, weil die Fächer einen besonderen Wert für die Erweiterung, Bereicherung und Transformation der Erfahrung in sich bergen (vgl. dazu auch: Giesinger 2010; Stojanov 2014).
Die Kompetenzorientierung mündet, sofern sie diese Dimensionen der fachlichen Bildung ausklammert, in einer radikalen Engführung des Bildungspotenzials fachlichen Lernens. Wenn Lernende beispielsweise in einem Mathematikkurs bloß mathematische Operationen durchzuführen, diese bei entsprechenden Problemstellungen anzuwenden und dadurch analytische Kenntnisse für ihre künftigen Deliberationen und Berufswege zu entwickeln lernen, kommt ihnen die Möglichkeit abhanden, solche Operationen auch als faszinierend, lebensbereichernd, sogar inspirierend wahrzunehmen (vgl. Yacek 2023). Jenseits des kompetenzorientierten Lehrens und Lernens können sie Gleichungen, Integrale, griechische Buchstaben und eine klug gelöste Problemstellung ebenso sehr wegen ihrer Eleganz zu schätzen lernen wie als Beitrag zur Verbesserung ihrer Rechenkompetenzen. Sie mögen beginnen, sich für Menschen in der Geschichte der Mathematik zu interessieren, von denen sie noch nie zuvor gehört haben, oder sich für abstruse mathematische Formen und Strukturen zu begeistern, die sie nun in der Natur entdecken können. Anhand einer solchen Beziehung zum Fach Mathematik können sich die Schülerinnen und Schüler einer zunehmend erweiterten Sichtweise auf die Welt annähern, die sowohl aus den besonderen Formen mathematischer Erkenntnisse als auch aus dem neu gewonnenen Zugang zur Erfahrungswelt der Mathematik hervorgeht.
Sofern heutige Schulen sich ausschließlich auf funktional-instrumentelle Dimensionen von Wissen und Lernen konzentrieren, verkennen sie darüber hinaus ihren Status als demokratische Institutionen. Denn es ist ein Grundgedanke demokratischer Gesellschaften, dass jedem Menschen, unabhängig von seinem sozio-ökonomischen, ethnischen, religiösen oder persönlichen Hintergrund, die Chance zuteilwerden soll, sein Potenzial als Individuum so weit wie möglich zu verwirklichen. »Das individuelle Potenzial zu verwirklichen« impliziert nicht nur die Mäßigung oder Beseitigung von sozialen Ungleichheiten, die der Formulierung und Realisierung des je eigenen Selbstkonzepts im Wege stehen (vgl. Nussbaum, 2011). Positiv betrachtet, deutet diese Formel auch auf Formen pädagogischen Handelns hin, die idealerweise auf eine Bereicherung und Intensivierung der individuellen Erfahrung abzielen, so die klassische These John Deweys (2011/1916), welche jüngst von Hartmut Rosa (2016) und Rahel Jaeggi (2016) wieder aufgegriffen wurde. Eine solche Erhöhung der Erfahrungsqualität lässt sich als ein entscheidendes Kriterium für als »demokratisch« geltende Bildung verstehen, da sie sowohl an und für sich wertvoll ist als auch einen sinngebenden Endzweck für soziale und politische Bestrebungen abbildet. Man setze sich etwa für die Gleichbehandlung von Minderheiten, für den Aufbau von lebenswerten und ökologischen Städten oder für humanere Arbeitsbedingungen ein, da das Gelingen dieser Projekte das gemeinsame soziale Leben bereichern würde – es führe zu einem vertieften Gefühl von Gemeinschaftlichkeit, Naturverbundenheit und persönlichem Wohlergehen. Die Unterrichtsfächer sind Bereiche des Denkens und Handelns, die sich – in einigen Fällen seit Jahrtausenden – als einige der wirksamsten Praktiken zur Vertiefung und Bereicherung der Erfahrung erwiesen haben. Auch aus diesem Grund sollten Unterrichtsansätze priorisiert werden, die in einem umfassenden Sinne zur Erhöhung der Erfahrungsqualität beitragen.
Dieser Band soll eine umfassende Vision des Bildungspotenzials der Schule darstellen, welche auf eine solche Erfahungsbildung und -bereicherung im weitesten Sinnen ausgerichtet ist. Der Band fängt beispielsweise mit einem Beitrag von Thomas Rucker an, der für einen erziehenden Unterricht mit genuinem Bildungsanspruch plädiert, der stets einen Bogen zur je eigenen Aufgabe spannt, ein gelingendes menschliches (Zusammen-)Leben zu führen. Michael Veeh zeigt in seinem Beitrag auf, dass der Ansatz des »deeper learning« zu einem vielversprechenden Umdenken in der Unterrichtsgestaltung führt, was durch dessen vielschichtige Aktivierung der Lernenden ein ebenso ganzheitliches Bildungsverständnis nahelegt. Ferner wird im nächsten Beitrag von Pierre-Carl Link für eine »konstellative« Bildungspraxis argumentiert, welche die Öffnung des Unterrichtsgeschehens für andere Lebens- und Seinsweisen in den Blick nimmt und dadurch die Gelingensbedingungen inklusiver Schul- und Unterrichtsgestaltung fördern soll. Wolfgang Endres spricht sich in seinem Beitrag auch für eine Öffnung des Unterrichtsgeschehens und -erlebens aus, und zwar für eines, das nicht nur auf gewünschte Lernergebnisse, sondern auf Resonanzerlebnisse seitens der Lernenden und Lehrenden abzielt.
Über diese Lehr- und Lernansätze hinaus werden in den Folgekapiteln Bildungsdimensionen hervorgehoben, die in der aktuellen kompetenzorientierten Schulpädagogik kaum zu finden sind. Michael May beschäftigt sich zum Beispiel in seinem Beitrag mit Demokratielernen und dessen schulische Gestaltung im Lichte des Spannungsverhältnisses zwischen einem kompetenzorientierten und einem bildungstheoretisch geleiteten Ansatz. Auch Marieke Schaper geht auf die Debatte über probate Ansätze der Demokratiebildung ein, um einen neuen Ansatz zum Umgang mit kontroversen Themen in verschiedenen fachlichen Kontexten auszuarbeiten – und zwar einen, der die Bewusstmachung und Weiterbildung bereits vorhandener Welt- und Menschenbilder zum Ziel hat. Sarah Prinz und Henning Schluss plädieren in ihrem Beitrag für eine weitere schulische Schwerpunkterweiterung, nämlich die Kooperation von binnen- und außerschulischen Lernorten zur Bereicherung und Intensivierung der umweltbildenden Aufgaben der Schule.
In den letzten beiden Beiträgen des Bandes werden empirische Perspektiven und Befunde sowie Möglichkeiten der Übertragung von bildungstheoretisch interessierten und anschlussfähigen Schul- und Unterrichtskonzepten auf die Unterrichtsforschung beleuchtet. Dazu werden einige Ansätze der Unterrichtsforschung ergänzt, die sich als besonders vielversprechend für die Rekonstruktion der weiteren Bildungsdimensionen des Unterrichts erwiesen haben. Frank Beier erörtert die Grenzen einer kompetenzorientierten Unterrichtsforschung am Beispiel Kontingenz und Kontrafaktizität und plädiert für die Vorteile eines interpretativen Forschungsansatzes. Im letzten Beitrag stellen wir eine eigene Schematisierung der transformativen Dimensionen des Unterrichts dar, um zur Erweiterung des Forschungsvokabulars beizutragen, das die bildenden Dimensionen des Unterrichts begreifen soll.
Mit dieser thematischen Ausrichtung trägt dieser Band nicht nur dazu bei, den einflussreichen Diskurs um Schulgestaltung und -bildung in der Erziehungswissenschaft zu öffnen. Er soll außerdem konkrete Ansätze und Orientierungspunkte für Lehrkräfte und Unterrichtsforscher*innen darlegen, wie bildungstheoretisch-inspirierte Schulpraxis aussehen kann. So soll er dazu dienen, die unterstellten Vorteile der Kompetenzorientierung für die Gestaltung von Schule und Unterricht auf den Prüfstand zu stellen, insbesondere aus der Sicht von alternativen Orientierungsrahmen, welche zumindest teilweise mit dem Kompetenzdenken konfligieren.
Literatur
Dewey, J. (2011): Demokratie und Erziehung: Eine Einleitung in die philosophische Pädagogik. Weinheim: Beltz.
Fuhrmann, M. (2000): Der europäische Bildungskanon des bürgerlichen Zeitalters. Frankfurt: Insel Verlag.
Giesinger, J. (2010): Bildung als Selbstverständigung. Vierteljahreschrift für wissenschaftliche Pädagogik 86(3), S. 363 – 375.
Gruschka, A. (2012): Missratener Fortschritt – Glänzende Geschäfte. Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik. 88(1), S. 96 – 109.
Gruschka, A. (2016): Was heißt »bildender Unterricht«? ZISU 1/2016, S. 77 – 92.
Hamborg, S. (2020): Bildung in der Krise. Eine Kritik krisendiagnostischer Bildungsentwürfe am Beispiel der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Kontroverse Miteinander. Interdisziplinäre und kontroverse Positionen zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Frankfurter Beiträge für Erziehungswissenschaft. Goethe-Universität Frankfurt am Main, S. 169 – 184.
Jaeggi, R. (2016): Entfremdung. Zur Aktualität eines sozialphilosophischen Problems. Frankfurt: Suhrkamp.
Klieme, E., Hermann, A. & Werner, B. et al. (2003): Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise. Bonn: Bundesministerium für Bildung und Forschung.
KMK (2016): Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz. URL: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2016/2016_12_08-Bildung-in-der-digitalen-Welt.pdf (Zugriff: 14. 11. 2023).
Nussbaum, M. (2011): Creating Capabilities. Cambridge: Harvard University Press.
Stojanov, V. (2014): Schule als Ort der Selbst-Bildung. In: J. Hagedorn (Hrsg.), Jugend, Schule und Identität. Wiesbaden: VS, S. 153 – 164.
Weinert, F. E. (2001): Leistungsmessungen in Schulen. Weinheim: Beltz.
Rohlfs, C., Harring, M. & Palentien, C. (2008): Kompetenz-Bildung. Soziale, emotionale und kommunikative Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen. Wiesbaden: VS.
Rosa, H. (2016): Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung. Frankfurt: Suhrkamp.
Wirsing, C. (2012): »Wir sind ohne Bildung‟. Eine Kritik der Bildungskritik. In: M. Winkler & K. Vieweg (Hrsg.), Bildung und Freiheit. Ein vergessener Zusammenhang. Paderborn: Brill Schöningh, S. 43 – 53.
Yacek, D. (2023): Begeisterung wecken. Anleitung zum transformativen Lehren und Lernen. Ditzingen: Reclam.
Zierer, K. (2012): Bildung und Kompetenz. Eine kritisch-konstruktive Analyse auf der Grundlage einer eklektischen Didaktik. Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik 88(1), S. 30 – 53.
Teil I: Das umfassende Bildungspotenzial der Schule
2 Erziehender Unterricht mit Bildungsanspruch
Thomas Rucker
2.1 Schule pädagogisch denken
Die Rede von Schule kann in einem spezifischen Sinne als komplex bezeichnet werden. Schule wird aus unterschiedlichen Perspektiven beschrieben, ohne dass die Möglichkeit besteht, die Vielheit der Beschreibungen aufzulösen und Schule auf die allein ›richtige‹ Art und Weise in den Blick zu nehmen. Vielmehr kann festgehalten werden, dass die öffentliche Debatte über Schule selbst zu diesem Sachverhalt gehört: Schule ist in modernen Gesellschaften Thema einer öffentlichen Auseinandersetzung, die nicht stillgelegt werden kann (zum Begriff der Komplexität vgl. Rucker & Anhalt, 2017, S. 23 ff.). Dabei sind immer wieder auch Versuche zu verzeichnen, Schule pädagogisch in den Blick zu nehmen. Doch sollte dieser Umstand nicht zu der Annahme verleiten, dass in der Erziehungswissenschaft ein Konsens darüber ausgemacht werden könnte, wie Schule pädagogisch zu thematisieren bzw. woran überhaupt eine pädagogische Perspektive auf Schule erkennbar ist. In diesem Zusammenhang hat Ewald Terhart vorgeschlagen, dass eine pädagogische Perspektive auf Schule an der »Prämisse des zu achtenden und zu befördernden Eigenrechts« von Schüler*innen auf eine »eigenständige Durchdringung und Weiterführung von Lerngegenständen und Kultursachverhalten« ausgerichtet sei. Der »Erfolg von Schule« wäre entsprechend daran festzumachen, dass Schüler*innen sich »im Durchlauf durch die Schule von der Schule frei machen«, d. h. sich von pädagogischer Sorge emanzipieren können (Terhart, 2017, S. 49; Hv. i. O.). Schule in diesem Sinne pädagogisch zu bestimmen, verlangt u. a. nach einer Allgemeinen Didaktik, in der eine Antwort auf die Frage offeriert wird, wie ein Unterricht bestimmt werden kann, der unter dem Anspruch steht, dass sich Schüler*innen ›im Durchlauf durch die Schule von der Schule frei machen‹ können. Die These, für die ich im Folgenden argumentieren werde, lautet, dass ein schulischer Unterricht, der dem besagten Anspruch Rechnung trägt, als erziehender Unterricht, genauer: als ein erziehender Unterricht mit Bildungsanspruch konzipiert werden sollte. Um diese These zu begründen, werde ich erziehenden Unterricht als einen die schulischen Fächer in spezifischer Hinsicht ›transzendierenden‹ Unterricht beschreiben. Ein solcher Unterricht verknüpft die Thematisierung fachlichen Wissens mit Fragen eines gelingenden Lebens und Zusammenlebens und zieht Heranwachsende darüber hinaus in eine Reflexion auf die Voraussetzungen hinein, auf denen ein spezifisches Wissen und spezifische Werturteile beruhen.
2.2. Der Anspruch der Bildung
Bildung – so die Ausgangsprämisse der folgenden Überlegungen – setzt damit an, dass Menschen an einer widerständigen Welt tätig sind und in diesem Zusammenhang Differenzerfahrungen erleiden. Bildung bedeutet nicht, entsprechende Differenzerfahrungen zu ignorieren. Vielmehr ist gemeint, dass Menschen die Widerständigkeit ›durcharbeiten‹, mit der sie sich konfrontiert sehen, und in diesem Durcharbeiten die eigene Position im Verhältnis zu sich selbst und zur Welt bestimmen. Der Entwurf eigener Positionen setzt Spielräume voraus, in denen sich Menschen zu sich selbst und zur Welt in ein Verhältnis setzen können. Diese Freiräume der eigenen Positionsbestimmung entstehen dadurch, dass Differenzerfahrungen Menschen gleichsam auf die eigenen Orientierungsmuster (Wissen, Können, Haltungen) zurückwerfen. So wenig von Bildung gesprochen werden kann, wenn Differenzerfahrungen ignoriert werden, so wenig wäre auch dann von Bildung zu sprechen, wenn Menschen vorgegebene Orientierungsmuster unbefragt übernehmen, um erlittene Irritationen zu beseitigen. Bildung bedeutet vielmehr, dass Menschen sich zu internen und externen Abhängigkeiten in ein Verhältnis setzen, eigene Urteile entwerfen und diesen im Handeln zu entsprechen suchen (vgl. Rucker, 2014, S. 61 ff., 149 ff.). Fasst man Bildung in diesem Sinne als einen Prozess der selbsttätigen Auseinandersetzung von Menschen mit einer widerständigen Welt, so ist Bildung weder als Anpassung an eine vorgegebene Ordnung noch als Widerstand gegenüber einer entsprechenden Ordnung sinnvoll beschreibbar.
Unterricht als Ermöglichung von Bildung zu bestimmen bedeutet, Unterricht einem Anspruch zu unterstellen, dem diese Form des Miteinanderumgehens nicht notwendigerweise genügt (vgl. Rucker, 2020a, S. 54 ff.). Im Unterricht werden Schüler*innen grundsätzlich mit einem Wissen konfrontiert, das in einer Kultur als tradierungswürdig eingestuft wird, jedoch im alltäglichen Miteinanderumgehen von Menschen nicht vermittelt und angeeignet werden kann. Ein Unterricht, der Bildung zu initiieren und unterstützen sucht, kann nicht sinnvoll als Unterweisung bestimmt werden, d. h. als eine Form des Miteinanderumgehens, in der die Geltungsansprüche, die mit einem bestimmten Wissen verknüpft sind, außer Frage stehen. Die Unterweisung ist darauf gerichtet, dass Schüler*innen sich ein (vermeintlich) zweifelsfrei feststehendes Wissen zu eigen machen, ohne sich zu diesem Wissen in ein Verhältnis zu setzen. Ein Unterricht unter Bildungsanspruch ist demgegenüber auf die Ermöglichung von sachlicher Einsicht gerichtet. Diese Ermöglichung schließt notwendigerweise mit ein, Schüler*innen in eine Prüfung von Geltungsansprüchen hineinzuziehen. Es geht in diesem Fall gerade nicht darum, dass Schüler*innen ein tradiertes Wissen in seinem Geltungsanspruch fraglos akzeptieren. Der Anspruch lautet vielmehr, dass Schüler*innen die Beschreibung eines Sachverhalts als gültig einsehen.
Im Unterricht werden die Schüler*innen zur Vertiefung in und zur Besinnung auf bestimmte Inhalte veranlasst, um ihnen Einsicht in eine Sache zu ermöglichen, die in der Erwachsenengeneration als bedeutsam eingeschätzt wird. In der Auseinandersetzung mit einer Sache können Schüler*innen Erfahrungen des eigenen Nicht-Wissens machen. Das Durcharbeiten solcher Differenzerfahrungen ist nur vermittelt über ein Selber-Denken möglich – und erst wenn Schüler*innen sich der Aufgabe stellen, Differenzerfahrungen in diesem Sinne zu bearbeiten, besteht für sie auch die Möglichkeit, sachliche Einsicht zu gewinnen. Unterricht in diesem Sinne setzt damit an, dass Lehrer*innen eine Sache erst einmal fragwürdig machen, so dass Schüler*innen sich dazu angehalten sehen, sich mit einem Sachverhalt auseinanderzusetzen (1). Darüber hinaus regulieren Lehrer*innen die Vertiefung in und die Besinnung auf eine Sache – nicht, indem sie den Schüler*innen die richtigen Antworten vorgeben, sondern indem sie ihnen durch Frage- und Zeigeaktivitäten dabei helfen, die richtigen Antworten selbst zu entdecken, d. h. Wissen in einem spezifischen Sinne selber denkend und urteilend ›hervorzubringen‹ (2). Schließlich kommt es aber auch darauf an, dass die Lehrer*innen nicht nur fragen und zeigen, sondern die Schüler*innen auch zu Antworten veranlassen, die daraufhin als der Ausgangspunkt für das weitere Miteinanderumgehen von Lehrer*innen und Schüler*innen fungieren, und die selbst wiederum Anlass für Differenzerfahrungen sein können (3). Entscheidend ist: Heranwachsende werden nicht in tradiertem Wissen unterwiesen, sondern in eine sachliche Auseinandersetzung verstrickt. Damit ist eine Durchsetzung von Geltungsansprüchen gleichsam ausgeschlossen, muss sich ein bestimmtes Wissen, das vermittelt und angeeignet werden soll, in der sachlichen Auseinandersetzung doch allererst darin bewähren, die Not des eigenen Nicht-Wissens zu wenden. Man könnte an dieser Stelle auch von einer Einladung an die Schüler*innen sprechen, tradiertes Wissen nicht unbefragt übernehmen zu müssen, sondern sich dieses so anzueignen, dass es als eine nicht sinnvoll bestreitbare Antwort auf eine Frage erkannt wird.
2.3 Erziehender Unterricht
Unterricht, der als Ermöglichung von Bildung begriffen wird, muss konsequenterweise als ein erziehender Unterricht konzipiert werden, in dem Schüler*innen sich nicht nur sachliche Einsichten aneignen, sondern auch die Möglichkeit erhalten, die Bedeutung des Gelernten für das eigene Leben im Umgang mit anderen zu erwägen (für die folgende Bestimmung des Grundgedankens eines erziehenden Unterrichts vgl. Rucker, 2021a, S. 34 ff.). Dies ist deshalb angezeigt, weil ein Unterricht mit Bildungsanspruch auf eine Freisetzung der Heranwachsenden für ein Handeln nach eigenem Urteil gerichtet ist, das Wissen, das im Unterricht vermittelt und angeeignet werden soll, als solches in seiner Bedeutung für die Lebensführung von Heranwachsenden jedoch indifferent ist. Soll es nicht dem Zufall überlassen bleiben, ob Schüler*innen angeeignetes Wissen auf die eigene Lebensführung beziehen, so folgt hieraus, dass die Frage nach der Bedeutung unterrichtlich vermittelten und angeeigneten Wissens selbst zum Thema des Unterrichts avancieren muss. Ein Unterricht mit Bildungsanspruch geht demzufolge nicht in einer Hinführung zu sachlicher Einsicht auf, sondern ist darauf bezogen, Heranwachsende zu einer selbstbestimmten Lebensführung zu befähigen, was die Unterstützung der Entwicklung eigener, mit der Freiheit anderer Menschen abgestimmter Positionen in Fragen eines gelingenden Lebens und Zusammenlebens einschließt. Umgekehrt sind die Positionen, deren Entwicklung initiiert und unterstützt werden soll, über eine Aneignung von Wissen vermittelt. Die Schüler*innen sollen dazu befähigt werden, sich im Lichte sachlicher Einsichten zu Fragen eines gelingenden Lebens und Zusammenlebens zu positionieren (vgl. hierzu auch Rucker, 2019, S. 649 ff.).
Es ist der Entwurf von Werturteilen, der die Verbindung zwischen einem fachlichen Wissen und der Lebensführung der Heranwachsenden stiftet. Vor diesem Hintergrund kann erziehender Unterricht auch als wertorientierter Unterricht begriffen werden – als ein Unterricht, in dem Schüler*innen dazu veranlasst werden, an das Gelernte die Frage nach dessen Bedeutsamkeit für die eigene Lebensführung im Umgang mit anderen zu richten sowie umgekehrt bereits entwickelte Werturteile im Lichte sachlicher Einsichten einer Prüfung zu unterziehen. Pointiert formuliert: »Unterricht ist unter pädagogischer Perspektive nur ›vollständig‹, wenn er das zu erwerbende Wissen mit der (Wert-)Haltung der Schüler in Beziehung setzt und so zu einer verantwortungsvollen Lebensführung beiträgt« (Rekus, 1993, S. 199).
Die Lebensführung von Heranwachsenden hat unter den Bedingungen moderner demokratischer Gesellschaften im Kontext einer irreduziblen »Perspektivendifferenz« ihren Ort, die mit einer »Mehrfachcodierung der Wirklichkeit« einhergeht (Nassehi, 2017, S. 61 ff.). Vor diesem Hintergrund steht ein erziehender Unterricht unter dem Anspruch, Heranwachsende in der Entwicklung eines vielseitig dimensionierten Selbst- und Weltbezugs zu unterstützen. ›Vielseitigkeit‹ steht dieser Lesart zufolge für die Aufgabe eines wertorientierten Unterrichts, Heranwachsenden dabei zu helfen, dass sie einen Sachverhalt »in seiner objektiven Vielgesichtigkeit erkennen« (Ramseger, 1993, S. 833) lernen und – damit verbunden – ihre bereits erlangten Urteilsmöglichkeiten hin zu einer »vielseitigen Werturteilsfähigkeit« (Rekus, 1993, S. 75) (weiter-)entwickeln. In diesem Sinne kann ›Vielseitigkeit‹ als eine Kategorie interpretiert werden, die dem Aufwachsen in modernen Gesellschaften Rechnung trägt. Ohne eine entsprechend ausdifferenzierte Ordnung des Selbst- und Weltverhältnisses dürfte es nämlich schwierig, vielleicht sogar unmöglich sein, das eigene Leben im Kontext einer komplexen Gesellschaft aus gedanklicher Selbständigkeit heraus zu führen.
Umgekehrt arbeitet ein erziehender Unterricht der Freisetzung von Schüler*innen für ein Leben in Selbstbestimmung gerade dadurch zu, dass diese nicht auf bestimmte Perspektiven festgelegt, sondern vielmehr dazu befähigt werden, Perspektiven in ein Verhältnis zu setzen. Indem »Unterricht« zu einem Raum der »Erprobung unterschiedlicher Sichtweisen von Wirklichkeit« avanciert, können nicht nur »Vorurteile und Voreingenommenheiten« irritiert werden (Duncker, 1999, S. 51). Darüber hinaus erlaubt es »das Zeigen der Welt im Spiegel unterschiedlicher perspektivischer Rekonstruktionen« auch, den »Wahrheitsanspruch einer einzelnen Perspektive« zu relativieren (ebd.). Dieser Umstand erlaubt es Heranwachsenden, sich freizumachen von der Erwartung, eine bestimmte Perspektive als die allein maßgebliche anzuerkennen, und zwar indem Schüler*innen die Möglichkeit eröffnet wird, Perspektiven mit Alternativen zu konfrontieren und in einem Wechselspiel der Perspektiven um sachliche Einsichten und eigene Werturteile zu ringen.
2.4 Grundstrukturen
Ein erziehender Unterricht mit Bildungsanspruch ist durch bestimmte Grundstrukturen ausgezeichnet, deren Klärung dazu geeignet ist, den bislang entwickelten Gedankengang auszudifferenzieren. Ein entsprechender Unterricht zeichnet sich u. a. dadurch aus, dass sachliche Einsicht und eigene Urteilsbildung angestrebt sowie Schüler*innen dazu angehalten werden, ihre Vernunft problematisierend zu gebrauchen und auf die Voraussetzungen von bestimmten Einsichten und Werturteilen zu reflektieren (vgl. Rucker, 2018b, S. 475 ff.; Rucker, 2023, S. 72 ff.).
2.4.1 Verstricken in eine sachliche Auseinandersetzung
Ein erziehender Unterricht mit Bildungsanspruch setzt damit an, dass tradiertes Wissen als ein Zusammenhang von Antworten auf Fragen begriffen und die Arbeit an diesen Fragen in den Mittelpunkt des Unterrichts gerückt wird. Lehrer*innen kommt von daher, wie oben bereits angedeutet, die Aufgabe zu, Sachverhalte, die eine potentielle Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung für Heranwachsende erkennen lassen und anhand derer exemplarisch Allgemeines einsichtig werden kann (vgl. Klafki, 2006; Rucker, 2020b), für die Schüler*innen erst einmal fragwürdig und zugänglich zu machen. Bei diesen Sachverhalten handelt es sich entweder um Methoden, die Menschen entwickelt haben, um bestimmte Fragen zu beantworten, oder um Ergebnisse des Einsatzes von Methoden. Hieraus folgt, dass Unterricht so angelegt sein muss, dass dabei dem »immanent-methodischen Charakter« (Klafki, 1985/2007, S. 123) tradierten Wissens Rechnung getragen wird, indem Schüler*innen darin unterstützt werden, den Weg, der zu einem bestimmten Wissen führt, in vereinfachter Form selbst zu gehen. Das bedeutet, ein Inhalt wird nicht in fertiger Gestalt präsentiert, sondern die Schüler*innen werden dazu veranlasst, im Wechselspiel von Vertiefung in und Besinnung auf einen Sachverhalt dessen Struktur Schritt für Schritt zu erschließen und in diesem Sinne Antworten auf die für sie maßgeblichen Fragen zu suchen und zu finden.
Ein erziehender Unterricht mit Bildungsanspruch ist daran erkennbar, dass Schüler*innen nicht nur dazu angehalten werden, den sachlogischen Aufbau eines Inhalts zu erschließen, sondern darüber hinaus auch – unter Berücksichtigung ihrer Individuallage – zur Prüfung der Geltungsansprüche aufgefordert werden, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Dies schließt Phasen der Unterweisung nicht aus. Umgekehrt ist es durchaus möglich, Unterricht als Instruktion anzulegen, d. h. so, dass eine Prüfung tradierter Geltungsansprüche ausgespart bleibt, weshalb ein erziehender Unterricht mit Bildungsanspruch nicht vorbehaltlos als der Normalfall oder gar als eine Trivialität angesehen werden sollte. Phasen der Unterweisung müssen im Kontext eines solchen Unterrichts im Verhältnis zu dessen Aufgabe, Heranwachsenden sachliche Einsicht zu ermöglichen, gerechtfertigt werden können, d. h. sie müssen sich als notwendige Voraussetzung dafür erweisen lassen, dass Heranwachsende überhaupt sinnvoll in eine sachliche Auseinandersetzung verwickelt werden können. So müssen Schüler*innen z. B. erst in den Bezeichnungen der Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks unterwiesen worden sein, ehe der Satz des Pythagoras erarbeitet sowie verschiedene Beweismöglichkeiten dieses Satzes durchgespielt werden können. Umgekehrt wäre ein Mathematikunterricht, in dem entsprechende Beweise außen vor blieben, als defizitär zu beurteilen – dies jedenfalls dann, wenn Schüler*innen Bildung ermöglicht werden soll. In diesem Fall wird den Heranwachsenden nämlich die Möglichkeit vorenthalten, Einsicht in den Satz des Pythagoras zu gewinnen, d. h. den damit verbundenen Geltungsanspruch in Freiheit zu akzeptieren. Zugespitzt formuliert: »Der Lernende soll aufnehmen und behalten, d. h. er soll lernen in der elementaren Bedeutung dieses Wortes, aber annehmen, d. h. für wahr halten, soll er das Gelernte nur unter dem Begleitschutz seines prüfenden und begründenden Denkens« (Koch, 2015, S. 71; Hv. i. O.).
Das Wissen, das im Unterricht thematisiert wird, ist freilich längst gefunden und wird von den Schüler*innen bestenfalls nachentdeckt. Es ist von daher nur folgerichtig, wenn Unterricht zwar einerseits als Aufforderung zum »Selberdenken« begriffen wird, die Aufforderung andererseits aber als Hilfe »zum selbständigen Finden von Erkenntnissen« (Klafki, 1999, S. 115) spezifiziert wird. Dies ist gemeint, wenn ich hier davon spreche, dass ein erziehender Unterricht mit Bildungsanspruch darauf gerichtet ist, Schüler*innen sachliche Einsicht zu ermöglichen. Der Satz des Pythagoras wird in einem Unterricht, der Bildung zu ermöglichen sucht, nicht einfach als gültig vorausgesetzt, sondern – im Erfolgsfall – von den Heranwachsenden im Durchspielen verschiedener Beweise als gültig erkannt.
2.4.2 Veranlassen zu eigener Werturteilsbildung
Für einen erziehenden Unterricht mit Bildungsanspruch ist ferner charakteristisch, dass Heranwachsende dazu veranlasst werden, im Lichte sachlicher Einsichten eigene Werturteile zu fällen. Die Frage, wie wir unter Berücksichtigung von im Fachunterricht vermitteltem und angeeignetem Wissen leben und zusammenleben sollen, wird nicht stellvertretend von den Lehrer*innen beantwortet, um die Schüler*innen schließlich auf eine Orientierung an den jeweils vorgegebenen Antworten zu verpflichten. Ein erziehender Unterricht mit Bildungsanspruch ist vielmehr dadurch gekennzeichnet, dass Schüler*innen auch in Fragen eines gelingenden Lebens und Zusammenlebens zu Suchbewegungen angehalten werden, um eigene Antworten auf diese Fragen zu finden. Hierbei spielen freilich überkommene Antworten eine zentrale Rolle, immerhin sollen Schüler*innen die Möglichkeit erhalten, auf einem bereits erreichten Niveau der Thematisierung von Fragen eines gelingenden Lebens und Zusammenlebens ihre Position zu finden. Die jeweiligen Antworten – und das ist hier entscheidend – geben jedoch nicht das Maß vor, an dem Orientierung gesucht wird. Vielmehr avancieren tradierte Antworten auf Fragen eines gelingenden Lebens und Zusammenlebens zu Gegenständen der Auseinandersetzung im Kontext einer in die Zukunft hinein offenen Suche nach Orientierung (vgl. Fischer, 1972, S. 132).





























