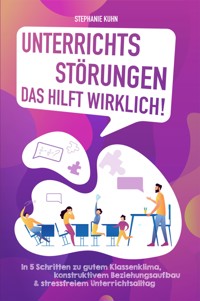
8,99 €
Mehr erfahren.
Schüler-Chaos & -Störungen in deinem Unterricht? So vermeidest Du diesen Energieräuber im Schulalltag!
Kennst du das?
- Deine Klasse wird immer lauter?
- "Fiese" Unterrichtsverweigerer widmenen sich Nebentätigkeiten oder Schwätzer machen deinem geordneten Unterrichtsablauf einen Strich durch die Rechnung?
- Oder hast du mit sonstigen Disziplinproblemen besonders schwieriger SchülerInnen (z.B. anhaltende Konflikte, Aggressivität) zu kämpfen?
Diese stressigen Unterrichtsstörungen zehren an den Nerven und können sogar das Selbstbewusstsein ankratzen. Gut gemeine Tipps wie „Du musst strenger sein“ oder „Bereite deinen Unterricht besser vor“ entlarven sich im schulalltäglichen Wahnsinn als Sackgasse, wenn die Klasse wieder aus dem Ruder läuft. Sicher hast du schon festgestellt, dass Nachsitz-Drohungen und klassische Verhaltensweisen (wie selbst immer lauter werden) nur kurzfristig helfen. Nicht nur Berufsanfänger fragen sich daher: Wie kann ich Unterrichtsstörungen vorbeugen und angespannte Situation, die zu eskalieren drohen, wieder unter meine Kontrolle bringen?
Unterrichtsstörungen - Das hilft wirklich: Wie du stressfreien Unterricht mit einem guten Lernklima in 5 praxisnahen Schritten erreichst
Dieser praxisnahe Ratgeber bringt Licht ins Dunkel: Du erfährst in praxisnahen Schritten und sofort umsetzbaren Tipps, wie du Unterrichtsstörungen vorbeugst und wirkungsvoll auf Störungen und Konflikte aller Art reagierst. Alle gewonnenen Erkenntnisse kannst du ohne oder mit minimalem Vorbereitungsaufwand in deine Unterrichtsgestaltung integrieren. Die Vorteile dieser spürbaren Verbesserung:
- Statt lautes Chaos & angekratzte Nerven endlich stressfrei & gelassen unterrichten.
- Von Respekt, aber auch Sympathie geprägter Beziehungsaufbau zur Klasse, sodass deine Schüler gerne in deinen Unterricht kommen.
- Erreiche somit dein Ziel, den Schülern den wichtigen Unterrichtsstoff zu vermitteln.
Basierend auf bewährten Konzepten erwarten dich unter anderem folgende Inhalte:
- Schritt 1: Mit erhellenden Erkenntnissen Unterrichtsstörungen und ihre Ursachen verstehen.
- Schritt 2: Schaffe entscheindene Strukturen für reibungslosen Unterrichtsablauf.
- Schritt 3: Schülerverhalten verstehen und mit gelungener Kommunikation ein harmonsches Klassenklima gewinnen.
- Schritt 4: Als Lehrer den Unterricht aktiv gestalten, ohne ihn an sich zu reißen.
- Schritt 5: Selberfürsorge, um im Alltag gelassen zu bleiben und dem gefürchteten "Lehrer-Burnout" zu entkommen.
Als Zusammenfassung erfährst du die 10 goldenen Regeln gegen Unterrichtsstörungen, die wirklich langfristig helfen!
Die beschriebenen Vorgehensweisen und Tipps können schon nach wenigen Tagen helfen, Unterrichtsstörungen zu auf ein völlig natürliches Maß zu reduzieren. Denn wer möchte schon im stressigen Schulalltag ausbrennen? Gestalte dir somit deinen Schulaltag berechenbarer und sei für alle Situationen im Schulalltag gerüstet!
Ein Muss für jede(n) Referendar(in) !
Lade dieses eBook jetzt herunter und lerne die 5 Schritte für störungsfreien Unterricht kennen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Unterrichtssörungen – Das hilft wirklich
In 5 Schritten zu gutem Klassenklima, konstruktivem Beziehungsaufbau & stressfreiem Unterrichtsalltag
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenDeckblatt
Unterrichtssörungen – Das hilft wirklich
In 5 Schritten zu gutem Klassenklima, konstruktivem Beziehungsaufbau & stressfreiem Unterrichtsalltag
© 2020 Williams & Brown
Stephanie Kuhn
Alle Rechte vorbehalten.
Prolog
Du spürst schon in dem Moment, als du die Klinke der geschlossenen Klassenzimmertür in die Hand nimmst, dass es dahinter brodelt. Der Lärm deiner Schüler ist nicht zu überhören und kündigt, ähnlich wie das Grummeln eines Vulkans, den baldigen Ausbruch an. Schon als du die Tür langsam öffnest, braust dir ein Sturm entgegen und du wirst von Kommentaren, Fragen und Ausreden bis zum Pult begleitet. Noch bevor der Unterricht begonnen hat, hast du dich bereits im Strom deiner Schüler verloren. Nachdem die eiligsten Anfragen geklärt sind, steigst du ein – sieben Minuten später als geplant. Deine Bemühung mit dem Unterricht loszulegen, nimmt kaum einer wahr, alle scheinen von der Gruppenernergie mitgerissen zu werden. Einer daddelt heimlich am Handy, drei blicken aus dem Fenster, zwei Mädels unterhalten sich leise, die letzte Reihe sinniert und schläft, einer kramt in seiner Schultasche. Deine Fragen gehen unter, du willst Aufmerksamkeit, blickst auf die Uhr. Einige wollten sich gerade melden, du selbst gibst die Antwort jedoch vorweg. Schnell teilst du das Arbeitsblatt aus, wirst kurzen Sprühfeuern ausgesetzt: „Das Blatt haben Sie uns schon gegeben!“, „Warum korrigieren Sie die Hausi nicht?“, „Darf ich schnell auf Klo?“ Währenddessen blubbert die Klassenmasse spürbar, droht, aus den Bahnen zu laufen. Du intervenierst, eine barsche Bitte um RUHE. Ein paar sind beeindruckt, andere belustigt, die Hälfte hat es nicht mitbekommen. Weiter gehts: Du erklärst die Aufgabe. Einmal für alle, danach für diejenigen, die extra Motivation brauchen und jene, die beim ersten Mal nicht zugehört haben. Dann erneut für die Schülerin, die auf dem Klo war und bei der darauffolgenden ernsthaften Nachfrage eines Fleißigen platzt dir der Kragen. Du gehst zum Pult, demonstrativ ablehnend und innerlich aufgewühlt. Du beobachtest einige beim Arbeiten, andere beim Tagträumen; ermahnst zur Arbeit, wenig später zur Ruhe. Kurz darauf musst du einen Streit schlichten, weil die Schüler untereinander das Abschreiben verwehren, was von üblen Schimpfwörtern begleitet wird, die du nicht tolerieren kannst. Es kommt zur verbalen Auseinandersetzung. Der Ausbruch ist unaufhaltsam, die Masse nicht mehr zu halten, die Kontrolle treibt endgültig davon …
Vorwort
Findest du dich in diesem Prolog wieder?
Wahrscheinlich, denn der Unterrichtsalltag ist selten purer Sonnenschein und kann gerade Junglehrer schnell an den Rand des persönlichen Abgrundes bringen. Das ist schade, liegt jedoch in der Natur der Sache. Zum einen aufgrund der Komplexität, die der lehrende Beruf mit sich bringt, zum anderen aufgrund der unzureichenden Intensität der Ausbildung. Denn das, was während des Studiums gelehrt wird, steht nicht in Relation zu dem, was in der Realität auf die Lehrer wartet. Während deines Studiums erhieltst du geballte Fachkompetenz in deinem Hauptfach, die du nie an den Schüler wirst bringen können. Zudem durftest du dich breit bilden, hast im erziehungswissenschaftlichen Studium vielleicht Seminare in Philosophie oder Soziologie besucht? Interessant, aber … nutzlos! Leider. Zahlreiche Wochenendseminare und Blockveranstaltungen während der Semesterferien haben dich, je nach Schulart, zum Ausschneiden und Basteln gezwungen, zur theoretischen Fallarbeit an hypothetischen Problemschülern oder haben dich durch Selbsterfahrung im Stationen-Lernen getrieben. In rar gesäten Schulpraktika konntest du eine Stunde in einer Klasse halten, die dankbar war, eine utopisch minutiös ausgearbeitete und kreative Stunde von einem jungen Menschen vorgesetzt zu bekommen.
Alles schöne Erfahrungen, ehrlich, und sehr wertvoll, keine Frage! Aber bei Weitem nicht das, worauf es im Unterricht zu 80 % ankommt. Denn Lehrer sind keine Theoretiker, sie arbeiten am heranwachsenden Menschen, der nur selten nach Lehrbuch funktioniert und sich in methodische Schablonen pressen lässt. Lehrer arbeiten mit dem heranwachsenden Menschen, wobei sich per se eine Dynamik entwickelt, die didaktisch nicht immer aufgefangen werden kann. Lehrer arbeiten unter heranwachsenden Menschen, die proaktiv wirken und reagieren, also immer auch Spuren hinterlassen. Und genau das ist es, wofür Lehrer Handwerkszeug brauchen: für den äußerst störanfälligen Umgang mit ihren Schülern während des Unterrichts.
Der vorliegende Ratgeber möchte genau da ansetzen und dir Möglichkeiten aufzeigen, mit deinen mitunter lustlosen, lauten oder schwierigen Schülern umzugehen. Er will dir Tipps dafür geben, wie du mit Nebentätigkeiten, Verweigerungen, Provokation oder Konflikten umgehen kannst und Situationen, wie die eingangs geschilderte, in Zukunft souveräner meistern kannst. Mithilfe von fünf Schritten wirst du im Folgenden dazu angeregt, das unterrichtliche Geschehen in seiner Komplexität zu erfassen, und lernst, dass Störungen mehr Regel als Ausnahme darstellen. Du wirst dazu angeleitet, präventiv durch Struktur und Ordnung in deiner Arbeitsweise auf solche Störungen einzuwirken und darüber viele praktische Tipps erhalten, wie du auf Unterrichtsebene mit auftretenden Störungen professionell umgehen kannst. Darüber hinaus sollst du für dich erfahren, was effektive Klassenführung bedeuten und wie pädagogisch wertvolle Kontrolle gelingen kann, um gesteckte Lernziele zu erreichen. Zudem wirst du einige Informationen darüber erhalten, wie sich ein gelingender Beziehungsaufbau vollziehen kann und worauf es zwischenmenschlich im Klassenzimmer ankommt. Dadurch kannst du dazu beitragen, dass deine Schüler gerne in den Unterricht kommen und von einem guten Lern- und Klassenklima profitieren können – ebenso wie du. Zu guter Letzt soll dir in einem kleinen Exkurs deutlich gemacht werden, wie wichtig deine persönliche Lehrergesundheit ist und welche Maßnahmen du dahingehend ergreifen kannst. Das soll dich dazu befähigen, gelassen und stressfrei durch den Schulalltag zu gehen und dabei authentisch auftreten zu können.
Der von dir gewählte Beruf ist ein sehr wertvoller und zudem äußerst bereichernder, was leider oftmals im alltäglichen Stress untergeht. Der Ratgeber will dir also implizit auch ermöglichen, dich wieder zu besinnen, warum du ihn ergriffen hast und dir mit praktischen Tipps für den Alltag eine gewisse Entlastung ermöglichen, damit du dich (wieder) auf die schönen Seiten der täglichen Arbeit mit jungen Menschen fokussieren kannst.
In fünf Schritten zu gutem Unterricht
Erster Schritt: Verstehen, wie störanfällig Unterricht ist
Mit Sicherheit wurdest du im Laufe deines Studiums im Fach Schulpädagogik gut vorbereitet und mit den verschiedenen Konzepten von Unterricht konfrontiert. All diese Theorien und Modelle versuchen, die Komplexität des Unterrichts hinsichtlich seines Lehr- und Lernprozesses zu operationalisieren. Durch eben diese Herausstellung von determinierenden Faktoren wird versucht, die dem Unterricht innewohnende Komplexität zu reduzieren. Unterrichtskonzeptionen möchten aufzeigen, wie die Struktur der wesentlichen Handlungsabläufe beschaffen ist und welche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Komponenten bestehen. Im Groben bedeutet das also, dass Unterricht eine Kombination aus Instruktion und Konstruktion darstellt und der Lehr-Lernprozess gewissen Bestimmungsfaktoren unterliegt: Der Unterricht muss sich an den jeweiligen Unterrichtsinhalten orientieren, deren Auswahl, Ordnung, Darbietung, Erarbeitung und Sicherung wiederum eine erzieherische Wirkung innewohnt, welche von der Lehrkraft begünstigt oder gehemmt werden kann. Dies stellt das Grundgerüst des Unterrichts dar, worauf aber noch eine Vielzahl unterschiedlicher Variablen einwirken (beispielsweise die Klassengemeinschaft, die Lernvoraussetzungen der Schüler, Sach- und Fachkompetenz des Lehrers). Unterrichtskonzepte möchten Lehrer also dabei helfen, mit dieser Komplexität umgehen zu lernen. Sie sollen insbesondere bei der Planung und Vorbereitung helfen, aber auch Vorgaben für die Durchführung bereitstellen und eine Evaluation ermöglichen.
Konzepte von Unterricht
Unterrichtskonzepte vereinen in sich also die Ausrichtung des didaktisch-methodischen Handelns im Unterrichtsalltag. Dies umfasst die inhaltliche Schwerpunktsetzung ebenso, wie die Auswahl passender Methoden, um zu gewährleisten, das vorab definierte Unterrichtsziel zu erreichen.
Gewissermaßen stellen solche Konzepte die theoriegeleitete Grundeinstellung der Lehrer dar, wie ihr Unterricht gestaltet sein soll. Die Wahl eines Unterrichtskonzepts wiederum ist von verschiedenen Variablen beeinflusst, darunter sowohl die eigene schulische Sozialisation als auch die Schwerpunkte der Studieninhalte. Zudem können praktische Berufserfahrungen, das Verständnis für die eigene Profession und grundsätzliche Überzeugungen eine Rolle spielen.
So wirst du für dich eine Entscheidung getroffen haben (oder sie noch treffen müssen), welcher grundsätzlichen Orientierung dein Unterricht folgen soll. Vielleicht verstehst du dich als Experte, der den Schülern angeleitet Wissen beibringen möchte, so wie du es in Vorlesungssälen erfahren hast, weshalb du eher zu direktiven Unterrichtskonzepten tendierst. Oder aber, du bist ein Freigeist, traust deinen Schülern Eigenverantwortung zu, und möchtest sie in offenen Strukturen eigene Erfahrungen machen lassen. Jede Variante ist völlig in Ordnung, sie darf auch zwischen Unterrichtsgegenständen variieren; wichtig ist aber, dass du ein Gefühl für deine persönliche Grundeinstellung zum Unterricht entwickelst und danach arbeitest.
Allgemein lässt sich feststellen, dass sich die Vorstellungen von Unterricht immer weiter von geschlossenen und direktiven Formen entfernen, sich öffnen und am Schüler und dessen Bedürfnissen orientieren. Die gängigen Unterrichtskonzepte wirst du kennen, zur Erinnerung hier noch eine kurze Liste der gängigsten Varianten ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
schülerorientierter Unterricht
lernzielorientierter Unterricht
prozessorientierter Unterricht
handlungsorientierter Unterricht
entdeckender Unterricht
erfahrungsbezogener Unterricht
kommunikativer Unterricht
Projektlernen
Kriterien guten Unterrichts
Da es nicht möglich ist, innerhalb des Ratgebers das eine Unterrichtskonzept vorzustellen, welches für jeden Leser und dessen Schülerschaft passt, erscheint es sinniger, eine Abstraktionsstufe nach oben zu gehen und auf diejenigen Faktoren einzugehen, die guten Unterricht ausmachen. Dabei ist irrelevant, welches Unterrichtskonzept zugrunde liegt; die „Kriterien guten Unterrichts“ von Hilbert Meyer sind allgemeingültige schulpädagogische Richtlinien, deren erneute Lektüre auch im Zuge vom Umgang mit Unterrichtsstörungen unerlässlich erscheint. Im Folgenden findest du daher einen kompakten Überblick über das, was wichtig ist:
1. Klare Strukturierung des Unterrichts
Unterricht sollte stets eine erkennbare Struktur aufweisen, die sich wie ein roter Faden durch die einzelnen Schritte des Unterrichts zieht. Dies impliziert auch, dass Rollenklarheit besteht, konsequent gehandelt wird und die Aufgaben jedes Einzelnen klar definiert sind.
2. Hoher Anteil echter Lernzeit
Echte Lernzeit meint die Phasen, in denen der Schüler tatsächlich effektiv lernt und an etwas arbeitet, das einen Fortschritt im Wissen ermöglicht. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist gutes Zeitmanagement und eine gute Vorbereitung unerlässlich. Zudem können Routinen und eine gewisse Rhythmisierung dabei helfen, Zeitfresser auszulagern.
3. Lernförderliches Klima
Schüler können dort gut lernen, wo sie sich wohlfühlen. Entsprechend wichtig ist es, ein gutes Klassenklima zu gewährleisten, in dem gegenseitiger Respekt herrscht, aufeinander Rücksicht und füreinander Verantwortung übernommen wird.
4. Inhaltliche Klarheit
Guter Unterricht gibt Schülern die notwendige inhaltliche Struktur vor, die sie brauchen, um sich flexibles, vernetztes und zum Transfer befähigendes Wissen anzueignen. Dies muss sich auch in der Unterrichtsstruktur niederschlagen, sodass klar wird, warum und wozu Themen gelernt werden müssen. Ebenfalls zählt hierzu Klarheit in der Aufgabenstellung, Angemessenheit im Anspruch, aber auch eine gewisse Verbindlichkeit bei der Ergebnissicherung.
5. Sinnstiftendes Kommunizieren
Kommunikation im Unterricht sollte nicht beiläufig passieren, sondern sinnvoll zum Erreichen der Lernziele beitragen. Hierzu zählt eine gewisse Form der Metakommunikation, aber auch Gespräche über Lernfortschritte sowie die Kultivierung einer Gesprächskultur, mit der sich alle Beteiligten identifizieren können.
6. Methodenvielfalt
Guter Unterricht zeichnet sich durch Methodenvielfalt aus. Dies impliziert sowohl die gewählten Sozialformen des Unterrichts, die Aufgabentypen als auch die Methodik. Hierbei ist es wichtig, dass diese zu den Schülern, zum Lernziel und zum Inhalt passt.
7. Individuelles Fördern
Jeder Schüler soll gleichermaßen die Chance haben, sein Potenzial zu entfalten. Dies bedeutet für guten Unterricht, innere Differenzierung und Freiräume zu ermöglichen. Hierfür ist eine gut fundierte Lerndiagnostik sowie aufeinander abgestimmte Förderpläne – je nach Begabung, Interessen oder Defizite – erforderlich.
8. Intelligentes Üben
Unterricht ist dann gut, wenn er Schüler sinnvoll beschäftigt und ihnen intelligentes Üben ermöglicht. Die Arbeitsaufträge sollen der Konsolidierung aber auch einem tieferen Verständnis dienen und somit Transfer begünstigen. Wiederholtes Üben soll Erfolge ermöglichen und so positiven Einfluss auf die Leistung nehmen. Die Vermittlung und das Training von Lernstrategien sollte ebenfalls Teil davon sein.
9. Transparente Leistungserwartungen
Schüler müssen wissen, welche Anforderungen an sie gestellt und welche Leistungen von ihnen erwartet werden. Darüber hinaus ist es Aufgabe guten Unterrichts, zügig und regelmäßig Rückmeldung über den individuellen Lernfortschritt zu geben.
10. Vorbereitete Umgebung
Guter Unterricht ist nur dort möglich, wo Schüler und Lehrer sich in einer vorbereiteten Umgebung wiederfinden. Dies impliziert Ordnung, Funktionalität und Adäquatheit des Klassenzimmers sowie des Lernwerkzeugs.





























