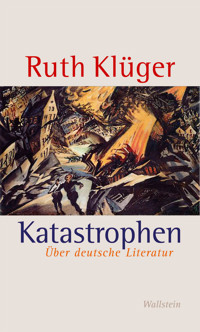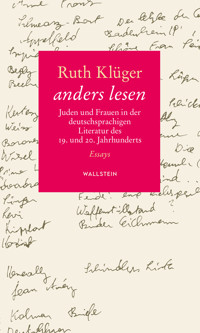Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Bestseller "weiter leben", Ruth Klügers autobiographisches Überlebensbuch, war ein beklemmendes Augenzeugnis der Konzentrationslager von Theresienstadt, Auschwitz-Birkenau, Christianstadt. Doch was kam nach dem Krieg? Aus dem dreizehnjährigen Mädchen, dem die Gaskammer nur durch einen glücklichen Zufall erspart geblieben war, wurde eine angesehene Literaturwissenschaftlerin, eine selbstbewusste Feministin und eine international ausgezeichnete Schriftstellerin. Der American Way of Life in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die komplexe Beziehung zu ihren zwei Söhnen, die unglückliche Ehe und die als Befreiung empfundene Scheidung sind Themen dieser Autobiographie. Hier erzählt eine Frau, die sich ihre Muttersprache ebenso zurückerobert wie ihre Geburtsstadt Wien, die sich mit den Verlusten, die das Altern bringt, auseinandersetzt und sich den Schatten und Visionen der Vergangenheit, aber auch denen der Gegenwart stellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Der Bestseller »weiter leben«, Ruth Klügers autobiographisches Überlebensbuch, war ein beklemmendes Augenzeugnis der Konzentrationslager von Theresienstadt, Auschwitz-Birkenau, Christianstadt. Doch was kam nach dem Krieg? Aus dem dreizehnjährigen Mädchen, dem die Gaskammer nur durch einen glücklichen Zufall erspart geblieben war, wurde eine angesehene Literaturwissenschaftlerin, eine selbstbewusste Feministin und eine international ausgezeichnete Schriftstellerin. Der American Way of Life in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die komplexe Beziehung zu ihren zwei Söhnen, die unglückliche Ehe und die als Befreiung empfundene Scheidung sind Themen dieser Autobiographie. Hier erzählt eine Frau, die sich ihre Muttersprache ebenso zurückerobert wie ihre Geburtsstadt Wien, die sich mit den Verlusten, die das Altern bringt, auseinandersetzt und sich den Schatten und Visionen der Vergangenheit, aber auch denen der Gegenwart stellt.
Ruth Klüger
unterwegs verloren
Erinnerungen
Paul Zsolnay Verlag
Für Gesa
einmal ging ich unterwegs verloren
einmal kam ich an wo ich nicht war
HERTA MÜLLER, »Die blassen Herren mit den Mokkatassen«
Eins
Abschiede
Ob ich euch wiedersehe oder ob ich euch nicht wiedersehe, ich sehe euch wieder.
ILSE AICHINGER, »Kleist, Moos, Fasane«
1. Geschichte einer Nummer
Mit dem Älterwerden weichen auch die Gespenster zurück. Jahrelang begleiten sie dich, hinken sozusagen neben dir her und verlangsamen deinen eigenen Schritt, denn du kannst doch, schon aus Höflichkeit, deinem großen Bruder, der mit 17 ermordet wurde, als du gerade elf warst, nicht weg- und voranlaufen; sie machen dir Vorwürfe, weil du Zeit hattest und hast, während sie, die doch auch leben wollten, genau wie du, in der Zeitlosigkeit ihres frühen Todes verharren müssen. Da schleichst du vor ihren verschleierten Augen dahin und tust so, als ginge es dir gar nicht so gut, wie es dir tatsächlich geht, als sei die Lebenskraft etwas an und für sich Unanständiges.
Ich trag die Nummer als Andenken an euch, sag ich dann, sagte ich immer. Aber jetzt, sag ich dem Schorschi, dem Bruder, sind deine dir von der Bibel zugestandenen 70 oder 75 Jahre abgelaufen, und jetzt könntest auch du, wenn wir wie zwei normale Menschen miteinander spazieren gingen, nicht mehr voraus, sondern nur noch zurückschauen auf dein Leben, höchstens die paar Augenblicke noch genießen, auf keinen Fall auf viel Zukunft mehr hoffen. Ich selbst ja auch nicht. Freilich, du hast sie nicht gehabt, du hast die Jahre nicht gehabt, und ich hatte sie, und du hast es mir zu Recht übelgenommen, aber jetzt hättest du sie auch nicht mehr, auch du müßtest einen Strich drunter ziehen und nachrechnen, ob es sich gelohnt hat. Wie ich.
Und so kam es, daß ich dir, dir und deinesgleichen, die KZ-Nummer nicht mehr schuldig zu sein meinte. Ich hab sie ein halbes Jahrhundert mitgehabt, angehabt, herumgeschleppt auf dem linken Arm, und dann riß mir die Geduld. In einer Laserklinik in Kalifornien, wo die Hautärzte ein Heidengeld damit verdienen, daß sie die Runzeln alternder Frauen und die Tätowierungen besoffener Jugendlicher, denen es nachher leid tut, daß sie sich ihr gepflegtes Äußeres aus Gaudi und um anzugeben verunstalten ließen, entfernen, da hat mir eine junge Dermatologin in dreimaliger Behandlung über Monate hinweg dieses Stück »Mahnmal« weggebrannt. Da hab ich sie dann endlich auswendig gewußt, denn vorher hatte ich immer Mühe gehabt, sie mir zu merken: A-3537. Sie war immer nur eine Hundemarke in dem Sinne, daß die eigentliche Zahlenfolge bedeutungslos war und ich sie nie als eine Einheit empfunden habe, nicht einmal wie eine Haus- oder Telefonnummer, warum sollte ich sie mir dann merken? Die Ziffern waren nur auf der Haut, nicht im Kopf. Nur als Tatsache, als Phänomen, als Zeichen war sie wichtig, aber dann so sehr, daß man sie für die Toten anbehielt. Anbehielt? Wie ein Kleidungsstück?
Für die Buchhaltung in Auschwitz, wenn man diese makabren Genauigkeiten so nennen kann, war sie unnötig, denn ob markiert oder nicht, die Juden wurden vernichtet. Ich bin nie bei dieser Nummer gerufen worden, auch diesen Zweck hatte sie nicht. Das Absonderliche daran, ein Kind so zu markieren, war mir jedoch schon in Auschwitz klar: Die spinnen, dachte ich, als ich sie als Zwölfjährige von geübten Häftlingshänden eintätowiert bekam und sie neugierig studierte; was wird ihnen als nächstes einfallen? Da starrte ich also auf ein Symbol des absolut Bösen, und in meinem präpubertären Hirn wurde daraus ein Kuriosum, eine, wenngleich schaurige, Absonderlichkeit. Auf die Ziffern selbst kam’s nicht an, denn die waren für sich weder böse noch absonderlich.
Auch anderen erging es so, daß sie sich keineswegs mit dieser Nummer identifiziert haben, wie man sich mit dem eigenen Namen identifiziert; ein Teil unseres Wesens wurde sie erst nachher, und dann eben als Andenken, ohne gegenwärtige Funktion. Im Frankfurter Auschwitz-Prozeß gab es eine Frau, die vom Richter nach ihrer Nummer befragt wurde. (Warum hat er gefragt, schien ihm die Frage nach der Nummer eine legitime Ausübung der Staatsgewalt zur Identifikation der Todgeweihten?) Sie erinnerte sich nicht an die Zahlen, und statt dem Richter zu sagen, »Du kannst mich« oder »Wie kommen Sie dazu, solche intimen Fragen zu stellen?« oder eine Nummer zu erfinden oder zu behaupten, sie habe sie sich herausschneiden lassen (mit der narbenfreien Lasermethode fing es damals erst an, glaube ich), hat sie sich mühsam ihrer Kostümjacke entledigt und die langärmelige Bluse aufgekrempelt, um die unselige Nummer dem hohen Gericht zu zeigen und sie abzulesen. Auch für sie war sie nichts zum Auswendiglernen gewesen.
Ich hatte ein Buch über das alles geschrieben, das war Vorbedingung für das Ablegen der Nummer, für den wieder unversehrten Arm. Ich hab alles gesagt, was ich darüber zu sagen hatte, Zeugnis abgelegt, das berühmte Zeugnis, das wir uns schon immer, seit der Zeit in den Lagern, abverlangt haben. Dann habe ich die Nummer noch ein paar Jahre — was sag ich da — viele Jahre sein lassen, wie ich den Ehering nach der Scheidung noch ein paar Wochen trug und den Namen meines ehemaligen Mannes noch jahrzehntelang, als gingen solche Trennungen nicht schnell. Das Buch nannte ich »weiter leben«, was nichts anderes zu bedeuten hatte, als daß das Weiterleben von alleine kommt und man nichts dazu tun muß, außer dem Umgebrachtwerden zu entgehen. Die Möglichkeit, getötet zu werden, haftet nämlich unsereinem nachher auch in Friedenszeiten im Hinterkopf.
Ja, sagte die junge Hautärztin, als sie mir die Schutzbrillen reichte, die alle im Operationssaal aufsetzen mußten, sie verstehe ganz gut, daß man diese Tätowierung loswerden wolle. Ihre eigene Mutter, sagte sie noch, sei ein Flüchtling aus Nazi-Deutschland gewesen und als Kind nach England gekommen. Sie behandelte die Sache unbefangen, wie etwas, was in die Geschichtsbücher gehört und worüber man weder sentimental noch entrüstet zu werden braucht. Außerdem und glücklicherweise sei eine solche Tätowierung leichter, viel leichter zu entfernen als die Modeartikel, die sich die jungen Leute heutzutage antun. Diese wieder loszuwerden, sagte sie, tut weh und ist sehr teuer.
Teuer war auch die Entfernung meiner einfachen Nummer, die Krankenkassen bezahlen sowas nicht, nicht einmal wenn’s um schuldlos verunstaltete Kindergesichter geht, sagte mir die Ärztin, wieviel weniger für Erwachsene, die sich mit Kriegsüberbleibseln herumschlagen. Ich konnte mir’s leisten, es war gut angelegtes Geld, dachte ich zufrieden. Doch eigentlich sollte die Bundesrepublik dafür aufkommen, dachte ich noch, wenn auch nicht im Ernst, aber an wen sollte ich mich da wenden? Und gerade ich, die ich nicht einmal um meine sogenannte Wiedergutmachung, eine richtige lebenslängliche Pension, eingereicht hatte; wie meine Mutter und teilweise, um es ihr gleichzutun. Was mir nachher leid tat und dann wieder nicht, man kommt nicht zurecht mit dieser Vergangenheit, gerade dann, wenn sie sich in Einzelheiten auflöst.
Es war wie diese Impfungen, die man mehrmals wiederholen muß, damit sie wirken, die Impfung für Hepatitis zum Beispiel. Bei der Nummer war es wichtig, sie zwischen den Behandlungen bedeckt zu halten, sodaß keine Sonne darauf scheinen konnte. Ich hielt mich brav an die ärztlichen Anweisungen, lief mit einem Verband am Arm herum, was besonders in Deutschland unausgesprochenes Staunen erregte. Dann war’s vorbei. Die junge Ärztin hat gute Arbeit geleistet, und ich werde diese Spuren der Nazizeit nicht in den Sarg (vom Jenseits halte ich nicht viel) mitnehmen müssen.
Aber es hatte nichts mit Geld und Geiz zu tun, wenn die Überlebenden diese Nummern so selten entfernen ließen. Man könnte doch denken, wir alle hätten nichts Eiligeres zu tun gehabt, als dieses üble Symbol loszuwerden — besonders die Jungen unter uns, denen daran gelegen war, sehr schnell eine Zukunft aufzubauen. Und eigentlich waren wir ja alle jung, denn nur wenige aus der älteren Generation hatten es überstanden. Doch ganz ohne darüber zu sprechen, und fast als sei es eine Verpflichtung den Toten gegenüber, nahm man die Auschwitznummer mit in die Nachkriegswelt, die gerne heil sein oder werden wollte und die durch das »Merkt euch« unserer Markierungen löchriger wurde. Aber war das die Absicht? Wollten wir die Draußengebliebenen beschämen? Ich glaube nicht. Es war Totenehrung und Lebensbejahung in einem. Es gibt einen schönen Vers von Rilke: »Wiedererholtes Herz ist das bewohnteste.« So oder ähnlich war mir nach Kriegsende zumute. Eine Stunde Null gab es für uns freilich nicht.
Also wie hat sich’s damit gelebt? Zuerst haben die Leute gar nicht gewußt, was es war, nur die Eingeweihten, das heißt Täter und Opfer und die Menschen in ihrem Umfeld. Aber mir war gar nicht daran gelegen, die Leute aufzuklären, sie an das Geschehene zu erinnern. Ich brauchte die Nummer für meinen eigenen Erinnerungshaushalt. Dieses sichtbare Überbleibsel. Dazu ein paar Anekdoten und Erlebnisse.
Das erste Mal, als ich versuchte, mich der Germanistik anzunähern, war 1952, also nur so lange nach Kriegsende, wie der Krieg selbst gedauert hatte. Ich war neu in Berkeley, hatte einen Bachelor mit Hauptfach Englisch vom Hunter College in New York, hatte einen Sommer im französischen Teil Kanadas an der Université Laval verbracht und später noch ein paar Wochen in Montreal als Tellerwäscherin in einem Restaurant. Nun meinte ich, ich sollte Komparatistik weiterstudieren, mit Englisch, Deutsch und meinem schlechten Französisch, das sich aber aufbessern ließ. Ich sprach bei einem Professor Schneider vor, der ein Seminar über das Junge Deutschland anbot. Er hat die Nummer auf meinem Arm gesehen und wollte mich nicht in diesem Seminar haben, aber ich habe das damals nicht verstanden, einfach weil ich mit meinen zwanzig Jahren zu naiv war. Er fragte, warum ich mich denn diesen unschönen Geschichten über jüdische Autoren, die es schwer gehabt hatten, aussetzen wolle? Mir war damals nicht klar, daß man sich die Professoren und nicht die Themen ihrer Seminare aussuchen muß, wenn man an der Uni was lernen will. Ich versicherte ihm, daß gerade Heinrich Heine mich sehr interessiere. Er hat mich dann doch, wenn auch widerwillig, an dem Seminar teilnehmen lassen, allerdings nicht sehr lange. Denn dieser Schneider (ein Name, der gerade in der Literaturwissenschaft überproportional oft vorkommt) war ein frustrierter Assistenzprofessor, also einer, der auf der niedrigsten akademischen Stufe steckengeblieben war. Obwohl er eine feste Stelle hatte, etwa vergleichbar mit deutschen akademischen Räten, haßte er seine Kollegen, besonders die zwei oder drei Juden unter ihnen. Im Seminar sprach er über fast nichts anderes, mit gelegentlichen Seitenhieben auf Heinrich Heine und Ludwig Börne, die zu ihrer Zeit als verwandt angesehen und mit ein paar anderen Schriftstellern das Junge Deutschland getauft wurden. Die Studenten wußten nicht recht, wie sie diese Tiraden aufnehmen sollten, und saßen mit verschlossenen Gesichtern da. Ich kritzelte aus Langeweile vor mich hin, versuchte Schillers »Lied von der Glocke« wortgerecht aus dem Gedächtnis aufzuschreiben, doch Herr Schneider hat vielleicht geglaubt, ich mache mir Notizen über seinen Ärger auf die Kollegen.
Plötzlich bekam ich eine Einladung zum Kaffee von einem Herrn Taylor, einem älteren Studenten (die Übereinstimmung mit dem Namen unseres Professors war ein amüsanter Zufall). Ich freute mich sehr darüber, denn ich hatte noch kaum Anschluß in Berkeley gefunden, doch das Gespräch nahm einen merkwürdigen Verlauf. Es war mitten in der berüchtigten, nach dem Senator von Wisconsin, Joseph McCarthy, benannten Ära, und Taylor wollte anscheinend herausfinden, ob ich kommunistenfreundlich oder gar Kommunistin sei. Trotz des scheinbaren Kameradschaftsangebots konnte ich beim besten Willen mit keiner besonderen Kenntnis von Marx und Engels aufwarten. Ich fand das Thema eher langweilig und wollte lieber über Heine reden. Schließlich ging mir ein Licht auf: Herr Taylor war von Professor Schneider auf mich angesetzt worden. Und ein paar Tage später bekam ich prompt einen Brief von dem Professor, auf einer Schreibmaschine mit ungewöhnlich altmodischer Fraktur, also vermutlich seiner eigenen, privaten, nicht der des Sekretariats, getippt, in dem er mir meine Unreife vorwarf, die mich ungeeignet mache, an seinem Seminar teilzunehmen. Ich sei ein störendes Element. Zu dieser Zeit war noch kein einziges Referat gehalten worden, auch hatte noch kein Examen stattgefunden, es gab nichts, womit er sein Urteil hätte begründen können, und er versuchte es auch gar nicht. Es war ein autoritärer Rauswurf, den ich der Nummer auf meinem Arm zu verdanken hatte, denn ohne diese wäre meine Vergangenheit nicht erkennbar gewesen. Inzwischen war schon ein Drittel des Semesters vorbei, zu spät, um sich anderswo einzuschreiben, und ich brauchte den Schein. Hilfesuchend wandte ich mich an verschiedene Instanzen und bekam zu hören, ein Professor habe das Recht, auch ohne explizite Erklärung eine Studierende aus seinem Seminar zu verweisen. Seit den sechziger und siebziger Jahren sind Studierende nicht mehr so rechtlos, aber damals gab es keine Ombudsstelle für Gleichberechtigung und die späteren »affirmative action offices«.
Nichts bleibt so unvergeßlich für Schüler wie die Ungerechtigkeit ehemaliger Lehrer. Ich bemerke das nicht nur an mir selbst, denn schon öfters haben mir erfolgreiche Menschen mit diesem eigentümlichen Gemisch aus verletztem Selbstwertgefühl und Triumph berichtet, wie sie sich gerade in dem Fach, in dem sie einst vom Lehrer herabgesetzt wurden, besonders bewährt hätten. Mir gelang es zwar, das Semester als voll eingeschriebene Studentin zu absolvieren, indem ich auf die Anglistik wechselte und einem Englischprofessor, der mich als gute Studentin kannte, meinen ungewöhnlichen Brief zeigte, der ihn zumindest erstaunte. Wir einigten uns, daß ich bei ihm mit einem längeren Aufsatz die nötigen Punkte sammeln könne. Ich schrieb über Matthew Arnold, den viktorianischen Kritiker und Dichter, und lernte eine Menge über das England der Intellektuellen im späten 19.Jahrhundert, über diese Mischung von Anpassung und Verzweiflung, die mich, mit meinen eigenen ungelenken Anpassungsversuchen an das optimistische Amerika, sehr ansprach. Doch war ich so geknickt, daß ich bald darauf das ganze Studium hinschmiß und meine Zukunft erst einmal auf Eis legte. Auch hatte ich kein Geld mehr, und das Jobben als Kellnerin brachte nicht genug ein, ich mußte schon eine Weile vollzeitlich arbeiten, um mir etwas mehr aufzusparen, sagte ich mir zum Trost. Ich zog also mit einer Freundin, mit der ich eine kleine Wohnung teilte, ins nahe San Francisco und war eine schlechte Kellnerin, ein Beruf, zu dem mir wirklich jedes Talent fehlt. Doch Kellnerin und untergeordnete Büroarbeit waren so ziemlich das einzige, was eine junge Frau, die nur einen Bachelor vorzuzeigen hatte, bekommen konnte. Was ich wirklich wollte, war Gedichte schreiben. Im Grunde war mir die ganze Sache mit dem Studium suspekt geworden. Ich verstand Herrn Schneider ja sehr gut. Da wollte sich jemand wie ich in einen Bereich drängen, wo sie mit ihrer Nummer nicht hingehörte. Ganz unrecht hatte er nicht, schien mir. Aber wo gehörte eine mit der Nummer schon hin? Nach Israel vielleicht. Aber da gab’s noch immer meine Mutter in New York, und obwohl ich nicht mit ihr leben und wohnen wollte, so wollte ich sie doch auch nicht ganz verlassen. Und aus Israel wäre ich nicht wiedergekommen. Irgendwie erwartete ich, daß sie wieder heiraten würde, was auch geschah. Andere erwarteten von mir, daß ich heiraten würde. Was ebenfalls innerhalb von zwei Jahren geschah.
Ich war jedoch noch lange nicht gewillt, die Nummer aufzugeben. Sie gehörte nun einmal zu mir. Meine Mutter hatte sich die ihre noch in den fünfziger Jahren herausschneiden lassen, und es blieb eine Narbe. Sie war damals in sehr schlechter Verfassung, das heißt, sie hatte einen Nervenzusammenbruch, war im Spital, und ich verband das eine mit dem anderen, Narbe und Nerven: Sie will ihre Identität ändern. Sie hat sich auch jünger gemacht, sogar auf offiziellen Papieren, genau um die sechs Kriegsjahre, als könne sie diese wegwischen. So etwas kann, soll, darf man nicht. Warum eigentlich nicht? Warum war ich so doktrinär? Ihre Narbe ist dann verheilt. Als sie starb, war die Narbe kaum noch sichtbar.
Es ist leicht, einem jungen Menschen die Tür zu verschließen, und es hilft enorm, wenn ein anderer sie dir einen Spaltbreit öffnet. Beide Erfahrungen habe ich während meiner Studienzeit in Berkeley gemacht, die zweite allerdings erst zehn Jahre später. Und weitere zehn Jahre später erfuhr ich es von seiten der Studenten, das Ressentiment gegen Menschen, denen sichtbares Unrecht geschehen ist und die die Zeichen nicht verheimlichen. Da war ich schon Professorin an der University of Virginia. In Virginia ist es warm, ich habe kurze Ärmel getragen und bekam diesen anonymen Brief in Großbuchstaben, der mir gehässige Vorwürfe machte. Der Schreiber war beleidigt, weil ich offen zur Schau trüge, was die Nazis mir angetan hätten. Das wollte er in der Deutschklasse ausgeklammert haben. Wie das geschehen sollte, hätte ich gerne gewußt. Langärmelige Wollkleider im Sommer? Seit wann sind denn die Söhne von Thomas Jeffersons stolzem Staat so zartbesaitet? Dachte ich. Ich bin ja nicht mit offenen Wunden in die Klasse gekommen, sondern mit Narben. Die Kriegsveteranen verdecken ihre Narben auch nicht. In Berkeley war ein Gastprofessor aus England, der hatte bei seinem Einsatz in der Royal Air Force ein paar Finger verloren und gestikulierte ganz unbefangen mit den übrigen. Der soll auch einmal was Negatives über mein angebliches »Zurschaustellen« der Nummer gesagt haben. Worin lag der Unterschied? Daß er ein Held war, ich als Zwölfjährige aber nur Pech gehabt hatte?
Wie aber an den Briefschreiber herankommen? Die University of Virginia hat einen sogenannten Ehrenkodex. Das bedeutet, daß die Studenten sich bei den Examen eidlich dazu verpflichten, nicht abzuschreiben. Dafür dürfen sie die Examensarbeiten ohne Beaufsichtigung ablegen. Die Lehrenden haben keine Wahl, sie müssen den Prüfungsraum verlassen. Wenn einer doch abschreibt und es kommt heraus, so wird er vor ein Studentengericht gestellt und bestraft. Das kann bis zur Exkommunikation führen, also bis zum Hinauswurf. Zu meiner Zeit waren es zumeist Vertreter von ethnischen Minderheiten, bei denen es zu Ehrenverletzungen und dem damit verbundenen Skandal kam; nicht weil sie von Haus aus unehrlicher gewesen wären, sondern weil sie sich weniger gut auskannten bei den Gebräuchen und nicht wußten, welche Regeln man verletzen darf und welche von einer dubiosen Tradition, die letztlich von den Kadettenschulen herstammt, geheiligt worden sind; diese Habenichtse erwischte man leichter und bestrafte sie härter.
Als Studentin in Berkeley stand ich mit dem Brief des Professors, der sowohl Heine und Börne als auch seine jüdischen Kollegen verunglimpfen wollte, ziemlich ratlos da; jetzt, als Professorin in Virginia, erging es mir ähnlich mit dem Schreiben eines Studenten, dem meine Haltung gegenüber den Nazis nicht paßte. Ich mußte ja weiterhin diese Klasse von etwa achzehn Studenten unterrichten, in der sich der Briefschreiber befand, konnte daher die Angelegenheit schlecht unter den Tisch kehren. Ich verlangte einen Repräsentanten des Ehrenkomitees zu sehen, der auch kam.
Es war in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts, auch an den konservativen Universitäten im Süden der USA wurde Staub aufgewirbelt, der sich an den Unis des Nordens fast schon wieder gelegt hatte. Der Präsident meiner Universität gehörte einem Klub an, der Schwarze prinzipiell von der Mitgliedschaft ausschloß, er meinte, das sei seine Privatangelegenheit. Ein Präsident ist aber keine Privatperson, was er tut, hat Vorbildcharakter. Darüber ließ ich mich im akademischen Senat ausführlich aus, erntete sowohl Beifall als auch Widerspruch, gehässige Briefe ohne Absender trafen ein, und Wildfremde schüttelten mir am Campus die Hand. Das war erfreulich, aber auch beschämend, denn ich hatte nichts riskiert, ich war Ordinaria, zeitweise sogar Geschäftsführerin des Departments, des Deutschen Seminars — eine unkündbare Stelle. Es war so, wie man’s erwartet, wenn man sich auf was Polemisches einläßt. Ich hatte schwarze Studenten, auch einen schwarzen Kollegen, der selbst aus Virginia stammte und sich noch gut daran erinnerte, als in seiner Kindheit die Schulen aus Protest gegen die neuen Integrationsgesetze geschlossen wurden, weil den Weißen gar keine Schule besser vorkam als eine mit Schwarzen. Da hatten ihn seine Eltern zu Verwandten in einer Gegend geschickt, wo er unbehelligt lernen durfte, aber natürlich seine Mutter und seine Geschwister vermißte. Inzwischen hatte er es zu einer Stelle an der Staatsuniversität seiner Heimat gebracht, in der allerdings das nichtakademische Personal noch immer wie der letzte Dreck behandelt wurde. Eine Putzfrau, die aus New York stammte, berichtete mir, sie werde hier abgekanzelt, als sei sie ein Kind. Im Norden sei die Bezahlung zwar auch schlecht, aber es werde respektvoller miteinander umgegangen. Das alles war im Begriff, sich zu ändern. Es ging damals ziemlich durcheinander, aber die Bürgerrechtsbewegung war nicht aufzuhalten, im Norden wußte man’s, im Süden versuchte man, sie zumindest zu verlangsamen. Ich kam aus dem Norden, und vorher aus einem Europa, für dessen Verbrechen ich in Amerika nicht die geringsten Ähnlichkeiten finden wollte. Das heißt, jede Diskriminierung schnitt mir ins eigene Fleisch.
Die Kritik an der Tätowierung auf meinem Arm traf und betraf mich persönlich. Das waren keine Rassisten aus der Stadt oder irgendwelche Hinterwäldler, das war einer meiner Studenten. Man darf allerdings nicht außer acht lassen, daß das Germanistikstudium, ja schon die deutschen Sprachkurse, immer auch eine kleine Gruppe von Nazibewunderern anzieht, eine Tatsache, die ich während meiner Unikarriere, so gut es ging, verdrängt habe. Das Ehrenkomitee, erwies sich rasch, hatte eine eher beschränkte Vorstellung von Ehre. Ich stellte den Antrag, das Komitee sollte sich darum kümmern herauszufinden, wer mir den Brief geschrieben hatte. Es handle sich um Antisemitismus, und das sei Ehrabschneidung, argumentierte ich. Ein Handschriftenexperte könne durch Vergleich feststellen, wer’s war, sagte ich, denn ich hätte handgeschriebene Examen aller meiner Studenten. Ich hegte sogar einen Verdacht, sei aber natürlich keine Expertin, bräuchte eine Bestätigung von einem, der’s verstehe und zuständig sei. Aber dafür war das Studentengremium nicht zu haben, dafür sei es nicht zuständig. Ihnen gehe es um Plagiate und abgeschriebene Examen. (Irgendwo habe ich gelesen, nirgends werde so viel gemogelt wie gerade an den Unis mit Ehrenkodex.)
Wie sollte ich also mit meinem Problem umgehen? Wieder einmal gab’s keine Instanz für eine Unannehmlichkeit, die die Nummer mir eingebracht hatte. Die Verwaltung mischte sich in diese Ehrenangelegenheiten prinzipiell nicht ein, ungeachtet der Tatsache, daß die Studentengerichtsbarkeit oft zu einer Parodie eines Standgerichts ausartete, teils aus Unerfahrenheit, teils wegen der von zu Hause mitgebrachten Vorurteile. Ich wandte mich an die Kollegenschaft. Was sollte ich machen? Einer von ihnen, Wiener Jude, Großordinarius und bekannter Wissenschaftler, fragte aufreizend kalt, warum denn das gerade mir passiere und nicht ihm. Die Frage war keiner Antwort würdig. Ist doch klar, ich war im KZ, daran wollen diese Scheißrassisten nicht erinnert werden. Und du selber, dachte ich, würdest gerne einem solchen Country Club angehören, Streber, der du bist. Anderswo macht die Integration Fortschritte, hier läuft sie in ein Hindernis nach dem anderen. Da sind Juden aus Europa unerwünscht, sie erinnern die Leute daran, was passieren kann, wenn sie so weitermachen. Die anderen Kollegen taten, als ob ich meine schmutzige Wäsche vor ihnen ausbreitete. Dahinter lauerte immer der Vorwurf: Warum hast du eine sichtbare Nummer? Warum? Weil ich im KZ war, ihr Idioten. Und trotzdem fragte mich einer eines Abends, als man kollegial zusammensaß, voller Erstaunen: »Was, du hast einmal den Judenstern getragen?« Ja, ich bin doch aus Wien, das weißt du doch, aus dem Wien, das der Hitler angeschlossen hat. Und denk mir: Und du willst Germanist sein?
Das alles hatte ich der Nummer zu verdanken und der Entfremdung, für die sie symbolisch geworden war oder die sie verursachte. Ich hatte mich für die Arbeit der anderen Kollegen interessiert, denn ich wollte mit ihnen ins Gespräch kommen, über unser Fach und über das, was im Land und in der Welt vor sich ging. Gerade der alte Herr aus Wien überhäufte mich mit seinen Schriften und verlangte Stellungnahmen, lud mich wiederholt zu seinen Vorlesungen ein und gab sich indigniert, wenn ich nach Semestermitte keine Zeit mehr dafür fand. Aber es beruhte nicht auf Gegenseitigkeit. Einmal, als ich ihm am Telefon etwas über meine Arbeit an Kleist erzählen wollte, unterbrach er mich und sagte, er wolle jetzt fernsehen, »Kojak«, eine populäre Krimiserie, deren Protagonist statt einer Zigarette immer einen Lutscher im Mund hatte. Ein deutlicheres Signal gab es nicht. Es zeigte mir, daß meine Arbeit nur Hilfsarbeit war; eine Frau, die den Herrschaften aushilft.
An unserem Campus fand einmal eine überregionale Tagung zu Geschichte und Literatur des 18.Jahrhunderts statt. Ich hielt einen Vortrag — keiner der Kollegen war unter den Zuhörern. Das ist eine Verletzung zumindest der Etikette unter Wissenschaftlern. Wenn man keinen stichhaltigen Grund hat, wegzubleiben, so setzt man sich dazu, wenn der Kollege öffentlich spricht.
Als ich während meines Referats keines der bekannten Gesichter im Publikum sah, wurde mir klar, daß ich hier nicht länger bleiben sollte, daß das Leben von allen Seiten her auf mich einzudringen schien und nicht zu bewältigen war. Die Gründe waren vielfältig, sie waren politisch und persönlich, und ich war einsam und fühlte mich wehrlos. Die Kinder waren damals schon fast erwachsen und lebten nicht mehr bei mir. Meine beste Freundin war meine kleine Katze Golda (Golda Miau), die ich eigentlich gar nicht in der Mietwohnung haben durfte. Ich pflegte zu sagen: Kinder sind ein Ersatz für Katzen. Wenn sie erwachsen sind, kehrt man zu seiner ersten Liebe zurück. Aber dieser Witz war nur eine Bestätigung meiner Einsamkeit. Aufgrund der gehässigen Post und der Ablehnung vom German Department stellten sich meine üblichen Symptome ein: abnormale Vergeßlichkeit, Ungeschicklichkeit, alles fiel mir aus den Händen, einmal bin ich sogar auf der falschen Straßenseite Auto gefahren und war dem Polizisten, der mich anhielt, so dankbar, daß er mich ohne Strafzettel weiterfahren ließ. Am Ende hatte ich Wahnvorstellungen: Auf dem Weg nach Hause dachte ich mir, jemand habe Golda gekreuzigt, ganz deutlich stellte ich mir das vor, mit den schwarzweißen Markierungen, die sie so hübsch machten, scharf vorm inneren Auge. Und dachte ganz irrational: Zumindest sind die Kinder in Sicherheit. Dann kam ein Ruf aus Kalifornien, und ich übersiedelte, was mir obendrein noch zwei Zeilen in Time einbrachte. Damit ging mein älterer Sohn Percy, Student an der Yale University, bei seinen Kommilitonen stolz hausieren: meine Mutter und die Bürgerrechte.
Doch als Provokation hatte ich die Nummer auf meinem Arm nie verstanden, auch nicht als Entblößung. Erst als ich sie nicht mehr hatte, fiel mir auf, wie sehr sie beides gewesen war. Eine Selbstverständlichkeit, wie alles am eigenen Körper, auch die Narben oder etwas Mißgestaltetes. Doch für andere ein Anstoß, etwas Anstößiges, das man dem, der’s hat, übelnimmt. Und die Kehrseite ist die Entblößung. Eigentlich sollte es nur die Entblößung der Naziverbrechen sein. Aber es funktioniert eben anders. Weil es am Körper ist. Ein bekannter amerikanischer Kritiker, Alfred Kazin, packte mich am Arm, sah sich die Nummer an wie andere Herren, vor allem Osteuropäer, deine Hand packen, um einen, auch nicht immer erwünschten, Handkuß darauf zu plazieren. Er meinte es gut, er beschwor mich, nur ja die Dissertation fertigzuschreiben, die »union card«, Eintrittskarte in die Gewerkschaft der Fakultät, und gleichzeitig nahm er sich eine, zwar nicht erotische, aber doch intime Vereinnahmung heraus. Meinte er ein Recht auf diese Überschreitung der privaten Grenzen zu haben, weil die Nummer ein Zeichen der Scham ist oder ein Grund für Stolz, auf jeden Fall die Trägerin zu einem öffentlichen Symbol macht? Oder weil wir beide Juden sind? Schäm dich. Oder das Gegenteil: Du brauchst dich nicht zu schämen. Gegenteil? Es kommt aufs selbe heraus. Bei einer Tagung des Internationalen Germanistenverbands hat ein Amateurphotograph mehrere Bilder von mir gemacht und mir dann einige geschickt. Einige, nicht alle. Auf einem stand ich mit verschränkten Armen, die Nummer direkt ins Gesicht des Beschauers. Eine Freundin war auch auf dem Bild, der hat er’s geschickt, die hat’s mir dann gezeigt. Ja, es war etwas Schockierendes dran, das sah ich plötzlich ein, aber als er den Schnappschuß machte, war ich mir dessen nicht bewußt gewesen, ich hab nicht darauf hinweisen wollen.
Der Anekdoten gibt es viele, sie häufen sich, sie widersprechen sich. Die Bekannte, die plötzlich über meine Armbanduhr zu faseln anfängt, ob das eine Herrenuhr sei, so groß, gar nicht schlecht. Eine Damenuhr wäre aber noch hübscher. In Wirklichkeit kaschiert sie ihr fasziniertes Starren auf die Tätowierung. An der US-kanadischen Grenze, wo man bis September 2001 ohne Paß, einfach mit einer Identifikation wie dem Führerschein, hin und her reisen konnte, wurde ein Beamter auf der amerikanischen Seite mißtrauisch, als er die Nummer sah, und hätte mich fast nicht nach Hause gelassen. Diesmal galt das Mißtrauen aber nicht dem Opfer, sondern eher einer Frau, die eines Verbrechens verdächtigt wurde, wofür sie wohl gebrandmarkt worden war.
Mit diesen und ähnlichen Erfahrungen war ich alt geworden und meinte, ich hätte sie im Griff, mir könne nichts mehr passieren in Sachen Voyeurismus, Ressentiments. Aber dann habe ich das Buch über meine Kindheit geschrieben, noch dazu auf deutsch, und da wollten die Leute die Nummer sehen, weil sie darüber gelesen hatten, sie besichtigen, bestaunen. Hat’s weh getan? Diese Frage, so direkt sie scheint, ist merkwürdig irrelevant, denn sie lenkt ab vom eigentlichen Sinn einer solchen Markierung, nämlich der herdenmäßigen Herabsetzung des Menschen. Oftmals, als ich in Österreich oder in Deutschland aus »weiter leben« las, stand nachher in den Zeitungen etwas über die Nummer, einmal unter dem Titel: »Die Auschwitznummer nicht verdecken.« (Das ist ein Zitat aus »weiter leben«. Aber aus dem Zusammenhang gerissen.)
Das reichte mir. Nicht länger wollte ich wie die Opfer in Kafkas »Strafkolonie« das ungerechte, das absolute, das unverständliche und der Vernunft nicht zugängliche Gesetz eingeritzt im Körper haben. Die Nummer hat immer nur mit mir und den Ermordeten zu tun gehabt, und ich wünschte mir ein paar Jahre mit kurzen Ärmeln in der Sonne.
So kam es zum Abschied vom Bruder, der sich langsam auflöste, um eins zu werden mit den meisten Toten, die einmal die Erde bewohnt haben und an die sich niemand mehr erinnert, weil sie nichts zurückließen als die flüchtige Spur im Gedächtnis des einen oder anderen Lebenden. Die Nummer war das sichtbare Zeichen für eine solche Spur gewesen. Je langsamer eine alte Frau auf der Straße geht, desto schneller entfernt sie sich von den rückwärts laufenden Gestorbenen. Erst hielt der Schorschi nicht mehr Schritt mit mir, konnte nicht mehr neben mir herlaufen, dann verschwammen sein Gesicht und seine Gestalt, und nun kann ich ihn kaum noch von den anderen unterscheiden. Bald erkenne ich ihn nicht mehr.
2. Das Ende einer Mutter
In Los Angeles muß der einfache, ungeschmückte Holzsarg, den die jüdische Sitte vorschreibt, in ein Zementgehäuse eingebettet werden, bevor er in die Erde versenkt werden darf. Hygienemaßnahmen einer Behörde, die meint, die Toten verseuchten die Erde. Tote Menschen nämlich; tote Tiere werden nicht in Zement verpackt. Vielleicht verseuchen die Toten tatsächlich die Erde, aber falls sie’s tun, so wird sie kein Lebender daran hindern.
Meine Mutter sah klein und verschrumpelt aus in den Stunden, als ich neben ihr saß, nachdem sie gestorben war, nicht eigentlich friedlich, eher erschöpft. Das Leben war in diesen letzten Tagen aus ihr herausgetröpfelt, und sie wollte nur ihre Ruhe haben. Im nachhinein tat mir’s leid, daß ich sie fortwährend zu überreden suchte, sich aufzusetzen und Orangensaft zu trinken oder an den Tisch zu kommen zu einer Tasse Kaffee Hag und einem Stück Toast. Sekkiert hab ich sie, wie man in Wien sagt. Sie hatte schlicht keine Lust zu solchen Lustbarkeiten. Es schien, als wollte sie uns zu verstehen geben: Ich habe euch alle fast hundert Jahre lang ertragen, und jetzt möchte ich bitte keine Gesellschaft mehr. Man kann’s einen guten Tod nennen, denn sie starb zu Hause, in ihrem eigenen Bett, immer noch bewegungsfähig, und sie hatte sich sogar eine halbe Stunde vor ihrem Tod auf die Toilette geschleppt, und das können Sterbende nur selten, sagte mir die Pflegerin, die bei ihr war. Aber ich meine, sowas wie einen guten Tod, das gibt’s vielleicht gar nicht, denn ihr Körper verweigerte oft den Gehorsam, ihr Geist war anderswo oder nirgendwo, und sie war einem Unbehagen ausgesetzt, in das ich mich gar nicht versetzen und über das ich nur rätseln kann. Nicht gerade Schmerzen, aber vielleicht sogar ärger als Schmerzen. Wer weiß?
Ihre Denkkraft hatte nach und nach abgenommen, hatte sie sozusagen im Stich gelassen, so wie die Sehkraft, das Gleichgewicht und die Fähigkeit, sich zu orientieren. Ihr Bewußtsein war zur schmalen Flamme geworden, jetzt ein helles Licht, dann wieder flackernd, dann trüb. Ich begann zu ahnen, daß das Sterben kein plötzlich einschlagender Blitz ist, sondern eine ausgedehnte Geschichte, sogar wenn es kein scharfes Leiden oder langes Koma zu ertragen gibt. Das was in dir »Ich« sagt, stiehlt sich allmählich fort. An dem Nachmittag, als sie zu atmen aufhörte, war sie nur ein wenig mehr tot als zu Mittag, als ich sie zuletzt sah. Und wochenlang war ihre Seele, wenn Seele das richtige Wort ist, in ihrem verfallenen Körper ein und aus gegangen, so daß sie stolperte und Fehler machte, richtig reagierte und gleich darauf auf Falschmeldungen hereinfiel, sich zu uns und dann gleich wieder von uns abwandte.
Als die Männer kamen, um sie aus ihrem Haus zu tragen und ich die kleine Leiche zum letzten Mal sah (denn bei der Beerdigung war der Sarg, wie die Sitte es will, versiegelt), überkam mich ein trauriges Triumphgefühl, wenn der Widerspruch erlaubt ist, denn ein menschlicher Tod war’s schon gewesen, da sie ja die bösen Zeiten überlebt hatte und ihrem eigenen Kalender entsprechend gestorben war, fast ein Jahrhundert nach ihrer Geburt. Und dann hatte ich doch wieder das Gefühl, sie sei wie eine alte Katze gestorben. Alte Katzen liegen am Lebensende einfach herum, schlafen fast durchgehend, schleichen gelegentlich zu ihrem Wasser und fressen wenig, aber sind immer noch sauber und verwechseln ihr Lager nicht mit der Sandkiste. Ansonsten sind sie fast blind, sehr lieb und leiden an aller Art tierischer Gebrechen. Sowohl meine Mutter als auch ich hatten solche Katzen gehabt und gehütet.
Sie hatte fast fünfzig Jahre in Kalifornien gelebt. Vorher war New York, wo sie nach einem Selbstmordversuch in einer psychiatrischen Anstalt Elektroschockbehandlungen erdulden mußte. »Es war die Hölle«, sagte sie. Und sie war damals, meines Erachtens, nicht verrückter gewesen als in den vorhergehenden Jahren. Dank ihrer Verfolgungsphantasien, die sich im KZ