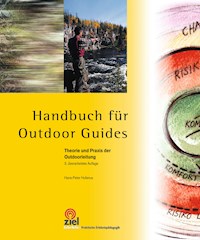Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AT Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Die "Cooking Hypothesis" beinhaltet, dass die Menschheit das Feuer schon viel länger kannte, als archäologische Funde nahelegen. Mehr noch, sie geht davon aus, dass wir unser Menschsein allein der Kochkunst zuzuschreiben haben. Damit reiht sich diese wissenschaftliche Perspektive in jene wachsenden Forschungserkenntnisse ein, die uns beweisen, dass unsere Urahnen nicht jene knüppelschwingenden Rohlinge waren, wie sie die klassische Geschichtsschreibung bis anhin gerne zeichnete. Im Gegenteil, unsere Urahnen waren soziale und kooperative Wesen, lebten in egalitären Gesellschaften, waren gesünder als wir und mussten bedeutend weniger arbeiten. Hans-Peter Hufenus führt die Leserin, den Leser auf eine Reise durch die Menschheitsgeschichte, wie sie aufgrund der neuen Erkenntnisse geschrieben werden muss. Mythologische Geschichten, persönliche Erzählungen, Rezepte für archaisches Kochen und Bilder von Zdenӗk Burian ergänzen den Text.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
URMENSCH, FEUER, KOCHEN
INHALT
Vorwort
Kapitel 1FRÜCHTEAlle mögen sie
Kapitel 2BLÄTTERBelebend, heilend, berauschend
Kapitel 3KNOCHENMARKDas Salz der Erde
Kapitel 4TROCKENFLEISCHManna des Himmels
Kapitel 5KNOLLENNahrung aus der Unterwelt
Kapitel 6MUSCHELNDer Schatz am Meeresstrand
Kapitel 7HONIGDie Süße des Lebens
Kapitel 8DRY AGED BEEFEin teures Stück Nahrung
Kapitel 9FISCHReichtum der Gewässer
Kapitel 10BOHNEDie verbotene Frucht im Paradies?
Kapitel 11DAS HUHNZiemlich dumm und ziemlich heilig
Kapitel 12WEIZENSegen oder Fluch?
Kapitel 13KÄSEDie besten stinken am meisten
Kapitel 14DAS LAMMEine gutmütige Nahrungsquelle
Kapitel 15DAS SCHWEINDies arme Tier ist vielen wurst
Kapitel 16MARSHMALLOWSSynthetisch oder natürlich?
Kapitel 17NÜSSEAußen hart und innen weich
Nachwort
Rezeptverzeichnis
Anmerkungen
Bildnachweis
Der Autor
VORWORT
Ein Buch wie dieses zu schreiben, ist eine delikate Angelegenheit, um gleich mit einer kulinarischen Metapher zu beginnen. Im Zusammenhang mit den Themen Urmensch, Feuer und Kochen werden nämlich auch Aspekte zur Sprache kommen, die einen schnell in Teufels Küche bringen könnten, etwa das ungebremste Wachstum der Menschheit in einer endlichen Welt. Die kulinarische Metapher kann hier etwas abdämpfen, weil das Sprechen über Nahrung völkerübergreifend und instinktiv verständlich ist. Konstruktiv-kritische Botschaften, vor allem wenn sie ethisch-moralische oder Glaubensfragen berühren, werden leichter verdaulich und sind – weil Liebe durch den Magen geht – in einer grundsätzlichen Menschenliebe aufgehoben, die ich in meinem Fall als »Menschheitsliebe« bezeichnen möchte.
Es sollte ursprünglich ein Kochbuch werden, ich koche ja so gern draußen am offenen Feuer. So hieß denn der Titel ehedem auch »Das Kochbuch der Menschheit«. Aber ein »klassisches Kochbuch« wäre dann vielleicht doch nicht das Richtige gewesen, sondern eher ein Lesebuch. Weil aber die einzelnen Kapitel mit dem Fokus auf je einem Nahrungsmittel bleiben sollten, fand jeweils doch ein archaisches Rezept seinen Weg auf diese Seiten.
Nach den ersten dreißig Seiten lief das Schreiben zu meiner Überraschung wie von selbst. Es wurde zu einer Art »Dreaming«, jenem »Traumzeit«-Prozess, den die australischen Aborigines als magisches Muster leben und worin sich die Schöpfung als Wirklichkeit fortlaufend entwickelt: Mein Denken gestaltete sich nichtlinear, und meine Finger schrieben eine »Songline«, einen »Traumpfad«.
Neben dem Menschheitsgeschichtlichen, mit dem ich mich nun schon seit Jahren befasse, bot mir das die Gelegenheit, auch Biografisches einzufügen, Ereignisse und Erfahrungen, die Urgeschichtliches mit Erlebtem verflechten. Dazu gesellte sich noch die Idee, hin und wieder einen afrikanischen Göttermythos zu erzählen und den Kapiteln eine afrikanisch-mythische Huldigung oder Anrufung der Götter voranzustellen. Afrika wird meist vergessen, wenn es darum geht, vergleichende Geschichten und Philosophien anderer Kulturen beizuziehen, jene der alten Griechen, der chinesischen Philosophen, der Indigenen Amerikas. Dabei sind wir Menschen doch alle Afrikaner. Diesem Umstand ist das Buch vor allem gewidmet.
Ich bin kein Wissenschaftler, sondern – ähnlich wie die Urmenschen – Outdoorkoch, Naturtherapeut, Tiefenmythologe und Musiker. Natürlich war ich aber stets darum bemüht, alle Fakten fachlich sauber zu recherchieren. Dabei habe ich sehr viel gelernt und bin sehr dankbar für diese geistige Nahrung, auch wenn sie mir manchmal ein wenig den Appetit verschlug. Weil ich die vielen Forscherinnen und Forscher wertschätzend als Mitwirkende betrachte, sind sie, wie es in Anmerkungen üblich ist, ähnlich einem Abspann im Kinofilm »in order of appearance« am Ende des Buches aufgeführt, also der Reihe nach, wie sie bei der Lektüre auftreten.
Dankbar bin ich auch all jenen Menschen, die mich in diesem Anliegen unterstützten. Allen voran meiner Partnerin Astrid Habiba Kreszmeier für die vielen Stunden des Austauschs, für das konstruktiv-kritische Lesen des Manuskripts und vor allem auch für die Beratung und Erzählung der Orixá-Mythen in ihrer Kompetenz als Mãe de Santo (eingeweihte Priesterin afroamerikanischer Traditionen). Mein Dank geht auch an Juliette Chrétien; als Fotografin und Verfasserin von Kochbüchern hat sie mich sehr unterstützt in der Startphase des Projekts. Danke auch an Friederike Lenart für die fachliche Prüfung meiner Texte und die wertvollen Rückmeldungen. Nicht zuletzt geht ein großer Dank an all die unsichtbaren Kräfte, die mir immer wieder gute Inspirationen zukommen ließen.
1
FRÜCHTE – ALLE MÖGEN SIE
» Euá – Wasserwesen der vielen Gesichter! Mal zeigst du dich als Fluss, bald als klarer Regen, oft als Nebel, oft bist du einfach unsichtbar. Mit dir will ich ständig wandelnd leben lernen.«
Es ist still im Urwald. Lautlos schleicht der Jaguar, und lautlos flattern die Riesenschmetterlinge. Nur hier und da ein Blatt oder eine reife Frucht, die zu Boden fällt. Aber dann wird ein dumpfes Grollen wahrnehmbar, das sich erst wie ein Vibrieren tief im Erdinnern anfühlt, dem sich einige Minuten später ein unheimliches Rauschen hinzugesellt. Es sind die Wasser des Iguazú-Flusses, die sich über eine Höhe von mehr als siebzig Metern und über eine Fallkante von fast drei Kilometern tosend in die Tiefe stürzen. Die aufsteigenden Nebel des stiebenden Wassers sind nur vom Flugzeug aus sichtbar oder von der Brücke, die ein paar Kilometer unterhalb der Fälle Argentinien mit Brasilien verbindet.
Über diese Brücke betrat ich zum ersten Mal in meinem Leben brasilianischen Boden. Es war frühmorgens, und ich hatte die Idee, auf der brasilianischen Seite zu frühstücken. Ich erwartete nichts Besonderes – in Argentinien bekam man zum Kaffee ein Brötchen oder ein Croissant; das halbe Kilo Bife de chorizo und der halbe Liter Malbec des späten Dinners hatten einen ja nachhaltig genährt. So war ich denn doch ziemlich überrascht, auf der anderen Seite des Flusses das reichhaltigste Frühstücksbuffet anzutreffen, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Neben allen agrarischen Produkten ein farbenfrohes und duftendes Festgelage tropischer Früchte. Urfrüchte in einer Urlandschaft eines paradiesischen Planeten.
Dieser Planet entstand vor circa fünf Milliarden Jahren. Es dauerte dann noch weitere zwei Milliarden bis zur Entstehung von Essbarem. Die Erde war damals mit Wasser bedeckt, aus dem nur einzelne rauchende Vulkaninseln ragten. In einem feuchten und kühlen Klima entstanden erste Urtierchen, Einzeller und Algen. Vor 500 Millionen Jahren begann dann die Trennung von Wasser und Land mit einem eher warmen und trockenen Klima, erste fischförmige Wirbeltiere tauchten auf, dann Fische, Muscheln, Krebse und Landpflanzen sowie Amphibien und Insekten. Vor 300 Millionen Jahren bevölkerten Raubechsen die Erde, vor rund 250 Millionen Jahren folgten die Dinosaurier, von denen einige zu Vegetariern mutierten. Es gab auch erste Säugetiere. Dann begann der Urkontinent auseinanderzudriften.
Unsere ältesten Urahnen, die Australopithecinen, belebten während fünf Millionen Jahren den afrikanischen Kontinent. Sie zogen in Gruppen umher und ernährten sich vorwiegend von Früchten, Nüssen und Kleinsttieren.
Beim Einschlag des Chicxulub-Meteoriten vor 66 Millionen Jahren starben alle Dinosaurier mit Ausnahme der Flugsaurier aus. Der Einschlag verursachte einen riesigen Tsunami, der mehrmals um die gesamte Erde ging. Überlebt haben die Sintflut nur jene Lebewesen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Wasser, in der Luft, auf Bergen oder im Erdinnern befanden. Wir sind aber nicht die Nachkommen von Noah, sondern einer Erdbewohnerin namens Eomaia (»kletternde frühe Mutter«), einer spitzmausartigen, behaarten Insektenfresserin.
Aus dieser Linie entstanden vor sechzig Millionen Jahren die Primaten, und in dieser Abstammungslinie kam vor vier Millionen Jahren mit den Australopithecinen die Menschlichkeit in die Welt. Zwei Millionen Jahre lebten diese aufrecht gehenden Wesen im südöstlichen Afrika. Es gab zwei Arten, die »robusten«, die sich überwiegend an hartfaserigen Pflanzen gütlich taten, und die »grazilen«, die Mischkost aßen. Dies waren in erster Linie Früchte, aber auch Nüsse, von denen sie die großen mittels Steinwerkzeugen aufbrechen konnten. Und diese Menschen dürften damals schon Kaviar verspeist und Austern geschlürft haben. Auch ein rohes Frühstücksei des Perlhuhns haben sie wahrscheinlich keineswegs degoutiert.
Diese grazilen Australopithecinen wurden unsere Urahnen. Sie hatten schon einen abwechslungsreichen und reichhaltigen Speiseplan – nur, sie standen auch auf dem Speiseplan anderer Erdenbewohner. Hyänen und Säbelzahnkatzen zum Beispiel sollten dafür sorgen, dass die Bevölkerung der Australopithecinen während zwei Millionen Jahren relativ stabil blieb und noch keine Auswanderungspläne aus Afrika schmiedete. Das wäre vielleicht anders gewesen, hätten sie von den Vorkommen süßester Früchte in Asien und im südlichen Amerika gewusst. Die Früchte vor Ort mussten sie mit ihren nächsten Verwandten, den Schimpansen und Bonobos, teilen.
Aus meiner Kindheit kenne ich noch den Früchtekorb als Geschenk unterm Weihnachtsbaum oder auf Tombola-Tischen. Bananen, Orangen, eine imposante Ananas, gedörrte Feigen und Datteln in exotischer Verpackung, eine haarige Kokosnuss und Kakis, bei denen auch die Schale essbar war. Kiwis, Papayas oder Mangos waren damals noch nicht darunter. Die Früchte hießen Südfrüchte, was für mich hieß, dass sie aus Afrika kamen. Dabei hat nur eine der Früchte, die wir heute im Supermarkt finden, ihren Ursprung in Afrika: die Wassermelone. Banane, Kiwi, Litschi, Mango, Orange, Granatapfel und Kiwi haben ihre Heimat in Asien, während Avocado, Kaktusfeige, Papaya, Ananas, Cherimoya aus Südamerika stammen.
So wenig, wie die Schimpansen des paläolithischen Afrika die Banane kannten, ahnten auch unsere Urahnen noch nichts von der Früchtevielfalt unseres Planeten. Umso erstaunlicher, dass für die späteren Auswanderer auch das Obst und Gemüse außerhalb Afrikas essbar waren, so ist es in unseren Genen festgelegt: Wir alle mögen süße, wohlriechende Früchte – aber nicht nur wir, sondern auch die meisten Tiere, und zwar von der winzigen Fruchtfliege bis zum Elefanten.
Und auch die Wesen der unsichtbaren Welt, Götter- und Göttinnen genannt, scheinen Früchte zu mögen, selbst im Alpenraum. Als ich einmal durch die Wälder des Südtessins streifte, stieß ich mitten im Dickicht an einem Bächlein auf eine Schale mit frischen Früchten. Das war für mich sehr rätselhaft. Sie muss von Menschenhand bewusst dorthin gestellt worden sein. Aber für wen? Was ich schon des Öfteren im Alpenraum gesehen habe, sind Statuen der heiligen Maria mit frischen Blumen, manchmal sogar brennenden Kerzen. Es muss sich dabei um eine unbewusste, aber gespürte Erinnerung an die Ansprechbarkeit und segnende Wirkkraft von Wassergottheiten handeln. Hier aber war es lediglich eine Fruchtschale ohne Figur und ohne Kerzen.
Früchte als Gaben für Göttinnen, Geister, Naturkräfte oder Heilige kommen in allen paläolithischen Ritualen vor und sind selbst in vielen heutigen Weltreligionen noch erhalten. So finden sich Früchte nicht nur auf christlichen Altären (zum Erntedankfest), sondern auch auf hinduistischen und buddhistischen. Nur bei den ursprünglichen Wüstenreligionen, die in Gebieten entstanden, wo Früchte lediglich in bewässerten Gärten gedeihen, findet man mehrheitlich tierische Opfergaben. Bei den afroamerikanischen Orixá-Traditionen, wo jeder Orixá seine eigene Auswahl an Speisen bekommt, finden sich in den meisten Gaben, den sogenannten Oferendas oder Ebós, Früchte. Bei Euá ist es die Banane.
Als die Götter und Göttinnen eines Tages fanden, dass sie ihren Speiseplan gern durch gekochte Speisen erweitern würden, brachten sie den Menschen das Feuer, und ab da schrieb sich die Urgeschichte der Menschheit als eine Geschichte der Feuernutzung und eine Geschichte des Kochens. Eine Geschichte, die – von einer breiten Öffentlichkeit kaum bemerkt – im Augenblick gerade neu geschrieben wird. Die neuen Möglichkeiten der Isotopen- und Genforschung haben archäologischen Funden teilweise so fundamental andere Bedeutungen gegeben, dass Archäologen von einer Revolution sprechen.
Das Bild eines keulenschwingenden Urahns, der nur dumpfe Laute von sich geben konnte, sich von Aas und Beeren ernährte und sich mit seinen Artgenossen in einem stetigen Wettkampf um Ressourcen befand, gehört nun in die Mottenkiste der Geschichte. Die Menschen der Urzeit waren gesünder, friedliebender und mussten für ihr Überleben um einiges weniger arbeiten als der heutige Homo sapiens, zumindest bis zum Zeitpunkt der Vertreibung aus dem Paradies. Und was am meisten überrascht: Die Sozialstruktur der Menschen in der voragrarischen Zeit war egalitär.
Und wieso wissen wir das heute? Die Genforschung kann uns berichten, wann und wie die ersten Menschen aus Afrika auswanderten und wo wann wie viele lebten. Die Isotopenforschung in der Archäologie kann uns zeigen, was die frühen Menschen aßen. Die Primatenforschung kann uns erklären, unter welchen Bedingungen sich bei Hominiden bestimmte Sozialstrukturen herausbildeten. Die moderne Hirnforschung beweist, dass das menschliche Gehirn genetisch auf Kooperation ausgelegt ist. Die Ethnologie zeigt uns das Volk der San, die älteste lebende Homo-sapiens-Gruppe, die im südlichen Afrika noch als Sammler und Jäger leben.
Eine interessante ethnologische Studie von Polly W. Wiessner über die San trägt den Titel »Embers of society: Firelight talk among the Ju/’hoansi Bushmen« (etwa: »Glut der Gesellschaft, Gespräche am Lagerfeuer der Ju/’hoansi-Buschmänner«).1 Aus diesen Aufzeichnungen der Gespräche am Lagerfeuer geht deutlich hervor, wie wichtig es den San-Völkern ist, einander gleichermaßen glücklich zu sehen. Will sich einer besonders hervortun, wird er – meist humorvoll, manchmal auch streng – zurückgestutzt. Wer das Sagen hat, ist nicht ein Boss, sondern das Feuer: »Our old people long ago had a government, and it was an ember from the fire where we last lived which we used to light the fire at the new place we were going.« (Etwa: »Unsere alten Leute hatten vor langer Zeit eine Regierung, und es war die Glut des Feuers vom Ort, an dem wir zuletzt gelebt hatten, mit dem wir das Feuer an dem neuen Ort anzündeten, an den wir gingen.«)
Wenn dieser San-Älteste davon spricht, dass die Glut ihre Regierung war, redet er schon von einer Vergangenheit, denn auch diese Lebensweise ist heute bedroht, weil die verbliebenen Wildnisräume durch Rohstoff- und Tourismuserschließung immer weiter eingeschränkt werden. Der San spricht von einer Vergangenheit, die 300 000 Jahre alt ist. 300 000 Jahre egalitäre Gesellschaftsform, friedliebende und frohe Charaktere, freundliche Nachbarschaftsverhältnisse, das muss sich in den Genen des Sapiens doch niedergeschlagen haben!
Aber wie konnte es dann kommen, dass wir heute in einer durch und durch patriarchalen Weltengemeinschaft leben, in der Missgunst, Neid und Fremdenfeindlichkeit die Oberhand zu haben scheinen und fast jeder nur an seiner Selbstoptimierung arbeitet? Weil das eben auch in unseren Genen steckt, nur in den noch älteren.
Die Primatenforschung präsentiert uns hierzu delikate Forschungsergebnisse durch den Vergleich der sozialen Organisierung bei den beiden uns genetisch ähnlichsten Lebewesen, den Schimpansen und den Bonobos. Die Schimpansen leben nördlich des Flusses Kongo, die Bonobos südlich. Bei den Schimpansen steht an der Spitze ein Mann, der über einen absoluten Machtanspruch verfügt. Es herrscht eine bedingungslose Dominanz über die Weibchen, die mit Brutalität durchgesetzt wird. Angriffe auf gruppenfremde Artgenossen sind üblich, und bei der Nahrungsverteilung herrscht Futterneid.
Die Bonobos sind das genaue Gegenteil. Hier führt ein Weibchen. Gegenüber benachbarten Gruppen wird Kontakt und Kommunikation gepflegt. Konflikte werden über Sex – also auf friedlichem Weg – gelöst. Beute wird gerecht untereinander verteilt. Aber was macht denn diesen Unterschied aus, bei genetisch fast gleichen Wesen, die im selben geografischen Raum, nur durch einen Fluss getrennt, leben? Es sind die Nahrungsressourcen: Südlich des Kongos gibt es für die Bonobos Nahrung im Überfluss, nördlich des Kongos herrscht Nahrungsknappheit.2
Vor dem Hintergrund dieses Kriteriums können wir auch die gesellschaftliche Entwicklung des Homo sapiens in seiner 300 000-jährigen Geschichte betrachten. 290 000 Jahre lebten die Menschen in egalitären und friedlichen Gesellschaften, weil Nahrung im Überfluss da war. Vor 12 000 Jahren war dann Schluss. Und zwar deshalb, weil zu dem Zeitpunkt die Besiedlung aller Kontinente abgeschlossen war und der Sapiens sich geografisch nicht mehr so leicht ausbreiten konnte. Weil einfach überall schon Artgenossen da waren, konnte der weiteren Bevölkerungsvermehrung nur durch die Erfindung der Landwirtschaft begegnet werden. Das hieß aber: mehr arbeiten. In der Bibel wird dieser Übergang als die Vertreibung aus dem Paradies bezeichnet, und es heißt dort, dass der Mensch »fortan im Schweiße seines Angesichts« mühsam den Acker bestellen müsse.
Nur war nicht »Sündhaftigkeit«, sondern Überbevölkerung der Grund für den Verlust des Paradieses, wie die Anthropologen Carel van Schaik und Kai Michel in ihrem beeindruckenden Tagebuch der Menschheit einleuchtend darstellen.3 Die Agrarisierung brachte den Menschen einen enormen Zuwachs an Möglichkeiten des Verzehrs von gekochter Nahrung, und es gab Landstriche wie zum Beispiel das vorminoische Kreta, in denen so viel Überfluss herrschte, dass die späteren Geschichtsschreiber von einem Goldenen Zeitalter sprachen. In dieser Zeit war Kreta egalitär organisiert. Erst durch die Ankunft marodierender Räuberbanden vom Festland änderte sich dies. Auch Kreta wurde patriarchal. Wir können also feststellen, dass die Agrarisierung den egalitären Gesellschaften den Garaus machte und sich hierarchische Strukturen etablierten. Und dass, wenn Gesellschaften in den Mangel kommen, sich das Schimpansen-Gen durchsetzt, sprich, das Patriarchat eingeführt wird.
Den Mangel als menschliches Leid kenne ich aus meiner Kindheit. Einmal erreichte uns ein Hilferuf meiner Patin, die mit ihrer Familie als kleine Bergbauernfamilie im Wallis lebte. Sie bat um Hilfe, weil sie kaum mehr was zu essen hatten und kein Geld. Auch wir waren arm, aber wovon wir genug hatten, waren Äpfel. Ich stand dabei, wie meine Mutter einen Karton mit Äpfeln füllte, die dann auf die Post gebracht wurden.
Weil ich als Kind viele Äpfel essen »musste«, mochte ich diese Früchte dann in späteren Jahren nicht mehr so sehr. »Südfrüchte« waren da attraktiver, schon weil es sie damals im Winter nicht gab. Die Äpfel wurden im dunklen Keller gelagert, und da gab es den sogenannten Lederapfel, der den ganzen Winter durch haltbar war und gegen Frühling ganz runzelig wurde. Knackig bis in den Juni blieb der Glockenapfel, wenn er kühl gelagert werden konnte. Und ab Mitte Juli beschenkte uns die Natur schon wieder mit dem frühen Klarapfel. So gab es fast das ganze Jahr durch Äpfel, und von denen, die im Herbst in Hülle und Fülle vorhanden waren, machte die Mutter Apfelmus.
Apfelmus war eine zentrale Beigabe zu diversen Teigwarengerichten wie die berühmten Älplermakkaroni oder das bekannte und beliebte Hörnli mit Gehacktem (Rindfleisch), sozusagen die Schweizer Versionen des »Süßsauer«. Birnen waren im Gegensatz zu Äpfeln nicht so lange haltbar und wurden deshalb auf dem Dachboden gedörrt. Aus ihnen wurde dann im Winter das leckere Birnenbrot gemacht. Zwetschgen, Pflaumen und Kirschen wurden eingemacht oder zu Marmelade verarbeitet. So kam man mit den Früchten des Nordens durch den Winter. Während in den südlicheren Teilen Europas die Kultivierung der Weintraube für fröhliche Runden sorgte, waren es im Norden die am Kaminfeuer gereichten Obstbrandgetränke, die etwas Gemütswärme in die kalten Winterabende zu bringen vermochten.
Unsere Nordfrüchte stammen allesamt von Wildsorten ab und bekamen als gezüchtete und veredelte Kulturpflanzen den Namen »Obst«. So auch der Apfel, der aus einer Kreuzung aus dem asiatischen Wildapfel und dem Kaukasusapfel hervorging und der es in Europa zu einer großen symbolischen Bedeutung gebracht hat. Wir Kinder erfuhren, dass Schneewittchen von der bösen Stiefmutter mit einem vergifteten Apfel getötet wurde. Und man erzählte uns, die verbotene Frucht im Paradies sei ein Apfel gewesen. In den ursprünglichen Texten war aber nicht von einem Apfel die Rede, das wurde erst in der lateinischen Bibel so gedeutet, weil das Wort malum sowohl »Apfel« als auch »das Böse, Schlechte« heißen kann.
Wie wahr die erzählt überlieferte Geschichte vom schweizerischen Nationalhelden Wilhelm Tell ist, kann nicht gesagt werden. In der Legende verweigert es Tell, den auf einer Stange steckenden Hut des habsburgischen Landvogts zu grüßen. Zur Strafe befiehlt ihm dieser, einen Apfel vom Kopf seines Sohnes Walther zu schießen. Tell tut, wie ihm geheißen, steckt aber einen zweiten Pfeil in den Köcher. Als er den Apfel getroffen hat, antwortet er auf die Frage, wozu er den zweiten Pfeil brauche, dass dieser, wenn er sein Kind getroffen hätte, für den Vogt bestimmt gewesen sei. Daraufhin wird er festgenommen und abgeführt, aber es gelingt ihm durch einen Trick, wieder freizukommen, und er lauert dem Landvogt auf, um ihn mit seiner Armbrust zu erschießen.
Dieser Mythos einer heroischen Guerillatat eines einfachen Bergbauern ist Teil der ideologischen Grundlage der schweizerischen Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei, die als »Schweizerische Volkspartei« die Eidgenossenschaft weiterhin von einem als »habsburgisch« wahrgenommenen Europa abschotten möchte. Dabei kamen die Habsburger ursprünglich selbst aus der Schweiz.
Dem Apfel können die heutigen Bauern trotz des Mythos keine besondere Liebe mehr entgegenbringen. In der Landwirtschaft ist diese Frucht nur rentabel, wenn sie in Monokulturen angepflanzt wird. Vielerorts wurden die altehrwürdigen, vereinzelt stehenden Hochstammbäume gefällt, weil sie beim Mähen bloß im Wege stehen. Und bei denen, die überlebt haben, werden die Früchte nicht geerntet. Sie fallen zu Boden und dienen im Winter als Nahrung für Vögel und Rehe, die sie selbst unter dem Schnee noch herausholen.
In meiner Jugend gab es noch eine weitere Apfelgeschichte, die aber im anderen Parteilager beheimatet war. Die Rede ist von jenem giftgrünen »Granny Smith«, den man auf keinen Fall kaufen sollte, weil er aus dem Südafrika der Apartheid kam. Auch Bananen waren wegen ihrer Herkunft aus den Ausbeuterplantagen verpönt. So hatte auch die moderne Zeit ihre verbotenen Paradiesfrüchte.
REZEPT
SCHOKOLADENBANANE
Bananen mitsamt der Schale der Länge nach aufschlitzen und Schokoladenstücke hineindrücken. In die Glut legen, bis die Schokolade geschmolzen ist.
Die Banane liebt die Schokolade heiß. Während sie schon im 6. Jahrhundert v. Chr. von Indien nach Ägypten eingeführt wurde, kam der Kakao, der in Mexiko seine Urheimat hat, erst 1528 nach Europa. Heute ist Lateinamerika für beide Produkte Hauptlieferant.
Bananen werden gern im Schatten der Kakaobäume gepflanzt. Die reifen Kakaofrüchte, aus denen die Schokolade hergestellt ist, werden vom Stamm getrennt, und die Samen und das Fruchtfleisch werden auf Bananenblättern ausgeschüttet und zum Fermentieren mit einer weiteren Schicht Blätter zugedeckt.
2
BLÄTTER – BELEBEND, HEILEND, BERAUSCHEND
»Ossain – du in den Blättern der tiefen Wälder Tanzender. Kundiger der tausend Säfte, ihrer Heilkunst, ihres Zaubers.«
War es der Kasperle, der krank war, oder die Prinzessin? Ich erinnere mich nicht, wer wem die Heilkräuter überreichte und ob die Hexe mit im Spiel war. Aber die Szene zog meine Kinderseele in den Bann. Dabei war es weniger die Inszenierung als vielmehr die Pflanzen. Während die Figuren aus Holz und Stoff waren, hatten die Vorführenden echte Blätter aus dem Garten genommen. Ich sehe sie noch heute deutlich vor mir: ein Bündel echter, saftig grüner Blätter.
Wieso mich diese Szene so berührte, verstand ich nicht gleich. Aber eigenartigerweise sprach ich auch mit niemandem darüber, weder mit den anderen Kindern noch mit meinen Eltern. Und so erfuhr ich natürlich auch nicht, um welche Pflanze es sich handelte: Es könnte Bärlauch gewesen sein oder aber Maiglöckchen oder Herbstzeitlose.
Heute wüsste ich es, und auch wie wichtig es ist, diese drei Pflanzen, die so ähnlich ausschauen, zu unterscheiden, sind doch die letzteren beiden für den Menschen giftig. Das Interesse für Wildpflanzen und ihre Nutzbarkeit wurde erst im Erwachsenenalter in mir geweckt; so kamen die Menschen in meinem Umfeld damals auch nicht auf die Idee, ich könnte Botaniker, Apotheker oder Naturheilarzt werden. Stattdessen sahen sie sich mit einem Kind konfrontiert, das aus unerklärlichen Gründen Straßenkehrer werden wollte. Hat ja, zumindest im Herbst, auch was mit Blättern zu tun …
Die ersten Lebewesen auf unserem Planeten waren die Blaualgen, die noch nicht eigentliche Pflanzen waren, sondern Bakterien mit der Fähigkeit, mittels Fotosynthese Sauerstoff aus dem Wasser freizusetzen. Damit wurde der Weg frei für eine der großen Kooperationen des Lebens auf der Erde, nämlich die zwischen jenen, die Sauerstoff einatmen, und jenen, die ihn abgeben. Deshalb sind die Blätter unserer Wälder für die Menschen lebensnotwendig, auch wenn sie nicht als Nahrungsmittel dienen wie bei ihren nächsten Verwandten, den Schimpansen und den Bonobos, deren Speiseplan in den sieben Millionen Jahren der Menschheitsgeschichte unverändert blieb: zu 60 Prozent Früchte und zu 20 Prozent Blätter. Den Rest lieferten Samen, Insekten und Fleisch. Somit teilten sich diese Rohköstler mit den Australopithecinen das Nahrungsvorkommen.
Der Regenbogen zeigt, dass hier gerade ein Gewitter vorbeigezogen ist. Ein Blitz hat einen Baum entzündet. Die Menschen (Erectus) schauen, wohin das Feuer ziehen wird, und werden dann mit ihren Stöcken in der Glut nach gekochter Nahrung suchen.
Das ging fünf Millionen Jahre lang gut, bis ein Klimawandel dem Australopithecus zu schaffen machte. Ein Zweig, den man als den robusten bezeichnet, änderte sein Menü und unterlag schlussendlich seinen tierischen Nahrungskonkurrenten. Überlebt hat wie gesagt der grazile Zweig. Dieser wendete sich vom Blätterkonsum ab und setzte auf das Konzept »Kopf statt Darm«. Wie wir bei den pflanzenfressenden
Tieren beobachten können, verbringen diese den ganzen Tag mit Fressen und Wiederkäuen, während fleischfressende die meiste Zeit auf der faulen Haut liegen.
Die Australopithecinen waren durch ihre Entwicklung für den Verzehr von rohem Fleisch nicht mehr ausgerüstet, weil ihnen der aufrechte Gang und ein Rückgang der Körperbehaarung den Zugang zu gekochter Nahrung öffnete, die sie in der Glut vorbeigezogener Wald- oder Buschbrände fanden. Dazu diente ihnen ein neues Werkzeug, das sich zum Faustkeil dazugesellte, der Grabstock.
Die Erweiterung der Speisekarte durch gekochte Nahrung machte es den Menschen möglich, auch Speisen zu essen, die roh ungenießbar oder gar giftig wären und an deren Genuss ihr Instinkt sie hinderte. Deshalb wurde dieser nach und nach ersetzt durch die Weitergabe von Wissen über Essbarkeit durch Kochen. Leben hieß jetzt Lernen und Weitergeben in der Community. Nicht dass die Menschen den Instinkt verloren hätten, aber er trat etwas zurück zugunsten eines wachsenden Gehirns, das sich erinnern und mit anderen kommunizieren konnte.
Was die Blätter anbelangt, deren wohltuende Wirkung den frühen Menschen nicht verborgen blieb, vollzog sich dann ein Wandel vom Blatt als Nahrungsmittel zum Blatt als Medizin; die Menschen wurden zu Naturheilkundigen. Eine Spezialisierung von Einzelnen, die einen besonderen Zugang zu den Heilkräften der Pflanzen hätten, gab es noch nicht. Alle zeichnete das mehr oder weniger gleiche Wissen aus, und alle waren bestrebt, gesund zu bleiben. In der eng zusammenbleibenden Horde waren sie sicherer vor den Angriffen der Wildkatzen, bestehen die Jagdmethoden dieser ja gerade darin, schwächelnde Individuen von der Herde zu trennen. Über die genaue Sozialstruktur dieser Urmenschen können wir nur Vermutungen anstellen. Waren sie patriarchal organisiert wie die Schimpansen? Oder matriarchal wie die Bonobos? Oder waren sie, als dritte Option, bereits egalitär wie ihre späteren Artgenossen?
Mit den Kompetenzen von Werkzeuggebrauch, aufrechtem Gang, spärlicher Behaarung, der Ergänzung des Speiseplans mit gekochter Nahrung und einem in der Folge größer werdenden Gehirn entstand vor zwei Millionen Jahren ein neuer Typus: der Homo erectus – ein Wesen, das in einer hochkooperativen egalitären Community lebte und mit einer der Gemeinschaft dienenden Originalität ausgestattet war.
Meine der Gemeinschaft dienliche Originalität machte sich – wie wahrscheinlich bei allen Menschen – schon früh im Leben bemerkbar. Dazu gehörte das Ergriffenheitserlebnis mit den Heilkräutern im Kasperletheater genauso wie das Berührtsein von der Tätigkeit der Straßenkehrer.
Im Alter von sieben Jahren ereilte mich ein weiteres einprägsames Erlebnis. In einem Schulferienlager bauten die Leiter mit uns Kindern im Wald eine Laubhütte, von deren Anblick ich auf unerklärliche Weise zutiefst gepackt wurde. War dies ein Resonanzphänomen, eine Tiefenerinnerung an Initiationshütten in menschlichen Urgesellschaften? Natürlich wusste ich von Initiation damals noch nichts, das würde sich erst im späteren Leben entschlüsseln. Aber deutlich wurde, dass sich in mir durch dieses Erlebnis ein neuer Berufswunsch entwickelte: Ich wollte Menschen in die Natur begleiten, so wie es die Leiter mit uns machten.
Der Wunsch geriet wieder in Vergessenheit, und ich erlernte dann einen gestalterischen Beruf. Fast hätte ich die Laufbahn eines Bühnenbildners eingeschlagen, da warf mich ein schwerer Motorradunfall aus der Bahn. Ein ganzes Jahr ans Krankenhausbett gefesselt, sah ich die Welt nur noch durchs Fenster. Der Blick ging zu einem bewaldeten Hügel in der Ferne, und da, auf einmal, ereilte mich der Ruf der Natur und die Erinnerung an jenen ursprünglichen Berufswunsch aus der Kindheit.
Als ich dann nach der Entlassung aus dem Krankenhaus vor dem städtischen Jugendhaus meiner Heimatstadt eine Gruppe beobachtete, die mit Rucksack und Schlafsack, begleitet von einem Jugendarbeiter, in die Natur aufbrach, war die Entscheidung gefallen, die Ausbildung zum Sozialarbeiter anzutreten. Trotz aller Begeisterung für Gruppendynamik und andere tolle psychologische Themen fehlte mir nach Abschluss der Ausbildung aber die Motivation, eine entsprechende Anstellung zu suchen. Ich machte vorerst etwas anderes, erlernte jedoch fleißig alle natursportlichen Techniken, die damals Mode waren: Klettern, Kanufahren, Skitourenfahren. Und dann, eines Tages, bekam ich unvermittelt, wie ein Geschenk vom Himmel, das Angebot, eine Reisegruppe auf einem Himalaya-Trekking zu begleiten.
So war ich dann 1979 in Nepal unterwegs. Beeindruckt von einer gewaltigen Landschaft – im Vordergrund grüne Reisterrassen, am Horizont riesige Schneeberge –, war der etwas befremdliche Anblick meiner Reisegruppe zweitrangig. Aber es beschäftigte mich, dass die einheimischen Träger das Gepäck der Teilnehmer tragen mussten. Vierzig Kilo auf dem Rücken und keine Schuhe an den Füßen – das war gewöhnungsbedürftig. Es gab neben den Trägern noch das Kochteam und die sogenannten Sherpas, Begleiter, die wenig Gepäck trugen. Ich lernte von den Köchinnen, wie man mit drei Steinen eine Kochstelle baut – eine Tradition, die ich seither tausendfach und bis zum heutigen Tag pflege.
Und ich lernte auch viel über westliche Touristen. Am letzten Abend der Reise sollte es ein kleines Fest mit den Sherpas geben, die dafür speziell einen Kuchen auf dem offenen Feuer gebacken hatten. Meine Teilnehmer wünschten sich, dass die Sherpas ihren Tanz vorführten, den sie manchmal vor dem Schlafengehen vollführten, wenn sie unter sich waren. Das würden sie gern tun, meinten die Sherpas auf meine Anfrage, wenn wir ihnen etwas Geld gäben, damit sie sich im nahen Dorf Marihuana kaufen könnten. Das ging nun für meine Teilnehmer ganz und gar nicht. Drogen – das könnten sie auf keinen Fall gutheißen.
Damit fiel die Tanzperformance für den Abend aus, und ich bekam meine erste Lektion in der Doppelseitigkeit von Blättern. Marihuana ist als Pflanze in Asien beheimatet, schon unterwegs während des Trekkings sah ich wildwachsende Cannabisstauden, von denen die Sherpas pflückten. Marihuana war in Nepal auch ganz legal, bis auf Druck der USA 1973 der Konsum verboten wurde.
Auch in anderen Bereichen lernte ich bei jener ersten Reiseleitung viel über Ambivalenz. Im Anschluss an das Trekking gab es eine Floßtour auf einem Fluss, mein erstes und einziges Rafting-Erlebnis. Der Rafting-Guide, damals noch mit Rudern ausgerüstet, lenkte das Gummiboot zu meinem Erstaunen immer in die größten Wellen. Auf meine Frage, warum er dies tue, meinte er: »Man muss den Leuten schon ein wenig Aufregung bieten.« Und mir wurde klar, dass das nicht die Art sein konnte, mit der ich Gruppen in der Natur begleiten würde. Das Rafting, wie ich es hier kennenlernte, wurde weltweit zum Erlebnishit für Touristen und auch zum sogenannten Teamtraining für »Manager«. Etwas abgewandelt, wurde Teamgeist trainiert in einem schwimmenden Vehikel, in dem das Team kräftig ruderte – aber nur auf Befehl des Bootsführers, der hinten ein Steuerruder bediente. Das Teamtraining war also nichts weiter als die Ausführung von Befehlen, ohne auch nur eine Ahnung von der jeweiligen Situation zu haben.
Auf jener Reise in Nepal hatte ich wieder ein Ergriffenheitserlebnis. Es war Abend, und von unserem Zeltlager aus war in der Ferne ein Feuerchen zu sehen, das vor einem der Lehmhäuser brannte. Warum mich der Anblick so berührte, verstand ich damals nicht, war es doch ein einfaches Bild, dessen Bedeutung ich erst viele Jahre später erkennen würde.
Einige Zeit danach bekam ich die Möglichkeit, an einem indigenen Feuer zu sitzen, denn eine nächste Reise führte mich nach Kolumbien, um eine Trekkingreise in der Sierra Nevada de Santa Marta zu erkunden. Das Feuerchen befand sich in der Mitte der strohbedeckten Steinhütte. Leider war der Rauch so dicht, dass ich niemanden in der Hütte erkennen konnte, ich vernahm lediglich Stimmen. Bis ich mich dann mal etwas zur Seite neigte und feststellte, dass es weiter unten keinen Rauch gab. Und so war der Sachverhalt: Da die Indianer bedeutend kleiner waren als ich, konnten sie sich durchaus gut untereinander sehen …
Am nächsten Morgen gab es gebratene Bananen mit Spiegelei. Wie kunstvoll die Köchin hantierte und in dieser holzarmen Gegend mit drei kleinen Stöckchen ein Kochfeuer unterhielt, das reichte, ein Frühstück für die ganze Familie zuzubereiten.
Die Kinder der Familie tanzten herum und riefen mich: »Me Gusto, Me Gusto.« Ich hatte keine Ahnung, warum sie mich so nannten. Erst als sich im Laufe meines Südamerikaaufenthalts mein Spanisch ein wenig verbesserte, erkannte ich, dass ich hatte sagen wollen, wie sehr es mir gefällt. Aber statt »Me gusta« sagte ich: »Me gusto«, was so viel heißt wie: »Ich gefalle mir.« Das muss für die Kinder sehr amüsant gewesen sein. Überhaupt war ich ein richtiges Greenhorn. Nicht den leisesten Schimmer hatte ich, dass ich in einem der gefährlichsten Drogenanbaugebiete der Welt unterwegs war; und so zog ich mit meinem gebuchten einheimischen Begleiter namens Benvindo weiter durch die Berglandschaft.
Malerisch sahen sie aus, die kleinwüchsigen Indianer dieser Gegend mit ihren langen, schwarzen Haaren und ganz in Weiß gekleidet. Alle trugen sie eine Tasche mit sich, aus der sie von Zeit zu Zeit eine Handvoll Blätter nahmen und in den Mund steckten. Mit einem Stab stocherten sie dann in einer Kalabasse herum und führten ihn schließlich in den Mund.
Mein Begleiter klärte mich auf, dass es sich um Kokablätter handelte und in der Kalabasse sich ein Puder aus Meeresmuscheln befinde, mit dessen Hilfe sich das Kokain aus den zerkauten Blättern herauslösen ließ. Wie schon in Nepal gehörten auch hier die Blätter einer Pflanze, die im Westen als Droge deklariert war, zum Alltag der Einheimischen. Wenn sich zwei Männer treffen, wird eine Handvoll Blätter als Zeichen des gegenseitigen Respekts ausgetauscht. Darüber hinaus wird das Blatt der Kokapflanze aber auch bei Opfergaben und Ritualen eingesetzt. Und auch hier waren es die USA, die diese Substanz kriminalisierten. Coca-Cola hatte ja ursprünglich, wie der Name schon sagt, als Bestandteile Kokablätter und Colanuss. 1914 verbot dann die amerikanische Regierung die Verwendung von Kokain in Getränken. Seither wird der Brause angeblich Koffein anstelle von Koka beigemischt, sie müsste also eigentlich »Coffee-Cola« heißen.
Wade Davis schreibt in seinem Buch The Wayfinders eine wunderschöne Hommage an das Kokablatt.4 Als junger Student durfte er 1974 an einer botanischen Expedition in die Anden teilnehmen, deren Ziel das Studium der Kokapflanze war. Das war zu einer Zeit, als der vorerst medizinische Gebrauch von Kokain in den westlichen Ländern bereits zu einem epidemischen Drogenproblem geworden war. Davis studierte den indigenen Umgang mit der heiligen Pflanze der südamerikanischen Ureinwohner. Er berichtet, wie sich schon die Inkas keinem heiligen Schrein zu nähern wagten, ohne ein Kokablatt im Mund zu haben. Und dass sich der Glaube an einen wechselseitigen Austausch von Energie in der Bevölkerung bis heute erhalten hat.
Die wissenschaftliche Untersuchung der Pflanze zeigt, dass der Anteil des Wirkstoffs Alkaloid lediglich ein Prozent des Trockengewichts ausmacht. Den weitaus größeren Anteil bilden Enzyme, die bei der kartoffelbasierten Ernährung der Andenvölker verdauungsunterstützend waren. Koka war keine Droge, aber eine heilige Speise, die als milder Stimulator ohne jegliche toxische Wirkung oder Abhängigkeit über viertausend Jahre von den Menschen konsumiert wurde.
Heute sind die Kokaplantagen der Einheimischen auf Wunsch westlicher Mächte »illegal«, weil diese sie als Ursache für die Kokaindrogenproblematik ihrer Bürger sehen – oder vielleicht auch einfach weil sie der steuerlichen Erhebung entzogen sind. Immer wenn den Ordnungskräften wieder mal ein Coup gegen Kokainhändler gelungen ist, findet das Ereignis einen großen Widerhall in den Medien. Von der global agierenden Kokainmafia ist die Rede und davon, dass der Markt überschwemmt wird von dieser Droge. Den Grund sieht man im steigenden Angebot, weshalb entsprechende Plantagen von Zeit zu Zeit medienwirksam – meist durch Militäreinheiten – zerstört werden. Das Publikum wird dabei im Glauben gelassen, es handelt sich bei den Konsumenten um Randexistenzen unserer Gesellschaft. Dass die Verfasser der entsprechenden Artikel zu einer der Berufsgruppen gehören, die besonders kokainabhängig ist, davon ist nirgends die Rede. Kokain nehmen nicht nur Partybesucher, sondern auch Banker, Hausfrauen, Bauarbeiter. Man kann es eigentlich nicht fassen, dass da so gut wie nie einer gefasst wird.
Ein neuerer Hit im Blätterwald ist das Ayahuasca. In Brasilien schon länger im Gebrauch, hat der psychedelisch wirkende Tee aus einer Mischung von einer bestimmten Liane und den Blättern eines Kaffeestrauchgewächses mittlerweile selbst die westliche Schickeria erreicht. Da wir in einer Zeit leben, in der eine wertschätzende Haltung gegenüber indigenen Völkern und ihren Bräuchen zur politischen Korrektheit gehört, können die Substanzen-Sittenwächter das Gebräu nicht mehr einfach verbieten wie die USA den Nepalesen den Cannabiskonsum und den Kolumbianern den Kokaanbau. So finden wir in verschiedenen Ländern teilweise originelle juristische Handhabungen des Ayahuasca-Konsums. In Peru gehört Ayahuasca zum nationalen Erbe und ist für Touristen nicht geregelt. In Brasilien soll der Konsum erlaubt, aber der Handel verboten sein. Im Iran ist der Konsum den Schiiten unter Aufsicht von Experten erlaubt. In den USA und in Kanada ist Ayahuasca mit der Begründung der freien Religionsausübung gestattet, während es in Deutschland und der Schweiz verboten ist.
Was den Indigenen der Amazonasregion Ayahuasca, den Bewohnern des südlichen Südamerikas das Mateblatt und den indigenen Völkern des südamerikanischen Hochlands die Kokapflanze ist, war der nordamerikanischen Urbevölkerung das Tabakblatt, eine heilige Pflanze für Ritual und Heilung. Von den Kolonisatoren im 17. Jahrhundert nach Europa eingeführt und vorerst nur als Heilpflanze angebaut, entwickelte sich der Tabakkonsum zu einer Epidemie, die heute jährlich viele Millionen Todesopfer fordert. Doch weil Zigarren und Zigaretten ein Produkt der westlichen Wirtschaft sind, ist weder der Anbau noch der Handel verboten.
Aber warum wird eine Heil- und Ritualpflanze, die Indigene seit Jahrtausenden gebrauchen, auf einmal ein die Gesundheit gefährdendes Suchtmittel? Warum wendet sich beim nichtrituellen Gebrauch das Blatt? Ist der Begriff »Missbrauch«, der ja den Drogenkonsum charakterisiert, auch spirituell zu verstehen?
In den Orixá-Traditionen wird unter anderen die folgende Geschichte über Ossain erzählt.
Nach langer Lehr- und Erfahrungszeit kannte Ossain alle Blätter, Säfte und ihre Heilkräfte. Er begann, Blätter oder Kräuter weiterzugeben, und bat dafür immer um eine kleine Gegenleistung, zum Beispiel ein Essen.
Mit einem dieser Blätter machten die Menschen dann ein Vermögen, und bald vergaßen sie Ossain und letztlich auch das eigentliche Blatt. Ossain wurde zornig und schickte nun auch viele Blätter, die krank machten. Und erst als die Menschen sich daran erinnerten und wieder zu ehren begannen, was zu ehren ist, erst dann konnte Gesundheit einkehren.
So geht es einem mit Ossain.
Es war der 26. April 1986. Ich war mit einer Gruppe in einem Kanukurs am Doubs im Schweizer Jura unterwegs. Als Abendessen war ein Wildkräuterreis geplant. Obwohl es ziemlich heftig regnete, stapften wir im Gelände herum und sammelten essbare Wildpflanzen: Bärlauch, Spitzwegerich, Birkenblätter, Brennnesselblätter, Frauenmantel, Brunnenkresse, junge Löwenzahnblätter, Schafgarbe und Klee. Trotz des miserablen Wetters hatten wir es ziemlich gemütlich am Feuer und unter dem Planendach, auf das der Regen unaufhörlich prasselte.
Erst zu Hause erfuhren wir, dass an jenem Tag der Reaktor von Tschernobyl in die Luft gegangen und der radioaktive Fallout ausgerechnet in jenem Gebiet der Schweiz am stärksten gewesen war, in dem wir uns befanden. Der Name »Tschernobyl« heißt »Beifuß«, eine Pflanze, die in früheren Zeiten zur Sommer- und Wintersonnenwende zwecks Abwehr von bösen Geistern als Räuchermittel genutzt wurde. Sie galt im Mittelalter als wirksames Mittel in der Hexerei und war Bestandteil magischer Rezepturen.
Die Erfahrung mit dem Tschernobyl’schen Hexenkessel brachte mich zur Entscheidung, die Kräuterkunst in meinem Kursangebot nicht mehr zu vermitteln. Den Umgang mit Heilkräutern hatte ich, obwohl lange studiert, schon immer den Profis überlassen. Das ist bei Heilpflanzen auch ratsam, ist es doch bei vielen allein die Dosierung, die zwischen heilsam oder giftig entscheidet.
Die Pharmazie ist eines der ältesten akademischen Lehrfächer. Die Trennung von Schulmedizin und Heilmagie erfolgte aber erst in der Neuzeit. Heute führt die kapitalintensive Pharmaindustrie einen Kampf gegen die Naturheilpraxis der Komplementärmedizin, der wie eine ideologische Neuauflage der mittelalterlichen Hexenverfolgung anmutet. In der Neuen Zürcher Zeitung las ich ein Interview mit dem CEO eines Pharmariesen, der anlässlich eines Afrikaaufenthalts unwidersprochen behaupten konnte, dass es in Afrika keine Heilkräuter mehr gäbe. Dabei ist vielerorts nachzulesen, dass von den circa 6400 im tropischen Afrika vorkommenden Pflanzen etwa 4000 für Heilzwecke verwendet werden. Aber die Pharmaindustrie ist natürlich an der Synthetisierung von natürlichen Heilmitteln interessiert und überzeugt davon, dass diese wirksamer seien als unverarbeitete Substanzen, die sich nicht patentieren lassen. Natürlich lässt sich Aspirin ökonomisch einfacher handhaben als Weiderinde, die eine vergleichbare Wirkkraft hat. Aber bei synthetisierten Heilmitteln müssen wir dafür oft unliebsame Nebenwirkungen in Kauf nehmen.
Ich hatte nur einmal beruflichen Kontakt mit Leuten aus der Pharmaindustrie und will das nicht verallgemeinern, aber was mir da entgegenschlug, war aus meiner Sicht eine Atmosphäre von Gier und Angst. Als ich das einem Freund, einem Organisationsberater, erzählte, bestätigte er mir, dass das auch seine Erfahrung in den Trainings mit Vertretern dieser Sparte sei. Aktuell gibt der Firmenchef eines solchen Konzerns in den Medien bekannt, dass er keine »Kultur der Angst« mehr haben möchte. Da kann man nur anfügen: Wie wäre es darüber hinaus mit einer Dankesgeste an die Kräfte der Blätter, des Zaubers und der Heilkunst?
REZEPT
FEUILLES CROQUANTES
125 g Mehl, 1/4 Liter herbes Bier, 1 Ei, Salz, Muskat, Pflanzenöl. Als Blätter und Blüten verwendet werden können: Bärlauch, Beinwell, Borretsch, Brombeer-, Himbeer- und Erdbeerblätter, Holunderblüten, Huflattich, Lindenblätter, Löwenzahn, Rosenblätter, Salbei, Sauerampfer, aber auch essbare Blumen wie Rosen.
Für den Teig das Mehl mit dem Bier, dem Eigelb und den Gewürzen zu einem dickflüssigen Teig verarbeiten. Das Eiweiß zu Schnee schlagen. 1 Teelöffel Öl unter den Teig rühren und den Eischnee unterheben. Einige Minuten ruhen lassen. Öl in einer Kasserolle erhitzen. Blätter in den Bierteig tauchen, abtropfen lassen und dann im heißen Öl goldgelb ausbacken. Mit Muskat und Salz würzen.
3
KNOCHENMARK – DAS SALZ DER ERDE
»Xangô – du Mächtiger! Feuer bringen deine Blicke. Deinen Tanz in Kraft und Ruhe willkommen heißen schafft Räume weiser Ordnung.«
Schon lange lebten die Menschen zusammen mit den anderen Tieren, den Steinen, den Pflanzen und mit der Erde, die, mal heiß, mal feucht, dann wieder trocken und kalt, vieles für sie bereithielt. Neugierig waren sie und auf ihre Art immer bereit für ein Schwätzchen mit allen rundherum; und doch wussten sie noch nicht, wie ein Feuer zu machen sei, und noch weniger, wie man kocht. Eines Tages jedoch begann ihnen ihre Nahrung schwer im Bauch zu liegen, und auch der Austausch mit der sonst so lebendigen Welt der Orixás rund um sie herum wurde mühsam.
So gingen sie zur Kreuzung von Exú und baten diesen um Hilfe. Wenn jemand weiterwusste, dann er, das spürten sie. Sie warteten drei Tage und drei Nächte, ohne dass ein Zeichen gekommen wäre. Aber dann hörten sie ein Geräusch im Wald. Es waren Bäume, die über ihnen lachten, indem sie ihre Äste aneinanderrieben. Den Menschen gefiel dieses Spiel überhaupt nicht, und sie riefen nach Xangô, dass er ihnen helfe und Blitze über die Bäume sende.
So geschah es! Von den in Brand gesetzten Bäumen fielen Teile auf die Erde und verbrannten, bis nur die glühende Kohle blieb. Das gefiel den Menschen, und sie begannen die Glutstücke zu sammeln, mit Holzspänen und Erde zu bedecken. Sie waren eben verspielt und neugierig und dachten sich nicht so viel dabei. Nach einiger Zeit machten sie das Hügelchen auf und fanden schwarze Stücke. Und als sie diese Teile (die wir heute Kohle nennen) gemeinsam mit den Glutresten zwischen Steine legten, blies zuerst der Wind hinein, bis sich ein Feuer entzündete. So inspiriert und beschützt durch Xangô – und seine Windfreundin Iansã –, erfanden die Menschen das Feuer, den Herd und das Kochen. Und sie kochten und aßen und teilten, das war gut für sie und die Orixás.
Von einem Tag auf den anderen hat sich dieser Übergang natürlich nicht vollzogen. Wie viele Entdeckungen, die dem Menschen zugeschrieben werden, wurde auch diese zuvor schon von anderen Lebewesen gemacht. So ist auch von Landtieren und vor allem Vögeln bekannt, dass sie gelegentlich Nahrung aus von einem Waldbrand heimgesuchten Landstrichen besorgen. Aber dank dem Rückgang der Körperbehaarung und der damit verbundenen größer gewordenen Fähigkeit zu schwitzen konnten sich diese Menschen näher als ihre befellten Ahnen an ein Feuer wagen.
Etwas rätselhaft an dem hier wiedergegebenen Mythos ist die Stelle, an der die Bäume »lachten«, indem sie ihre Äste aneinanderrieben. Wie wir wissen, kann durch das Aneinanderreiben von trockenen Hölzern auch ein Feuer entfacht werden. Nur, diese Technik begannen die Menschen erst viele hunderttausend Jahre später einzusetzen. Und auch die Kunst, Kohlestücke zu platzieren und mit Glutstücken zu entfachen, entdeckten sie erst später. Zunächst beschieden sie sich damit, in von Blitzen in Brand gesetzten Wäldern gekochte beziehungsweise gebratene Nahrung aufzustöbern.