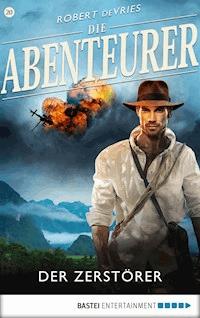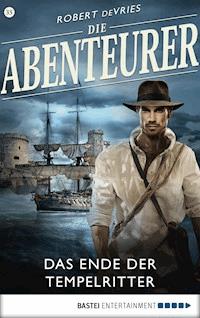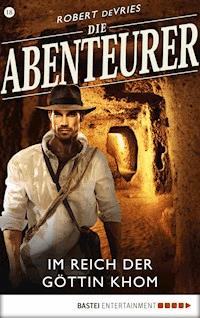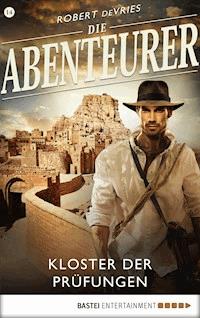1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Vampira
- Sprache: Deutsch
Der Kampf mit Tattoo hat Lilith - und dem Symbionten - das Letzte abverlangt. Bewusstlos bricht sie auf der Straße zusammen. Dort wird sie bald gefunden - und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der behandelnde Arzt müsste blind sein, um nicht zu bemerken, dass mit seiner Patienten etwas nicht stimmt. Doch anstatt sie der Polizei zu melden, erkennt er die Sensation, die hinter seiner Entdeckung steckt. Die einmalige Chance, ein Wesen zu erforschen, das ewig lebt und anderen als menschlichen Naturgesetzen gehorcht. Für Lilith wird die Zeit nach ihrem Erwachen zum Horror-Trip. Sie ist Dr. Romano und seinen Kollegen hilflos ausgeliefert!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Was bisher geschah ...
Ausgeliefert
Leserbild von Roger Szilagyi
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Lektorat: Michael Schönenbröcher
Titelbild: Pelaez/Norma
E-Book-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-8387-1696-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Lilith Eden – Tochter eines Menschen und der Vampirin Creanna, dazu gezeugt, eine geheimnisvolle Bestimmung zu erfüllen. Für 98 Jahre lag sie schlafend in einem lebenden Haus in Sydney, doch sie ist zu früh erwacht – die Zeit ist noch nicht reif. Sie muss gegen die Vampire kämpfen, die in ihr einen Bastard sehen, bis sich ihre Bestimmung erfüllt. Dabei hilft ihr ein Symbiont.
Der Symbiont – ein geheimnisvolles Wesen, das Lilith als Kleid dient, obwohl es fast jede Form annehmen kann. Einst gehörte es Creanna und wurde von ihr an Lilith weitergereicht. Der Symbiont ernährt sich von schwarzem Vampirblut und verlässt seine Wirtin bis zu deren Tod nie mehr.
Landru – Mächtigster der alten Vampire und der Mörder von Liliths Vater. Seit 267 Jahren jagt er dem verlorenen Lilienkelch nach, dem Unheiligtum der Vampire, ohne den es keinen Nachwuchs geben kann. Landru scheint irgendeine Schuld auf sich geladen zu haben – welche, ist noch unklar.
Duncan Luther – ehemaliger Priesteranwärter mit bewegter Vergangenheit. Er lernt Lilith kennen, verliebt sich in sie, wird in Indien von Vampiren getötet und taucht plötzlich und ohne Erinnerung wieder auf.
Beth MacKinsey – Journalistin bei einer Sydneyer Zeitung. Beth kennt Liliths wahre Identität – und hat sich, gleichgeschlechtlich veranlagt, in die Halbvampirin verliebt.
Dies wurde jedoch durch die Nachwirkungen einer magischen Pest mittlerweile ins Gegenteil verkehrt: Unter deren Einfluss hat sie sich mit Landru gegen Lilith verbündet.
Die Dienerkreaturen – Tötet ein Vampir einen Menschen mit seinem Biss, wird dieser kein vollwertiger Blutsauger, sondern eine Kreatur, die dem Vampir bedingungslos gehorcht. Seinerseits kann eine Dienerkreatur den Vampirkeim nicht weitergeben, benötigt aber Blut zum (ewigen) Leben und wird – anders als die Ur-Vampire – mit zunehmendem Alter immer lichtempfindlicher.
Noch immer spricht Beth nicht auf das Serum an, das Frans Stålheim gegen ihre Persönlichkeitsveränderung entwickelt hat, das aber von Landru manipuliert wurde.
Duncan weiß inzwischen zwar, dass er tot war, fühlt sich aber lebendig. Lilith kostet sein Blut; es schmeckt fad, aber nicht wie das eines Toten. Doch nach dem Biss verschwinden – von Lilith unbemerkt – Duncans Schatten und Spiegelbild!
Beth wirft die beiden hinaus. Ein weiterer Verlust: Die Sydney-Vampire lassen dort, wo Lilith geboren wurde, von der Firma »Salem Enterprises« ein Hochhaus errichten, dessen Fundament mit Weihwasser angerührt wurde. Lilith zieht mit Duncan in das Haus des inzwischen toten Virgil Codd.
Kurz darauf erhalten sie Besuch! Herak, der neue Führer der Sydney-Sippe, schickt einen Killer-Vampir. Dieser wird jedoch von einem zweiten Blutsauger abgefangen und getötet.
Liliths Retter stellt sich als Feyn vor, ein »Experiment« der rothaarigen Unbekannten, die auch Liliths Mutter Creanna schuf. Feyn behauptet, wie Lilith gegen sein Volk zu kämpfen, und nach und nach erlangt er ihr Vertrauen. Gemeinsam erforschen sie das Geheimnis um Salem Enterprises: Offenbar versucht man dort ein menschliches Gen zu isolieren, das es den Vampiren gestattet soll, sich noch freier unter den Menschen zu bewegen: mit Schatten und Spiegelbild, ohne Aversion gegen christliche Symbole!
Inzwischen hat Duncan Luther ein seltsames »Hobby« entwickelt: Er interessiert sich für Mesopotamien, den heutigen Irak, weiß aber nicht, warum. Schließlich hat er in einem Spiegel eine Vision. Eine gleißende Lichtgestalt ruft ihn – aber wohin? Als Lilith eines Tages heimkehrt, ist er verschwunden.
Und Feyn lässt seine Maske fallen. Er hat sich Liliths Vertrauen erschlichen, um sie zu töten! Sein Körper ist von tätowierten Fratzen überzogen: den Gesichtern seiner vampirischen Opfer, deren Kraft er in sich aufnahm!
Beim folgenden Kampf verletzt er Lilith und den Symbionten schwer, doch dann kann Lilith seine Kraft gegen ihn selbst wenden, und er wird von seinen Tätowierungen aufgefressen. Lilith taumelt schwerverletzt in die Nacht hinaus …
Ausgeliefert
von Robert deVries
Eigentlich waren ihre Augen geschaffen für die Nacht. Doch jetzt kamen dunkle Schatten von allen Seiten ihres Gesichtsfeldes und schlugen über ihr zusammen. Lilith Eden wankte. Die Beine versagten ihr den Dienst, während ihr Gehirn in Flammen stand.
Schmerz! Alles verschlingend, alles beherrschend.
Mit dem letzten Funken Bewusstsein ahnte sie, dass es nicht nur ihre eigenen Schmerzen waren. Es war die Agonie des Symbionten. Feyn hatte ihm tiefe Wunden gerissen; Wunden, die vielleicht nie wieder heilen würden.
Das war ihr letzter Gedanke, bevor es vollends dunkel um sie wurde. Die hastigen Schritte und die aufgeregten Stimmen, die sich ihr näherten, bemerkte sie schon nicht mehr …
»Doktor Berglundson!«, schallte es klirrend aus den Lautsprechern des Ruheraumes. »Bitte in die Notaufnahme! Dr. Berglundson, bitte in die Notaufnahme!«
Michael Berglundson, Arzt an der St. Margarete’s Clinic, einem angesehenen Sydneyer Privathospital, fluchte leise. Es war noch keine zwei Minuten her, dass er sich in den Ruheraum zurückgezogen hatte, um sich einen Becher Kaffee aus dem Automaten zu ziehen.
Heute Nacht war wirklich der Teufel los. In den letzten vier Stunden hatte es mehr Notfälle gegeben als in den Nachtschichten der ganzen Woche zuvor. Erst ein Vierjähriger, der einen Abflussreiniger für Limonade gehalten hatte, dann die Opfer eines schweren Verkehrsunfalls, wenig später ein Siebzigjähriger, der sich beim Sturz die Hüfte gebrochen hatte, und vor einer halben Stunde schließlich ein Jugendlicher, der versucht hatte, sich die Pulsadern aufzuschneiden.
Berglundson fragte sich, was es diesmal sein würde. Warum hatte er sich nur überreden lassen, ausgerechnet diese Nachtschicht für einen erkrankten Kollegen zu übernehmen?
Er betätigte die Sprechanlage.
»Ja, was gibt’s?«
»Der Ambulanzwagen hat sich gerade über Funk gemeldet«, erwiderte die Nachtwache am anderen Ende. »Die Sanitäter haben eine Frau aufgegabelt. Wahrscheinlich das Opfer eines Überfalls. Der Wagen muss jeden Augenblick ankommen.«
»Schon gut. Ich bin gleich unten.«
Berglundson nahm noch einen kurzen Schluck aus dem Becher, verzog angewidert das Gesicht und knallte ihn auf den Tisch zurück. Der Kaffee aus dem Automaten war wirklich ungenießbar. Warum nur musste er immer wieder darauf hereinfallen und sich einen Becher ziehen?
Während Berglundson nach unten in die Notaufnahme eilte, galten seine wenig freundlichen Gedanken der Tatsache, dass die Menschheit es schon vor zwanzig Jahren fertiggebracht hatte, auf dem Mond zu landen – aber einen Automaten zu konstruieren, der einen genießbaren Kaffee ausspuckte, dazu hatte aller Fortschritt bis heute offensichtlich noch nicht gereicht.
Unten wartete bereits Virginia Mayfield, eine Krankenschwester aus dem Nachtdienst, auf ihn. Die resolute Mittvierzigerin hatte ihm bereits bei den letzten Einlieferungen assistiert.
Sie quittierte sein Eintreffen mit einem kurzen Blick. Nach den anstrengenden letzten Stunden war ihnen beiden nicht nach einer Unterhaltung zumute.
Wenig später fuhr der Ambulanzwagen vor und hielt mit dem Heck vor der Tür der Notaufnahme.
Die beiden Rettungssanitäter stiegen aus dem Cockpit. Während einer von ihnen nach hinten eilte und die Heckklappe öffnete, nahm der andere Berglundson zur Seite.
»Eine junge Frau«, erstattete er dem Arzt Bericht. »Sie wurde bewusstlos in einem Hinterhof am Rande der Stadt gefunden. »
»Was ist mir ihr?«
»Sieht ziemlich schlimm aus. Zahlreiche Prellungen, Schnittwunden und Verdacht auf innere Verletzungen. Herzschlag und Puls sind äußerst schwach. Und sie hat das Bewusstsein bisher noch nicht wiedererlangt.«
»Eine Vergewaltigung?«
»Nein.« Der Rettungssanitäter schüttelte den Kopf. »Es sieht eher so aus, als ob sie von einem wilden Tier angefallen worden wäre.«
»Sie meinen einen Dingo oder so etwas?«
»Nein, dafür fehlen entsprechende Bissverletzungen. Sie überzeugen sich selbst davon.«
»Ja, das denke ich auch.«
Berglundson wollte zum Heck des Rettungswagens eilen, wo die Bahre mittlerweile auf einen fahrbaren Untersatz geladen worden war.
»Und da ist noch etwas, was Sie sich ansehen sollten«, hielt ihn der Sanitäter noch einmal zurück. »Und zwar ihr Blut.«
»Was ist damit?«
»Ich weiß nicht recht. Es sieht irgendwie komisch aus. Viel dunkler als normales Blut.«
Berglundson schluckte die ärgerliche Bemerkung, die er auf der Zunge hatte, herunter und wandte sich endgültig der Patientin zu.
Sie war um die 1,70 Meter groß, wurde von zwei Gurten auf der Trage gehalten, und die Decke, die sie bis zu den Schultern einhüllte, vermochte ihre üppigen Formen kaum zu verhüllen.
Doch nicht sie waren es, die Berglundson regelrecht elektrisierten.
Es war ihr Gesicht.
In dem Moment, da Berglundson es erblickte, waren alle medizinischen Gedanken, die ihm eben noch im Kopf herumgegangen waren, mit einem Male wie weggewischt. Es war, als würde plötzlich die Zeit stehenbleiben.
Das Gesicht war oval, mit hohen Wangenknochen, und es wurde von langem, tiefschwarzem Haar eingerahmt. Die Haut hingegen war von einer außerordentlichen, fast unnatürlichen Blässe. Doch es war nicht die Art ungesunder Blässe, die Berglundson von so vielen Patienten kannte und die eine Folge von Krankheit und Siechtum war.
Nein, die Blässe dieser Haut hatte etwas Unnahbares, etwas fast Aristokratisches an sich.
Diese Frau war wunderschön, und daran konnten selbst der Dreck, die zahlreichen Blessuren und die blutige Wunde, die sich quer über ihre rechte Wange zog, nichts ändern.
Berglundson fühlte Bedauern, als er an die Narbe dachte, die diese Wunde auf ihrem Gesicht hinterlassen würde. Doch es tat der Schönheit dieser Frau keinen Abbruch.
Jedenfalls nicht für ihn.
In seinem bisherigen Leben hatte er mit Frauen nicht viel Glück gehabt, und das war der Grund, warum er mit seinen 31 Jahren noch immer Junggeselle war. Natürlich hatte er bereits einige Beziehungen hinter sich, doch keine davon hatte sehr lange gehalten. Jedesmal war er seiner Partnerin spätestens nach einem halben Jahr überdrüssig geworden. Das war sein Fluch: Sobald er eine Frau erst einmal hinlänglich gut kannte, war das geheimnisvolle Etwas, das am Anfang jeder Beziehung stand, plötzlich verschwunden.
Und damit blieb nichts mehr zurück, was ihn noch an ihr hätte reizen können.
Bei dieser Frau jedoch, die dort auf der Bahre lag, würde das anders sein – das fühlte er mit jeder Faser seines Körpers. Sie war vollkommen anders als alle Frauen, denen er bislang begegnet war.
»Dr. Berglundson?«
Sein Blick blieb auf den geschlossenen Lidern ihrer leicht schräg stehenden Augen liegen, und er hatte das Gefühl, als würde sie sie jeden Moment öffnen und ihn ansehen. Er fragte sich, welche Farbe ihre Augen wohl haben würden.
Grün, wisperte ein Gedanke in ihm. Sie würden grün sein. Sie konnten nur grün sein!
Er spürte eine Berührung an der Schulter und schreckte zusammen. Als er den Kopf wandte, sah er einen der Rettungssanitäter vor sich, der ihn fragend ansah.
»Ja, was ist?«, fragte Berglundson träge. Es war, als erwachte er aus einem tiefen Schlaf.
»Am schlimmsten hat es an der Schulter erwischt hat. Ein ziemlich tiefer Einschnitt. Wir haben ihn erst einmal geklammert, damit sie nicht zu viel Blut verliert.«
Berglundson nickte gedankenverloren. Es fiel ihm schwer, sich auf die Worte zu konzentrieren. Das Gesicht nahm ihn wie mit hypnotischer Kraft gefangen.
»Was ist mit Ihnen?«, erreichte ihn die besorgte Stimme von Schwester Mayfield. »Ist Ihnen nicht gut?«
Berglundson riss sich zusammen. Endlich gelang es ihm, seinen Blick von der Frau zu lösen.
»Doch, doch. Es war nur …«, er räusperte sich, »… nur eine kurze Unkonzentriertheit.« Er wandte sich an den Sanitäter. »Was sagten Sie gerade?«
»Ich sagte, dass es sie am schlimmsten an der Schulter erwischt hat. Ein tiefer Einschnitt. Hier, sehen Sie selbst.« Der Sanitäter schlug die Decke zurück und verzog ungläubig das Gesicht. »Aber … das gibt es doch nicht?«
»Was meinen Sie?«
»Diese Wunde dort. Ich könnte schwören, dass sie vor zwanzig Minuten, als wir die Frau gefunden haben, noch bedeutend größer war. »
Berglundson betrachtete die Wunde, die nicht sehr frisch aussah. Sie war bereits vollständig verschorft.
»Gut, dass Sie sich getäuscht haben«, sagte er zu dem Sanitäter, und als dieser zu einer empörten Antwort ansetzte, schnitt er ihm das Wort ab. »Nur eine Frage noch. Hatte sie irgendwelche Papiere bei sich? Oder sonstige persönliche Sachen?«
»Nein, nichts – bis auf das Kleid, das sie trägt.«
»Gut. Sie beide können sich dann wieder auf den Weg machen. Den Rest übernehmen wir.« Berglundson nickte Virginia Mayfield zu. »Schwester?«
Zusammen schoben sie die Trage ins Gebäude. Die beiden Rettungssanitäter sahen zu, wie die drei im hinter der Tür befindlichen Korridor verschwanden.
»Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Wunde vorhin noch viel größer war«, wandte sich derjenige, der mit Berglundson gesprochen hatte, kopfschüttelnd an seinen Kollegen. »Und frischer. Ich bin doch nicht verrückt! Ich weiß, was ich gesehen habe.«
»Wenn du verrückt bist, bin ich’s auch.«
»Wie meinst du das?«
»Ich habe genau dasselbe gesehen wie du. Aber das soll uns jetzt nicht mehr kümmern. Wir haben unsere Schuldigkeit getan. Seien wir froh, dass wir sie los sind.«
»Mir war von Anfang an nicht geheuer dabei. Schon als wir sie aufgelesen haben.«
»Was solls? Das ist jetzt nicht mehr unser Problem. Lass uns losfahren. In einer Stunde wird’s hell. Und dann ist endlich Feierabend.«
Berglundson entschied, die Frau zuerst in die Röntgenabteilung zu bringen. Es gab keine Wunden, die dringend hätten versorgt werden müssen. Diese Arbeit hatten die Rettungssanitäter ihnen bereits abgenommen.
Ein erstes Abtasten – bei dem Berglundson Mühe gehabt hatte, sich die Erregung, die dabei in ihm aufstieg, nicht anmerken zu lassen – hatte keine Hinweise auf Knochenbrüche ergeben. Doch es bestand noch immer die Möglichkeit, dass sie innere Verletzungen erlitten hatte.
Womit immer es diese Frau zu tun gehabt hatte, es musste mit der Urgewalt einer Dampflok über sie hereingebrochen sein!
»Eine gute Nachricht«, sagte die Krankenschwester, nachdem die Röntgenfilme entwickelt waren. »Keine inneren Verletzungen.«
Berglundson nahm die Filme an sich und klemmte sie vor einen Leuchtschirm. Und erst nachdem er sich selbst davon überzeugt hatte, dass die Krankenschwester recht hatte, atmete er auf.
»Gut«, murmelte er erleichtert und begriff erst jetzt, wie todunglücklich es ihn gemacht hätte, wenn sich herausgestellt hätte, dass die Frau größere körperliche Schäden davongetragen hatte – womöglich so große, dass er nicht mehr viel für sie hätte tun können. »Sehr gut.«
Anschließend brachten sie sie in einen Behandlungsraum und betteten sie gemeinsam auf die dortige Liege um.
Während die Schwester eine elektronische Diagnoseeinheit heranrollte und die Patientin mit einem halben Dutzend Kabel verband, nahm Berglundson sich Zeit, das seltsame Kleid genauer in Augenschein zu nehmen, das die junge Frau am Leib trug.
Es war so tiefschwarz wie das Haar der Frau, schien aus Lack oder Leder zu bestehen und lag so hauteng auf der Haut an, dass er es anfangs fast für ein Body-Painting gehalten hatte. Dort, wo die Krallen die Haut zerrissen hatten, klaffte der Stoff zwar auseinander, aber er war nicht zerfetzt. Stattdessen sahen seine Ränder ebenmäßig und fast wie geschmolzen aus.
Es machte einen irgendwie seltsamen Eindruck, ohne dass Berglundson hätte sagen können, woher diese Empfindung rührte.
Er fragte sich, in was für einen abgefahrenen Laden man gehen musste, um solch ein Kleid zu bekommen. Und wie viel Geld man auf den Tisch blättern musste, um es zu erstehen. Und die wichtigste Frage von allen: Was für eine Frau musste man sein, um so etwas zu tragen und sich damit nachts auf die Straße zu wagen?
»Pulsschlag schwach«, riss ihn die Stimme von Schwester Mayfield aus seinen Gedanken.
Verdammt!, dachte Berglundson. Er musste sich mehr zusammenreißen. Er durfte sich nicht in seinen Gedanken verlieren.
»Blutdruck ebenfalls schwach und kaum messbar«, fuhr die Schwester fort und las die Ergebnisse der Diagnoseeinheit ab. »Auch der Herzschlag ist äußerst langsam. Zwanzig Schläge in der Minute.«
Der letzte Satz ließ Berglundson aufhorchen.
»Wie bitte? Zwanzig Schläge?« Das war ein Wert, den vielleicht gerade einmal indische Gurus erreichten, wenn sie sich aus Public-Relations-Gründen mal wieder für vier Wochen beerdigen oder in einen luftdichten Glaskasten setzen ließen! »Das Gerät muss defekt sein!«
»Nein, Sir.« Die Krankenschwester überprüfte die Apparatur. »Das Gerät ist in Ordnung.«
Berglundson reagierte, wie er es in der Ausbildung gelernt hatte.
»Sauerstoff! Und fünf Milliliter Effortil, um den Kreislauf zu stabilisieren. Schnell, Schwester!«
Beides blieb ohne Erfolg.
»Werte unverändert schwach. Herzschlag weiterhin bei zwanzig Schlägen.«