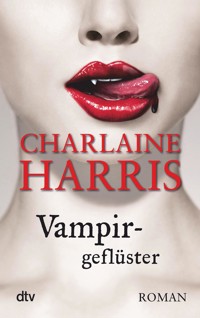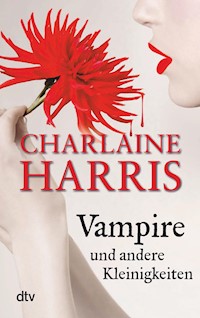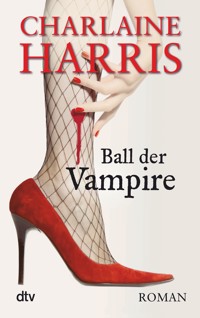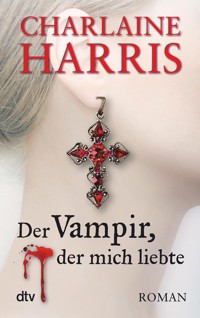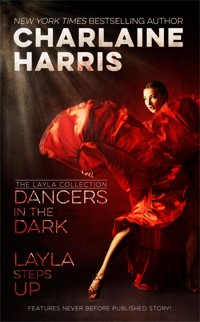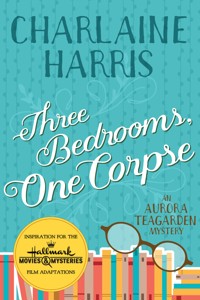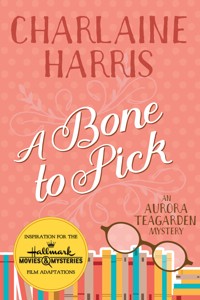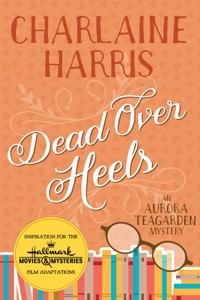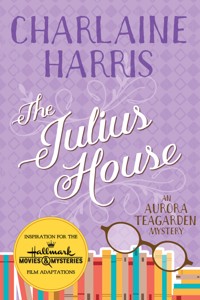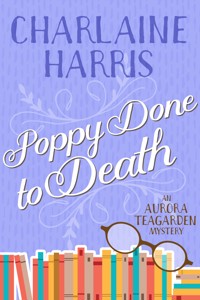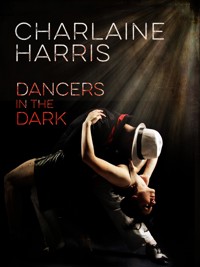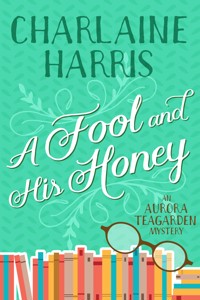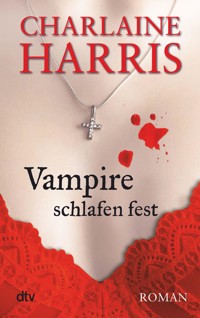
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Sookie Stackhouse
- Sprache: Deutsch
Ein Vampir-Gipfeltreffen - Machtkämpfe, Intrigen und heimliche Allianzen Eine Reise zu einem Vampir-Gipfeltreffen - das kann unangenehm werden für gewöhnliche Sterbliche. Doch gewöhnlich ist Sookie Stackhouse, die Kellnerin aus Louisiana, sowieso nicht. Ihr besonderes Talent wird ihr vielleicht eine Hilfe sein: Sie kann Gedanken lesen. Die Vampirkönigin von Louisiana ist in einer misslichen Lage: Sie ist angeklagt, ihren Gemahl endgültig ums Leben gebracht zu haben. Und ihre Machtbasis schwindet - nach dem verheerenden Hurrikan in New Orleans ist sie auf Hilfe von außen angewiesen. Machtkämpfe, Intrigen und heimliche Allianzen überall. Es ist fraglich, wie lange Sookie die Rolle der neutralen Beobachterin durchhalten kann. Als wäre das nicht genug, ist sie umgeben von alten Lieben und einer neuen: Auch hier sind Entscheidungen gefragt. Und dann häufen sich die Hinweise auf eine Verschwörung, die alles gefährdet, was ihr lieb und teuer ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Eine Reise zu einem Vampir-Gipfeltreffen - das kann unangenehm werden für gewöhnliche Sterbliche. Doch gewöhnlich ist Sookie Stackhouse, die Kellnerin aus Louisiana, sowieso nicht. Ihr besonderes Talent wird ihr vielleicht eine Hilfe sein: Sie kann Gedanken lesen. Die Vampirkönigin von Louisiana ist in einer misslichen Lage: Sie ist angeklagt, ihren Gemahl endgültig ums Leben gebracht zu haben. Und ihre Machtbasis schwindet - nach dem verheerenden Hurrikan in New Orleans ist sie auf Hilfe von außen angewiesen. Machtkämpfe, Intrigen und heimliche Allianzen überall. Es ist fraglich, wie lange Sookie die Rolle der neutralen Beobachterin durchhalten kann. Als wäre das nicht genug, ist sie umgeben von alten Lieben und einer neuen: Auch hier sind Entscheidungen gefragt. Und dann häufen sich die Hinweise auf eine Verschwörung, die alles gefährdet, was ihr lieb und teuer ist.
Von Charlaine Harris sind bei dtv außerdem erschienen:
Vorübergehend tot
Untot in Dallas
Club Dead
Der Vampir, der mich liebte
Vampire bevorzugt
Ball der Vampire
Ein Vampir für alle Fälle
Vampirgeflüster
Vor Vampiren wird gewarnt
Vampir mit Vergangenheit
Cocktail für einen Vampir
Vampirmelodie
Die Welt der Sookie Stackhouse
Vampire und andere Kleinigkeiten
Charlaine Harris
Vampire schlafen fest
Sookie Stackhouse Band 7
Roman
Deutsch von Britta Mümmler
Dieser Roman ist einigen der Frauen gewidmet, die ich stolz »Freundin« nennen darf: Jodi Dabson Bollendorf, Kate Buker, Toni Kelner, Dana Cameron, Joan Hess, Eve Sandstorm, Paula Woldan und Betty Epley. Ihr alle bedeutet mir sehr viel, jede auf ihre Art, und ich bin dankbar, dass ich euch habe.
Kapitel 1
Die Vampir-Bar in Shreveport würde an diesem Abend erst später öffnen. Ich war selbst zu spät dran und automatisch zur Vordertür geeilt, dem Eingang für Gäste, nur um von einem ordentlich mit roten Gothic-Lettern beschriebenen weißen Pappschild gestoppt zu werden: AUF EINEN BISS ZUR NACHT, HEUTE ERST AB ACHT.BITTE ENTSCHULDIGEN SIE UNSERE SPÄTERE ÖFFNUNGSZEIT.Unterschrieben war es mit »Ihr Fangtasia-Team«.
Es war die dritte Septemberwoche, und über dem Eingang leuchtete bereits der rote Neonschriftzug FANGTASIA.Der Himmel war beinahe pechschwarz. Mit einem Fuß schon wieder im Auto, stand ich noch einen Augenblick lang da und genoss den milden Abend und den schwachen, trockenen Vampirgeruch, der um die Bar wehte. Dann fuhr ich zur Rückseite des Gebäudes und parkte neben den anderen Autos, die beim Eingang für Angestellte aufgereiht standen. Ich hatte mich nur fünf Minuten verspätet, aber es sah aus, als wären alle anderen außer mir pünktlich zu diesem Treffen erschienen. Ich klopfte an die Tür und wartete.
Ich hatte gerade die Hand gehoben, um erneut zu klopfen, als Pam, Erics Stellvertreterin, die Tür öffnete. Pam hatte ihr Büro im Fangtasia, obwohl sie eigentlich andere Aufgaben in Erics vielfältigen Geschäften wahrnahm. Die Vampire waren zwar vor fünf Jahren an die Öffentlichkeit getreten und zeigten der Welt nur ihr allerbestes Gesicht, taten aber, was das Geldverdienen anging, immer noch ziemlich geheimnisvoll. Manchmal fragte ich mich, wie viel von Amerika den Untoten wohl gehören mochte. Eric, der Besitzer des Fangtasia, war ein echter Vampir, wenn’s ums Bloß-nichts-verraten ging. Okay, in seinem extrem langen Leben war das sicher auch nötig gewesen.
»Komm herein, meine liebe Gedankenleserin«, sagte Pam theatralisch gestikulierend. Sie trug ihre Arbeitskluft: das lange, hauchdünne schwarze Kleid, das alle Touristen, die in die Bar kamen, an weiblichen Vampiren zu erwarten schienen. (Wenn Pam sich nach eigenem Geschmack kleidete, gehörte sie eher zur Pastell- und Twinset-Fraktion.) Sie hatte das hellste, glatteste blonde Haar, das es überhaupt gab. Pam war eine geradezu ätherische Schönheit, mit einem winzig kleinen tödlichen Zug darin. Und genau dieser tödliche Zug war es, den man besser niemals vergaß.
»Wie geht es?«, fragte ich höflich.
»Außerordentlich gut«, erwiderte sie. »Und Eric ist glücklich und zufrieden.«
Eric Northman, der Vampirsheriff von Bezirk Fünf, hatte Pam zu einer Vampirin gemacht, und sie gehorchte seinen Befehlen nicht nur gern, sondern war auch verpflichtet dazu. Das war Teil des Handels, wenn man zu einem Untoten wurde: Man stand immer in der Macht seines Schöpfers. Aber Pam hatte mir mehr als einmal versichert, dass Eric ein guter Boss sei und sie ihren eigenen Weg gehen ließe, falls sie das wolle. Tatsächlich hatte sie in Minnesota gelebt, bis Eric das Fangtasia kaufte und sie bat, ihn bei der Leitung der Bar zu unterstützen.
Zu Bezirk Fünf gehörte fast der gesamte Nordwesten von Louisiana, bis vor einem Monat noch die wirtschaftlich schwächere Hälfte des Bundesstaates. Seitdem Hurrikan Katrina über das Land gerast war, hatten sich jedoch die Machtverhältnisse in Louisiana dramatisch verschoben, insbesondere innerhalb der Vampirgemeinde.
»Wie geht es deinem wunderbaren Bruder, Sookie? Und deinem Boss, diesem Gestaltwandler?«, fragte Pam.
»Mein wunderbarer Bruder redet dauernd davon, dass er heiraten will, wie alle anderen in Bon Temps«, sagte ich.
»Du klingst ein wenig deprimiert.« Pam neigte den Kopf und fixierte mich wie ein Spatz einen Wurm.
»Na ja, ein klein wenig vielleicht«, erwiderte ich.
»Du musst dich beschäftigen«, belehrte Pam mich. »Dann hast du keine Zeit, Trübsal zu blasen.«
Pam vergötterte »Liebe Abby«. Eine Menge Vampire lasen diese Kolumne täglich. Abbys Lösungen für die Probleme ihrer Leser waren allerdings zum Schreien. Im wahrsten Sinn des Wortes. So hatte Pam mir schon mal erklärt, dass andere sich mir nur aufdrängen könnten, weil ich es ihnen erlaubte, und dass ich bei der Auswahl meiner Freunde wählerischer sein sollte. Tja, großartig, ich wurde in Sachen Gefühle von einer Vampirin beraten.
»Tu ich«, sagte ich. »Mich beschäftigen, meine ich. Ich arbeite, meine Mitbewohnerin aus New Orleans ist noch da, und morgen gehe ich auf eine Junggesellinnenparty, auf der’s nur so regnen wird. Nicht für Jason und Crystal. Für ein anderes Paar.«
Pam hielt inne, eine Hand schon am Türknauf zu Erics Büro. Mit gerunzelter Stirn dachte sie über meine Bemerkung nach. »Ich erinnere mich nicht, was eine Party mit Regen zu tun hat, obwohl ich schon davon gehört habe.« Dann hellte sich ihre Miene auf. »Diese Party wird nur bei Regen gefeiert? Nein. Aber ich habe mal so was gelesen, ganz sicher. Ach ja! Eine Frau schrieb an Abby, dass sie keine Dankeskarte erhalten habe, obwohl sie die Geschenke nur so regnen ließ. Es gibt auf dieser Party… Geschenke?«
»Jetzt hast du’s«, sagte ich. »Es ist eine Party für eine Braut, vor der Hochzeit. Jeder bringt Geschenke mit, damit das Paar dann gleich alles hat, was es zum Leben braucht. Was Ähnliches gibt’s auch, wenn ein Paar ein Kind erwartet. Dann regnet’s natürlich Babysachen.«
»Ein Babyregen«, sinnierte Pam mit einem eisigen Lächeln auf den Lippen, das problemlos einen Kürbis schockgefroren hätte. »Das gefällt mir.« Sie klopfte an Erics Bürotür und öffnete sie. »Eric«, rief sie, »vielleicht wird irgendwann eine unserer Kellnerinnen schwanger, dann gibt es einen Babyregen!«
»Wär mal was anderes«, sagte Eric, der seinen goldblonden Kopf hob und von den Papieren auf seinem Schreibtisch aufsah. Er bemerkte mich, warf mir einen harten Blick zu und beschloss, mich zu ignorieren. Eric und ich hatten so unsere Probleme miteinander.
Das Zimmer war voller Leute, die darauf warteten, dass er ihnen seine Aufmerksamkeit schenkte. Doch Eric legte erst mal den Stift beiseite, stand auf und reckte seinen großen, prachtvollen Körper– vielleicht meinetwegen. Wie immer trug er enge Jeans und ein schwarzes Fangtasia-Shirt mit den weißen, stilisierten Fangzähnen, die das Logo der Bar waren. »Fangtasia« stand in blutroter Schrift quer über dem Weiß der Fangzähne, im gleichen Stil wie die Neonschrift draußen. Hätte Eric sich umgedreht, wäre auf seinem Rücken »Bar mit Biss« zu lesen gewesen. Pam hatte mir eins dieser Shirts geschenkt, als das Fangtasia mit dem Merchandising begann.
An Eric sah es einfach klasse aus, und ich erinnerte mich nur allzu gut, wie es darunter aussah.
Gewaltsam riss ich mich von seinem Anblick los und sah mich im Zimmer um. Das kleine Büro war voller Vampire. Solange man sich nicht umschaute, bemerkte man sie kaum, so still und leise waren sie. Clancy, der Manager der Bar, hatte einen der beiden Besucherstühle vor dem Schreibtisch für sich reklamiert. Er hatte den Hexenkrieg im letzten Jahr nur knapp überlebt und war nicht unversehrt davongekommen. Die Hexen hatten Clancy so stark ausgeblutet, bis es fast zu spät für ihn war. Als Eric ihn endlich auf einem Friedhof in Shreveport aufspürte, war Clancy nur noch eine Phiole Blut vom Tod entfernt gewesen. Während seiner langen Genesungszeit war der rothaarige Vampir bitter und zynisch geworden. Jetzt grinste er mich an und ließ seine Fangzähne sehen. »Kannst dich auf meinen Schoß setzen, Sookie«, sagte er und klopfte sich auf die Oberschenkel.
Ich lächelte zurück, aber es kam nicht von Herzen. »Nein, danke, Clancy«, erwiderte ich höflich. Clancys Flirts waren schon immer gefährlich gewesen, aber jetzt waren sie rasiermesserscharf. Er gehörte zu den Vampiren, denen ich lieber nicht allein im Dunkeln begegnen wollte. Obwohl er die Bar kompetent leitete und mich nie angerührt hatte, läuteten bei mir in seiner Gegenwart stets alle Alarmglocken. Die Gedanken der Vampire konnte ich nicht lesen, gerade deshalb fand ich ihre Nähe ja so erfrischend. Aber wenn ich diesen Unterton hörte, wünschte ich glatt, ich könnte in Clancys Kopf eintauchen und herausfinden, was darin vor sich ging.
Felicia, die neue Barkeeperin, saß mit Indira und Maxwell Lee auf dem Sofa. Die reinste Regenbogenkoalition der Vampire. Felicia war eine gelungene Mischung aus Afrikanerin und Weißer und fast 1,85Meter groß, so dass an ihr jede Menge Schönheit zu bewundern war. Maxwell Lee war einer der schwärzesten Männer, die ich je gesehen hatte. Und Little Indira war die Tochter indischer Einwanderer.
Und dann waren da noch vier weitere Menschen im Raum (der Begriff »Mensch« jetzt mal im allerweitesten Sinne gebraucht), von denen jeder Einzelne mich ziemlich aufregte, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß.
Einen von ihnen nahm ich gar nicht erst zur Kenntnis. Ich machte mir die Regel der Werwölfe zu eigen und behandelte ihn wie ein geächtetes Mitglied meines Rudels: Ich sagte mich von ihm los. Ich sprach seinen Namen nicht aus, ich sprach ihn nicht an, ich registrierte seine Anwesenheit nicht. (Genau, das war mein Ex, Bill Compton– was aber nicht heißt, dass ich ihn bemerkt hätte, wie er da in einer Ecke des Zimmers vor sich hin grübelte.)
An der Wand neben ihm lehnte die uralte Thalia, die vermutlich sogar älter war als Eric. Sie war genauso klein wie Indira, sehr bleich, trug ihr rabenschwarzes Haar in brettharte Wellen gelegt– und hatte ein höchst unverschämtes Benehmen.
Erstaunlicherweise machte gerade das einige Menschen absolut an. Thalia hatte tatsächlich ein Gefolge ihr völlig ergebener Anhänger, die auch noch begeistert zu sein schienen, wenn sie sie in gestelztem Englisch abzuwimmeln versuchte. Und ich hatte herausgefunden, dass sie sogar eine eigene Webseite besaß, eingerichtet und gepflegt von ihren Fans. Statt Thalia in Shreveport wohnen zu lassen, hätte Eric auch einen schlecht erzogenen Pitbull im Hof festbinden können, hatte Pam mal gesagt. Pam gefiel diese Entscheidung ganz und gar nicht.
All diese untoten Bürger wohnten im Bezirk Fünf. Und um unter Erics Schutz leben zu können, hatten sie ihm Treue geschworen. Dafür mussten sie einen gewissen Teil ihrer Zeit seinen Befehlen widmen, auch wenn sie nicht im Fangtasia arbeiteten. Im Moment lebten sehr viel mehr Vampire in Shreveport als üblich, wegen Hurrikan Katrina. Genau wie die Menschen hatten sie irgendwohin gemusst. Eric hatte noch nicht entschieden, was aus den untoten Flüchtlingen werden sollte, und sie waren auch nicht zu diesem Treffen eingeladen worden.
Heute Abend waren nur zwei Besucher von auswärts im Fangtasia, von denen der eine sogar höheren Ranges war als Eric.
Andre war der persönliche Bodyguard von Sophie-Anne Leclerq, der Königin von Louisiana. Die Königin war nach Baton Rouge evakuiert worden, wo sie sich derzeit aufhielt. Andre sah sehr jung aus, wie sechzehn vielleicht; sein Gesicht war glatt wie das eines Babys, sein helles Haar dick und schwer. Doch Andre hatte schon ein langes Leben hinter sich, in dem er sich ausschließlich um Sophie-Anne, seine Schöpferin und Retterin, gekümmert hatte. Seinen Säbel trug er heute Abend nicht, denn er war ja nicht als ihr Bodyguard hier. Doch ich war mir sicher, dass er trotzdem irgendwie bewaffnet war– mit einem Messer oder einer Pistole. Aber im Grunde war er ja selbst eine tödliche Waffe, mit oder ohne Hilfsmittel.
Als Andre mich gerade ansprechen wollte, sagte jemand hinter seinem Stuhl mit tiefer Stimme: »Hey, Sookie.« Der zweite Besucher von auswärts, Jake Purifoy. Ich blieb ganz ruhig stehen, obwohl alles in mir geradezu danach schrie, sofort aus dem Büro zu stürmen. So was Idiotisches. Wenn ich vor Andre nicht weggerannt war, wieso sollte ich dann vor Jake türmen? Ich zwang mich, dem gut aussehenden jungen Mann, der immer noch recht lebendig aussah, zuzunicken. Aber ich wusste, dass mein Gruß nicht gerade natürlich wirkte. Jake erfüllte mich mit einer schrecklichen Mischung aus Mitleid und Furcht.
Jake, ein Werwolf von Geburt, war von einem Vampir angegriffen worden und dabei beinahe verblutet. Meine Cousine Hadley (auch eine Vampirin) hatte Jake fast leblos gefunden und ihn herübergeholt, wohl in einem Akt falsch verstandener Barmherzigkeit– okay, man hätte es sicher auch für eine gute Tat halten können. Doch es stellte sich heraus, dass niemand Hadleys Gnadenakt zu schätzen wusste… nicht mal Jake selbst. Niemand hatte je davon gehört, dass ein Werwolf zu einem Vampir geworden war: Werwölfe verachteten Vampire und misstrauten ihnen, und dieses Gefühl beruhte eindeutig auf Gegenseitigkeit. Für Jake war das alles sehr schwierig, er saß in einer Art Niemandsland. Die Königin von Louisiana hatte ihm schließlich einen Posten in ihren Diensten verschafft, weil kein anderer den ersten Schritt tun wollte.
Blind vor Blutdurst hatte Jake sich nach seinem Erwachen übrigens mich als seinen ersten Vampirsnack ausgesucht. Ich hatte davon immer noch eine rote Narbe am Arm.
Na, das konnte ja ein heiterer Abend werden.
»Miss Stackhouse«, sagte Andre, stand von Erics zweitem Besucherstuhl auf und verbeugte sich. Das war eine Geste echten Respekts, und meine Stimmung hob sich ein wenig.
»Mr Andre«, erwiderte ich und verbeugte mich ebenfalls. Er wies mit der Hand höflich auf den frei gewordenen Stuhl, und da ich so mein Sitzplatzproblem lösen konnte, nahm ich an.
Clancy wirkte verdrossen. Er hätte mir seinen Stuhl anbieten sollen, weil er der rangniedrigere Vampir war. Andre hatte mit seinem Verhalten so deutlich darauf hingewiesen wie ein blinkender roter Neonpfeil. Ich musste mich beherrschen, um nicht zu grinsen.
»Wie geht es Ihrer Majestät?«, fragte ich, denn ich wollte mindestens so höflich sein wie Andre. Es wäre übertrieben zu behaupten, dass ich Sophie-Anne mochte, aber ich respektierte sie.
»Unter anderem aus diesem Grund bin ich heute Abend hier«, erwiderte Andre. »Eric, können wir jetzt anfangen?« Eine diskrete Rüge für Erics Zeitschinderei, vermutete ich. Pam ließ sich neben meinem Stuhl auf dem Boden nieder und hockte sich auf die Fersen.
»Ja, jetzt sind alle da. Fahren Sie fort, Andre. Sie haben das Wort«, sagte Eric mit einem kleinen Lächeln über seine eigene Großherzigkeit. Er ließ sich wieder in seinen Stuhl fallen und legte seine langen Beine auf eine Ecke des Schreibtisches.
»Die Königin wohnt im Haus des Sheriffs von Bezirk Vier in Baton Rouge«, begann Andre seine Ansprache an die kleine Versammlung. »Gervaise hat seine Gastfreundschaft großzügig ausgedehnt.«
Pam sah mit hochgezogenen Augenbrauen zu mir auf. Gervaise wäre einen Kopf kürzer gemacht worden, wenn er seine Gastfreundschaft nicht ausgedehnt hätte.
»Aber der Aufenthalt in Gervaises Haus kann nur eine Übergangslösung sein«, fuhr Andre fort. »Wir waren bereits ein paar Mal in New Orleans seit der Katastrophe. Hier ein Bericht über den Zustand unserer Besitztümer.«
Obwohl sich keiner der Vampire rührte, spürte ich doch, wie ihre Aufmerksamkeit wuchs.
»Die Residenz der Königin hat fast das gesamte Dach eingebüßt, so dass es im Dachgeschoss und im zweiten Stockwerk große Wasserschäden gibt. Zudem ist der Großteil eines anderen Daches in das Gebäude geflogen und hat einen Haufen Trümmer verursacht, eingerissene Wände und ähnliche Schäden. Wir versuchen im Moment, das Innere zu trocknen, doch das Dach ist immer noch mit einer blauen Plastikplane abgedeckt. Und das ist einer der Gründe, warum ich hier bin: Wir brauchen einen Dachdecker, der sofort mit der Arbeit beginnen kann. Bislang hatte ich kein Glück. Sollte also einer von Ihnen Beziehungen zu einem Menschen haben, der solche Arbeiten macht, bitte ich um Hilfe. Im Erdgeschoss gab es ebenfalls eine Menge wenn auch kleinerer Schäden. Etwas Wasser kam herein, und auch Plünderer haben ihr Unwesen getrieben.«
»Vielleicht sollte die Königin einfach in Baton Rouge bleiben«, sagte Clancy boshaft. »Ich bin sicher, Gervaise wäre ganz überwältigt, wenn er sie auf Dauer beherbergen dürfte.«
Sieh an, Clancy war also ein selbstmörderischer Vollidiot.
»Eine Delegation von Politikern aus New Orleans kam unsere Königin in Baton Rouge besuchen und hat sie gebeten, in die Stadt zurückzukehren.« Andre ignorierte Clancy vollständig. »Die Politiker glauben, dass der Tourismus wieder anzieht, wenn die Vampire nach New Orleans zurückkommen.« Mit kaltem Blick fixierte Andre Eric. »Mit den vier anderen Sheriffs hat die Königin inzwischen schon über die finanziellen Aspekte einer Instandsetzung der Residenz gesprochen.«
Eric nickte beinahe unmerklich mit dem Kopf. Schwer zu sagen, wie er es fand, für die Reparaturen am Gebäude der Königin zahlen zu sollen.
New Orleans war der Ort für Vampire und alle, die ihnen begegnen wollten, seit sich erwiesen hatte, dass Anne Rice zu Recht von ihrer Existenz ausging. Die Stadt war das reinste Disneyland für Vampire. Doch durch Katrina war all das zerstört worden, wie so vieles andere. Sogar Bon Temps bekam die Auswirkungen zu spüren, sowohl als der Hurrikan übers Land fegte als auch danach. Unsere kleine Stadt war noch heute voller Leute, die aus dem Süden geflohen waren.
»Was ist mit dem Partyanwesen der Königin?«, fragte Eric. Die Königin hatte ein altes Kloster am Rande des Garden District gekauft, wo sie eine große Anzahl Gäste bewirten konnte, Vampire und auch Nichtvampire. Das Anwesen war von hohen Mauern umschlossen, galt aber dennoch als unsicher (es war ein denkmalgeschütztes Gebäude, das nicht umgebaut werden durfte, nicht mal die Fenster durfte man vergittern lassen), so dass die Königin dort auf Dauer nicht wohnen konnte. Für mich war es immer bloß ihr Partyschuppen gewesen.
»Das Anwesen hat keine allzu großen Schäden erlitten«, sagte Andre. »Aber auch dort waren Plünderer. Die natürlich ihren Geruch hinterlassen haben.« Vampire wurden in der Kunst der Fährtensuche nur von Werwölfen geschlagen. »Einer von ihnen hat den Löwen erschossen.«
Wie schade. Den Löwen hatte ich irgendwie gemocht.
»Brauchen Sie Hilfe beim Aufspüren?«, fragte Eric.
Andre zog eine Augenbraue hoch.
»Ich frage nur, weil Sie im Moment nicht so viele Leute haben«, erklärte Eric.
»Nein, das hat schon jemand erledigt«, erwiderte Andre und lächelte ein klein wenig.
Ich versuchte erst gar nicht, mir das vorzustellen.
»Mal abgesehen vom Löwen und den Plünderern, in welchem Zustand ist das Anwesen?«, fragte Eric, um das Gespräch wieder auf die Sturmschäden zu lenken.
»Die Königin kann dort wohnen, wenn sie die anderen Häuser und Grundstücke besichtigen fährt«, fuhr Andre fort, »aber höchstens ein, zwei Nächte.«
Alle in der Runde ließen ein angedeutetes Nicken erkennen.
»Zu unseren Verlusten an Mitarbeitern«, sagte Andre, um in seinem Bericht fortzufahren. Alle Vampire waren leicht angespannt, sogar Jake Purifoy, der Neuling. »Unsere erste Schätzung war eher gering, wie Sie wissen. Wir hatten vermutet, einige würden wieder auftauchen, sobald der Sturm völlig abflaut. Aber nur zehn sind zurückgekommen: fünf hier, drei in Baton Rouge, zwei in Monroe. Anscheinend haben wir allein in Louisiana dreißig von uns verloren. In Mississippi sind es mindestens zehn.«
Eine leichte Unruhe machte sich im Raum breit, als die Vampire von Shreveport diese Neuigkeit hörten. In New Orleans hatte es sehr viele Vampire gegeben, sowohl Ansässige als auch Besucher. Wäre Katrina mit dieser Kraft über Tampa hinweggefegt, wäre die Anzahl der Toten und Vermissten viel geringer ausgefallen.
Ich hob die Hand und fragte: »Was ist mit Bubba?«, nachdem Andre mir zugenickt hatte. Seit Katrina hatte ich von Bubba nichts mehr gehört oder gesehen. Und Bubba erkannte man sofort, wenn man ihn sah. Jeder auf der Welt würde ihn erkennen, zumindest jeder ab einem gewissen Alter. Er war nicht so richtig gestorben damals, auf dem Badezimmerboden in Memphis. Sein Gehirn war jedoch bereits geschädigt, ehe er herübergeholt wurde, und so war er kein besonders guter Vampir geworden.
»Bubba lebt«, erwiderte Andre. »Er hatte in einem Grabgewölbe Unterschlupf gefunden und sich von Mäusen und Ratten ernährt. Allerdings geht es ihm seelisch nicht besonders gut, und die Königin hat ihn rauf nach Tennessee geschickt, damit er eine Weile in Nashville bleibt.«
»Andre hat mir eine Liste der Vermissten gegeben«, sagte Eric. »Ich hänge sie nach dem Treffen aus.«
Das kam mir gelegen, denn ich kannte auch ein paar der Bodyguards der Königin und wollte gern wissen, was aus ihnen geworden war.
Ich hatte noch eine Frage, also wedelte ich mit der Hand.
»Ja, Sookie?« Andre fixierte mich mit seinem Blick, und fast bereute ich, dass ich mich zu Wort gemeldet hatte.
»Wissen Sie, ich frage mich schon die ganze Zeit, ob von den Königen und Königinnen, die zu dieser Konferenz, wie Sie das nennen, kommen sollen… also, ob von denen einer einen– na ja, so was wie einen Wettervorhersager unter seinen Leuten hat.«
Die meisten starrten mich verständnislos an, nur Andres Blick wirkte interessiert.
»Eigentlich sollte diese Vampirkonferenz ja schon im Frühjahr stattfinden. Doch sie wurde ein ums andere Mal verschoben, stimmt’s? Und dann schlug Katrina zu. Wenn die Konferenz wie geplant stattgefunden hätte, wäre die Königin in einer viel stärkeren Machtposition gewesen. Sie hätte eine volle Kriegskasse und ein Heer an Vampiren gehabt, und vielleicht wäre nie einer auf die Idee gekommen, ihr den Tod des Königs vorzuwerfen. Die Königin hätte vermutlich alles durchsetzen können, was sie wollte. Doch stattdessen geht sie jetzt dorthin als…« Ich wollte schon sagen »als Bettlerin«, dachte aber noch rechtzeitig an Andre. »…na ja, eben geschwächt.« Ich hatte gefürchtet, sie würden mich auslachen oder verspotten, aber die auf meine Worte folgende Stille wirkte unglaublich nachdenklich.
»Das ist etwas, das Sie auf der Konferenz unbedingt herausfinden müssen«, sagte Andre. »Jetzt, da Sie es sagen, erscheint es mir auch höchst wahrscheinlich. Eric?«
»Ja, ich glaube, da ist was dran«, erwiderte Eric und sah mich an. »Sookie hat ein Talent, um die Ecke zu denken.«
Pam lächelte auf Höhe meines Ellbogens zu mir herauf.
»Was ist eigentlich aus dieser Klage geworden, die Jennifer Cater angestrengt hat?«, fragte Clancy, dem es immer unbequemer zu werden schien auf dem Stuhl, den er sich so clever geschnappt hatte.
Man hätte eine Stecknadel fallen hören. Wovon zum Teufel redete der rothaarige Vampir da? Aber es war wohl klüger, dem Gespräch zu folgen, als Fragen zu stellen.
»Da ist noch nichts entschieden«, sagte Andre.
Pam flüsterte: »Jennifer Cater sollte zu Peter Threadgills Stellvertreterin herangezogen werden. Sie war in Arkansas und kümmerte sich um seine Angelegenheiten, als der Mord geschah.«
Ich nickte, denn ich war Pam ziemlich dankbar für diese Erklärung. Die Vampire in Arkansas hatten zwar keinen Hurrikan durchgemacht, aber trotzdem große Verluste in den eigenen Reihen erlitten– die ihnen die Vampire aus Louisiana beigebracht hatten.
»Die Königin hat gegen die Anschuldigung eingewendet«, sagte Andre, »dass sie Peter töten musste, um ihr eigenes Leben zu retten. Und sie hat natürlich der Bundeskasse eine Entschädigung angeboten.«
»Warum nicht Arkansas?«, flüsterte ich Pam zu.
»Weil der Königin das seit Peters Tod gehört. Arkansas geht an sie, laut Ehevertrag«, murmelte Pam. »Sie kann sich nicht selbst eine Entschädigung zahlen. Wenn Jennifer Cater den Prozess gewinnt, verliert die Königin Arkansas nicht nur, dann muss sie dem Bundesstaat auch eine Geldstrafe zahlen. Eine riesige Summe. Und auch andere Entschädigungen.«
Andre begann geräuschlos im Zimmer auf und ab zu gehen, das einzige Anzeichen, dass er über das Thema nicht glücklich war.
»Haben wir nach der Katastrophe überhaupt noch so viel Geld?«, fragte Clancy. Eine höchst unkluge Frage.
»Die Königin hofft, dass die Klage abgewiesen wird«, sagte Andre, indem er Clancy erneut ignorierte. Andres ewig jugendliche Miene wirkte ausdruckslos. »Aber anscheinend rechnet das Gericht damit, dass es zum Prozess kommt. Jennifer behauptet, die Königin habe Threadgill nach New Orleans gelockt, weg von seinem eigenen Territorium, weil sie den Krieg und auch den Mord an ihm schon lange geplant hätte.« Diesmal erklang Andres Stimme hinter meinem Rücken.
»Aber so ist es doch gar nicht gewesen«, widersprach ich. Sophie-Anne hatte den König nicht getötet. Ich war bei seinem Tod dabei gewesen. Der Vampir, der in diesem Moment direkt hinter mir stand, hatte Threadgill ermordet, und zu dem damaligen Zeitpunkt fand ich das auch gerechtfertigt.
Ich spürte, wie Andres kalte Finger mir über den Nacken fuhren. Woher ich wusste, dass es Andres Finger waren, kann ich nicht sagen. Aber die leichte Berührung, diese eine Sekunde Hautkontakt, rief mir plötzlich eine schreckliche Tatsache ins Gedächtnis: Ich war die einzige Zeugin, was den Tod des Königs betraf, außer Andre und Sophie-Anne.
So konkret hatte ich mir das noch nie klargemacht, und– ich schwör’s– einen Augenblick lang setzte mein Herzschlag aus. Mindestens die Hälfte der Vampire im Zimmer richtete den Blick auf mich. Erics Augen wurden größer und größer, während er mich ansah. Und dann schlug mein Herz wieder, und der Augenblick war vorüber, als hätte es ihn nie gegeben. Doch Erics Hand auf dem Schreibtisch zuckte, und ich wusste, dass er diesen Augenblick nicht vergessen und wissen wollen würde, was das zu bedeuten hatte.
»Sie glauben also, es kommt zum Prozess?«, fragte Eric Andre.
»Hätte die Königin als Regentin von New Orleans– von New Orleans, wie es war– auf die Konferenz gehen können, wäre das Gericht vermutlich auf einen Handel zwischen Jennifer und der Königin aus gewesen: vielleicht, dass Jennifer die mächtige Stellvertreterin der Königin wird und zudem einen Sonderbonus erhält, etwas in der Art. Aber so wie die Dinge jetzt liegen…« Ein langes Schweigen trat ein, in dem wir alle die unausgesprochenen Worte ergänzten. New Orleans war nicht mehr, wie es war, würde es vielleicht nie wieder werden. Sophie-Annes Position war geschwächt. »Nun, da Jennifer so sehr darauf besteht, wird das Gericht die Angelegenheit verfolgen«, fügte Andre hinzu und schwieg wieder.
»Wir wissen, dass die Anschuldigungen haltlos sind«, ertönte in einer Ecke eine klare, kühle Stimme. Bis jetzt war es mir bestens gelungen, meinen Ex Bill zu ignorieren, auch wenn’s mir nicht leichtfiel. »Eric war dort. Ich war dort. Sookie war dort«, fuhr er (der Namenlose, wie ich ihn jetzt mal nenne) fort.
Das stimmte. Jennifer Caters Anschuldigungen, dass die Königin den König in ihren Partyschuppen gelockt habe, um ihn zu töten, war frei erfunden. Zu dem Blutbad war es gekommen, weil einer von Peter Threadgills Vampiren einen Mann der Königin geköpft hatte.
Eric lächelte wehmütig. Er hatte den Kampf genossen. »Ich habe den erledigt, der begonnen hat«, sagte er stolz. »Der König hat alles Mögliche versucht, um die Königin in eine heikle Situation zu bringen– was ihm aber nicht gelungen ist, dank Sookie. Und als sein Plan nicht aufging, hat er auf einen Frontalangriff gesetzt.« Und Eric fügte noch hinzu: »Ich habe Jennifer seit zwanzig Jahren nicht gesehen. Sie ist schnell aufgestiegen. Muss ganz schön rücksichtslos sein.«
Zu meiner Erleichterung war Andre an meine rechte Seite getreten und befand sich nun in meinem Blickfeld. Er nickte. Wieder bewegten sich alle Vampire im Zimmer auf unheimliche Weise beinahe gleichzeitig. Selten hatte ich mich so fremd gefühlt: die einzige Lebende in einem Zimmer voller zum Leben erweckter toter Geschöpfe.
»Gewöhnlich würde die Königin ein ganzes Aufgebot an Vampiren zu ihrer Unterstützung um sich haben wollen«, sagte Andre. »Aber da wir sparen müssen, wurde die Anzahl begrenzt.« Wieder kam er mir nahe und berührte mich, nur ganz leicht, als sein Handrücken über meine Wange streifte.
Und plötzlich hatte ich eine Art Mini-Offenbarung: So fühlte es sich also an, wenn man ein ganz normaler Mensch war. Ich hatte nicht die blasseste Ahnung von den wahren Absichten und Plänen der Leute um mich herum. Genauso lebten normale Menschen jeden Tag ihres Lebens. Es war beängstigend, aber aufregend, wie mit verbundenen Augen durch einen überfüllten Raum zu gehen. Wie hielten normale Menschen diese Ungewissheit im täglichen Leben bloß aus?
»Die Königin will Ihre Telepathin bei den Besprechungen dabeihaben, weil auch Menschen anwesend sein werden.« Andre sprach ausschließlich zu Eric. Wir anderen hätten genauso gut Luft sein können. »Sie will wissen, was diese Menschen denken. Stan bringt seinen Telepathen ebenfalls mit. Kennen Sie den Mann?«
»Ich bin nicht ›seine Telepathin‹«, murmelte ich vor mich hin, auch wenn keiner außer Pam darauf achtete. Sie warf mir ein sonniges Lächeln zu. Überhaupt starrten all die kalten Augen plötzlich mich an, und ich merkte, dass sie auf meine Antwort warteten, dass Andre mich angesprochen hatte. Ich hatte mich so sehr an die über mich hinwegredenden Vampire gewöhnt, dass ich nun völlig überrumpelt war. Im Geiste wiederholte ich noch einmal Andres Bemerkungen, bis ich verstand, dass er mir eine Frage gestellt hatte.
»Ich habe nur einen anderen Telepathen in meinem Leben kennengelernt, und der lebt in Dallas, vermutlich ist es derselbe Typ– Barry Bellboy. Er hat als Gepäckträger in einem Vampirhotel in Dallas gearbeitet, als ich sein, äh, Talent entdeckte.«
»Was wissen Sie über ihn?«
»Er ist jünger als ich, und schwächer– zumindest war er es damals. Er hatte noch nicht akzeptiert, was er war.« Ich zuckte die Achseln. Mehr konnte ich dazu auch nicht sagen.
»Sookie wird in meiner Delegation mitreisen«, sagte Eric zu Andre. »Sie ist die Beste auf ihrem Gebiet.«
Sehr schmeichelhaft, wenngleich ich mich dunkel daran erinnerte, dass Eric mal erzählt hatte, vor mir habe er überhaupt nur einen einzigen Gedankenleser gekannt. Allerdings war es auch sehr ärgerlich, denn Eric tat Andre gegenüber gerade so, als wäre meine Fähigkeit sein Verdienst, und nicht meins. In seiner Delegation, pah.
Eigentlich freute ich mich, mal aus meiner Kleinstadt herauszukommen. Doch jetzt wünschte ich bloß, ich könnte diese Reise nach Rhodes abblasen. Leider hatte ich schon vor Monaten zugesagt, als bezahlte Mitarbeiterin der Königin an dieser Vampirkonferenz teilzunehmen. Und während des letzten Monats hatte ich im Merlotte’s viele Schichten übernommen, um genug Zeit zu bunkern und mich eine Woche lang von den anderen Kellnerinnen vertreten lassen zu können.
»Clancy wird hierbleiben und das Fangtasia geöffnet halten«, sagte Eric.
»Eine Menschenfrau darf mit, während ich zu Hause bleiben muss?« Der rothaarige Manager der Bar war unglücklich über Erics Entscheidung. »Dann entgeht mir ja der gesamte Spaß.«
»Stimmt«, sagte Eric liebenswürdig. Falls Clancy noch irgendetwas Negatives anfügen wollte, so genügte ihm ein Blick in Erics Gesicht, um die Klappe zu halten. »Felicia wird auch bleiben, um dir zu helfen. Und Bill.«
»Nein«, erwiderte die ruhige, kühle Stimme in der Ecke. »Die Königin hat mich angefordert. Ich habe hart an dieser Datenbank gearbeitet, und sie hat mich gebeten, diese auf der Konferenz zu vermarkten, damit sie einen Teil ihrer Verluste wettmachen kann.«
Eine Minute lang wirkte Eric wie eine Statue, dann zog er eine Augenbraue hoch. »Ach ja, dass du mit dem Computer umgehen kannst, hatte ich ganz vergessen.« Genauso gut hätte Eric sagen können: »Oh, dass du buchstabieren kannst, hatte ich ganz vergessen«, denn er zeigte weder Interesse noch Achtung. »Dann musst du uns vermutlich begleiten. Maxwell?«
»Wenn du es wünschst, bleibe ich hier.« Maxwell Lee wollte deutlich machen, dass er sehr gut wusste, wie sich ein treuer Untergebener zu verhalten hatte, und sah in die versammelte Runde, um seine Haltung noch zu unterstreichen.
Eric nickte. Wahrscheinlich würde Maxwell ein nettes Weihnachtsgeschenk erhalten und Bill– ups, der Namenlose– nur Kohlen und eine Rute. »Dann bleibst du hier. Und du auch, Thalia. Aber du musst mir versprechen, dass du dich in der Bar anständig benimmst.« Thalias Pflichten bestanden darin, an zwei Abenden die Woche im Fangtasia herumzusitzen und die mysteriöse Vampirin zu geben– was nicht immer ohne Zwischenfälle ablief.
Thalia, ständig mürrisch und grüblerisch, nickte knapp. »Ich wollte sowieso nicht hin«, murmelte sie. In ihren runden dunklen Augen stand nichts als Verachtung für die Welt. Sie hatte schon zu viel gesehen in ihrem langen Leben und sich in einigen Jahrhunderten so gar nicht amüsiert, wie es schien. Ich versuchte, Thalia so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Ich staunte, dass sie sich überhaupt mit anderen Vampiren abgab. Auf mich wirkte sie wie eine Einzelgängerin.
»Sie strebt nicht nach einer Führungsposition«, flüsterte Pam mir ins Ohr. »Sie will nur in Frieden gelassen werden. Aus Illinois ist sie rausgeflogen, weil sie nach der Großen Enthüllung zu aggressiv war.« Die Große Enthüllung nannten die Vampire jenen Abend, an dem sie überall auf der Welt im Fernsehen auftraten und verkündeten, dass sie tatsächlich existierten und zudem aus der Schattenwelt treten wollten, um am wirtschaftlichen und sozialen Leben der menschlichen Gesellschaft teilzuhaben.
»Eric lässt Thalia tun, was sie will, solange sie sich an die Regeln hält und pünktlich zu ihren Pflichtstunden in der Bar erscheint«, fuhr Pam wispernd fort. Eric war der Herrscher dieser kleinen Welt, und das vergaß niemand. »Sie weiß, welche Strafe sie erwartet, wenn sie aus der Reihe tanzt. Manchmal scheint sie allerdings zu vergessen, wie wenig ihr diese Strafe gefallen würde. Sie sollte mal Abbys Kolumnen lesen und sich ein paar Ratschläge holen.«
Fehlt es Ihrem Leben an Freude? Dann sollten Sie… äh, anderen Gutes tun, sich ein neues Hobby suchen, so was in der Art, stimmt’s? So lauteten doch die üblichen Ratschläge. Ich sah’s schon vor mir: Thalia, die in einem Hospiz freiwillig die Nachtschicht übernahm– ich schauderte. Thalia, die mit zwei langen scharfen Nadeln dasaß und strickte– ich zuckte vor Schreck zusammen. Zum Teufel mit all diesen Ratschlägen.
»Also nehmen nur Andre, die Königin, Sookie, ich selbst, Bill und Pam an der Konferenz teil«, sagte Eric. »Der Anwalt Cataliades und seine Nichte als Kurierin. Oh, ja, und Gervaise aus Bezirk Vier mit seiner Menschenfreundin. Das können wir ihm nicht abschlagen, nachdem er die Königin so großzügig aufgenommen hat. Rasul als Fahrer. Und Sigebert natürlich. Das sind alle. Ich weiß, ein paar von euch sind enttäuscht, und ich kann nur hoffen, dass das nächste Jahr besser wird für Louisiana. Und für Arkansas, das jetzt Teil unseres Territoriums ist.«
»Das war, glaube ich, alles, was wir gemeinsam besprechen müssen«, sagte Andre. Die restlichen Fragen würden er und Eric unter vier Augen diskutieren. Andre berührte mich kein weiteres Mal mehr, ein Glück, denn er jagte mir eine Heidenangst ein, die ich bis zu meinen rotlackierten Fußnägeln spürte. Okay, so hätte ich vermutlich über jeden in diesem Büro denken sollen. Wäre ich vernünftig, würde ich nach Wyoming ziehen, wo es die wenigsten Vampire gab (genau zwei, wie ich mal in einem Artikel in ›Vampire in Amerika‹ gelesen hatte). Manchmal geriet ich schon schwer in Versuchung.
Ich zog ein kleines Notizbuch aus meiner Handtasche, als Eric die Formalitäten durchging: das Datum der Abreise, das Datum der Rückreise, die Abflugzeit des von Anubis Airline gecharterten Flugzeugs, das aus Baton Rouge kommen und die Gruppe aus Shreveport abholen würde, und eine Liste der benötigten Kleidungsstücke. Einigermaßen entsetzt stellte ich fest, dass ich mir wieder mal etwas von meiner Freundin würde leihen müssen. Doch Eric fügte hinzu: »Sookie, da du diese Sachen ausschließlich für die Reise benötigst: Ich habe in der Boutique deiner Freundin angerufen und einen Geldbetrag hinterlegt. Nutze ihn.«
Ich spürte, wie ich rot anlief, und fühlte mich wie die arme Cousine, bis er weitersprach: »Für die anderen ist in zwei Geschäften hier in Shreveport Geld hinterlegt, aber das wäre zu unpraktisch für dich.« Mein Nacken entspannte sich, hoffentlich sagte er auch die Wahrheit. Nicht ein Zucken seiner Augenlider ließ auf etwas anderes schließen.
»Wir haben zwar eine Katastrophe erlebt, aber wir werden nicht abgerissen herumlaufen.« Eric bemühte sich, mir nur flüchtig einen Blick zuzuwerfen.
»Nicht abgerissen herumlaufen«, notierte ich mir.
»Ist so weit alles klar? Unsere Ziele auf der Konferenz sind es, die Königin gegen diese lächerliche Anschuldigung zu unterstützen und allen zu zeigen, dass Louisiana immer noch ein hohes Prestige hat. Keiner der Vampire aus Arkansas, die mit ihrem König nach Louisiana kamen, hat überlebt, und daher kann auch keiner von ihnen seine Version der Geschichte erzählen.« Eric lächelte, aber es war kein freundliches Lächeln.
Das hörte ich heute Abend zum ersten Mal.
Na, wenn das nicht praktisch war.
Kapitel 2
»Halleigh, Sie heiraten doch einen Detective. Da können Sie es uns bestimmt verraten… Wie groß ist eigentlich so ein Polizistenprügel bei Nacht?«, fragte Elmer Claire Vaudry.
Ich saß neben der Braut Halleigh Robinson, denn mir war die überaus wichtige Aufgabe übertragen worden, jedes Geschenk mitsamt seiner Geberin aufzuschreiben. Halleigh selbst war völlig damit ausgelastet, all die silberweiß eingewickelten Kartons und geblümten Geschenktüten zu öffnen.
Keine außer mir schien im Mindesten überrascht, dass Mrs Vaudry, eine Grundschullehrerin in den Vierzigern, auf dieser ganz und gar gutbürgerlichen Party eine so obszöne Frage stellte.
»Woher soll ich denn so was wissen, Elmer Claire«, sagte Halleigh spröde, gefolgt vom ungläubigen Kichern aller anderen Anwesenden.
»Schon gut, aber was ist mit den Handschellen?«, fragte Elmer Claire. »Benutzen Sie je solche Handschellen?«
Ein Stimmengewirr erhob sich unter den Südstaatenfrauen im Wohnzimmer der Gastgeberin Marcia Albanese, die ihr Haus als Opferstätte zur Verfügung gestellt hatte: Hier regnete es, aber eben Geschenke. Die anderen hatten die weniger aufwendige Aufgabe gehabt, etwas zum Essen oder Bowle mitzubringen.
»Sie sind mir ja eine, also wirklich, Elmer Claire«, mischte sich Maria ein, die gerade beim Tisch mit den Erfrischungen stand. Aber sie lächelte. Elmer Claire spielte gern die Rolle der Kecken, und die anderen ließen sie gewähren.
Elmer Claire wäre nie so ordinär geworden, wenn die alte Caroline Bellefleur bei dieser Junggesellinnenparty dabei gewesen wäre. Caroline galt als gesellschaftlicher Maßstab in Bon Temps. Miss Caroline war etwa eine Million Jahre alt und besaß eine Haltung, aufrechter und strenger als die eines jeden Soldaten. Nur etwas Außergewöhnliches konnte Miss Caroline von einem gesellschaftlichen Anlass fernhalten, der von solcher Bedeutung für ihre eigene Familie war, und etwas Außergewöhnliches war geschehen. Caroline Bellefleur hatte einen Herzinfarkt erlitten, zur großen Überraschung aller in Bon Temps. Nur ihre Familie war nicht so furchtbar überrascht gewesen.
Die große Bellefleur-Doppelhochzeit (von Halleigh und Andy und von Portia und ihrem Steuerberater Glen) hätte schon im vergangenen Frühling stattfinden sollen. Alles war in höchster Eile organisiert worden, weil Miss Carolines Gesundheitszustand sich plötzlich verschlechterte. Doch dann wurde Caroline Bellefleur, noch ehe diese Eilhochzeit stattfinden konnte, von einem Herzinfarkt niedergestreckt. Und danach brach sie sich die Hüfte.
Im Einverständnis mit Andys Schwester Portia und deren Bräutigam hatten Andy und Halleigh die Hochzeit in den späten Oktober verlegt. Soweit ich wusste, erholte sich Miss Caroline allerdings nicht so wie von ihren Enkeln erhofft, und es schien unwahrscheinlich, dass sie je wieder ganz zu ihrer alten Form zurückfinden würde.
Mit rot glühenden Wangen kämpfte Halleigh mit dem Geschenkband eines schweren Kartons. Ich reichte ihr eine Schere. Es gab zwar irgendeinen Brauch, dass man das Band nicht zerschneiden solle, weil damit die Anzahl der Kinder des Brautpaars vorhergesagt würde, aber ich wäre jede Wette eingegangen, dass Halleigh eine schnelle Lösung vorzog. Sie durchschnitt das Geschenkband an der Kartonseite, die ihr am nächsten war, damit ja niemand ihre herzlose Missachtung des Brauchs mitbekam, und warf mir einen dankbaren Blick zu. Wir trugen natürlich alle unsere beste Partykleidung, und Halleigh sah wirklich süß und sehr jung aus in ihrem hellblauen Hosenanzug mit den verstreut auf das Jackett gestickten roten Rosen. Als Ehrengast und Braut trug sie darunter natürlich ein Miedertop.
Mir kam es vor, als würde ich einen Stamm interessanter Eingeborener in einem fremden Land beobachten, einen Stamm, der zufällig meine Sprache spricht. Als Kellnerin stehe ich einige Sprossen unter Halleigh auf der gesellschaftlichen Leiter von Bon Temps. Und dann kann ich auch noch Gedanken lesen, obwohl die Leute das immer wieder gern vergessen, weil es bei meinem total normalen Äußeren so schwer zu glauben ist. Doch ich war auf der Gästeliste gelandet und hatte mir kleidungstechnisch größte Mühe gegeben. Und das ziemlich erfolgreich, wie ich fand. Zu einer ärmellosen, taillierten weißen Bluse trug ich eine gelbe Hose und gelb-orange Sandalen, und mein offenes Haar fiel weich auf meine Schultern herab. Gelbe Ohrringe und eine kleine Goldkette rundeten das Bild ab. Es mochte zwar Ende September sein, aber es war heiß wie im Schattenreich der Hölle. Fast alle der Frauen hatten ihre schicksten Sommersachen angezogen, nur ein paar Tapfere waren in Herbstfarben erschienen.
Ich kannte natürlich jede auf dieser Party. Bon Temps ist nicht sehr groß, und meine Familie lebt bereits seit fast zweihundert Jahren hier. Aber die Leute zu kennen heißt nicht automatisch, sich in ihrer Gegenwart wohlzufühlen, und so war ich ziemlich froh, dass ich die Geschenkeliste schreiben durfte.
Denn ob ich wollte oder nicht, ich erfuhr eine Menge. Zwar gab ich mir größte Mühe, nicht darauf zu achten– wobei meine kleine Schreibaufgabe mir half–, wurde aber trotzdem von Gedanken nur so überflutet.
Halleigh zum Beispiel schwebte auf Wolke sieben: Sie bekam Geschenke, sie stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, sie würde einen großartigen Kerl heiraten. Ich war nicht überzeugt, dass sie ihren Bräutigam wirklich richtig einschätzte, aber Andy Bellefleur hatte ganz bestimmt ein paar »großartige« Seiten, von denen selbst ich noch nie etwas mitbekommen hatte. Immerhin besaß Andy mehr Vorstellungskraft als der Durchschnittsmann von Bon Temps, das wusste ich. Und er hatte tief vergrabene Ängste und Wünsche, das wusste ich auch.
Halleighs Mutter war natürlich extra aus Mandeville zur Party angereist und hatte ihr bestes Lächeln aufgesetzt, um ihre Tochter zu unterstützen. Ich war sicher die Einzige, die wusste, wie sehr Halleighs Mutter Menschenansammlungen hasste, sogar so kleine wie diese hier. Jeder Augenblick, den Linette Robinson in Marcias Wohnzimmer verbringen musste, war die reinste Qual für sie. Jetzt gerade, während sie über einen weiteren Witz von Elmer Claire lachte, wünschte sie im Grunde nichts sehnlicher, als mit einem guten Buch und einem Glas Eistee zu Hause zu sitzen.
Ich wollte ihr eben zuflüstern, dass das Ganze (ich warf einen Blick auf meine Armbanduhr) in etwa einer Stunde, spätestens anderthalb, zu Ende sein würde– dachte aber zum Glück noch rechtzeitig daran, dass diese Mitteilung sie erst recht verschrecken würde. Also notierte ich »Selah Pumphrey, Geschirrhandtücher« und saß einfach nur da, bereit, das nächste Geschenk in meine Liste aufzunehmen. Als Selah Pumphrey vorhin zur Tür hereingesegelt kam, war sie wie immer auf einen Ausraster von mir gefasst gewesen. Selah ging schon seit Wochen mit jenem Vampir aus, von dem ich mich losgesagt hatte, und pflegte die fixe Idee, ich wolle mich auf sie stürzen und ihr eine Ohrfeige verpassen. Tja, obwohl sie mich überhaupt nicht kannte, hielt sie nicht sonderlich viel von mir. Ihr war zweifellos entgangen, dass ich den fraglichen Vampir mittlerweile komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen hatte. Vermutlich war sie sowieso nur eingeladen, weil sie die Maklerin war, über die Andy und Halleigh ihr kleines Haus gekauft hatten.
»Tara Thornton, Spitzenbody« schrieb ich und warf meiner Freundin Tara ein Lächeln zu. Ihr Geschenk für Halleigh stammte sicher aus dem Warenbestand von Tara’s Togs, ihrer eigenen Boutique. Natürlich, Elmer Claire ließ sich wieder ausführlich zu dem Spitzenbody aus, und eine Weile lang amüsierten sich alle– zumindest dem äußeren Anschein nach. Einige der Frauen hatten für Elmer Claires schlüpfrigen Humor nicht allzu viel übrig, andere dachten, dass Elmer Claires Ehemann einem echt leidtun konnte, und wieder andere wünschten einfach nur, sie möge endlich die Klappe halten– unter anderem Linette Robinson, Halleigh und ich.
Der Direktor der Schule, an der Halleigh unterrichtete, hatte dem Hochzeitspaar zwei wirklich schöne Platzdeckchen geschenkt und seine Stellvertreterin die dazu passenden Servietten. Das notierte ich mit einem riesigen Schnörkel und stopfte dann einen Teil des zerrissenen Geschenkpapiers in den Papierkorb neben mir.
»Danke, Sookie«, flüsterte Halleigh. Elmer Claire erzählte bereits eine weitere Geschichte über irgendetwas, das auf ihrer eigenen Hochzeit passiert war und an dem ein Huhn und der Trauzeuge beteiligt gewesen waren. »Wirklich toll, dass du mir hilfst.«
»Schon okay«, erwiderte ich ziemlich überrascht.
»Andy hat mir erzählt, dass du für ihn den Verlobungsring versteckt hast an dem Abend, als er mir den Antrag machte«, flüsterte sie lächelnd. »Und bei anderer Gelegenheit hast du mir auch schon geholfen.« Dann hatte Andy ihr also alles über mich erzählt.
»Kein Problem«, sagte ich ein bisschen verlegen.
Sie warf einen Blick auf Selah Pumphrey, die zwei Stühle entfernt saß. »Triffst du dich eigentlich noch mit diesem schönen Mann, mit dem ich dich mal gesehen habe?«, fragte Halleigh mich auf einmal eine Spur zu laut. »Mit diesem hinreißenden Typ mit dem prachtvollen schwarzen Haar?«
Halleigh hatte Claude genau einmal gesehen, als er mich vor meiner vorübergehenden Behausung in der Stadt absetzte– Claude, den Bruder von Claudine, meinem Schutzengel. Ja, wirklich. Claude war hinreißend, und er konnte (Frauen gegenüber) enorm charmant sein– etwa sechzig Sekunden lang. Und als wir auf Halleigh trafen, hatte er sich richtig Mühe gegeben, wofür ich nur dankbar sein konnte, denn Selah hatte jetzt die Ohren aufgestellt wie ein Fuchs.
»Ich habe ihn vor etwa drei Wochen zuletzt gesehen«, erwiderte ich wahrheitsgetreu. »Aber wir gehen nicht mehr miteinander aus.« Waren wir auch eigentlich nie, weil Claudes Vorstellung von einem gelungenen Date eher etwas mit einem Dreitagebart zu tun hatte und einer gewissen Ausstattung, die ich nie besitzen würde. Aber das musste ja nicht jeder wissen, stimmt’s? »Ich treffe mich mit einem anderen«, fügte ich bescheiden hinzu.
»Oh?« Halleigh tat ganz unschuldig interessiert. Mir gefiel das Mädchen (immerhin war sie volle vier Jahre jünger als ich) von Sekunde zu Sekunde besser.
»Ja«, sagte ich. »Ein Eventmanager aus Memphis.«
»Den musst du unbedingt auf die Hochzeit mitbringen«, schlug Halleigh vor. »Wäre das nicht großartig, Portia?«
Na, wenn das mal nicht zu weit ging. Portia Bellefleur, Andys Schwester und die zweite Braut der Bellefleur-Doppelhochzeit, hatte mich gebeten, mit meinem Boss Sam Merlotte auf der Hochzeit die alkoholischen Getränke zu servieren. Jetzt war Portia in der Klemme. Sie hätte mich niemals von sich aus als richtigen Gast eingeladen. (Und selbstverständlich war ich nicht zu Portias Jungesellinnenparty eingeladen.) Aber jetzt strahlte ich sie natürlich treuherzig mit einer Ich-freu-mich-ja-so-Miene an.
»Aber sicher«, erwiderte Portia aalglatt. Sie hatte nicht umsonst Jura studiert. »Wir würden uns freuen, wenn du deinen Freund mitbringst.«
Ich stellte mir schon vergnügt vor, wie Quinn sich auf dem Empfang in einen Tiger verwandelte. Und lächelte Portia nun umso strahlender an. »Mal sehen, ob er Zeit hat«, sagte ich.
»Und jetzt mal herhören, meine Lieben!«, rief Elmer Claire. »Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, ich solle mal aufschreiben, was Halleigh beim Geschenkeauspacken so alles von sich gibt. Denn wie wir alle wissen, werden das ihre Worte in der Hochzeitsnacht sein!« Sie wedelte mit einem Notizblock.
Alle verstummten, vor Freude. Oder vor Grauen.
»Zuerst hat Halleigh gesagt: ›Oh, wie schön das verpackt ist!‹« Pflichtbewusstes Lachen. »Dann folgte: ›Das passt bestimmt, ich kann’s kaum erwarten, es auszuprobieren!‹« Gekicher. »Und schließlich: ›Oh, genau das habe ich gebraucht!‹« Gelächter.
Danach wurde es Zeit für Kuchen, Bowle, Erdnüsse und Käsebällchen. Wir hatten alle unsere Plätze eingenommen und balancierten vorsichtig unsere Teller und Gläser, als die beste Freundin meiner verstorbenen Großmutter, die fast sechzigjährige Maxine Fortenberry, ein neues Thema anschnitt.
»Wie geht’s deiner neuen Freundin, Sookie?«, fragte sie mich, obwohl sie ganz am anderen Ende des Zimmers saß. Aber das war kein Problem für die kräftige, herzliche Maxine, die für meinen Bruder Jason, den besten Freund ihres Sohnes Hoyt, so etwas wie eine zweite Mutter war. »Diese Kleine aus New Orleans, meine ich.«
»Amelia geht’s prima.« Ich lächelte nervös, weil mir nur allzu klar war, wer jetzt im Zentrum der Aufmerksamkeit stand.
»Stimmt es, dass sie bei der Überflutung ihr Haus verloren hat?«
»Es hat wohl einige Schäden erlitten, sagt ihr Mieter. Amelia will aber erst mal abwarten, bis sie von der Versicherung hört, und dann entscheiden, was zu tun ist.«
»Was für ein Glück, dass sie hier war, als der Hurrikan zuschlug«, sagte Maxine.
Ich schätze, das hatte die arme Amelia seit August schon tausendmal gehört. Amelia war es jedenfalls ziemlich leid, gesagt zu bekommen, wie glücklich sie doch dran war. »Oh, ja«, stimmte ich zu. »Was für ein Glück.«
Amelia Broadways Ankunft in Bon Temps hatte Anlass zu jeder Menge Klatsch gegeben. Aber so was ist nur normal.
»Bleibt Amelia deshalb in nächster Zeit noch bei dir?«, fragte Halleigh hilfsbereit.
»Eine Weile«, erwiderte ich.
»Das ist wirklich äußerst nett von Ihnen«, sagte Marcia Albanese anerkennend.
»Ach, Marcia, wissen Sie, ich habe ja das ganze obere Stockwerk, das ich kaum nutze. Und sie hat dort sogar Verbesserungen vorgenommen. Mit dem tragbaren Klimagerät ist es gleich viel erträglicher da oben. Es macht mir nichts aus.«
»Trotzdem würden nicht viele jemanden so lange bei sich wohnen lassen. Vielleicht sollte ich selbst ein paar der armen Leute aufnehmen, die im Days Inn untergebracht sind. Aber ich bringe es einfach nicht fertig, Fremde in mein Haus zu lassen.«
»Ich habe gern Gesellschaft«, erwiderte ich, was größtenteils der Wahrheit entsprach.
»War sie schon in New Orleans und hat sich ihr Haus angesehen?«
»Oh, nur einmal.« Amelia hatte rasend schnell aus New Orleans wieder herausgemusst, damit keine ihrer hexenden Freundinnen sie aufspüren konnte. Es gab da so einige kleinere Schwierigkeiten zwischen Amelia und der Hexengemeinde von Big Easy.
»Ihr Haustier liebt sie jedenfalls über alles«, sagte Elmer Claire. »Neulich war sie mit dem Kater beim Tierarzt, als ich selbst mit Powderpuff hinmusste.« Powderpuff, Elmer Claires weiße Perserkatze, war ungefähr eine Million Jahre alt. »Ich habe gefragt, warum sie ihn denn nicht kastrieren lässt. Da hat sie dem Kater die Ohren zugehalten, als würde er mich verstehen, und mich gebeten, vor Bob nicht über solche Dinge zu sprechen– geradeso, als wäre er ein Mensch.«
»Ja, sie liebt Bob wirklich.« Ich wusste nicht, ob ich mich darüber lustig machen oder bloß lachen sollte bei der Vorstellung, der Tierarzt könnte Bob kastrieren.
»Woher kennst du diese Amelia noch mal?«, fragte Maxine.
»Erinnert ihr euch an meine Cousine Hadley?«
Alle im Zimmer nickten, außer Halleigh, die noch nicht allzu lange in Bon Temps war, und ihrer Mutter.
»Nun, Hadley hat in New Orleans das Apartment im oberen Stockwerk von Amelias Haus bewohnt«, erzählte ich. »Und als ich nach Hadleys Tod«– feierliches Kopfnicken in der Runde– »in New Orleans ihre Wohnung aufgelöst habe, bin ich dabei Amelia begegnet, und wir haben uns angefreundet. Tja, und dann wollte sie einfach mal eine Weile nach Bon Temps kommen.«
Alle Frauen sahen mich mit so erwartungsvollen Mienen an, als könnten sie kaum erwarten, was als Nächstes käme. Denn es gab doch sicher noch eine Menge zu erklären, stimmt’s?
An der Geschichte war tatsächlich noch viel mehr dran, aber sie würden bestimmt nicht hören wollen, dass Amelia Bob nach einer großartigen Liebesnacht während eines Sexexperiments zufällig in einen Kater verwandelt hatte. Ich hatte Amelia nie gebeten, mir die Details genauer zu beschreiben, denn eins wollte ich garantiert nicht: mir das alles auch noch bildlich vorstellen. Doch die Frauen warteten auf eine weitere Erklärung. Irgendeine.
»Amelia hatte gerade eine schlimme Trennung hinter sich«, sagte ich leise in vertraulichem Ton.
In den Gesichtern spiegelten sich sowohl reges Interesse als auch Mitleid.
»Ihr Freund war ein Mormonenmissionar«, erzählte ich. Na, Bob hatte zumindest ausgesehen wie ein Mormone in seiner schwarzen Hose und dem weißen kurzärmligen Hemd, und er war sogar auf einem Fahrrad zu Amelia gekommen. In Wahrheit war er ein Zauberer, so wie Amelia in Wahrheit eine Hexe war. »Er hat als Missionar an ihre Tür geklopft, und sie sind einander in Liebe verfallen.« Na ja, eigentlich miteinander ins Bett gefallen. Aber– ach, ist doch egal für den Zweck dieser Geschichte.
»Wussten seine Eltern davon?«
»Wusste seine Kirche davon?«
»Haben Mormonen nicht mehr als nur eine Ehefrau?«
Die Fragen prasselten derart auf mich nieder, dass ich nicht mehr folgen konnte, und so wartete ich erst mal, bis die Anwesenden wieder erwartungsvoll lauschten. Ich war es nicht gewöhnt, irgendwelche Geschichten zu erfinden, und langsam gingen mir schon die Halbwahrheiten aus, auf die ich sie gründen konnte. »Ich weiß nicht allzu viel über die Kirche der Mormonen«, erwiderte ich auf die letzte Frage, und das war die volle Wahrheit. »Obwohl ich glaube, dass die Mormonen heutzutage auch nicht mehr als eine Ehefrau haben dürfen. Aber den beiden sind dann seine Verwandten auf die Schliche gekommen, und die wurden richtig wütend, weil ihnen Amelia nicht gut genug war. Sie haben sich Bob geschnappt und ihn gezwungen, zurück nach Hause zu kommen. Deshalb wollte sie New Orleans verlassen. Um mal einen Ortswechsel zu haben, um die Vergangenheit zu vergessen, so was eben.«
Alle nickten, absolut fasziniert von Amelias großem Drama. Mich packte das schlechte Gewissen. Einige Minuten lang tat jede ihre Meinung zu dieser traurigen Geschichte kund.
Maxine Fortenberry fasste es schließlich zusammen. »Armes Ding. Er hätte seinen Verwandten die Stirn bieten sollen.«
Ich reichte der Braut ein weiteres Geschenk, das sie öffnen konnte. »Halleigh, so wird’s dir garantiert nicht ergehen.« Ich wollte das Gespräch wieder auf den Anlass der Party lenken. »Andy ist ganz verrückt nach dir, das kann jede hier bestätigen.«
Halleigh wurde rot, und ihre Mutter ergriff das Wort. »Wir alle mögen Andy sehr.« Und damit war die Party wieder in den richtigen Gleisen. Die restlichen Gespräche drehten sich um die Doppelhochzeit und wandten sich dann noch den Mahlzeiten zu, die jede Kirchengemeinde reihum für die Evakuierten kochte. Morgen Abend waren die Katholiken dran. Maxine klang ziemlich erleichtert, als sie erzählte, die Anzahl der zu Bekochenden sei bereits auf fünfundzwanzig geschrumpft.
Später auf dem Heimweg fühlte ich mich ein bisschen erschöpft von der ungewohnten Geselligkeit. Und außerdem machte ich mich darauf gefasst, Amelia ihre neu erfundene Vergangenheit erzählen zu müssen. Aber als ich auf meinen Hof fuhr und dort einen gewissen Pick-up stehen sah, waren all diese Gedanken wie weggeblasen.
Quinn war hier– der Wertiger Quinn, dessen Beruf es war, extravagante Veranstaltungen für die Welt der unheimlichen Geschöpfe zu planen und zu organisieren– mein lieber süßer Quinn. Ich fuhr auf die Rückseite des Hauses und sprang beinahe aus dem Auto, nicht ohne einen letzten besorgten Blick in den Rückspiegel zu werfen, ob mein Make-up noch in Ordnung war.
Quinn trat aus der Hintertür, als ich die Stufen hinauflief, und ich machte einen kleinen Satz. Er fing mich auf, wirbelte mich herum, und als er mich wieder absetzte, nahm er mein Gesicht in seine großen Hände und küsste mich.
»Du bist so schön«, sagte er, als er zwischendurch einmal Luft holen musste. Einen Augenblick später atmete er hörbar ein. »Und du riechst so gut.« Und küsste mich schon weiter.
Aber schließlich legten wir eine Pause ein und sahen uns an.
»Oh, wir haben uns so lange nicht gesehen!«, rief ich. »Wie ich mich freu, dass du hier bist!« Ich hatte Quinn seit Wochen nicht gesehen, und zuletzt auch nur kurz, als er auf dem Weg nach Florida durch Shreveport kam, mit einer ganzen Ladung Requisiten für das Fest zur Volljährigkeit der Tochter irgendeines Rudelführers.
»Wie ich dich erst vermisst habe, Liebling.« Seine großen weißen Zähne schimmerten, und sein kahlrasierter Schädel glänzte in der Sonne, die so spät am Nachmittag bereits ziemlich tief stand. »Ich hatte schon Gelegenheit, von deiner Mitbewohnerin einiges zu erfahren. Wie war’s denn auf der Party?«
»Wie’s auf solchen Partys eben so ist. Viele Geschenke, viel Klatsch. Das war jetzt schon die zweite für diese Braut. Ich habe dem Hochzeitspaar noch eine Servierplatte zu dem neuen Geschirr geschenkt. Ganz schön großzügig, was?«
»Es kann mehr als eine Party für dieselbe Braut geben?«
»In einer so kleinen Stadt wie dieser, ja. Und im Sommer hat sie auch noch bei sich zu Hause in Mandeville eine Dinnerparty gegeben. Andy und Halleigh sind jetzt vermutlich ziemlich gut ausgestattet.«
»Ich dachte, sie wollten schon letzten April heiraten.«
Ich erzählte ihm von Caroline Bellefleurs Herzinfarkt. »Und als sie das überstanden hatte und alle schon wieder nach einem Hochzeitstermin suchten, ist Miss Caroline gestürzt und hat sich die Hüfte gebrochen.«
»Wow.«
»Die Ärzte glaubten nicht, dass sie das überstehen würde, aber sie hat es überlebt. Tja, und so werden Halleigh und Andy und Portia und Glen irgendwann nächsten Monat die wohl am heißesten herbeigesehnte Hochzeit von Bon Temps feiern. Und du bist eingeladen.«
»Ich?«
Zu diesem Zeitpunkt waren wir schon auf dem Weg ins Haus, denn ich wollte meine Schuhe loswerden und herausfinden, was meine Mitbewohnerin trieb. Ich überlegte bereits, mit welcher Besorgung ich sie wegschicken könnte, da ich Quinn so selten zu sehen bekam und er in gewisser Weise ja mein Freund war– falls man das in meinem Alter (siebenundzwanzig) noch so nennen konnte.
Das heißt, er könnte mein Freund werden, wenn er sich jemals genug Zeit nehmen und sich richtig auf mich einlassen würde, dachte ich.
Aber Quinn, der für ein Tochterunternehmen von Elegante (Extreme) Events arbeitete, war für ein riesiges Gebiet zuständig. Seit in New Orleans Werwölfe versucht hatten, uns zu entführen, hatten wir uns genau dreimal wiedergesehen. An einem Wochenende war Quinn auf dem Weg nach sonst wo in Shreveport vorbeigekommen, und wir waren zum Dinner ins Ralph & Kacoo’s, ein beliebtes Restaurant, gegangen. Es war ein wunderbarer Abend gewesen, nach dem Quinn mich aber nach Hause fuhr, weil er am nächsten Morgen um sieben aufbrechen musste. Beim zweiten Mal war er während meiner Arbeitszeit ins Merlotte’s gekommen, und weil an dem Abend fast nichts los war, hatte ich eine Stunde freigemacht, mich zu ihm gesetzt, geplaudert und ein bisschen Händchen gehalten. Und beim dritten Mal hatte ich Quinn zu einer Speditionsfirma begleitet, wo Dinge für ihn eingelagert waren und er einen Anhänger beladen hatte. Das war mitten im Sommer gewesen, der Schweiß war uns in Strömen heruntergelaufen. Unerträgliche Hitze, Unmengen Staub, Lagerhallen, hier und da ein Fahrzeug, das über das Firmengelände kurvte… nicht gerade ein romantisches Ambiente.
Aber was hieß schon romantisch. Ich fand es auch nicht allzu verlockend, mich jetzt so hoppladihopp mit einem Mann einzulassen, den ich derart selten sah. Obwohl in diesem Augenblick Amelia pflichtschuldigst mit ihrer Handtasche über der Schulter die Treppe herunterkam und ganz offensichtlich in die Stadt entschwinden wollte, um uns ein wenig Privatsphäre zu geben.
»Tschüüüs!«, flötete Amelia mit einem breiten Grinsen im Gesicht, und weil sie die weißesten Zähne der Welt besaß, sah sie aus wie die Grinsekatze in ›Alice im Wunderland‹. Ihr kurzes Haar stand in alle Richtungen ab (angeblich konnte keiner in Bon Temps es richtig schneiden), und ihr gebräuntes Gesicht war ohne Make-up. Amelia wirkte wie eine dieser jungen Vorstadtmütter, die alle auf der Rückbank ihres Minivan einen Kindersitz haben– aber von der Sorte Mütter, die sich Zeit nehmen zum Joggen, Schwimmen und Tennisspielen. Amelia joggte wirklich dreimal die Woche und machte draußen auf dem Hof Tai-Chi-Übungen, doch sie ging nicht gern ins Wasser und hielt Tennis für eine Sportart für (ich zitiere) »künstlich beatmete Idioten«. Ich hatte Tennisspieler stets bewundert, aber wenn Amelia mal eine Meinung gefasst hatte, hielt sie daran fest.