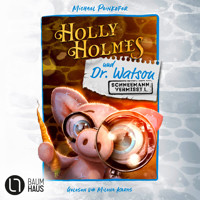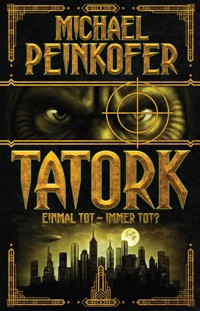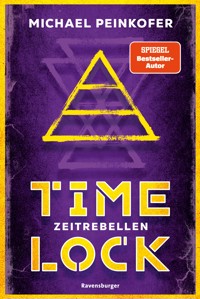5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Ordo Invisibilium will die totale Kontrolle über die Menschheit erlangen und trachtet seinen Feinden unerbittlich nach dem Leben. Nach dem gescheiterten Attentat versuchen sie nur noch stärker die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ein besonderer Dorn im Auge ist ihnen die Historikerin Alexandra Lessing, gnadenlos wird sie gejagt und mit ihr all jene, die sich dem bewaffneten Widerstand gegen den Orden angeschlossen haben. Währenddessen findet eine amerikanische Psychologin ein Kind in Hongkong, dass über eine seltene Fähigkeit verfügt und das Tor zu einer neuen Zeitrechnung aufstoßen könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-98342-6
April 2017
Die »Invisibilis«-Reihe ist ursprünglich unter Michael Peinkofers Pseudonym Marc van Allen bei den Ullstein Buchverlagen erschienen. Dieser Band unter dem Titel »Venatum. Die Invisibilis-Thriller, Band 2«
© der Originalausgabe: Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2008
© dieser Ausgabe: Piper Fahrenheit, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2017
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: agsandrew_shutterstock
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich Fahrenheitbooks nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
»Die Eigenschaft der Unsichtbarkeit ist nur für zwei Dinge gut: Um unbemerkt zu fliehen oder sich unbemerkt zu nähern. Also eignet sie sich hervorragend, um zu töten …«
H. G. Wells, Der Unsichtbare
»Nehmen wir einmal an, es gäbe zwei von diesen Ringen, die unsichtbar machen – einen, der von einer moralisch guten Person, und einen anderen, der von einer unmoralischen Person getragen wird. Dann wären beide Personen unsichtbar und niemand könnte die moralisch gute Person von der moralisch schlechten Person unterscheiden …«
Plato, Über den Staat, 2. Buch
Prolog
Flüchtige Eindrücke, die auf das schmerzgepeitschte Bewusstsein niederprasseln. Schlaglichter, die die Umgebung für Augenblicke aus der Dunkelheit reißen, um sogleich wieder zu verblassen.
Ein langer Korridor … Neonröhren an der Decke … gleißendes Licht … hektisch trampelnde Schritte … irgendwo ein quäkender Lautsprecher … dann Stimmen, die aufgeregt durcheinanderrufen.
»Was haben wir?«
»Vorzeitige Wehen, Sir. Eine Polizeistreife hat sie gefunden, unten an der Willard Street.«
»Obdachlos?«
»Offensichtlich, Sir.«
»Papiere?«
»Keine, Sir. Aber sie sagte, ihr Name sei Dorothy.«
»Dorothy. Und wie weiter?«
»Nichts weiter, Sir.«
»Na schön, dann muss das genügen«, sagt die energischere der beiden Stimmen und ist plötzlich direkt über ihr. »Dorothy, ich bin Dr. Huer. Ich bin Ihr zuständiger Arzt. Verstehen Sie, was ich sage, Dorothy?«
Trotz der Schmerzen, die sie quälen, zwingt sie sich zu einem Nicken. Das Gesicht, das über ihr schwebt und einem jungen Mann Anfang dreißig gehört, ist unverhohlen besorgt. Dann macht es den Mund auf und beginnt zu reden, erzählt Dinge, von denen sie nur die Hälfte begreift.
Von Fruchtwasser, das bereits ausgetreten sei.
Von einem Kind, das sich nicht gedreht habe.
Von einer sectio, die augenblicklich erforderlich sei.
»Verstehen Sie mich? Verstehen Sie, was ich sage?«
Sie nickt, während ihre Gedanken in diesem Augenblick nur dem winzigen, zerbrechlichen Leben gehören, das sich in ihr befindet. Sie will es nicht verlieren, fühlt sich noch nicht bereit, es in die Welt zu entlassen – und das nicht nur, weil die Zeit noch nicht reif ist, sondern weil ein dunkles Geheimnis das Kind in ihrem Schoß umgibt.
Ein Geheimnis von solch zerstörerischer Kraft, dass es den Fortbestand der Welt gefährden könnte.
»Nein!«, hört sie sich selbst schreien, während sie die Hände auf die Wölbung ihres Unterbauchs presst und mit Entsetzen feststellt, dass sie das Kind dort nicht mehr fühlen kann. Es ist noch da, aber die Verbindung zu ihm scheint abgerissen, die Loslösung bereits eingesetzt zu haben.
»Neiiin …!«
Ihr Schrei verhallt im Korridor, durch den sie geschoben wird, auf einer kargen Liege aus metallenem Rohrgestänge, einer breiten, von hinten beleuchteten Milchglastür entgegen. Mit elektrischem Summen schwingt die Tür auf, kurz bevor die Trage dagegenstoßen kann. Das Licht wird noch greller, antiseptischer Geruch brennt in ihrer Nase.
Ein gutes Dutzend Hände fallen über sie her. Sie wehrt sich nicht dagegen, der Schmerz in ihrem Unterbauch ist zu groß. Man beraubt sie ihrer Kleider, legt sie auf einen Operationstisch aus blankem Stahl und beginnt, sie zu untersuchen – und über allem hört sie immer wieder die Stimme Dr. Huers, der sie zu beruhigen versucht, während sie nichts anderes tun kann als schreien.
Dann: der Einstich.
Wie eine Messerklinge fährt er in ihr Becken und injiziert die Narkose in ihr Rückenmark. Für einen Augenblick ist der Schmerz so überwältigend, dass ihr Schrei erstickt und sie nichts als dunkle und helle Flecke vor Augen sieht. Dann spürt sie, wie die Betäubung zu wirken beginnt. Der Schmerz verschwindet hinter Nebelschleiern, die sich mit jedem Augenblick verdichten, während ihr Unterleib langsam abzusterben scheint.
Ein weiterer Einstich in ihrem Unterarm – ein Antibiotikum, wie man ihr sagt –, aber es ist ihr gleichgültig. Ihr eigenes Schicksal ist bedeutungslos angesichts des neuen Lebens, dem nun all ihre Gebete, ihre Ängste und ihre Hoffnungen gehören.
»Ismael«, flüstert sie. »Ismael.«
Sie streckt eine Hand aus in der Hoffnung, dass er da wäre und sie ergreifen würde, um ihr Mut und Trost zu spenden. Aber sie ist allein und auf sich gestellt und die einzige Hand, die schließlich doch nach ihrer Rechten greift, ist mit Latex umhüllt. Keine Wärme, keine Nähe.
Vergeblich versucht sie, sich aufzurichten, um zu sehen, was mit ihr geschieht. Ein Vorhang wird vorgezogen, der ihr den Blick auf ihren Unterleib verwehrt, obwohl sie deutlich spüren kann, dass die Operation bereits begonnen hat. Dumpfe Empfindungen durchströmen ihren Körper, keine Schmerzen, aber doch eine lebhafte Vorstellung von dem, was jenseits des Vorhangs geschieht.
Die Stimmen der Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen klingen gedämpft unter dem Mundschutz, den sie tragen. In beherrschtem Tonfall, der keine Gefühlsregung erkennen lässt, werden Anweisungen gegeben und Informationen ausgetauscht.
»Mein Baby«, flüstert sie immer wieder. »Mein Baby …«
Plötzlich kehrt Schweigen ein.
Von einem Augenblick zum anderen herrscht eine Stille, die vollkommen ist und eine quälende Ewigkeit zu währen scheint – bis sie von einem erlösenden Schrei durchbrochen wird.
Das Kind, soeben aus dem Bauch der Mutter gehoben, gibt das elementarste aller Lebenszeichen von sich und sie atmet auf. Das Kind lebt und sie will es sehen.
»Mein Baby!«, ruft sie laut. »Wo ist es?«
Noch immer herrscht Schweigen.
Keiner der Ärzte sagt ein Wort, nur das Schreien des Kindes ist zu hören.
»Mein Baby!«, verlangt sie, Panik in der Stimme. »Wo ist es? Zeigt es mir, ich will es sehen!«
Die Ärzte schweigen noch immer.
Dafür sind endlich Schritte zu hören.
Eine Hebamme, die einen blauen OP-Kittel trägt und dazu Haube und Mundschutz, kommt um den Vorhang herum, ein in blutige Tücher gewickeltes schreiendes Bündel im Arm. Ihr schockierter Blick versetzt die Mutter noch mehr in Unruhe.
»Was ist mit meinem Baby?«, schreit sie, dass es von der hohen Decke widerhallt. »Ist es gesund? Bitte sagen Sie doch etwas.«
Anstatt zu antworten, beugt sich die Hebamme herab und hält ihr das Bündel hin, schlägt die Handtücher so auseinander, dass das Gesicht des Kindes sichtbar wird.
Die Mutter ist erleichtert.
Blut und eine bläuliche Schmierschicht bedecken das kleine, verkniffene Gesicht. Die Augen sind fest geschlossen, so, als weigerten sie sich, der Wirklichkeit entgegenzublicken, während laute, quäkende Schreie aus dem kleinen Mund dringen.
So hilflos, so unschuldig, so unwissend um die Kälte und Bosheit der Welt, liegt das Kind vor ihr, dass die Mutter nicht anders kann als zu lächeln. Das Neugeborene berührt ihr Herz und unwillkürlich fragt sie sich, weshalb die Ärzte noch immer betreten schweigen – denn in ihren Augen ist das Kind vollkommen.
Sehnsüchtig streckt sie die Hände danach aus, als die Hebamme mit einem losen Stück Handtuch über das Gesicht des Neugeborenen wischt, um es von Blut und Schmiere zu befreien – und nichts darunter zutage tritt.
Keine zarte, vom Schreien gerötete Haut.
Keine hilflos suchenden Augen.
Keine rosigen Wangen.
Obwohl das Kind schreit und seine Stimme laut und vernehmlich ist, scheint sich nichts unter all den Schichten von Blut und Sekreten zu befinden, und während die junge Mutter erst ganz allmählich zu begreifen beginnt, spürt sie, wie der Blick der Hebamme sich in unverhohlener Anklage auf sie richtet.
»Niemand«, sagt sie vorwurfsvoll, »kann dieses Kind sehen – und das ist allein Ihre Schuld!«
»Nein!«
Der Klang ihrer eigenen Stimme riss Alexandra Lessing aus dem Schlaf. Jäh fuhr sie hoch, getrieben vom Gedanken an Flucht – nur um festzustellen, dass sie sich keineswegs in einem Operationssaal befand.
Das grelle Licht war schlagartig beruhigendem Halbdunkel gewichen und die einzigen Geräusche, die zu hören waren, stammten vom Verkehr auf dem nahen Interstate. Ihre Blicke erfassten vertraute Gegenstände und Alex wurde klar, dass sie sich nicht etwa in einem Krankenhaus aufhielt, sondern zu Hause, in ihrem Apartment südlich von Washington D. C.
»Es war nur ein Albtraum«, stellte sie flüsternd fest, und um es sich endgültig klarzumachen, wiederholte sie die Worte noch einmal, dabei jede einzelne Silbe betonend: »Nur ein Albtraum.«
Unwillkürlich fiel ihr Blick auf die andere Hälfte des Doppelbetts, die jedoch verwaist war. Laken und Decke lagen unberührt, wie so oft in den letzten Wochen. Ismael war häufig unterwegs – »geschäftlich«, wie er es zu nennen pflegte. Alex jedoch war klar, dass jede dieser angeblichen Geschäftsreisen ihn das Leben kosten konnte, so wie Winston Seymour und unzählige andere vor ihm. Der Kampf war erbarmungslos und wurde mit aller Härte ausgetragen, Gnade wurde nicht gewährt. Ein Krieg spielte sich ab vor den Augen der Welt, von dem die allermeisten Menschen jedoch nichts ahnten.
Noch vor wenigen Monaten hatte Alex zu dieser überwältigenden Mehrheit gehört. Als Dozentin für Neuere Geschichte war sie an der Universität München ihrer Arbeit nachgegangen und hatte keinen Gedanken an jene Dinge verschwendet, die ihr Leben schon kurz darauf aus der Bahn geworfen hatten. Dinge, die sie noch vor nicht allzu langer Zeit als bloße Fantasterei, als kindische Science-Fiction abgetan hätte – und die dennoch die Welt bedrohten.
Unerkannt arbeiteten sie im Hintergrund.
Unsichtbar.
»Es war nur ein Albtraum«, redete sie sich noch einmal ein, aber wie zuvor fehlte ihrer Stimme die Überzeugung.
Ein Blick auf den Wecker auf dem Nachtschrank:
Kurz nach fünf.
In einem jähen Entschluss schwang sich Alex aus dem Bett, um das zu tun, wovor sie sich die letzten Tage beständig gefürchtet hatte. Als ob es noch nicht zu spät wäre, schalt sie sich selbst. Als ob es einen Unterschied machte, ob sie es wusste oder nicht. Der Traum jedoch hatte ihr klargemacht, dass sie Gewissheit wollte.
Sie ging ins Badezimmer, knipste das Licht an und erschrak ein wenig über die blassen, von kurzgeschnittenem dunklen Haar umrahmten Züge, die ihr aus dem Spiegel entgegenblickten. Noch vor Kurzem, sagte sie sich, hatte dieses Gesicht anders ausgesehen – oder sah um fünf Uhr morgens jedes Gesicht so aus?
Sie lächelte freudlos. Dann öffnete sie den Spiegelschrank und entnahm ihm die kleine Schachtel, die sie ganz hinten versteckt hatte, damit Ismael sie nicht fand. Sie machte die Packung auf und entnahm ihr den Gegenstand, der in etwa Form und Größe eines Kugelschreibers hatte und dennoch ganz anderen Zwecken diente. Rasch überflog sie die Packungsbeilage, ehe sie tat, wozu sie darin aufgefordert wurde.
Dann setzte das unerträgliche Warten ein.
Obwohl es nur wenige Minuten waren, kamen sie Alex wie eine Ewigkeit vor. Nervös mit den Fingern trommelnd, saß sie auf dem Badewannenrand, während sie immer wieder auf das kleine Instrument aus Plastik starrte, das sie auf das Bord gelegt hatte. Aus sicherer Entfernung, als wäre es eine Bombe, die jeden Augenblick explodieren könnte.
Endlich war es soweit.
Alex bebte am ganzen Körper, als sie nach dem Gegenstand griff, denn ihr war klar, dass die nächsten Sekunden ihr Leben verändern konnten – und möglicherweise nicht nur ihres.
Sie nahm die Teströhre und warf einen Blick auf das kleine Sichtfenster – um dann die Röhre fallen zu lassen, so als hätte sie sich daran die Finger verbrannt.
Alex holte tief Luft. Vergeblich versuchte sie, sich zu beruhigen, während sich ihr Pulsschlag zu hämmerndem Stakkato steigerte. Zögernd, fast widerwillig hob sie den Test vom Boden auf und nahm ihn noch einmal prüfend in Augenschein – obwohl sie ahnte, dass das Ergebnis unverändert war.
Nicht einer, sondern zwei blaue Striche.
Schwanger.
Teil I
Videns
1.
Um die Wahrheit zu sagen, habe ich den Grund, warum Menschen Bücher lesen, nie wirklich verstanden.
Was, in aller Welt, treibt jemanden dazu, ein Buch in die Hand zu nehmen, es aufzuschlagen und Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort jene Gedanken nachzuempfinden, die ein anderer schon lange vor ihm hatte? Warum beschreiten die Menschen nicht eigene Pfade, anstatt sich in den ausgetretenen Bahnen anderer zu bewegen? Warum haben sie keine eigenen Gedanken?
Ich habe lange gebraucht, um die Antwort auf diese Frage zu finden: Es ist ihre Feigheit, die die Menschen dazu treibt, ihr Unvermögen, eigene Gedanken zu fassen und eigene Pläne zu entwickeln. Im Gegensatz zu uns.
Die Zahl der Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe, lässt sich an zwei Händen abzählen. Ich hasse es, mich den Gedanken eines anderen aussetzen zu müssen – wozu sollte ich? Muss es in Wahrheit nicht umgekehrt sein? Sollten sich die Menschen nicht vielmehr mit meinen Gedanken auseinandersetzen? Bin ich es nicht, der aufgrund seiner Natur und der Vision, die er verfolgt, den anderen weit überlegen ist?
Anstatt das wiederzukäuen, was andere vor mir gedacht und getan haben, ziehe ich es vor, selbst zu handeln und selbst zu kontrollieren.
Das war schon immer so.
Unbekannter Ort
Sechs Monate nach dem vereitelten Anschlag auf das Hauptquartier der Vereinten Nationen, New York
»Sie haben mich rufen lassen?«
»Allerdings, Gallagher – es gibt eine heiße Spur.«
»Eine heiße Spur, Sir?«
»In der Tat, mein junger Freund.«
Es schienen zwei Stimmen ohne Körper zu sein, die sich in dem abgedunkelten Raum unterhielten, dessen Wände aus glattem, blankem Stahl bestanden. Andernfalls wäre im Gesicht des jüngeren Gesprächspartners ebenso viel Erstaunen wie Genugtuung zu erkennen gewesen.
»Wo?«, war alles, was er wissen wollte.
»Den Informationen zufolge, die unsere Washingtoner Außenstelle uns zugespielt hat, deutet alles darauf hin, dass sich die gesuchten Personen in der Nähe der US-Hauptstadt aufhalten. Allem Anschein nach haben sie eine kleine Wohnung in Alexandria bezogen und leben dort den kleinen Traum vom stillen Glück.« Die ältere Stimme lachte zynisch.
»Dieser Traum wird schon bald zum Albtraum werden, Sir«, zischte der Jüngere. »Dafür werde ich persönlich sorgen.«
»Tun Sie das, Gallagher. Sie wissen, wir haben uns für einiges zu revanchieren.«
Das stimmte allerdings und der konturlose Schatten, den der andere mit dem Namen Gallagher angesprochen hatte, war sich dessen nur zu bewusst – wäre es anders gewesen, hätte dieses Gespräch nicht stattzufinden brauchen, und schon gar nicht an diesem düsteren, geheimen, der Welt entrückten Ort.
Vor wenigen Monaten hätte sich alles ändern können.
Alles.
Ein Anschlag auf den sogenannten »Weltgipfel«, eine Zusammenkunft der wichtigsten Staatsoberhäupter dieser Erde, zu der auch die Vertreter von Schwellenländern und Drittweltstaaten eingeladen worden waren, hätte auf einen Schlag die gesamte politische Führung der Welt auslöschen sollen. Eine atomare Explosion im Herzen von New York City, ein greller Lichtblitz, der Hunderttausende von Menschen ins Verderben riss und mit ihnen die Machthaber dieser Erde – und die Sonne des darauf folgenden Tages hätte auf eine veränderte Welt geblickt. Eine Welt, in der die alten Gesetzmäßigkeiten keinen Bestand mehr hatten.
In der Anarchie, die um sich gegriffen hätte, im Chaos der gegenseitigen Schuldzuweisungen, in die die Länder fraglos verfallen wären, und in der Dämmerung der sich anbahnenden Kriege hätte eine neue, unbekannte Größe nach der Macht gegriffen. Eine Organisation, von der die Menschheit bislang noch nicht einmal etwas ahnte und die es dennoch gab. Im Verborgenen hatte sie bisher existiert und gewirkt, immer wieder, die Jahrtausende hindurch. Sie hatte die Entscheidungen der Menschen beeinflusst und ihre Geschichte nachhaltig bestimmt.
Der ordo invisibilium.
New York hatte die Wende markieren, hatte dem Orden den uneingeschränkten, direkten Einfluss auf die Verwaltungsorgane dieser Welt sichern sollen. Als rettende Macht, als Lösung aller Probleme und Antwort auf alle Fragen hatte er sich der verzweifelten Menschheit präsentieren und so nach einer langen Zeit unerkannten Wirkens aus dem Schatten der Geschichte treten wollen.
Doch es war anders gekommen.
Eine Gruppe verbrecherischer Aufständischer, die sich die Anderen nannten, hatte den Plan aufgedeckt, und obwohl es zur Strategie gehört hatte, den Rebellen das Vorhaben nach und nach zu offenbaren und sie so unfreiwillig zu Komplizen des Anschlags zu machen, war das Unternehmen am Ende gescheitert. Ein pensionierter New Yorker Cop namens Winston Seymour, der die Schlüsselfigur des Komplotts gewesen war, hatte sich schließlich als das indifferente Element der Gleichung erwiesen, als Risiko, das man nicht hatte vorausberechnen können.
Gallagher zweifelte nicht daran, dass es mehr ein unglücklicher Zufall gewesen war als Seymours freier Wille, der die Pläne des Ordens vereitelt hatte – schließlich war er nicht einmal ein electus gewesen, sondern nur ein durchschnittlicher Vertreter der Spezies homo sapiens, und dazu noch einer, der dem Suff und der Depression verfallen war. Aber es stand außer Frage, dass Seymour Helfer gehabt hatte – und diese Helfer zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen hatte Gallagher geschworen.
»Nennt er sich noch immer Ismael?«, wollte er unvermittelt wissen.
»Jedenfalls haben wir keine anders lautenden Informationen. Der Hang zur Theatralik, den diese Aufständischen an den Tag legen, ist mitleiderregend. Wussten Sie, dass sie alle ihre ursprünglichen Namen abgelegt und stattdessen solche aus der Literatur ausgewählt haben? Shakespeare, Tolstoi, Goethe, Melville – niemands Werk ist vor ihnen sicher.«
»Ismael – der Name ist nicht nur dämlich, sondern auch völlig unpassend. Der Ismael aus der Literatur hat seinen Kampf gegen die Bestie überlebt – diesem hier wird das nicht gelingen, darauf gebe ich Ihnen mein Wort.«
»Das haben Sie bereits getan, mein junger Freund. Halten Sie dieses Versprechen einfach und der Dank des Ordens ist Ihnen gewiss.«
»Was ist mit der Deutschen?«
»Soweit wir wissen, ist sie bei ihm. Allerdings hat auch sie ihren Namen geändert – sie nennt sich jetzt Dorothy.«
»Dorothy. Und weiter?«
»Gale«, drang es gedämpft zurück.
»Ahnte ich es doch.« Gallagher lachte leise. »Ich konnte diesen Film noch nie leiden. Diese grässliche Musik! Und wie das Bild von schwarzweiß auf farbig wechselt …«
»Das gefällt Ihnen wohl nicht?«
»Nein, Sir. Offen gestanden konnte ich mich mit dieser Sorte Kitsch nie anfreunden, denn in der Welt, in der ich lebe, ist es genau umgekehrt.«
Die ältere Stimme aus dem Nichts lachte kehlig. »Ich weiß, was Sie meinen, mein Junge – und Ihr Vater hat es ebenfalls gewusst. Vermissen Sie ihn bisweilen?«
Wäre Gallagher sichtbar gewesen, hätte man gesehen, wie sich seine athletische Gestalt straffte. »Nein, Sir«, behauptete er. »Mein Vater gab sein Leben im Dienst für den Orden und für unsere Rasse. Ich habe keinen Grund, ihn zu vermissen.«
»Eine gute Antwort«, scholl es aus dem Nichts. »Ich habe schon immer große Stücke auf Sie gehalten, Gallagher, schon vom Augenblick unserer ersten Begegnung an, und ich hoffe, dass Sie mich auch diesmal nicht enttäuschen werden – ungeachtet dessen, was in Ihnen vorgehen mag.«
»Keine Sorge, Sir. Ismael und die Deutsche werden gefasst und ihrer gerechten Strafe zugeführt werden, so wahr ich hier vor Ihnen stehe.«
»Ich kann Sie nicht sehen, mein Junge«, erwiderte der Ältere und lachte auf eine Weise, wie nur die Grauen es vermochten. »Tatsächlich kann ich Sie nicht sehen.«
George Washington University Hospital,
Gynäkologische Abteilung
Washington D. C.
Am nächsten Tag
»Und?«
Alexandra Lessings Stimme bebte, als sie die Frage stellte. Kalter Schweiß stand ihr auf der Stirn, die Luft im Sprechzimmer kam ihr unglaublich stickig vor.
»Nun«, meinte Dr. Clayborne, ein väterlich wirkender, dunkelhäutiger Mitfünfziger, der seine Freude über das Untersuchungsergebnis nicht verhehlen konnte oder wollte. »Ein Schnelltest gibt natürlich immer nur eine Momentaufnahme und kann durchaus auch falsche Ergebnisse liefern, besonders wenn die Probandin erhöhtem Stress ausgesetzt ist.«
»Aber?«, bohrte Alex weiter.
»In Ihrem Fall jedoch«, fuhr Clayborne mit feierlicher Miene fort, »können wir dies mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen. Bluttest und Ultraschalluntersuchung lassen nur einen Schluss zu: Sie sind schwanger, meine Liebe.«
»Sind Sie ganz sicher?«
»Aber ja.« Clayborne lächelte und rückte seine altmodische Brille zurecht. »Herzlichen Glückwunsch, Miss Gale.«
»Danke«, sagte Alex, ohne eine Miene zu verziehen.
»Sie scheinen nicht besonders erfreut darüber zu sein.«
»Offen gestanden hatte ich bis zuletzt gehofft, dass …«
»Ich verstehe.« Clayborne nickte, das Lächeln brach aus seinem Gesicht wie Putz von einer alten Wand. »Haben Sie denn noch keine Schwangerschaftssymptome empfunden? Hatten Sie kein Spannungsgefühl in den Brüsten?«
»Nein.«
»Morgenübelkeit?«
Alex schürzte die Lippen. Was hätte sie dem Arzt sagen sollen? Dass sie seit jenem Tag, da sie von der Existenz des Ordens und seinem Wirken in der Welt erfahren hatte, jeden Morgen weiche Knie hatte, wenn sie sich aus dem Bett erhob? Dass ihr regelmäßig übel wurde, wenn sie nur daran dachte, dass die Geschichte seit mehr als dreitausend Jahren von unsichtbaren Mächten beeinflusst wurde? Dass sie schon vor Monaten damit aufgehört hatte, ein normales Leben zu führen?
»Sehen Sie«, meinte Clayborne zufrieden, der ihr Schweigen missdeutete. »Der moderne Mensch hat es leider verlernt, in sich hineinzuhorchen und auf seinen Körper zu vertrauen. Das würde uns manche Überraschung ersparen, glauben Sie mir.«
»Allerdings«, sagte Alex nur.
»Miss Gale – in diesem Sprechzimmer haben vor Ihnen schon viele junge Frauen gesessen, die zunächst schockiert waren von der Aussicht, ein Kind zu bekommen. Mutter zu werden bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Sich dem Leben auf eine Art und Weise zu stellen, wie Sie es sich bislang vielleicht noch nicht vorstellen können. Aber ich versichere Ihnen, dass ich aus Erfahrung genau weiß, was …«
»Nein, Doktor«, fiel Alex ihm leise ins Wort und konnte nicht verhindern, dass ihre Augen feucht wurden. »Sie wissen nichts. Gar nichts.«
»Natürlich.« Clayborne lächelte verschämt. »Ich bin ein Mann, und wenn Sie sagen, dass mir die biologische Berufung fehlt, um mich exakt in Ihre Rolle hineinzuversetzen, so haben Sie damit natürlich recht. Diese Dame hier allerdings kann es.« Er griff in ein kleines Kästchen, das auf seinem Schreibtisch stand, und zog eine Visitenkarte heraus, die er Alex reichte.
»Was ist das?«, fragte sie einigermaßen verwirrt.
»Die Karte von Carla Warren. Sie ist Sozialarbeiterin und hat viel Erfahrung im Umgang mit …«
»Vergessen Sie’s«, erwiderte Alex barsch und erhob sich. Ihren Mantel und ihre Tasche presste sie an sich, als schämte sie sich im Nachhinein wegen der Blöße, die sie sich vor dem Arzt gegeben hatte. Nicht in physischer, sondern in emotionaler Hinsicht. »Haben Sie vielen Dank, Doktor«, sagte sie und wandte sich zum Gehen. »Ich weiß Ihre Bemühungen sehr zu schätzen, aber ich bezweifle, dass Mrs. Warren oder irgendjemand sonst verstehen kann, was in mir vorgeht.«
»Lassen Sie es auf einen Versuch ankommen, Miss Gale«, rief Clayborne ihr nach, während sie bereits zur Tür ging, »und vergessen Sie nicht, sich einen Termin geben zu lassen wegen der nächsten Ultraschallunter…«
Den Rest von dem, was der Arzt sagte, hörte Alex nicht mehr – sie hatte das Sprechzimmer verlassen und die Tür hinter sich geschlossen. Wie in Trance durchmaß sie den Korridor, passierte den Empfangstresen, wo eine Krankenschwester ihr irgendetwas zurief, und nahm den Lift hinunter ins Erdgeschoss.
Vor dem Krankenhaus warteten Taxen, von denen sie eine bestieg und sich nach Alexandria bringen ließ. Es war früher Abend und auf dem Dupont Circle herrschte reger Verkehr. Alex jedoch hatte keine Augen für die Hektik, die jenseits der getönten Autofenster herrschte. Ihr Blick war nach innen gerichtet, auf die Myriaden widersprüchlicher Gefühle, die in ihr tobten, und auf das Leben, das in ihr reifte. Mit aller Macht wehrte sie sich dagegen, als gegeben hinzunehmen, was Clayborne ihr eröffnet hatte, obwohl sie wusste, dass es sinnlos war, es noch weiter zu leugnen. Sie war schwanger und erwartete ein Kind von dem Mann, den sie zwar aufrichtig liebte und der ihr der einzige Rettungsanker in dieser Welt zu sein schien, die völlig aus den Fugen geraten war, der jedoch auch mit einem schwerwiegenden Makel behaftet war.
Er war unsichtbar.
Ein invisibilis der dritten Generation, das Kind zweier Menschen, die ebenfalls unsichtbar gewesen waren. Was, wenn Ismael dieses Unsichtbarkeits-Gen, das er von seinen Eltern geerbt hatte, an sein Kind weitergegeben hatte? Jenen Teil seiner Erbmasse, die dafür verantwortlich war, dass sich seine Körpermoleküle in fortwährender optischer Oszillation befanden und er dem bloßen menschlichen Auge dadurch verborgen blieb?
Mehrmals hatte er Alex die Grundprinzipien der »negativen Rezeption« erklärt, ohne dass sie behaupten konnte, sie tatsächlich begriffen zu haben. Zwar verstand sie den zugrunde liegenden Gedanken, den Ismael gewöhnlich mit einem Ventilator verbildlichte, dessen Propeller bei entsprechender Geschwindigkeit ebenfalls unsichtbar wurden – wie sich dieses Prinzip allerdings auf die Molekularphysik übertragen ließ, weshalb es nur bei organischer Masse funktionierte und wie es kam, dass es sich aus der Bioelektrizität des menschlichen Körpers speiste, war Alex nach wie vor ein Rätsel. Kein Wunder, schließlich war sie Historikerin und keine Naturwissenschaftlerin. Sie war weder dazu ausgebildet noch dazu gemacht, Dinge wie diese zu verstehen – dennoch würde ihr nichts anderes übrigbleiben, wenn sich herausstellte, dass ihr Kind ebenfalls mit dem Makel des Vaters behaftet war.
Ein Makel, der sich ebenso gut als Chance erweisen konnte wie als Fluch.
Obwohl sie sich dem Widerstand gegen den Orden angeschlossen hatte und im Dienst der Anderen stand, hatte Alex die Hoffnung nie ganz aufgegeben, dass vielleicht, eines fernen Tages, eine Zeit anbrechen könnte, da sie wieder in ihr altes Leben zurückkehren, ihrer früheren Arbeit nachgehen und eine ganz normale junge Frau sein konnte. Wenn sie ehrlich sich selbst gegenüber war, musste Alex sich eingestehen, dass sie nie wirklich verstanden hatte, weshalb Ismael damals gerade ihr das Logbuch zugespielt hatte, das den Bericht über eine U-Boot-Mission enthielt, die in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs unter strengster Geheimhaltung durchgeführt worden war, und das Hinweise auf die Existenz der Unsichtbaren barg.
Man hatte ihr gesagt, dass sie aufgrund ihres Forschungsgebiets ausgewählt worden war, um das Geheimnis zu entschlüsseln. Alex hatte sich auf historische Wahrheitsfindung spezialisiert. Aber es hätte sicher auch noch viele andere talentierte Wissenschaftler gegeben, die zum einen der deutschen Sprache mächtig und zum anderen familiär ungebunden waren. Was es tatsächlich war, was die Anderen auf sie aufmerksam gemacht hatte, würde Alex wohl immer ein Rätsel bleiben.
Ismael gehörte der sogenannten dritten Generation der Unsichtbaren an. Beide Elternteile waren Unsichtbare gewesen, da war es nur natürlich, dass auch er unsichtbar war. Aber bei diesem Kind war es anders. Alex war eine normale Frau, gehörte der sichtbaren Welt an. Vielleicht würde sich ja ihr Erbe durchsetzen. Möglicherweise würde ihr Kind völlig normal sein.
Aber was, wenn sie tatsächlich ein Kind bekam, das Ismaels Erbe in sich trug und wie er über jene sagenumwobene Fähigkeit verfügte, über die sich Philosophen und Schriftsteller seit Jahrtausenden den Kopf zerbrachen? Darüber wollte Alex gar nicht erst nachdenken.
Vielleicht, redete sie sich ein, war es besser, wenn es das Licht der Welt gar nicht erst …
»Alles in Ordnung, Miss?«
Die Stimme des Taxifahrers riss sie aus ihren Gedanken. Besorgt blickte der junge Mann, der indischer Herkunft zu sein schien, in den Rückspiegel. Offenbar hatte er die Tränen bemerkt, die ihr über die Wangen rannen.
»Ja«, versicherte sie, »alles in Ordnung«, und wischte sich die Tränen ab.
»Bestimmt?«
»Ja doch«, beteuerte sie noch einmal und ungewollt laut, sodass der Fahrer zusammenzuckte und es vorzog, wieder durch die Windschutzscheibe geradeaus zu blicken. Alex bedauerte ihre harsche Reaktion, aber sie hatte weder die Geduld noch die Kraft, sich zu entschuldigen oder sich zu erklären. Alles, was sie wollte, war allein sein mit ihren Gedanken, um das Chaos zu ordnen, das in ihrem Inneren herrschte – ein Wunsch, der allerdings nicht in Erfüllung ging.
Vor dem zweistöckigen, aus rotem Backstein gemauerten Gebäude, in dessen oberer Etage sie wohnte, ließ Alex das Taxi anhalten und bezahlte. Gleichsam als Entschuldigung für ihr unhöfliches Benehmen ließ sie ein üppiges Trinkgeld springen. Dann stieg sie aus und erklomm die Stufen der schmalen Treppe, die zur Eingangstür emporführte. Früher hatte der Bau ein Immobilienbüro und eine Computerfirma beherbergt – nach dem Börsencrash war ein Wohnhaus daraus geworden.
In Gedanken versunken, schloss Alex die Tür auf und trat ein. Das Treppenhaus war eng, schmale Stufen aus weiß gestrichenem Holz führten in den ersten Stock. Bedächtig stieg sie hinauf – und registrierte plötzlich, dass etwas nicht stimmte.
Musik drang aus ihrer Wohnung, obwohl sie nicht zu Hause war. Eine von ihren CDs.
Jazz.
Miles Davis.
Ihre Vorsicht erwachte. In einem antrainierten Reflex glitten ihre Hände in die Handtasche und förderten zwei Gegenstände zutage – eine Pistole vom deutschen Typ HK P2000, wie sie in Alex’ Heimat in einigen Bundesländern bei der Polizei eingesetzt wurde, sowie etwas, das wie eine Sonnenbrille aussah, in Wirklichkeit jedoch eine sehr komplexe Technologie barg: Es war eine sogenannte Y-Brille, benannt nach den Strahlen, mit Hilfe derer die erste Generation von Unsichtbaren aus dem sichtbaren Spektrum ausgekoppelt worden war. Im Grunde war es ein Wärmesichtgerät, das unsichtbare Personen durch ihre Wärmeabstrahlung sichtbar machte. Da die Brille einseitig transparent war, wurde dieses Wärmebild vor den realen Hintergrund projiziert, sodass man die unsichtbare Person in ihrer Umgebung sah.
Rasch setzte Alex die Brille auf und sah sich um. Die Waffe hielt sie unter ihrem Mantel verborgen, bereit und entschlossen, sie notfalls einzusetzen.
Als sie sicher sein konnte, dass kein unsichtbarer Feind auf den Stufen lauerte, stieg sie die Treppe hinauf. Mit jedem Schritt wurde die Musik ein wenig lauter und Alex fragte sich, was dies zu bedeuten hatte. Ismael hatte gesagt, dass er vor Ende der Woche nicht zurück sein würde. Zudem wäre er niemals so leichtsinnig gewesen, Musik zu hören, wenn »offiziell« niemand zu Hause war.
Endlich erreichte sie das Ende der Treppe.
Was sollte sie tun?
Sich zurückziehen und das Haus beobachten? Die nächste Observierungsstation rufen und Bericht erstatten?
An einem anderen Tag hätte Alex es wohl getan – an diesem Tag jedoch fühlte sie sich zu matt, zu erschlagen, und zudem war da eine erschreckende Gleichgültigkeit ihrem eigenen Schicksal gegenüber. Hatte ihr Leben nicht ohnehin geendet, damals, in jener schicksalhaften Nacht, in der ihr Kollege Peter Manhart ermordet und die Jagd auf sie eröffnet worden war? Wie oft hatte sie sich seither versteckt, wie viele Male die Flucht ergriffen?
Alexandra hatte es satt.
So satt.
Kurz entschlossen griff sie nach dem Schlüssel, steckte ihn ins Schloss und drehte ihn um. Mit leisem Klicken sprang das Schloss auf und die Tür öffnete sich einen Spalt, gerade weit genug, um erkennen zu lassen, dass in der Wohnung gedämpfte, flackernde Beleuchtung herrschte.
Kerzenlicht.
Beherzt schlüpfte Alex durch den Türspalt und in den kurzen Gang. Prüfend blickte sie sich um, aber außer dem orangegelben Kerzenschein, der aus dem Wohnzimmer drang, war durch die Brille nichts Verdächtiges zu sehen. Lautlos, die halbautomatische Pistole beidhändig im Anschlag, huschte Alex auf die Tür zu, rief sich dabei all das ins Gedächtnis, was Ismael ihr über Situationen wie diese beigebracht hatte – und platzte im nächsten Moment durch die angelehnte Wohnzimmertür.
»Keine Bewegung!«
Durch die Spezialbrille taxierte sie ihre Umgebung und gewahrte tatsächlich eine rot leuchtende menschliche Gestalt, die am Tisch saß und alarmiert in die Höhe schoss, als Alex hereinkam. In einem Reflex bog sich ihr Finger am Abzug, um den Eindringling unschädlich zu machen – aber die vertraute Stimme, die ihr entgegenscholl, stoppte die Bewegung im letzten, entscheidenden Moment.
»Alex, nicht! Ich bin es …!«
Wie vom Donner gerührt stand sie da, die Waffe noch immer im Anschlag, während sie spürte, wie ihre Hände unter dem Einfluss des Adrenalins zu zittern begannen und ihre Knie weich wurden. Rasch nahm sie den Finger vom Abzug.
»Ismael!«
Der rote Schemen kam auf sie zu und nahm ihr die Waffe ab, worauf sie in seine Arme sank. Sie spürte seine vertraute Gestalt, die Zärtlichkeit seiner Umarmung und ihre Lippen begegneten sich in einem flüchtigen Kuss. Als sie die Brille jedoch abnahm, war es so, als wäre er verschwunden.
»Was sollte das eben?«, fragte er, halb im Spaß, halb im Ernst. »Wolltest du mich erschießen? Ich gehöre zu den guten Jungs, schon vergessen?«
»Du bist zurück?«, fragte sie dagegen. »Schon so früh?«
»Wie du siehst«, entgegnete er und korrigierte sich sogleich: »Oder eben nicht. Jedenfalls dachte ich mir, wir sollten das ein wenig feiern. Allerdings sieht es so aus, als würde sich deine Freude darüber in Grenzen halten.«
Erst da fiel ihr Blick auf den Tisch, den er gedeckt hatte. Auf das weiße Geschirr und die Rotweingläser, in denen sich der Schein der Kerzen brach.
»Bitte entschuldige«, sagte sie leise. Er gab ihr die Pistole zurück, und sie steckte sie wieder in ihre Tasche. Dann zog sie den Mantel aus und legte ihn über einen der Sessel. »Es ist nur – ich habe nicht mit dir gerechnet. Und dann diese Musik …«
»Ich dachte, du magst Jazz?«
»Mag ich ja auch«, versicherte sie, »aber darum geht es nicht. Es war leichtsinnig von dir, den CD-Spieler anzustellen, während niemand zu Hause ist.«
»Zugegeben«, gestand er amüsiert ein. »Aber hast du schon mal von einem Candlelight-Dinner ohne romantische Musik gehört?«
»Nein.« Sie musste unwillkürlich lächeln. Ismael hatte schon immer eine Art gehabt, sie von ihren Problemen abzulenken und dafür zu sorgen, dass sie sich wieder ein wenig besser fühlte.
»Der Job in Miami hat nicht so lange gedauert, wie wir befürchtet hatten. Observierungsbasis 38 scheint sauber zu sein, entgegen der Hinweise, die wir bekommen haben. Also habe ich den nächsten Zug genommen …«
»… und bist nach Hause gekommen«, vervollständigte sie.
»Genau. Und wo hast du dich rumgetrieben?«, wollte er scherzhaft wissen.
»Nirgendwo«, erwiderte sie fast ein wenig zu hastig.
»Nirgendwo«, echote er.
»Ich war einkaufen.«
»Ach ja? Wo sind die Tüten?«
»Ich … äh …«
Alex’ unsichtbares Gegenüber brach in Gelächter aus. »Schon gut«, meinte er, »ich will es gar nicht wissen. Ich bin froh, dass du allmählich anfängst, wieder ein normales Leben zu führen, wenigstens nach außen hin. Anfangs dachte ich schon, du würdest niemals über New York hinwegkommen.«
»Tja«, meinte Alex, und diesmal wirkte ihr Lächeln ein wenig gequält. »Hast du gedacht.«
»Wirklich fündig scheinst du beim Einkaufen allerdings nicht geworden zu sein«, fuhr Ismael feixend fort. »Wie gut, dass ich vorgesorgt habe, sonst müssten wir den Abend mit knurrenden Mägen verbringen.«
»Du bist einkaufen gewesen?«, fragte sie mit hochgezogenen Brauen. »Stelle ich mir witzig vor.«
»Das gerade nicht – der Typ an der Kasse hätte wahrscheinlich ein ziemlich dämliches Gesicht gemacht, wenn ein gut gefüllter Einkaufskorb an ihm vorbeigeschwebt wäre.«
»Anzunehmen.«
»Dabei vergisst du allerdings, dass ich zwar unsichtbar, aber nicht unhörbar bin – den Dinnerservice anzurufen und ein Menü für zwei zu bestellen, liegt also durchaus in meinen Möglichkeiten.«
Sie kannte Ismaels Humor und wusste, dass er auf ein Lachen ihrerseits wartete. Alex jedoch war nicht nach Lachen zumute. Sie verzog keine Miene.
»Das war ein Scherz«, drang es erklärend aus dem Nichts.
»Ich weiß.«
»Was ist los, Alex? Du weißt, ich habe noch immer nicht sehr viel Übung darin, sichtbare Mienen zu deuten – aber nach allem, was ich inzwischen über euch weiß, würde ich sagen, dass du besorgt aussiehst.«
»Nein«, widersprach Alex kopfschüttelnd. »Da irrst du dich.«
»Ganz sicher?«
»Sicher«, erwiderte sie und gab sich alle Mühe, ihren Gram hinter einem Lächeln zu verbergen. Ismael jedoch ließ nicht locker.
»Ich weiß nicht«, meinte er. »Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass du mir etwas verheimlichst. Was ist los, Alex? Etwa ein anderer Mann?«
Er hatte das nur im Spaß gesagt, aber sie kannte ihn inzwischen gut genug, um zu wissen, dass auch ein wenig echte Besorgnis in der Frage steckte. »Natürlich nicht«, antwortete sie. »Sei nicht albern. Es ist nur …«
Sie unterbrach sich, als jemand laut an die Tür des Apartments klopfte.
»Das ist der Dinnerservice«, erklärte Ismael entschuldigend. »Ich habe das Essen für halb sieben bestellt.«
»Und?«, fragte sie spitz, dankbar für die Unterbrechung. »Willst du nicht aufmachen?«
»Sehr witzig.«
Sie revanchierte sich mit einem schiefen Lächeln, dann ging sie hinaus, um die Tür zu öffnen.
»Und es ist wirklich alles in Ordnung?«, rief er ihr nach.
»Natürlich«, gab sie zurück.
2.
Noch immer ist die Fachwelt erschüttert über den ebenso plötzlichen wie unerwarteten Tod von Professor Dr. Luigi Benati, der vor nunmehr einem halben Jahr einem Selbstmordanschlag auf dem Flughafen Rom zum Opfer fiel. Was der Attentäter – ein unbekannter Mann arabischer Herkunft – mit dem Anschlag bezweckte, bei dem außer Benati noch sieben weitere Menschen, darunter zwei seiner Assistenten, den Tod fanden, konnte noch nicht endgültig geklärt werden, die Ermittlungen der Polizei dauern noch immer an.
Um den vielen Freunden und Bewunderern, die Benati trotz seiner in der Fachwelt teils heftig umstrittenen Thesen an unserer Universität hatte, dennoch Gelegenheit zu geben, sich von ihrem Kollegen und Mentor zu verabschieden, findet ihm zu Ehren am kommenden Mittwoch eine Gedenkfeier auf dem Gelände der La Sapienza statt. Das Dekanat und das Professorenkollegium werden geschlossen an der Veranstaltung teilnehmen, darüber hinaus haben einige ehemalige Schüler Benatis ihr Kommen angekündigt, die Forschungen im Ausland betreiben und lange Anreisewege auf sich nehmen, um ihren ehemaligen Lehrer zu ehren.
Meldung aus dem Intranet der
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Via Marco Aurelio
Lateran, Rom
11 Uhr 18 Ortszeit
Es war ein seltsames Gefühl, wieder zu Hause zu sein.
Das Apartment, das sich auf halber Strecke zwischen dem Kolosseum und dem Militärkrankenhaus del Celio befand und das er schon während der Studienzeit bewohnt hatte, kam Dr. Paolo Genaro luxuriös und riesig vor im Vergleich zu den Zelten und schäbigen albergos, in denen er in den letzten fünf Jahren den Großteil der Nächte verbracht hatte.
Alles war noch genauso, wie er es in Erinnerung hatte: der Wandschrank, den er von seinem Vormieter übernommen hatte. Das alte Sofa, das sich zum Bett umbauen ließ und auf dem das Häkelkissen lag, das ihm seine Tante Marta vermacht hatte. Der kleine Beistelltisch mit dem uralten Fernseher darauf und schließlich der Schreibtisch, an dem er unzählige Stunden gearbeitet und auch seine Dissertation verfasst hatte, inklusive eines alten 386er Computers, der inzwischen schon fast museal anmutete. Sogar der Geruch schien noch derselbe zu sein: eine eigentümliche Mischung aus altem Holz und Moder, versetzt mit einer leichten Note von Knoblauch und Tomaten, die aus dem Restaurant heraufdrang, das im Erdgeschoss des Hauses untergebracht war.
Paolo musste lächeln, als eine Welle von Erinnerungen über ihn hinwegschwappte. Die meisten davon waren recht heiterer Natur, anders als der Anlass seiner Rückkehr.
Seufzend trat er ein und schloss die Tür hinter sich, dann stellte er seine Reisetasche ab und entledigte sich der khakifarbenen Jacke, deren abgewetzter und mit unzähligen Flecken behafteter Stoff vermuten ließ, an welch abenteuerlichen Orten ihr Besitzer die letzten Jahre zugebracht hatte.
Der Boden des Apartments war von Briefen übersät – Post, die in der Zwischenzeit für ihn gekommen war und die sein Vermieter einfach unter der Tür durchgeschoben hatte. Paolo sammelte die Kuverts vom Boden auf und überflog die Adressen der Absender. Das meiste war Werbung, dazu eine oder zwei unbezahlte Rechnungen und ein Ticket wegen Falschparkens, das inzwischen schon verjährt sein mochte. Ein Brief jedoch stach aus dem Stapel hervor, denn er war als Einziger von Hand beschriftet, und trotz der Hitze, die in dem schlecht belüfteten Apartment herrschte, bekam Paolo eine Gänsehaut, als er die Schrift erkannte.
Sie gehörte keinem anderen als seinem alten Mentor und Förderer. Dem Mann, dessentwegen er den weiten Flug von Lima nach Europa auf sich genommen hatte, weil er dabei sein wollte, wenn ihm die Fachwelt eine letzte Ehrung erwies.
Professor Luigi Benati.
Verblüfft besah sich Paolo den Poststempel. Der Brief war vor einem guten halben Jahr abgeschickt worden, nur wenige Wochen vor Benatis gewaltsamem Tod. Die Briefmarke stammte aus Ägypten und zeigte eine Ansicht der Sphinx, was sich mit Paolos Informationen deckte, denen zufolge Benati zuletzt in der Nähe von Kairo gearbeitet hatte. Warum aber hatte der Professor den Brief nicht nach Iquitos geschickt? Er hatte doch gewusst, dass sein ehemaliger Schüler dort ein Postfach hatte einrichten lassen, in dem eintreffende Sendungen für ihn gelagert wurden, solange er bei Ausgrabungen im Dschungel weilte.
Paolo kannte seinen alten Freund und Mentor gut genug, um zu wissen, dass er nicht der zerstreute Spinner gewesen war, zu dem die Fachwelt und bisweilen auch die Presse ihn gemacht hatten. Im Gegenteil war Benati einer der brillantesten Denker gewesen, denen Paolo in seinem Leben begegnet war, ein Visionär seiner Wissenschaft, dessen Theorien nicht an den Grenzen seiner Disziplin endeten, sondern der nach großen, universalen Zusammenhängen suchte. Wenn Benati einen Brief an Paolos Heimatadresse geschickt hatte, so musste es einen Grund dafür geben. Möglicherweise hatte er befürchtet, dass das Schreiben auf dem Weg nach Übersee verlorengehen könnte. Oder er hatte geahnt, dass sein ehemaliger Schüler schon bald nach Italien zurückkehren würde.
Der Gedanke war Paolo unangenehm und er verscheuchte ihn wie ein lästiges Insekt. Neugier hatte ihn gepackt und er öffnete den Brief, der ihm, Monate nach dem Tod seines einstigen Mentors, wie eine Nachricht aus dem Jenseits vorkam. Seine Hände bebten, als er das Papier entfaltete und flüsternd zu lesen begann:
Lieber Freund,
sicher wundern Sie sich, warum ich Ihnen diesen Brief zweimal schicke. Sollten Sie ihn bereits gelesen haben, so wissen Sie schon alles, was ich Ihnen mitteilen wollte. Sollten Sie die nachfolgenden Zeilen jedoch zum ersten Mal lesen, so nehmen Sie dies als Indiz dafür, dass meine Vermutungen mich nicht getäuscht haben und ich mich tatsächlich bereits unter Beobachtung befinde. Meine Telefongespräche werden abgehört und ich hege schon seit Längerem den Verdacht, dass meine Post abgefangen wird. Die Zahl derer, denen ich noch trauen kann, scheint mit jedem Tag geringer zu werden. Sie hingegen, als mein bester und gelehrigster Schüler, genießen nach wie vor mein volles Vertrauen.
Wie ich Ihnen bei unserem letzten Telefonat im vergangenen Frühjahr mitteilte, halte ich mich derzeit in Kairo auf und leite eine aus privaten Mitteln finanzierte Ausgrabung in der Nähe von Gizeh. Von Anfang an ist mir klar gewesen, dass der Ausgang dieser Grabung so sein könnte, dass die Geschichte der Menschheit, wie wir sie verstehen und begreifen, über weite Passagen umgeschrieben werden müsste. Was wir jedoch tatsächlich gefunden haben, geht weit über das hinaus, was ich erwartet habe. Die Wurzeln dieser Entdeckung reichen weiter in die Vergangenheit, als ich mir es je hätte träumen lassen, und meine wachsende Faszination schlägt zusehends in Bestürzung um, je mehr ich herausfinde. Die vielen Jahre, die ich geforscht und gearbeitet habe, die Grabungen, die ich in Syrien, Jordanien und der Türkei durchgeführt habe, all dies scheint sich nun endlich auszuzahlen und in eine Entdeckung zu münden, die schier unglaublich und geradezu gewaltig ist. Die Fachwelt wird mich nicht mehr länger verspotten, denn nun werde ich unwiderlegbare Beweise präsentieren können.
Die meisten der Assistenten, die an der Grabung teilnehmen, ahnen nichts von der wahren Natur unserer Suche. Lediglich zwei von ihnen habe ich eingeweiht. Sie werden mich in wenigen Wochen nach Rom begleiten, wo ich meine Entdeckung im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgeben will, auch wenn noch längst nicht alle Mysterien geklärt sind. Natürlich ist mir klar, dass es Gefahren birgt, ein Geheimnis ans Licht der Öffentlichkeit zu zerren, das jahrtausendelang verborgen war, zumal ich fühle, dass es Kräfte gibt, die dies verhindern wollen. Aber als Wissenschaftler sind wir der Wahrheit verpflichtet, selbst wenn das den Einsatz unseres Lebens fordert.
All dies schreibe ich Ihnen, mein guter Paolo, weil ich allen Grund zu der Annahme habe, dass ein Zusammenhang zu Fiorino besteht, den Sie im Rahmen Ihrer eigenen Forschungen ungleich besser ausloten können, als ich das vermag. Ich ersuche Sie daher, sich umgehend mit mir in Verbindung zu setzen – wir müssen uns so bald wie möglich treffen. Sollte sich dieses Treffen, aus welchen Gründen auch immer, nicht arrangieren lassen, so rate ich Ihnen, das zu tun, was ich allen Studenten stets empfohlen habe: Beginnen Sie dort, wo alles anfing, und fragen Sie Herodot, den Vater der Geschichtsschreibung. Und vergessen Sie niemals, dass wir alle, die wir in den Diensten dieser so elementaren Wissenschaft stehen, der Wahrheit verpflichtet sind.
Mit den besten kollegialen Wünschen,
Luigi Benati
Professor der Archäologie
Augenblicke stand Paolo Genaro wie vom Donner gerührt.
Erst nach einer Weile war er in der Lage, wieder einen klaren Gedanken zu fassen, so sehr hatte Benatis Schreiben ihn berührt. Natürlich war der Brief lange vor den tragischen Ereignissen in Rom abgeschickt worden, dennoch war er von düsteren Anspielungen durchdrungen. Sein alter Mentor hatte unter Verfolgungsängsten gelitten – Ängste, die wohl nicht ganz unbegründet gewesen waren. Warum sonst hatte er Benatis anderen Brief nicht längst erhalten? Das Schreiben nach Südamerika musste tatsächlich abgefangen worden sein.
Andererseits konnte das natürlich auch ein brillanter Kniff sein, um Paolo gleich zu Beginn zu beweisen, dass die wilden Verdächtigungen, die der Professor in seinem Schreiben machte, nicht aus der Luft gegriffen waren. Captatio benevolentiae hätten die Vertreter der antiken Rhetorik so etwas genannt.
Typisch für den alten Fuchs.
Der Anflug eines Lächelns huschte über Paolos Züge, das sofort wieder verschwand, als ihm erneut klar wurde, dass es der Brief eines Toten war, den er da in den Händen hielt.
Benati weilte nicht mehr unter den Lebenden, sodass er ihn niemals würde fragen können, was es mit all den Anspielungen und mysteriösen Andeutungen auf sich hatte. Die im Brief angekündigte Pressekonferenz hatte der Professor nie abgehalten und die beiden Assistenten, die er in seinem Brief erwähnte und die er in seine Forschungen eingeweiht hatte, waren bei dem Anschlag ebenso getötet worden wie er selbst. Sein Geheimnis hatte Benati wohl mit ins Grab genommen.
Oder …?
Paolo überflog das Schreiben noch einmal und mehr noch als beim ersten Lesen hatte er den Eindruck, dass dies nicht nur ein einfacher Brief war, nicht nur ein Höflichkeitsschreiben, in dem ein Professor seinen ehemaligen Schüler über den Stand seiner aktuellen Forschungen unterrichtete und um Zusammenarbeit bat. Vielmehr kam es Paolo vor, als sei der Brief Benatis ein Vermächtnis an ihn, gewissermaßen das Erbe, das er ihm auf Erden hinterlassen wollte. Hatte der Professor am Ende geahnt, dass man ihm nach dem Leben trachtete? Dass er die nächsten Monate womöglich nicht überleben würde?
Einige Passagen des Schreibens legten die Vermutung nahe – etwa, wenn Benati von gegnerischen »Kräften« sprach oder wenn er mit ans Hellseherische grenzender Voraussicht argwöhnte, dass es zu einem Treffen nicht mehr kommen würde. Ein Anflug von Trauer überkam Paolo, in die sich schon im nächsten Moment der Verdacht mischte, der Anschlag auf Professor Benati könnte möglicherweise mehr gewesen sein als die Tat eines verblendeten Fundamentalisten. Und ohne dass er etwas dagegen tun konnte, fühlte Paolo Genaro, wie seine Neugier erwachte.
Von was für einer sensationellen Entdeckung hatte Benati gesprochen, deren Wurzeln angeblich weit in die Vergangenheit reichten? Woran genau hatte er gearbeitet? Und worin, in aller Welt, sollte der Zusammenhang zu Fiorino bestehen?
Paolo wollte Antworten auf diese Fragen.
Doch er ahnte, dass sie ihm nicht gefallen würden.
Alexandria, Washington D. C.
Tags darauf
»Mina! Wie schön, dich zu sehen!«
In ihrer Freude merkte Alexandra nicht, wie unpassend die Formulierung war. Es tat gut, Besuch zu bekommen und von Sorgen abgelenkt zu werden – auch wenn der Besucher nur mit Hilfe einer Spezialbrille wahrgenommen werden konnte und dann auch nur als roter Schemen vor dunkel getöntem Hintergrund.
»Die Freude ist ganz meinerseits«, versicherte eine resolute Frauenstimme und Alex verspürte einen Luftzug, als Mina Harker ins Wohnzimmer trat. Ein zweiter Schemen folgte ihr auf dem Fuß, den Alex als Ismael erkannte. Wie Ismael war auch Mina Harker unbekleidet, da die genetische Mutation, die ihre Unsichtbarkeit bewirkte, natürlich auf sie selbst beschränkt war. Dinge, die sie bei sich oder am Körper trug, blieben davon unberührt. Da Nacktheit eine unabänderliche Begleiterscheinung ihres Daseins war, waren es die Unsichtbaren seit frühester Jugend nicht anders gewöhnt und gingen auf die denkbar natürlichste Weise damit um. Selbst Alex nahm es inzwischen kaum noch zur Kenntnis, wenn sie als einzige Bekleidete unter lauter Nackten weilte.
»Was führt dich zu uns?«, wollte sie von Mina wissen.
»Oberon schickt mich«, erwiderte diese und nahm auf dem Sofa Platz, ohne auf eine Aufforderung zu warten. In der ihr eigenen legeren Weise legte sie die Beine auf den Tisch, was wohl ein wenig Geringschätzung zum Ausdruck bringen sollte. »Er will wissen, wie es dir geht.«
Alex zuckte mit den Schultern. »Wie es jemandem eben geht, dem allmählich die Decke auf den Kopf fällt.«
»Das kann ich gut verstehen.« Mina nickte. »Dennoch musst du dich noch ein wenig gedulden. Oberon hält es für unbedingt erforderlich, dass noch ein wenig Zeit vergeht, bis er dich wieder in den aktiven Dienst beordert. New York hat zu hohe Wellen geschlagen. Ich wette, dass es da draußen nur so vor Demons wimmelt, die es auf dich abgesehen haben.«
Alex nickte.
Noch vor einigen Monaten hätte sie das Gefühl gehabt, mit einer Schwachsinnigen zu reden. Aber alles, was Mina Harker, ihres Zeichens Offizier im Rang eines Commanders, sagte, ergab für Eingeweihte durchaus Sinn.
Oberon war der Anführer der Anderen, ihr geheimnisvolles Oberhaupt, das sich nicht zu erkennen gab und sich aus Gründen der Sicherheit an einem unbekannten Ort aufhielt. Die meisten Mitglieder der Rebellentruppe hatten ihm noch nie gegenübergestanden. Er pflegte via Satellitenverbindung mit ihnen zu kommunizieren.
Wie alle, die in den Diensten der Anderen standen, hatte auch Oberon den Namen einer literarischen Figur angenommen. Alex hatte gelernt, dass diese Namen nicht nur als Codebezeichnungen dienten. In ihrer Wahl spiegelten sich auch die Persönlichkeit und die individuelle Geschichte ihres Trägers wider. Alex beispielsweise hatte sich »Dorothy« genannt, nach dem Mädchen, das über den mit gelben Steinen gepflasterten Weg unversehens ins Zauberland Oz geraten war.
Die Demons, von denen Mina gesprochen hatte, waren die gefürchteten Agenten des ordo invisibilium – skrupellose Killer, die ihre Fähigkeit dazu nutzten, kaltblütig jeden zu töten, dessen Interessen denen des Ordens zuwiderliefen. Menschen, die – aus welchem Grund auch immer – den Schutz der Unsichtbaren genossen, wurden hingegen sogenannte Guardians zur Seite gestellt, die sie auf Schritt und Tritt bewachten. Auch Ismael war einst solch ein Guardian gewesen.
Harker hatte gelernt, das Spiel sichtbarer Mienen zu deuten, und so entging ihr nicht die Enttäuschung, die sich in Alex’ Zügen spiegelte. »Oberon würde dich lieber heute als morgen zurückhaben«, erklärte sie deshalb, »aber er hält es nun mal einfach für besser, wenn du noch eine Weile untergetaucht bleibst.«
»Und was ist mit Ismael?«, fragte Alex in einem impulsiven Anflug von Trotz. »Er war auch in New York dabei und Oberon scheint kein Problem damit zu haben, ihn in den Einsatz zu schicken.«
»Sein Gesicht steht auf den Fahndungslisten des Ordens auch nicht ganz oben«, erwiderte Harker ebenso knapp und entwaffnend. »Du bist anders als wir, vergiss das nicht.«
»Wie könnte ich das?«, fragte Alex giftig und verdrehte die Augen. Sie wusste, dass sie ungerecht war. Oberon wollte sie nur beschützen, aber genau das konnte sie nicht ertragen. Sie wollte endlich wieder eingesetzt werden, wollte eine Rolle spielen in dem Kampf, den sie austrugen.
»Was gibt es für Neuigkeiten?«, erkundigte sich Ismael, um das Thema zu wechseln und den sich anbahnenden Streit zu vermeiden. Alex und Mina Harker waren einander nicht immer grün gewesen und es bedurfte nur eines geringen Anlasses, um den alten Konflikt wieder aufflammen zu lassen.
»Eine ganze Menge«, antwortete Mina. »Ersatz für die aufgegebene Observationsbasis Zero wurde geschaffen, der den gesamten Mittelwesten abdeckt. Außerdem wurde die Außenstelle in Anchorage aufgestockt, nachdem wir Hinweise auf verstärkte Aktivitäten des Ordens in Alaska bekamen.«
»Und Washington?«, wollte Alex wissen.
Mina lachte auf. »Es gibt kaum einen Ort auf der Welt, wo der Orden aktiver ist als hier, in der Hauptstadt der letzten verbliebenen Supermacht. Erst vor einer Woche kam es zu einem Zusammenstoß zwischen unseren Leuten und Agenten des Ordens, bei dem wir einen Verlust zu beklagen hatten.«
»Wen?«
»Rowena«, entgegnete Mina Harker in einem Anflug von Trauer, während gleichzeitig nur mühsam zurückgehaltener Zorn in ihrer Stimme mitschwang. »Sie haben sie gefangen genommen und verschleppt. Zwei Tage später fand eine Polizeistreife ihre Leiche im Potomac.«
Alex nickte betroffen. Wenn ein Unsichtbarer starb und sein bioelektrisches Feld erlosch, wurde der Auskopplungsvorgang umgekehrt und er wurde für das bloße Auge sichtbar. Die Frage war allerdings, was Sergeant Rowena vor ihrem Tod verraten hatte.
»Bislang wurde keine unserer Observierungsbasen angegriffen«, erklärte Harker, die zu erahnen schien, was Alex als Nächstes fragen würde. »Wir können also davon ausgehen, dass Rowena ihnen nichts preisgegeben hat.«
Alex’ Betroffenheit wurde noch größer. Von Ismael wusste sie, dass der Orden in der Wahl seiner Verhörmethoden nicht zimperlich war und auch vor Folter nicht zurückschreckte, wenn es darum ging, widerspenstigen Gefangenen die Zunge zu lösen. Rowena musste unglaublich tapfer gewesen sein.
Bis zuletzt.
Obwohl Alex die junge Soldatin nur flüchtig gekannt hatte – sie war seinerzeit beim Sturm auf die Eagleridge-Wetterstation auf dem Gipfel des Mount Antero dabei gewesen –, fühlte auch sie tiefe Trauer. Fast schämte sie sich dafür, dass ihr nächster Gedanke ihrer eigenen Sicherheit galt.
»War sie über meinen Aufenthaltsort informiert?«, erkundigte sie sich vorsichtig.
»Nein«, antwortete Mina. »Rowena hatte lediglich Zugang zu Informationen der Stufe 4. Sie wusste, dass du dich irgendwo an der Ostküste aufhältst, kannte aber weder die Stadt noch die genaue Lage des Verstecks.«
»Keine Sorge«, meinte Ismael beschwichtigend, »du bist hier absolut sicher.«
»Absolute Sicherheit gibt es nicht«, widersprach Alex. »Nicht wenn man es mit dem Orden zu tun hat. Das hast du mir immer wieder eingeschärft.«
»Zugegeben. Dennoch brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Du bedienst dich des ältesten aller Tricks, um deinen Aufenthaltsort zu tarnen.«
»Nämlich?«
»Du verbirgst dich direkt vor den Augen der Beobachter, dort, wo sie es am wenigsten erwarten. Alle Zauberkünstler, die etwas auf sich halten, machen es so.«
Alex schnitt eine Grimasse – bisweilen konnte sie mit Ismaels Humor nicht allzu viel anfangen. »Wie geht es den anderen?«, erkundigte sie sich.
»Dr. Jekyll lässt dich schön grüßen, und auch von Robinson soll ich dir Grüße bestellen.«
»Danke.« Alex fragte sich selbst, warum sie sich nicht mehr über die seltsamen Namen wunderte. Manchmal kam es ihr vor, als wären die Buchgestalten aus ihrer Kindheit zum Leben erwacht. Ihr Vater hatte ihr oft etwas vorgelesen, wenn sie als kleines Mädchen nicht hatte einschlafen können, vor vielen Jahren. Sie hatte es geliebt, seiner sanften Stimme zu lauschen, und hatte sein Englisch stets als beruhigender und schöner empfunden als das harte Deutsch ihrer Mutter. Es war die Sprache ihrer Sehnsüchte und Kindheitsträume gewesen – aus denen sie allerdings rasch erwacht war, nachdem ihr Vater über Nacht spurlos aus ihrem Leben verschwunden war.
»Schnucklig hast du’s hier«, stellte Mina mit einem Hauch von Sarkasmus fest. »Eine kleine Wohnung, ein schöner Teppich, schöne Möbel …«
»Ich könnte gut darauf verzichten«, versicherte Alex säuerlich und trat ans Fenster, in dessen Glasscheibe sie ihr eigenes Spiegelbild sehen konnte. Gedankenverloren starrte sie hinaus auf die in Dunkelheit versinkende Straße. Heftiger Regen hatte eingesetzt, der nasse Asphalt reflektierte den fahlen Schein der Straßenlaternen.
Schweigen trat ein, das weder Ismael noch Mina Harker als unangenehm zu empfinden schienen – sie waren es gewohnt, unter ihresgleichen zu sein, ohne sich an der Gegenwart des anderen zu stören. Alex hingegen hatte das Gefühl, dass ihre unsichtbaren Gesprächspartner sie fortwährend anstarrten. »Entschuldigt mich«, bat sie deshalb, verließ das Wohnzimmer und ging zur Toilette.
Noch eine Weile dauerte das Schweigen an.
»Was soll das?«, erkundigte sich Harker unvermittelt.
»Was meinst du?«, fragte Ismael zurück.
»Du weißt verdammt genau, was ich meine. Was ist hier los?«
»Was soll schon los sein?«
»Warum bist du hier?«
»Warum ich …?«
»Oberon hat dich beauftragt, ab und an nach Dorothy zu sehen. Davon, dass du hier einziehst, war nicht die Rede.«
»Mina, ich …«
»Es ist also wahr?« Harker schnappte nach Luft. »Verdammt! Und ich Idiotin wollte es nicht glauben, als Jekyll es mir erzählte. Du hast etwas angefangen mit einer … Sichtbaren?«
Ismael schwieg. Das war Antwort genug.
»Bist du von allen guten Geistern verlassen? Du weißt, dass das zu keinem guten Ende führt!«
»Ich liebe sie!«
»Du liebst sie«, echote Mina Harker. »So einfach, ja? Und hast du dir schon überlegt, wie es mit euch weitergehen soll? Wollt ihr zusammenziehen? Heiraten? Kinder kriegen? Das ganze Programm?«
»Das ist nicht witzig«, stellte Ismael fest.
»Allerdings nicht – und du solltest das eigentlich wissen. Ist dir nicht klar, was geschehen könnte, wenn du das Gen an einen Nachkommen weitergibst?«
»Es ist nur eine Vermutung. Selbst Oberon weiß nicht mit Bestimmtheit, was dann geschehen würde.«
»Dennoch haben wir alle einen Eid geleistet«, brachte Mina in Erinnerung. »Oder willst du das bestreiten? Denkst du jetzt schon wie jene, gegen die wir kämpfen?«
»Natürlich nicht«, versicherte Ismael. »Aber wenn es uns nicht erlaubt ist, unser persönliches Glück zu verfolgen, welchen Sinn hat dann der ganze Kampf, den wir führen?«
»Unser persönliches Glück zählt nicht, das weißt du genau. Das war nicht der Grund, warum wir den Orden verlassen und uns gegen unseresgleichen gestellt haben.«
»So? Was war dann der Grund, Mina?«
»Die Wahl zu haben«, entgegnete sie ohne Zögern. »Nicht ein Mittel zum Zweck zu sein, ein winziges Rädchen inmitten einer seelenlosen Maschinerie. Die Geschichte wieder zu dem zu machen, was sie einmal war, nämlich die Folge unabhängiger Entscheidungen.«
»Dieser Ansicht bist du nicht immer gewesen.«
»Was ich früher gedacht habe, spielt keine Rolle. Tatsache ist, dass du dich auf verbotenes Terrain begibst. Uns fortzupflanzen ist uns untersagt, Ismael, und das aus gutem Grund. Der Orden mag Unsichtbarkeit als nächsten Schritt der Evolution betrachten – wir hingegen glauben, dass sie lediglich die Folge willkürlicher Experimente und deshalb widernatürlich ist. Es mag dir gefallen oder nicht, aber wir alle sind nichts als entartete Wesen, deren Existenz eine Bedrohung für die Welt darstellt. Eine Bedrohung, die immer stärker wird und die es eigentlich nicht geben dürfte. Also tu, was du tun musst, und beende diese Angelegenheit, ehe sie Folgen hat, die du nicht mehr …«
»Ich brauche keine Moralpredigt, Mina«, fiel Ismael ihr barsch ins Wort, »und schon gar nicht von dir.«
»Was willst du damit sagen?«
»Das weißt du verdammt genau. Beantworte mir nur eine Frage: Wärst du auch dieser Meinung, wenn es damals mit Jonathan anders gekommen wäre? Oder darf niemand, den du kennst, glücklich sein, nur weil du es nicht geworden bist?«
Es wurde totenstill im Raum und die Luft im Wohnzimmer schien zu gefrieren.
»Wie kannst du es wagen?«, fragte Mina Harker in einem Tonfall, der deutlich machte, dass Ismael eine Grenze überschritten hatte. »Wie kannst du mich das nur fragen? Wie kannst du seinen Namen auch nur erwähnen?«
»Weil ich gern eine Antwort hätte«, beharrte Ismael unbarmherzig. »Habe ich recht oder nicht?«
»Bastard«, flüsterte sie. »Du elender Bastard.«
In diesem Moment kam Alex ins Wohnzimmer zurück. Obwohl sie nichts mitbekommen hatte von dem Streit, blieb ihr nicht verborgen, dass sich etwas verändert hatte. So als hätte das Schweigen im Raum seine Farbe gewechselt.
»Etwas nicht in Ordnung?«, erkundigte sie sich.
»Nein, durchaus nicht«, versicherte Ismael.
»Alles ist wunderbar«, stimmte Mina Harker zu, wenngleich mit eigenartigem Unterton.
»Gut«, meinte Alex. »Wollt ihr etwas essen? Ich habe Pizza im Kühlschrank.«
»Ich sterbe für Pizza«, behauptete Ismael.
»Ja«, knurrte Commander Harker verdrießlich, »es sei denn, dein großes Maul bringt dich vorher um.«
Zwei Straßenzüge weiter nördlich
Zur selben Zeit
»Wie ich das hasse!«
Frustriert starrte Officer Corey Stevens durch die Windschutzscheibe des Streifenwagens, an der das Wasser in Strömen herabfloss, während es gleichzeitig mit lautem Stakkato auf das Dach trommelte. »Warum kann es nicht einfach nur regnen? Warum muss es in dieser Gegend immer gleich schütten, als hätten sich alle Himmelsschleusen geöffnet?«
»Liegt an der Luftfeuchtigkeit in unserer Gegend«, gab sein Partner, Officer Stanley Cooks, zur Antwort, der den weißen Streifenwagen im Schritttempo die von Birken gesäumte Allee entlangsteuerte. »Ein Schwager von mir arbeitet als Wetterfrosch beim Radio. Er hat mir das mal erklärt. Wusstest du, dass das meiste Land hier früher Sumpf gewesen ist? Das musst du dir mal vorstellen? Was, in aller Welt, hat den guten alten George Washington nur darauf gebracht, die Hauptstadt unseres Landes mitten in einem verdammten Sumpf zu errichten?«
»Ist mir egal«, schimpfte Stevens. »Ich weiß nur, dass wir die ganze Nacht Streifendienst haben und dass diese elende Nässe in jede verdammte Ritze kriecht.«
»Wenn schon«, versuchte sein Partner ihn aufzumuntern, »dann fahren wir eben zu Barney’s und holen uns ’nen heißen Kaffee, der … Was ist das?«
»Was meinst du?«



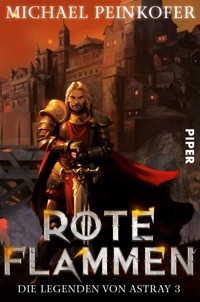
![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)
![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)