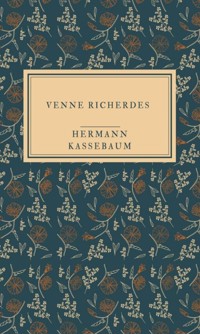
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die welschen Studenten nannten die beiden blonden Jünglinge insgemein ›li gemini‹, die Zwillinge. Halb war es Spott, halb Neid, der aus diesem Beinamen erklang. Besser noch trafen es die Bologneser Schönen, die den dritten, den braunlockigen Gottfried Kristaller, aus dem Bistum Straßburg gebürtig, in ihren Scherz mit einschlossen und die drei die ›Unzertrennlichen‹, ›li inseparabili‹, tauften. Hinter dem vorgehaltenen Fächer, hinter dem wohlverwahrten Fenster klang es immer wieder: ›Li inseparabili‹, wenn die drei Deutschen auftauchten oder vorübergingen. Seit geraumer Zeit schon weilten sie auf Bolognas Hoher Schule, um dem Studium der Rechte obzuliegen, das hier nach wie vor seine vornehmste Pflegestätte hatte. Der Älteste von ihnen, Johannes Hardt, war der Semester vier hier, sein Vetter Heinrich Achtermann, gleich ihm in der alten Kaiserstadt Goslar am Fuße des Harzes daheim, kam vor mehr als Jahresfrist über die Alpen gezogen, und der dritte, Gottfried Kristaller, hielt die Mitte zwischen ihnen, was die Zeit des Studiums an der welschen Universität betraf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Venne Richerdes
Roman aus der Geschichte Goslars
von
Hermann Kassebaum
Meiner lieben Heimatstadt Goslar
Erstes Buch
D
ie welschen Studenten nannten die beiden blonden Jünglinge insgemein ›li gemini‹, die Zwillinge. Halb war es Spott, halb Neid, der aus diesem Beinamen erklang. Besser noch trafen es die Bologneser Schönen, die den dritten, den braunlockigen Gottfried Kristaller, aus dem Bistum Straßburg gebürtig, in ihren Scherz mit einschlossen und die drei die ›Unzertrennlichen‹, ›li inseparabili‹, tauften. Hinter dem vorgehaltenen Fächer, hinter dem wohlverwahrten Fenster klang es immer wieder: ›Li inseparabili‹, wenn die drei Deutschen auftauchten oder vorübergingen.
Seit geraumer Zeit schon weilten sie auf Bolognas Hoher Schule, um dem Studium der Rechte obzuliegen, das hier nach wie vor seine vornehmste Pflegestätte hatte. Der Älteste von ihnen, Johannes Hardt, war der Semester vier hier, sein Vetter Heinrich Achtermann, gleich ihm in der alten Kaiserstadt Goslar am Fuße des Harzes daheim, kam vor mehr als Jahresfrist über die Alpen gezogen, und der dritte, Gottfried Kristaller, hielt die Mitte zwischen ihnen, was die Zeit des Studiums an der welschen Universität betraf.
Jetzt waren sie alle drei bereit, Bologna zu verlassen. Johannes hatte sein Ziel erreicht, denn er war unlängst zum Doktor der Rechte promoviert worden. Heinrich wollte mit ihm ziehen, weil es so geplant war und weil ihm der Zweck seines Aufenthaltes im Auslande erreicht zu sein schien, nämlich sich in der Welt umzusehen und sich dabei ein wenn auch bescheidenes Maß von juristischen Kenntnissen anzueignen, das ihm für die Ratsherrnstelle in Goslar, die ihm nach Geburt und Herkommen sicher war, nicht schaden würde und ihm auch für seine demnächstige Beschäftigung in dem umfangreichen Handelsgeschäfte seines Vaters, des Rats- und Kaufherrn Heinrich Achtermann, nur förderlich sein konnte. Und Gottfried endlich schied, weil er es ohne die Gesellen in Bologna fürder nicht glaubte aushalten zu können.
Die Abreise war beschlossen, der Tag dazu festgesetzt, der die Unzertrennlichen scheiden würde. Die beiden Goslarer wollten den kürzesten Weg in die Heimat einschlagen, den über den Brenner, während Gottfried Kristaller die Reise über Mailand und den Gotthardt wählte, um so gleichfalls möglichst schnell nach Straßburg zu gelangen.
Das bessere Teil fiel dabei Heinrich und Johannes zu, denn ihnen erblühte mit dem in Aussicht genommenen Wege das Glück, in anmutiger Gesellschaft bis in die Heimat zusammenreisen zu können. Es waren die Damen von Walldorf, des Feldobristen von Walldorf zu Braunschweig Ehegemahl und seine liebreizende und lebensfrische Tochter Richenza.
Man lernte die Damen in dem gastlichen Hause des Professors von Wendelin kennen, der am Collegium germanicum der welschen Universität die Rechte lehrte. Bologna genoß, wie schon angedeutet, dermalen noch den Ruf, die berühmteste Rechtsschule der Welt in seinen Mauern zu beherbergen, und die meisten Nationen, so auch das Deutsche Reich, unterhielten dort Akademien, die der Universität angeschlossen waren.
Professor Hieronymus von Wendelin weilte seit fast 30 Jahren als berühmter Lehrer in Bologna, und zu seinen Füßen hatte Johannes seit mehr als zwei Jahren gesessen.
Auch die Freunde verdankten, was sie an geistiger Nahrung dort genossen, in vornehmster Weise Wendelin. Viel war das freilich bei Gottfried Kristaller nicht, und noch weniger hatte sich Heinrich Achtermann mit der trockenen Rechtswissenschaft den Magen verdorben. Er war Studierens halber in Italien, in Bologna seinetwegen, aber das Studium beschränkte sich nach seiner Ansicht nicht darauf, den spröden Stoff des römischen und kirchlichen Rechts zu zergliedern, wie es Wendelin und andere gelehrte Herren versuchten, sondern für ihn schloß es auch das Studieren von Land und Leuten in sich, und unter diesen wieder nahmen die Frauen sein Hauptaugenmerk in Anspruch, die schönen, wie sich versteht. Und so beharrlich schaute er den liebreizenden Bologneserinnen in die glänzenden Augen, bis die Besitzerinnen, was freilich nicht oft geschah, verwirrt die dunklen Wimpern über die leuchtenden Sterne herabsenkten oder er erforscht zu haben glaubte, was auf ihrem tiefsten Grunde an Geheimnissen und Seelenregungen geschrieben stand.
Gottfried Kristaller, der leichtlebige, bewegliche Alemanne, suchte es ihm darin gleichzutun. Was er an Wissen mit sich nahm, drückte ihn gewiß nicht nieder; aber er hoffte, die Lücken in seinen Kenntnissen daheim, in der gleichförmigen Ruhe des Vaterhauses bald ausfüllen zu können. So ergab es sich, daß er und Heinrich Achtermann in Wahrheit die Unzertrennlichen waren. Gemeinsam durchtollten sie die Nächte, gemeinsam verübten sie ihre losen Streiche, von denen dieser oder jener sie in nicht unbedenkliche Händel zu verwickeln drohte. Aber ihr unverwüstlicher Frohsinn half ihnen über alle Schwierigkeiten hinweg, und vor dem Freimut, mit dem sie ihre Sünden bekannten, glättete sich auch die düsterste Stirn.
Nur selten eilten Heinrichs Gedanken in die ferne Heimat. Und was vor ihm alsdann auftauchte an altmodischer Tracht und Sitte im Vaterhause, vermochte ihn nicht lange zu fesseln. Er kehrte immer wieder schnell in die Wirklichkeit zurück, die ihn lachend und schmeichelnd umgab. Daheim lebte ihm der würdige Vater, immer und allerorts bestrebt, seiner Stellung als Ratsherr und Patrizier nichts zu vergeben, ihn, den Sohn und Erben, schon jetzt immer ermahnend, auf seinen künftigen Rang Rücksicht zu nehmen. Dort waltete die Mutter, die in ähnlicher Fürsorge an ihm arbeitete. Dort war alles auf die Form, auf den Anstand zugeschnitten, hier aber umgab ihn das lachende, sorglose Leben der Italiener, die in heiterer Ungebundenheit jeder Regung des Herzens unverhüllt und ungeschmält Ausdruck verleihen durften. Wäre es nach ihm allein gegangen, er hätte das sonnige Land noch länger zu seiner Heimat erwählt.
Auch eine Schwester war ihm beschieden, nur wenig jünger als er und im Wesen ihm nicht unähnlich. Aber die beiderseitige Lebhaftigkeit trug nur dazu bei, daß sie sich nach Geschwisterart ständig in den Haaren lagen, ohne daß eigentlich ernstliche Zerwürfnisse zwischen ihnen vorkamen. Doch Heinrichs Bedürfnis, zu necken und zu hänseln, erregte immer wieder den hellen Zorn des Schwesterleins, namentlich, wenn er es sich einfallen ließ, in ihr Zimmer zu kommen, während Freundinnen zu Besuch da waren. Drang er alsdann unbefugterweise ein, so konnte man darauf wetten, daß sein Abzug zuletzt ein unfreiwilliger war, der unter Schelten der Mädchen vor sich ging. Ihn aber focht das nicht weiter an, und noch heute gedachte er mit Schmunzeln der mancherlei Szenen, die es dabei gegeben hatte. Am lebhaftesten stand ihm die letzte vor Augen, die sich kurz vor seiner Abreise abspielte. Und auch die Gestalt der Freundin, um die es sich dabei handelte, war ihm in aller Lebendigkeit gewärtig.
Ein eigenartiges Mädchen, diese Venne Richerdes, wie sie ihm in der Erinnerung vorschwebte, lang aufgeschossen und noch ohne jede Rundung in den Formen. Weshalb gerade diese ihm besonders vor Augen stand, hätte er selbst nicht zu sagen vermocht. Vielleicht entwickelte sich das junge Ding noch einmal zu einer annehmbaren Mädchengestalt. Vorab aber fiel sie nur auf durch ihr sprödes, zurückhaltendes Wesen, das nicht selten sich in schroffen Meinungsäußerungen gefiel, besonders wenn sie mit seinesgleichen zusammengeriet.
Doch, eins hob sie aus dem Rahmen der übrigen hervor, das war die unnachahmliche Haltung des Kopfes mit dem wundervollen Rund der Zöpfe, die sich wie eine Krone um das Haupt legten, und dann das Spiel der Augen. Diese Augen, in deren unergründlicher Tiefe jetzt verhaltene Wehmut schlummerte, jetzt schalkhafte Teufelchen ihr Wesen zu treiben schienen und die in Augenblicken der Erregung flimmernde Blitze zu sprühen begannen. Ihm selbst war aus ihnen auch oft der Zornteufel entgegengefahren, wenn er sich nach seiner Art mit irgendeiner ihrer kleinen Eigenheiten beschäftigte. Selbst der Abschied von ihr verlief als ein solches Gewitter. Ja, zum Abschiednehmen kam es eigentlich gar nicht; denn als er sie am Tage vor seiner Abreise zufällig bei der Schwester traf, trat die zornige Spannung in ihrem Gesicht von Minute zu Minute deutlicher hervor. Die Schwester suchte ihn, wie so oft schon, auf schickliche Weise, hinauszubugsieren; aber in seiner behaglichen Dickfelligkeit pflanzte er sich nun erst recht breit in einen Sessel. Als das Gespräch zwischen den beiden Mädchen einen Augenblick stockte, suchte er es durch eine seiner gewöhnlichen Neckereien wieder in Fluß zu bringen. Noch schwieg die kampfbereite Venne, doch in ihren Augen wetterleuchtete es unheilverkündend, wie er mit innerer Freude feststellte. Nun bedurfte es nur noch geringer Mühe: hierhin einen kleinen Stich und dort einen Hieb, da war die Entladung da. Noch ein Wort, und Venne sprang auf und eilte zur Tür, ohne ihn eines Wortes zu würdigen; nur ein funkelnder Blick traf ihn dort noch, vor dem er sich, wäre er weniger dickfellig gewesen, hätte verkriechen sollen.
Der Erfolg verblüffte selbst ihn: Teufel auch, war das eine hitzige Kröte! Und nun setzte noch das Schmälen und Schelten der Schwester ein, daß er alle ihre Freundinnen weggraule. Es endigte zuletzt damit, daß sie ihn wutentbrannt aus dem Zimmer jagte. Er ging in dem nicht sehr behaglichen Gefühl, daß er vielleicht doch etwas zu weit gegangen sei, und es tat ihm halbwegs leid, daß sein Abschied von diesem Mädchen, das ihn durch ihre Eigenart immer wieder anzog, sich in so unfreundlicher Weise vollzogen hatte und daß sie seiner vielleicht mit Groll gedenke; denn Heinrich Achtermann war ein durchaus gutmütiger Gesell, dem es nicht entfernt beikam, einem Menschen absichtlich Unrecht zuzufügen.
Heute freilich lächelte er in der Erinnerung an jene dramatische Szene: Wetter noch einmal, hatte das Ding Temperament! — Wie mochte sie sich übrigens wohl inzwischen entwickelt haben? Ob sie seiner noch immer in unauslöschlichem Groll gedachte! — Da kehrten seine Gedanken in die Umwelt zurück und fanden sogleich das Ziel seiner Sehnsucht und Wünsche von heute, Richenza von Walldorf.
Ja, die wenigen Wochen ihres Aufenthaltes im Hause der Wendelins und der rege Verkehr mit den Damen hatte genügt, um sein Herz lichterloh für die schöne Tochter des Obristen brennen zu lassen. Vergessen waren die liebreizenden Bologneserinnen, verdrängt von der lebensfrischen, sprudelnden Nichte des Professors.
Sie war zur Zeit unbeschränkte Alleinherrscherin in seinem Herzen. Auch die Freunde merkten seinen Gemütszustand und ließen es an harmlosen Neckereien nicht fehlen. Daß die kluge Richenza allein die Verheerung nicht erkannt hätte, die sie angerichtet, war kaum zu glauben. Sie ließ sich die Huldigungen des stattlichen Jünglings gern gefallen. Freilich besorgte sie nicht, daß er dauernd seinen Seelenfrieden an sie verlieren werde; denn die gelegentlichen Äußerungen der Freunde verrieten ihr, daß sie nicht die erste Rose sei, die er zu pflücken begehre. Über ihre eigenen Gefühle war sie sich nicht ganz im klaren, aber sie traute sich die Zurückhaltung zu, die gegebenenfalls, auch während der engeren Berührung, wie sie die gemeinsame Heimreise notwendig bringen mußte, eine Schranke festhalten würde, um ein allzu ungestümes Werben zu verhindern. Jetzt sahen sie sich täglich, ja die letzten Tage, seit die Studenten ihrer Verpflichtungen gegen die Universität überhoben waren, mehrmals am Tage, nachmittags bei gemeinsamen Spaziergängen, abends im Hause der Wendelins.
Ein besonderer Anlaß hatte die Walldorfschen Damen nach Italien geführt. Daheim lag das Brüderlein an langem Siechtum darnieder. Keine ärztliche Kunst konnte ihm Heilung bringen. Da riet der ihnen befreundete Prior eines Klosters der frommen Mutter, sie solle eine Wallfahrt nach Rom unternehmen, um den Segen des Papstes und die mächtige Fürbitte der Heiligen zu gewinnen. Der Vater, der rauhe Kriegsmann, murrte und sprach von pfäffischem Firlefanz, aber die Mutter ließ sich nicht beirren und brach mit der Tochter auf.
Rom lag hinter ihnen, und ihre Herzen waren voll froher Hoffnung; denn nicht nur hatten sie sich die Fürsprache im Himmel gesichert, sondern sie brachten auch die Vorschriften eines berühmten Arztes mit, von dessen Heilkunst sie in Rom erfuhren. Nach genauer Erkundigung über die Art des Leidens gab er ihnen seinen ärztlichen Rat mit auf den Weg.
Angesichts der Beschwerden der Reise war es für die Damen eine große Erleichterung, daß sie in den Wendelins Verwandte fanden, die ihnen auf der Hin-, wie auf der Rückreise gern Gastfreundschaft erwiesen. Dieser Aufenthalt bei dem berühmten Rechtsgelehrten, den sie, besonders Richenza, bisher kaum mehr als dem Namen nach gekannt hatten, bot ihnen nicht nur willkommene Rast, sondern zwischen der Tochter des Hauses, der lieblichen Gisela, und Richenza war eine aufrichtige Freundschaft und eine fast schwesterliche Liebe aufgeblüht.
Lag, als sie nach Rom wollten, noch die Sorge um den Sohn und Bruder wie ein Druck auf ihnen, so gab sich Richenza jetzt mit der ungebundenen Fröhlichkeit, die ein Grundzug ihres Wesens war. In den jungen Deutschen, die im Hause Wendelin ein und aus gingen, fand sie das willkommene Gegenstück zu ihrem eigenen Frohsinn, und Heinrich Achtermann wie Gottfried Kristaller waren immer bereit, auf ihre tausend Neckereien und Scherze einzugehen, während Johannes mehr zu der stilleren Gisela stand.
Die Aussicht, mit den beiden Goslarern die Heimreise antreten zu können, erfüllte Richenza mit heller Freude; denn auf die Dauer war von der frommen Mutter und dem bewährten Diener, den sie mitgebracht hatten, nicht allzuviel Kurzweil zu erwarten. Man beredete alle Einzelheiten der Fahrt, und der Tag der Abreise stand fest, da wurden ihre Pläne noch im letzten Augenblick über den Haufen geworfen.
Heinrich und Johannes wohnten in einem Hause der Karmelitergasse. Die Verbindung mit der Heimat war während ihres Aufenthaltes in der Fremde nicht allzu eng gewesen, ein Schreiben hin und her im Jahre oder deren zwei, das erschien beiden Teilen ausreichend, um sich von dem gegenseitigen Wohlergehen unterrichtet zu halten. Um so größer daher das Staunen, als Heinrich Achtermann kurz vor der Abreise noch einen Brief des Vaters ausgehändigt erhielt, der den letzten Teil seines Weges, von Trient ab, sogar mit besonderem Boten befördert worden war, da der Wagenzug der Kaufleute, die bis dahin den freundwilligen Beförderer abgegeben hatten, linksab, ins Val Sugano, einbog, um nach Venedig zu gelangen. Heinrich erbrach das Siegel voller Erregung, denn er ahnte, daß in dem Briefe Ungewöhnliches stehen werde. Kaum hatte er ihn durchflogen, da eilte er auch schon zu Johannes und pochte ungestüm an das noch verschlossene Zimmer.
»Auf, Langschläfer, mach' auf!« Und als der drinnen etwas von »Ruhestörer« murrte, rief er noch dringlicher: »Eile Dich, wichtige Nachricht von daheim!«
Da öffnete Johannes, der erst notdürftig bekleidet war, die Tür, und schon sprudelte ihm Heinrich die Neuigkeit entgegen.
»So lies doch, Mensch, lies doch«, drängte er, fuchtelte dabei aber mit dem Schreiben umher. Ruhig nahm es ihm Johannes aus der Hand und schickte sich an zu lesen, doch schon unterbrach ihn der Freund wieder: »Denk' doch, unser ganzer Reiseplan ist über den Haufen geworfen; nach Mailand sollen wir, über den Gotthardt, mit dem Ernesti ziehen!«
Etwas unwillig wehrte ihn Johannes ab: »Soll ich nun lesen, oder willst Du erzählen?«
Da ließ jener von ihm ab, konnte sich aber nicht enthalten, über dem Lesen immer wieder einen kleinen Fluch oder ein erregtes »Was sagst Du dazu?« einzuschalten. Johannes ließ sich indes nicht beirren, sondern las den Brief mit aller Gründlichkeit, und als er am Ende war, begann er noch einmal. Aber wiederum vermochte er nichts anderes herauszudeuten, als was er schon zum ersten Male gelesen.
Also schrieb aber der Vater und Ratsherr Heinrich Achtermann zu Goslar an seinen Sohn Heinrich:
»... demnach wir darauff gefaßt seyn undt erwarten, daß Deine Rückkehr, viellieber Sohn, sich noch umb mehreres verzögern werde, wasmaßen wir wünschen müssen, daß Du, ohngeachtet der größeren Strapazen undt Fatiguen, von Bologna den Weg uber Mediolanum, welches man jetzo heyßet Maylant, undt weyter uber den Sankt Gotthardtsperg wählen mögest, weyl Du in obgemeldeter Statt zum Anfang octobris den wohledlen undt wohlachtbaren Herrn Henricus Ernesti würst treffen, als welcher, nähmlich Herr Henricus Ernesti, dem hohen Rahte der Statt Goslar günstige Bottschaft von der römischen Curia, auch des Papstes Heyligkeyt zu erlangen beauftraget undt gewillt ist.
Obzwar nun vorbemeldeter Herr Henricus Ernesti unß solche Bottschaft in persona zu uberbringen bereyt, auch gehalten ist, er unß aber bittet, ihn vors erste davon zu befreyen, sintemalen er noch in denen hollandtschen Stätten zu weylen obligieret sey, haben wir unß dahin resolvieret, daß Du, viellieber Sohn, die obgemeldete Bottschaft uns, sigillo wohl verwahret, unversehret uberbringen mögest, undt seyn wir gewärtig, daß Du Dich der hohen Ehre, so Dir damit widerfähret, würst wohl gewachsen zeygen. Tun Dir auch zu wissen, daß es des Herrn Doctor Rudolpfus Hardt, als des Vaters Deynes Freundes undt Gesellen Johannes Hardt, Wille undt Befehl ist, selbiger möge Dir das Geleyt geben auf der Reyse gen Maylant zum Herrn Henricus Ernesti. Auch verhoffen wir, daß Ihr alle Fährlichkeyten der Fahrt möget wohl bestehen undt bey unß in Gesundtheyt werdet eyntreffen ...« Also schrieb der Ratsherr Achtermann an seinen Sohn Heinrich unter dem 25. Juni des Jahres 1515.
Johannes rieb sich die Stirn: Das warf ihre Reisepläne allerdings gründlich über den Haufen! Ihm selbst machte es ja schließlich nicht viel aus, ob er einige Monate früher oder später in Goslar eintraf, und da ihm Gelegenheit geboten wurde, das mächtige Handelszentrum Mailand zu sehen, wie die Schweiz und den Rhein, so sagte ihm die Änderung von Minute zu Minute mehr zu. Aber er verstand den Groll Heinrichs ebensosehr, kam dieser doch um die Möglichkeit, mit seiner neuen Herzenskönigin, der schönen Richenza, noch länger zusammenzusein.
Natürlich mußte auch Gottfried Kristaller sogleich von der veränderten Lage unterrichtet werden! Sie fanden ihn beim Frühstück. Er gewann der Sache sofort die beste Seite ab. »Aber das ist ja herrlich, prächtig, ihr Leute«, rief er begeistert. »Da reisen wir ja zusammen, und ich kann Euch unser altes, liebes Straßburg zeigen.«
»Du hast gut reden«, murrte Heinrich. »Dir mag es gelegen kommen, aber mir verdirbt es die ganze Rechnung.«
»Ach ja, ich verstehe,« schaltete Gottfried gutmütig lachend ein, »Du meinst, nun geht Dir das trauliche Zusammensein mit Richenza Walldorf verloren. Herzliches Beileid! Aber ich schaffe Dir Ersatz in unsern schönen Straßburgerinnen.«
»Geh mir mit Deinen Dummheiten. Was gehen mich Deine Straßburger Gänschen an!« grollte er. »Oho,« zürnte da Gottfried, dem der Schelm im Nacken saß, »das laß nur mein Schwesterlein hören! Gerade ihr wollte ich Dich präsentieren, von den noch schöneren Bäschen und Freundinnen ganz zu schweigen. Doch wenn Du nicht willst, so habe ich noch ein anderes Lockmittel: Unsern Wein wirst Du nicht verschmähen, und der wird Deine Lebensgeister schon wieder heben. Erst wird gehörig Rast im alten Straßburg gehalten, und dann mögt Ihr zu Euren Hyperboräern heimziehen. Mich friert jetzt schon, denke ich nur an Eure Eiswüsten da oben im Norden!«
Da mischte sich Johannes ins Wort. »Nun gebt einmal Ruhe, Ihr Streithähne, und laßt uns überlegen, was zunächst zu tun ist. Ich meine, vor allem müssen wir die Walldorfschen Damen von der Neuigkeit unterrichten.« Und das geschah denn auch.
Man war natürlich im Hause Wendelin nicht weniger überrascht, und besonders Richenza tat unzufrieden, daß die schönen Pläne ins Wasser fielen. Aber es zeigte sich doch, daß die Wunde, die ihrem Herzen geschlagen war, nicht allzu tief ging. Während die Mutter noch klagte, daß sie nun der angenehmen Begleitung und des Schutzes verlustig gingen, fand Richenza schon wieder ein munteres Wort. »Ei, so müssen wir uns also des Wiedersehens daheim getrösten, in Goslar oder in Braunschweig. Und nun wollen wir nicht länger Kopfhänger sein«, schloß sie herzhaft. »Die Tage schwinden schnell dahin, die uns noch bleiben. ›Carpe diem‹, heißt's nicht so, Ihr gelehrten Herren? Ich hörte es immer vom Oheim in Braunschweig, wenn ihm die Schaffnerin noch heimlich eine Flasche des guten Weines holen mußte, ohne daß es die Gattin sah. Also ans Werk, das heißt: Was wollen wir heute noch unternehmen?«
Die Auswahl war nicht groß in Bologna. Die dumpfen, glutheißen Straßen der Stadt boten kaum des Abends Erholung, und die Elemente, welche sie alsdann belebten, waren, wie andererorts, kein Anreiz für Damen. Es blieben nur die Uferwaldungen am nahen Reno übrig, dessen schattige Gänge man also am Spätnachmittage aufsuchen wollte. Der Fluß selbst war, wie die meisten Wasserläufe, die der Apennin speist, jetzt zu einem dünnen Rinnsal zusammengeschrumpft.
Der Schicklichkeit halber begleitete Donna Wendelin, die Mutter Giselas, die Ausflügler, obwohl diese lieber unter sich gewesen wären. Dem guten Gottfried fiel die Ehre zu, die Dame zu führen. Er machte zuerst ein etwas sauersüßes Gesicht, doch er fand sich bald mit Anstand in seine Würde, zumal er wußte, daß er den Freunden, mindestens Heinrich Achtermann, einen Gefallen erwies. Auch war Frau von Wendelin noch eine sehr hübsche Frau zu nennen, der man die erwachsene Tochter nicht ansah. Gottfried spielte seine Rolle als galanter Ritter so anmutig und war so unerschöpflich in seinen drolligen Einfällen, daß Frau von Wendelin aus dem Lachen nicht herauskam.
Die beiden anderen Paare gingen bald langsamer, bald schneller und beredeten, was ihnen am Herzen lag. Heinrichs Ungestüm drängte immer wieder zu einem entscheidenden Wort, aber Richenza hielt ihn mit ebensoviel Anmut wie Geschicklichkeit in Schranken. Als er dann doch von seiner Liebe zu reden begann, unterbrach sie ihn schelmisch lächelnd, wie wohl auch ihr bei seinen Worten ums Herz war.
»Ich bitte Euch, sprecht nicht weiter. Wir wollen den Tag nicht durch so ernste Dinge belasten. Ihr seid mir gut, das will ich glauben, wenngleich ...« — Heinrich wollte beteuern, da fuhr sie heiter fort: »Um Gottes willen, nur nicht auch noch einen schweren Eid bei dieser schrecklichen Hitze; ich will's Euch glauben, auch unbeschworen. Doch im Ernst, wir wollen jetzt vernünftig sein. Laßt erst einmal die Reise zwischen unserer jungen Freundschaft liegen, dann mag's sich erweisen. Übrigens wird auch mein Herr Vater noch ein Wort mitreden wollen, ein gar gestrenger Herr!« — Die Schelmin wußte, daß sie den Vater bisher immer noch dahin brachte, wohin sie ihn haben wollte, und sie verschwieg auch, daß just in diesem Augenblick das hübsche Gesicht eines Vetters von daheim vor ihr auftauchte, der ihr seine Neigung mit noch heißeren Worten kundgetan hatte, ohne daß sie auch darüber gerade ungehalten gewesen wäre.
Seufzend ergab sich Heinrich in sein Schicksal und machte ein so betrübtes Gesicht, daß die muntere Richenza hellauf lachte. »Um Gott, nicht diese Leichenbittermiene. Ich verschwöre es ja nicht, Euch später anzuhören, nur Geduld sollt Ihr haben. Vielleicht sehen wir uns demnächst in Braunschweig wieder, und vielleicht müßt ihr mich dort im edlen Wettbewerb mit andern zu erringen suchen, die auch mich garstige Person ins Auge gefaßt haben. Ich freue mich schon jetzt auf die Rolle der minniglichen Richterin über euch.« Das war wieder ganz der Schelm Richenza, und nun fand sich auch Heinrich wieder.
Währenddessen gingen Gisela und Johannes miteinander. Ihr Gespräch floß nicht so leicht dahin wie das der Übrigen. Namentlich Gisela wollte bisweilen, wie es schien, das Wort versagen.
Sie waren in der langen Zeit, seit Johannes in Bologna weilte, in ein fast kameradschaftliches Verhältnis zueinander gekommen. Als der junge Student vor nunmehr mehr als zwei Jahren ankam, brachte er die Grüße und Empfehlungen seines Vaters mit, der, jetzt ein gesuchter Arzt in Goslar, einst mit dem Professor von Wendelin in Leipzig zusammen studiert und Freundschaft gehalten hatte. Diese alte Bekanntschaft öffnete Johannes sogleich das Haus der Wendelins, und er ging dort bald wie ein Sohn ein und aus.
Die Studenten des Collegium germanicum hielten gleich denen der andern Nationen eng zusammen, und die Professoren, zumeist Deutsche, wie Herr von Wendelin, stützten diesen Zusammenschluß dadurch, daß sie die jungen Leute an sich zogen, blieb ihnen doch selbst die Verbindung mit der alten Heimat erhalten.
Nicht alle die wilden Gesellen jener Zeit der Scholaren und Vaganten vermochten sich im Zaum zu halten. Aber die Gutgearteten unter ihnen und die aus gesitteten Familien waren doch froh, daß sich ihnen hier im fernen Welschland ein Haus auftat, in dem deutsche Laute erklangen und deutsche Art gepflegt wurde. Auch die rohen Elemente vergaßen selten eine Wohltat, die ihnen von den Professoren erwiesen wurde. Und Herr von Wendelin hatte sich in dieser Hinsicht in mehr als einem Herzen ein Denkmal der Dankbarkeit gesetzt.
Von all diesem sprach Johannes heute zu Gisela, und aus seinen Worten erklang eine aufrichtige, ehrliche Dankbarkeit, daß es ihr warm ums Herz wurde bei so viel Anerkennung ihres geliebten Vaters. Und dann kam Johannes auf sie selbst zu sprechen und ihre Freundschaft, und er gab ihr seinen heißen Dank zu erkennen, daß sie ihn dieser Freundschaft gewürdigt habe. Einem Impulse folgend, ergriff er ihre Hände und sprach, während er sich zu ihr neigte: »Habt Dank für alles, was Ihr mir erwiesen. Ich weiß nicht, wie ich die Trennung von Euch und Euren lieben Eltern werde ertragen können. In meinem Herzen bleibt Ihr für immer. Bewahrt auch mir ein freundliches Gedenken.«
Gisela war unter den Worten ihres Begleiters errötet und erblaßt. Sie vermochte kein Wort zu sagen, ihre Augen füllten sich mit Tränen. Da kam ihrer Verwirrung Gottfried zu Hilfe, der sich gerade näherte. Sie suchte sich zu fassen und zwang sich sogar ein Lächeln ab, als jener eine launige Bemerkung fallen ließ. Dann schickte man sich zur Rückkehr an.
Dies war nun der letzte Abend, den die jungen Deutschen in Bologna verlebten. Er beschloß die schönen Tage, welche dem Abschiede vorhergingen, und fand sie, wie begreiflich, im Hause der Wendelins.
Alle bemühten sich, den Scheidenden die Stunden so angenehm wie möglich zu machen. Aber sie konnten es doch nicht verhindern, daß ein Hauch leiser Wehmut über dem kleinen Kreise lag, je weiter die Stunden vorrückten. Besonders Gisela zerdrückte mehr als einmal eine stille Träne, wenn sie sich unbeobachtet glaubte. Dann glitt wohl ein schneller, heimlicher Blick nach dem Platze, wo Johannes neben der Mutter saß: Ach, er wußte ja nicht, wie ihm ihr junges Herz entgegenschlug und wie schwer sie an dem Gedanken trug, ihn morgen vielleicht für immer zu verlieren.
Die Mutter ahnte nicht, welche Verwirrung der junge Deutsche im Herzen ihres Töchterchens angerichtet hatte. Sie unterhielt sich mit ihm über die ferne Heimat ihres Gatten und sah sie durch den Mund des Freundes neu, in begeisterter Schilderung vor sich erstehen. Aber immer mehr senkten sich, von den Augenblicken angeregter Rede abgesehen, die Schatten wehmutsvoller Trauer herab. Noch einmal suchte die fröhliche Richenza die Stimmung zu retten mit einem Appell an die Jugend, wobei sie ihre Freundin Gisela besonders ins Auge faßte.
»Euch ist wohl heute nachmittag der letzte Trost auf dem Reno davongeschwommen, als wir an seinen Ufern uns ergingen. Laßt Euch nicht an Seelenstärke von einem schwachen Mädchen, wie ich es bin, übertreffen. Droht uns doch, meinem lieben Mütterlein, wie mir, in gleicher Weise die Stunde des Abschieds von diesem gastlichsten aller Häuser im Lande Italia. Ich aber habe mein Herz gewappnet gegen alle Trübsal und helfe mir über die Wehmut des Augenblicks mit einem herzhaften ›Auf Wiedersehen‹ hinweg.«
»Mach' es wie ich,« wandte sie sich nunmehr direkt an ihre Base, die liebliche Gisela, deren Gesicht sich bei den Worten der Freundin noch mehr mit Trauer überschattet hatte, »verhärte dein Herzlein, daß die Herren nicht meinen, sie hätten uns bezwungen.«
Doch damit beschwor sie das Unheil erst recht herauf. Hatte sich Gisela bis jetzt noch tapfer gehalten, so rannen ihr nunmehr die Tränen unaufhörlich über die Wangen, und sie stürzte fluchtartig aus dem Zimmer, um ihr Herzeleid den übrigen zu verbergen. Bestürzt sahen diese ihr nach. Wohl hatten die Eltern bemerkt, daß eine Freundschaft zwischen ihrem Töchterlein und dem jungen Deutschen sich entwickelte; aber der unbefangene, fast kameradschaftliche Ton, in dem sie sich äußerte, ließ sie nicht ahnen, daß die Herzensruhe ihres Lieblings ernstlich gestört wurde. Nun schien dies dennoch der Fall.
Die Mutter wie Richenza eilten der Entflohenen nach. Der Vater blieb allein zurück mit den jungen Freunden.
Auch die Männer blickten betroffen drein. Der Vater erkannte, daß sich eben vor seinen Augen der Anfang eines Dramas abzuspielen begann, dessen Ausgang im dunkeln lag. Aber bei der Gefühlstiefe, die er an seinem Töchterchen als ein Erbteil seiner selbst zu jeder Zeit bezeugt gesehen hatte, mußte er besorgen, daß ihr schwere Stunden bevorstanden.
Heinrich Achtermann und Gottfried Kristaller waren am meisten überrascht. Daß die Tränen nicht ihnen galten, wußten sie genau. Ihre eigenen Angelegenheiten hatten sie immer so sehr in Anspruch genommen, daß sie auf Johannes und Gisela nicht sonderlich achtgaben. Nun zeigte es sich, daß die arme Gisela, die ihnen um ihrer anspruchslosen Hilfsbereitschaft und Uneigennützigkeit willen ans Herz gewachsen war, ein Kummer bedrückte, der sie nach ihrer Eigenart besonders schwer treffen mußte. Sie schieden beide nur mit leichter Bürde auf dem Herzen, wenn auch Heinrich im Augenblick meinte, ohne Richenza nicht leben zu können. Doch ihm stand ja die Aussicht offen, sie in Deutschland wiederzusehen, während für Gisela und Johannes morgen der Abschied für immer bevorstand. Das tat ihm von Herzen leid.
Johannes durchzuckte ein Gefühl, halb des Schreckens, halb der Freude, als Gisela davoneilte. Hatte er bisher eine Art schwesterlichen Empfindens für sich bei ihr vorausgesetzt, so war er zuerst hieran irre geworden, als sie vor einigen Tagen am Reno ihre Gedanken über seine bevorstehende Abreise austauschten. Er sah ihre seltsame Erregung und Verwirrung und war geneigt, sie als eine Äußerung nicht nur rein freundschaftlicher Zuneigung zu deuten. Worüber er sich selbst nie zuvor klar geworden, was er für sich nie zu erhoffen gewagt hätte, das schien in ihrem Herzen Wurzel geschlagen zu haben. Damals schon durchzuckte ihn der Gedanke, sie könne ihn lieben, sie wolle ihm angehören, mit einem heißen Glücksgefühl. Jetzt fand er bestätigt, was er nicht auszudenken gewagt hatte.
Dieses junge Menschenkind, über das eine gütige Fee alle Holdseligkeit der Jugend ausgebreitet zu haben schien und das in seiner Brust gleicherweise die edelsten Gefühle echter Weiblichkeit barg, war ihm mehr als die Genossin frohseliger Jugendstunden, sie brachte ihm das Geschenk einer ersten, keuschen, zarten Liebe dar. Aber zugleich bestürmte ihn auch der Schmerz, daß er morgen schon verlieren sollte, was er eben erst gewonnen hatte. Die Trauer griff ihm ans Herz, denn er mußte sich bezwingen, um ihren Frieden nicht noch mehr zu stören, wie er sich Zwang angetan hatte, seit er selbst erkannte, daß die Liebe zu dem holdseligen Geschöpf seine Brust durchzittere.
Inzwischen waren die Mutter und Richenza um Gisela bemüht. Da sie argwöhnte, daß der junge Deutsche ihre Tochter durch seine Schuld um ihre Herzensruhe gebracht habe, wallte zuerst der Unmut gegen jenen in ihr auf. Aber beim ersten Wort, welches sie in dieser Hinsicht fallen ließ, warf sich Gisela sofort zum Verteidiger des heimlich Geliebten auf.
»Er ist gewiß ganz unschuldig an der Sache, die Schuld habe ich dummes Mädchen allein. Weshalb wußte ich meine Gefühle nicht besser zu verbergen. Nun habe ich zu dem Schmerz auch noch den Spott, denn die Freunde werden sich gewiß über mich einfältiges Ding lustig machen.«
»Das werden sie nicht tun,« fiel ihr Richenza ins Wort, »dazu sind sie viel zu ehrlich und anständig. Und Dein Johannes im besonderen, so darf ich ihn hier doch wohl nennen, denkt zuletzt daran; denn ich müßte eine schlechte Beobachterin sein, wenn nicht auch ihm der Abschied von Dir recht naheginge.«
Gisela wehrte unter Tränen lächelnd ab, doch die Freundin ließ sich nicht beirren. »Ich weiß, was ich weiß. Übrigens kann ich ihn ja erforschen, wenn Du es wünschest.« Erschrocken wehrte Gisela ab, während tiefe Röte ihr Gesicht überflutete.
»Daß Du Dich nicht unterstehst! Ich müßte mich ja zu Tode schämen; denn gewiß würde er glauben, Du handeltest in meinem Auftrage, um ihn auszuforschen.«
Richenza versprach zu schweigen. »Nun aber auch wieder ein fröhliches Gesicht aufgesteckt, daß die Herren sich nicht einbilden, Du habest um sie Dein Tränenkrüglein gefüllt. Ich weiß zudem noch einen Trost für Dein Leid. Es muß ja morgen nicht für immer geschieden sein. Wenn die Eltern es erlauben, besuchst Du uns daheim in Braunschweig. Der Weg zu uns ist nicht weiter als von uns zu Euch, und Du siehst, ich bin heil hier angelangt und hoffe, auch unversehrt wieder im alten Braunschweig einzutreffen. Von da nach Goslar ist's ein Katzensprung. Wollt Ihr also, so gibt es im nächsten Jahr ein frohes Wiedersehn bei uns daheim.«
Gisela lächelte schwermütig zu den Zukunftsplänen der Base. »Du glaubst ja selbst nicht, daß der Plan gelingen wird.«
»Das tue ich allerdings; es hängt nur von Dir und Deinen Eltern ab, ob und wann er in Erfüllung gehen soll. Ihr seht doch an mir und der lieben Mutter, daß auch ein Frauenzimmer den Weg über die Alpen wagen kann. Außerdem wirst Du immer reiche Gesellschaft finden, denn die Straße über den Brenner ist so begangen, daß jede Gefahr ausgeschlossen ist. Wenn Dich also nicht jedes Murmeltierchen schreckt, das ein Steinchen zum Herabrollen bringt, so mach' Dich getrost auf die Reise. An Kurzweil wird's Dir bei uns nicht fehlen. Nun aber laßt uns wieder zu den Herren hineingehen, daß sie nicht auf falsche Gedanken geraten.«
Auch die Mutter trieb dazu. Ihr Herz war von mehr Sorge erfüllt, als sie zu erkennen gab; denn sie kannte ihr Kind zu genau, um nicht zu wissen, daß die Wunde zu tief ging, um ohne ernsten Schaden geheilt werden zu können.
Im Zimmer ergriff Richenza sogleich wieder das Wort und suchte die Situation zu klären.
»Das sind die dummen Schwächen, unter denen wir Frauenzimmer leiden. Kaum freut man sich einmal wirklich, ist auch gleich so eine Migräne da, die uns bis zu Tränen niederzwingt. Aber, Herr Oheim, wir haben indes schon ein Plänchen ausgeheckt, das unsere Gisela heilen wird. Sie muß einmal heraus aus eurer Tropenluft hierzulande. Erlaubt, daß sie uns besuche daheim im lieben Braunschweig, wo ja auch Eure Wiege stand. Dann mögen Euch ihre roten Wänglein bei der Rückkehr verraten, daß wir gute Pflege gegeben haben; und was dabei noch für Euch, Herr Oheim, abfällt an lebendigen Erinnerungen an Eure liebe Heimatstadt, das nehmt als gern gegebene Draufgabe. Also entscheidet Euch kurzerhand und gebt die Erlaubnis. Ist's nicht für sogleich, so schenkt uns die Gisela für das kommende Jahr. Und wenn es die Herren Studiosi und Doctores gelüstet, uns zu besuchen, so wissen die Herren, daß es von Goslar nur ein Ritt von wenigen Stunden ist. Herr Kristaller muß sich allerdings schon von seinem fernen Straßburg herbemühen, will er, daß der lustige Kreis von Bologna in Braunschweig aufs neue erstehen soll.«
Der Vater war überrascht und suchte nach Einwendungen. Aber da er die leuchtenden Augen seines Lieblings während der Worte Richenzas sah, hielt er mit lauten Bedenken zurück und hoffte, daß die Zeit ihn der Notwendigkeit überheben werde, die endgültige Zustimmung zu erteilen. Doch nun legte sich auch Johannes für den Plan ins Zeug. Das war ja die Erfüllung einer Hoffnung, die er selbst gar nicht zu hegen gewagt hätte. Und den vereinten Anstrengungen gelang es, die endgültige Zusage zu erhalten. Er ahnte nicht, daß die Ausführung unter viel trüberen Umständen wirklich erfolgen sollte.
Die Stunde des Abschieds war gekommen. Als Johannes sich über die Hand Giselas neigte, flüsterte er ihr zu: »Ich weiß, daß wir uns wiedersehen; das macht mir den Abschied leichter. Bewahrt mir bis dahin ein Plätzchen in Eurem Herzen.«
Ein lichtes Rot der Freude überflog das Gesichtchen Giselas, und eine reizende Verwirrung ließ sie noch lieblicher erscheinen. Aufs neue füllten Tränen ihre Augen, aber es waren Tränen seligen Glücks. Dann schloß sich hinter den Freunden das Tor des alten Palazzo Faba, in dem der Professor wohnte.
A
ls am andern Morgen die Glocken von San Giacomo Maggiore die Frühmette einläuteten, traten Johannes und Heinrich, wie auch Gottfried, aus ihrer Wohnung und bestiegen die schon bereitgehaltenen Pferde, denen ihre Felleisen, das einzige Reisegepäck, welches sie persönlich mit sich führten, sorgsam aufgeschnallt waren.
Das Tor wurde gerade von dem halbverschlafenen Wächter geöffnet, als sie die Stadt auf dem Wege verließen, der als die uralte Via Aemilia vor dem Apennin entlang führt und nur jeweils in den Städten, die sie durchkreuzt, sich eine Abweichung von der schnurgeraden Richtung gefallen lassen muß, in der sie als ein endloses, weißes Band sich dahinzieht. Mit ihnen ging noch ein Mönchlein aus der Stadt, das dort wohl übernachtet hatte und nun in sein Kloster zurückkehren wollte. Es hielt indes nur kurze Zeit Schritt mit den rüstig ausgreifenden Rossen, und sie waren allein. Noch lag der Schatten des frühen Morgens mit seiner Kühle auf der Straße, und ein Frösteln überflog ihre Glieder. Aber munter ging es weiter.
»Du sinnst wohl noch über den Abschied von der lieblichen Gisela nach?« unterbrach Gottfried das Schweigen. Doch Johannes verspürte keine Neigung auf den scherzhaften Ton einzugehen. »Laß die Geschichte; Du tust mir weh mit dieser Art davon zu sprechen.« Da brach Gottfried das Gespräch ab, und sie ritten schweigend fürbaß. Auch Heinrich Achtermann zog wider seine sonstige Gewohnheit mürrisch und wortkarg dahin.
Noch war nichts Lebendes auf der Straße zu sehen. Doch jetzt blitzte es im Morgennebel vor ihnen, und trapp, trapp, trapp kam es zu ihnen heran. Es waren Speerreiter des Podesta von Bologna, die ein paar armselige Lumpen mit sich führten. Auf einer nächtlichen Streife im Banngebiet der Stadt auf frischer Tat ertappt, trabten sie jetzt trübselig hinter den Pferden drein, an deren Schweif sie kurzerhand gebunden waren. Auch andere Frühaufsteher tauchten bald auf der Straße auf, Landleute, die ihr Geschäft in die Stadt führte, Bauern mit Ochsenkarren, welche Getreide und sonstige Früchte den Kaufleuten in Bologna bringen wollten, junge, rüstige Dirnen und alte Weiber, die Melonen und andere Früchte heimischen Fleißes am selben Ziel in Geld umzusetzen hofften.
Inzwischen war die Sonne hervorgebrochen und übergoß Land und Straße mit ihren wärmenden Strahlen.
Langes Schweigen war wider die Natur des lebhaften Gottfried.
»Wißt ihr übrigens, daß wir in unserm Stumpfsinn auf geschichtsschwangerem Boden dahinreiten? Hier erklang schon vor anderthalbtausend Jahren der eherne Tritt römischer Legionen, die auf Eroberung auszogen, und wieder um ein beträchtliches später zogen in umgekehrter Richtung die Gewappneten der deutschen Kaiser sie entlang, um in das Land Italia einzudringen?«
Die lachende Septembersonne verscheuchte auch die Grübeleien, in die Johannes versunken war, und die jugendliche Hoffnungsfreudigkeit siegte über die Zweifel, die sich ihm aufgedrängt hatten: Es würde doch alles gut werden, wie er es selbst gestern Gisela gesagt hatte. Und er konnte auf den fröhlichen Ton des Freundes eingehen.
»Da kennst Du unsern guten Magister Sutor schlecht — den schlichten ›Schuster‹ vertrug seine Gelehrsamkeit schlecht, und wenn er uns einmal aus Unachtsamkeit oder Bosheit über die Lippen glitt, saß uns der Bakel schon auf dem Buckel. — Er hat uns haarklein den Weg gezeigt, den der große Cäsar mit seinen Heeren nahm, und die Tuben der Legionen des Varus hörten wir schon erklingen, wenn sie noch diesseits der Alpen, meinetwegen auf der alten Via Aemilia, ertönten, auf der wir jetzt selbst dahintraben. Ich wollte nur, ich hätte gleich ihnen erst die Alpen überschritten und zöge dem alten Goslar zu.«
Unterdes war die Sonne höher und höher gestiegen und sandte ihre Strahlen mit einer Glut auf die Reisenden herab, daß ihr Gespräch wieder versiegte. Auf den Feldern arbeiteten Bauern mit ihrem Ochsengespann, vor ihnen lag das weiße, schattenlose Band der Straße, auf der sich kaum ein Lebewesen zeigte, denn alles floh vor der sengenden Hitze.
Die Freunde hatten sich als Ziel des Tages Parma gesetzt; aber als sie Modena, etwa halbwegs zwischen Bologna und Parma, gegen Mittag erreichten, fühlten sie doch, daß sie gut täten, den Pferden, wie sich selbst nicht noch eine gleich große Wegstrecke zuzumuten, und sie blieben dort bis zum nächsten Morgen. Nach zwei weiteren, gleich ermüdenden Tagereisen trafen sie in Piacenza, der alten Brückenstadt am Po, ein, wo ihre letzte Raststätte vor Mailand sein sollte.
In Piacenza erfuhren sie in der Herberge von deutschen Landsleuten, die von Genua angekommen waren, daß der Kaufherr Ernesti tags zuvor hier eingetroffen, aber schon nach Mailand vorausgeeilt sei, weil er dort noch Geschäfte zu erledigen habe.
Unterwegs schon hatte Gottfried nach diesem Ernesti gefragt, aber Heinrich wie Johannes vermochten ihm keinen Aufschluß über den seltsamen Mann zu geben, der als einfacher Kaufmann mit den Mächtigsten der Erde verhandelte, wie es sonst nur die Aufgabe kaiserlicher Ambassaden war. Wohl hatten sie in Goslar den Namen des Mannes aussprechen hören, doch nach Art der Jugend kümmerten sie sich wenig um Dinge, die sie und ihre Jahre nicht berührten. Beide, besonders Heinrich, fesselten viel mehr, da sie noch in der Münsterschule zu Goslar saßen und unter dem Joch des gestrengen Magisters Sutor seufzten, die Spiele mit den Altersgenossen und die Reigen mit den hübschen Goslarer Bürgermädchen, besonders der Lange Tanz, ein Reigen aus alter Zeit, welcher der Sage nach die immerwährenden Kämpfe zwischen den einheimischen Sachsen und den zugewanderten fränkischen Bergleuten beendet hatte. Alljährlich zur Fastnachtszeit fand er statt, und selbst ein hochweiser und gestrenger Rat sah dem lustigen Treiben wohlgefällig zu, das sich vor seinen Augen abspielte in dem anmutigen Schreiten und Sichneigen und Hüpfen lieblicher Jungfräulein und kühnstolzer Jünglinge, die jene geleiteten.
Man konnte also die Wißbegier des Freundes hinsichtlich Ernestis nicht befriedigen. Auch das, was die mitreisenden Kaufleute nächsten Tages auf der Reise von Piacenza nach Mailand über ihn zu sagen wußten, ließ noch vieles an diesem Manne im dunklen. Daß er ein seltsamer Mensch sei, erhellte zur Genüge aus ihren Worten, aber auch, daß er weltbefahren und über das gewöhnliche Maß hinaus angesehen und mächtig sein müsse, blieb demnach nicht zweifelhaft. Seine Beziehungen reichten von Italien bis Frankreich, und er war in den Handelsplätzen der Niederlande gleich bekannt wie in der berühmten Stadt Nowgorod am Ilmensee im fernen Reiche der reußischen Zaren.
Daß Ernesti in besonders wichtiger Mission vom Rate der Stadt Goslar zur Päpstlichen Kurie in Rom entsandt worden war, wußten sie aus dem Briefe von daheim. Heinrich ließ darüber den Kaufleuten gegenüber nichts verlauten, da er nicht wußte, ob das der Sache dienlich war, und Johannes schwieg ebenso selbstverständlich. Die Kaufherren erzählten, daß Ernesti als Heimweg von Rom nicht den Weg über die Abruzzen gewählt habe, wiewohl dieser der kürzere war, sondern in einem kleinen Küstenklipper nach Genua gefahren sei, um dort im Dogenpalast noch etwas zu erledigen. — Fürwahr, ein seltsamer, geheimnisvoller Mann, dieser Ernesti, dachte auch Johannes, dessen Gedanken sich allmählich mehr und mehr mit ihm beschäftigten, dem die Sache seiner Vaterstadt anvertraut war und mit dem ihn das Leben wahrscheinlich auch künftig noch mehr als einmal zusammenbringen würde, wenn er erst, wozu seine Studien den Weg bereitet hatten und was sein Vater sehnlich wünschte, im Rate der Stadt Goslar Sitz und Stimme hätte.
Der Wagenzug war durch ein Hindernis ins Stocken geraten. Während die Knechte unter der Aufsicht der Kaufherren noch mit der Beseitigung des Hindernisses beschäftigt waren, ritt Johannes mit den Freunden langsam voraus. Noch klangen in seinen Ohren die Worte der Mitreisenden über Ernesti wieder, aber seine Gedanken blieben an der alten, wehrhaften Stadt am Harz haften, die jenen gesandt hatte und durch ihn selbst von dem Ausfalle des Auftrages Kunde erhalten würde. Wie mochte es dort aussehen, was die Freunde und Gespielinnen treiben, von denen er nun schon manches Jahr fern weilte; denn auch vor den Jahren, die er in Bologna verlebte, sah ihn die Heimat nur selten, wenn er in den Ferien von der Universität Wittenberg zu Besuch kam. Die seltenen Briefe der Eltern gaben nur unvollkommen Auskunft über das, was gerade ihn interessierte.





























