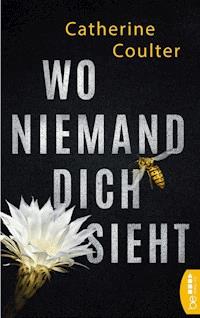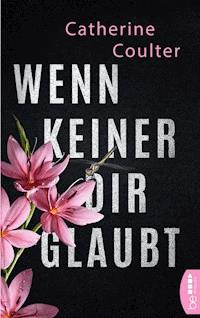4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein FBI Thriller mit Dillon Savich und Lacey Sherlock
- Sprache: Deutsch
Wenn Hilfe zur tödlichen Gefahr wird ...
Richter Ramsey Hunt sucht nach einer Schießerei in seinem Gerichtssaal Zuflucht in der Einsamkeit der Berge. Dort findet er ein schwerverletztes Mädchen, das er in seiner Hütte gesund pflegt. Doch die Wildnis bietet keinen Schutz vor der Vergangenheit, denn plötzlich bedrohen nicht nur zwei Killer sein Leben, sondern auch die Mutter des kleinen Kindes will ihn erschießen. Eine tödliches Katz-und-Maus-Spiel beginnt ...
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Danksagung
Prolog
1
Rocky Mountains, im Frühling
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Epilog
Über dieses Buch
Wenn Hilfe zur tödlichen Gefahr wird …
Richter Ramsey Hunt sucht nach einer Schießerei in seinem Gerichtssaal Zuflucht in der Einsamkeit der Berge. Dort findet er ein schwerverletztes Mädchen, das er in seiner Hütte gesund pflegt. Doch die Wildnis bietet keinen Schutz vor der Vergangenheit, denn plötzlich bedrohen nicht nur zwei Killer sein Leben, sondern auch die Mutter des kleinen Kindes will ihn erschießen. Eine tödliches Katz-und-Maus-Spiel beginnt …
Über die Autorin
Catherine Coulter wuchs auf einer Ranch in Texas auf und schrieb nach ihrem Uniabschluss Reden an der Wall Street, bevor sie sich voll und ganz dem Schreiben widmete. Inzwischen hat sie mehr als 70 Romane veröffentlicht – darunter viele Regency Romances, aber auch einige Thriller. Ihre Bücher stürmen regelmäßig die Bestsellerlisten der New York Times. Catherine Coulter lebt mit ihrem Ehemann und drei Katzen in Nordkalifornien.
Catherine Coulter
Vergeben, nicht vergessen
Aus dem Amerikanischen von Inez Meyer
beTHRILLED
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1998 by Catherine Coulter
Titel der amerikanischen Originalausgabe: The Target
Originalverlag: G. P. Putnam’s Sons, a member of Penguin Putnam Inc., New York
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2000 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH
Übersetzung: Inez Meyer
Lektorat/Projektmanagement: Anne Pias
Covergestaltung: © www.buerosued.de
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-4490-5
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Mein Dank gilt Alex McClure,Esquire, für ihre unerschrockeneUnterweisung der Abläufe einesbundesstaatlichen Rechtssystems.
Für Dr. Anton Pogany,der den Instinkt,die Geduld unddie Leichtigkeit besitzt –mit anderen Worten,die passende Ausrüstung hat.Lass uns weiterkochen.
Prolog
Er hatte den Mann deutlich vor Augen: groß, dunkel gekleidet, eine starre Silhouette vor dem neblig grauen Himmel. Er betrat einen riesigen Granitbau, hässlich und uninteressant, mit einer Unzahl von Fenstern, die, von den allerobersten einmal abgesehen, eigentlich auf gar nichts hinausschauten. Plötzlich stand er hinter dem Mann, unmittelbar hinter seiner Schulter, hielt mit ihm Schritt und beobachtete, wie er mit dem Aufzug in das neunzehnte Stockwerk fuhr. Fast schon neben ihm laufend, begleitete er ihn den langen Korridor entlang, wo er eine Tür zu einem weitläufigen Büro öffnete. Eine freundliche Sekretärin empfing ihn und lachte über eine von ihm gemachte Bemerkung. Er beobachtete, wie der Mann noch zwei weitere Leute begrüßte, einen jungen Mann und eine junge Frau, beide gut gekleidet und beide offenbar ihm unterstellt. Er betrat mit dem Mann zusammen ein großes Büro, sah die amerikanische Flagge, einen voluminösen Schreibtisch mit einem Computer, im Rücken eingebaute Wandregale, neben ihm das Fenster. Dann stand er dicht hinter dem Mann und hätte die Hand ausstrecken und ihm helfen können, seinen langen, schwarzen Talar überzuziehen. Er beobachtete ihn dabei, wie er die beiden Verschlüsse festzurrte. Der Mann öffnete die Tür und betrat einen großen Saal, sein Gesichtsausdruck ernst, fast schon kalt, jeglicher Humor von vorhin wie weggewischt. Ein Klingeln ertönte und hörte in dem Moment auf, als er den Saal betrat. Es wurde vollkommen still.
Plötzlich begann sich der Saal zu drehen, Gesichter verschwammen miteinander, die Luft des Raums wurde schwer und schwerer, dann wurden die beiden Haupttüren aufgerissen, und drei Männer stürzten herein. Sie trugen Gewehre, Angriffswaffen, die einer russischen AK47 ähnelten. Sie schossen, Menschen schrien, Blut spritzte auf. Er beobachtete, wie sich die Gesichtszüge des Mannes vor Schreck und Wut verspannten. Plötzlich bemerkte er, wie der Mann mit fliegender Robe über die Barriere sprang, die ihn von den anderen Menschen im Saal trennte. Sein Bein verharrte in der Luft, er drehte sich um die eigene Achse und griff an. Seine Bewegungen waren so schnell, dass man sie nicht deutlich erkennen konnte. Jemand schrie laut auf.
Jetzt war er dicht hinter dem Mann, hörte seinen Atem, spürte seine angestaute Wut, diese unbändige Anspannung und Konzentration, und er begann zu grübeln.
Plötzlich drehte sich der Mann erneut herum, diesmal, um ihm ins Gesicht zu blicken. Er starrte sich selbst an, sah tief in die Augen eines Mannes, der gerade gemordet hatte und wieder morden würde. Er fühlte, wie sich der Speichel in seinem Mund sammelte, fühlte die angespannten Muskeln, fühlte, wie sein Arm zuschlug und den Mann dann an der Gurgel packte.
Jäh richtete er sich auf und strampelte das Laken, das ihn wie bei einer Mumie dicht umhüllt hatte, von sich. Ein Schrei erstarb auf seinen Lippen. Er war schweißgebadet, das Haar klebte ihm am Kopf. Sein Herz schlug so schnell und laut, dass er zu explodieren glaubte. Da war er wieder, dachte er, dieser verdammte Traum. Es schien ihm, als ob er es nicht mehr länger würde ertragen können.
Eine Stunde später ging er aus dem Haus und verschloss sorgfältig die Tür. Er war auf dem Weg zu seinem Auto, als ein Mann aus dem Gebüsch sprang und ihn mit einem Blitzlichtgewitter blendete. Das war zu viel.
Er hechtete auf den hinstürzenden Fotografen zu, verkrallte sich in seinen Hemdkragen und schrie ihm ins Gesicht: »Sie sind zu weit gegangen, Sie Mistkerl!« Er grabschte sich die Kamera, zerrte den Film heraus und schmiss ihn weg. Dann schmetterte er dem Mann, der ihn, auf dem Rücken liegend, anstarrte, die Kamera vor die Füße.
»Das können Sie nicht tun!«
»Ich habe es gerade getan. Runter von meinem Grundstück.«
Der Mann stolperte auf die Füße und presste die Kamera gegen die Brust. »Ich werde Sie verklagen! Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf diese Information!«
Am liebsten hätte er den Mann zu Brei verprügelt. Sein Verlangen danach war so heftig, dass er bebte. In diesem Augenblick wurde ihm klar, dass er gehen musste. Er würde sich sonst vielleicht nicht mäßigen können, durchdrehen und tatsächlich einen dieser Mistkerle ernsthaft verletzen. Oder er würde schlichtweg verrückt werden.
1
Rocky Mountains, im Frühling
Er stand am Rande des Bergabhangs, der gute siebzig Meter abfiel, ehe er in den von Bäumen bestandenen Tälern und weichen, von wilden Blumen bewachsenen Hügeln zwischen den auseinanderklaffenden Kämmen mündete. Er atmete die frische Luft ein, die so rein war, dass ihm davon die Lunge brannte. Um der Wahrheit Genüge zu tun, brannte sie heute bereits weniger als gestern noch. Schon bald würde die reine Bergluft in zweitausend Meter Höhe ihm völlig normal erscheinen. Gestern erst war ihm aufgefallen, dass er den ganzen Tag nicht einen Gedanken an Telefon, Fernseher, Radio, Faxgerät und die Geräusche aus den umliegenden Büros verschwendet hatte, aus denen heraus Menschen ihn mit Fragen überhäuften. Und an diese grässlich blendenden, ständig gegenwärtigen Blitzlichter. Endlich begann er abzuschalten und zumindest ab und an das zu vergessen, was vorgefallen war.
Er blickte über das Tal hinweg auf das raue Bergmassiv, das sich endlose Kilometer weit in der Form unregelmäßiger Zähne ausdehnte. Herr Goudge, der Besitzer der Union-Gas-Tankstelle unten in Dillinger, hatte ihm erzählt, dass viele der hier Ansässigen, darunter zahlreiche Ursiedler, die Ansammlung zackiger Bergspitzen als Ferengi-Massiv bezeichneten. Der höchste Gipfel brachte es auf viertausend Meter und kippte ein wenig Richtung Süden ab, was ihm das Aussehen eines verunglückten Phallus verlieh. Er hatte nicht die Absicht, einen Berg mit einer so offensichtlichen Form zu besteigen. Die Leute unten in Dillinger witzelten über diesen Gipfel und erzählten, was für ein prachtvoller Anblick es sei, wenn im Frühjahr der Schnee herunterrutschte.
Wie so oft zuvor wurde er sich der Tatsache bewusst, dass er ganz und gar alleine war. Auf der Erhöhung, auf der er sich befand, wuchsen dichte Koniferenwälder, hauptsächlich Birken und Tannen und mehr Ponderosakiefern, als man hätte zählen können. Auch Zittergras gab es reichlich. Nicht eine einzige der Holzrodungsfirmen hatte jemals dieses Land überfallen. Auf der anderen, noch höher gelegenen Seite des Tals wuchsen weder Bäume noch Blumen, so wie auf seiner Alpenwiese. Dort gab es nur Schnee und unberührte Natur, jede Menge wilder Schönheit, die von keiner Menschenhand jemals angefasst worden war.
Er blickte in Richtung des kleinen Ortes Dillinger am Ende des Tals, das sich unter ihm von Osten nach Westen streckte. Tausenfünfhundertdrei Menschen lebten dort. In den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts hatten die Silberminen es zu einer rasch expandierenden Ortschaft gemacht. Damals hatten annähernd dreißigtausend Menschen das Tal fast zum Bersten gebracht – Bergarbeiter, Prostituierte, Ladeninhaber, Verbrecher, dann und wann ein Sheriff und ein Priester, wenig Familien. Das gehörte schon lange der Vergangenheit an. Die Nachfahren der Leute, die nach dem Schließen der Silberminen geblieben waren, kümmerten sich heute um den kärglichen Zugang der Sommertouristen. Im Tal weideten zwar einige Rinderherden, doch boten sie einen kümmerlichen Anblick. Er hatte Bergziegen und Steinböcke in unmittelbarer Nähe der Rinderherden beobachtet. Gabelantilopen grasten auf den unteren Hängen, und Kojoten streiften ab und zu herum.
Er war mit seinem Allradjeep nur ein einziges Mal seit seiner Ankunft hinuntergefahren, um seine Lebensmittelvorräte in Clements Laden aufzustocken. War das am Dienstag gewesen? Vor zwei Tagen? Er hatte ein Paket tiefgekühlter Erbsen gekauft und dabei vergessen, dass er kein Tiefkühlfach hatte, sondern lediglich einen kleinen, sehr modernen Kühlschrank, der von dem vor der Hütte stehenden Generator gespeist wurde. Also hatte er die Erbsen auf seinem Holzkohleofen gekocht und die ganze Packung im Schein einer hellen Lampe aufgegessen, die ebenfalls von dem Generator betrieben wurde.
Er streckte sich, sah zwei Beute suchende Falken vorüberfliegen, nahm seine Axt und ging zum Baumstumpen neben der Hütte, wo er Holz spaltete. Es dauerte nicht lange, ehe er seine Daunenjacke auszog, dann sein Flanellhemd, gefolgt von seinem Unterhemd. Immer noch schwitzte er. Er steigerte seinen Rhythmus. Die Sonne fühlte sich heiß und angenehm auf seiner Haut an und wärmte seine Muskeln. Er fühlte sich kräftig und gesund, es ging ihm gut. Er wusste, dass er mehr Holz spaltete, als er in der nächsten Woche würde aufbrauchen können, aber er behielt den schnellen, geschmeidigen Rhythmus bei, spannte und entspannte die Muskeln, die sich kraftvoll zusammenzogen, um sich dann wieder zu lockern.
Kurz hielt er inne, um sich mit dem Hemdsärmel den Schweiß von der Stirn zu wischen. Selbst der Schweiß roch frisch, als ob sein Körper innerlich rein wäre.
Er hörte ein Geräusch.
Ein kaum wahrnehmbares Geräusch. Es musste ein Tier sein. An die Eulen und Rotfalken, an die Backenhörnchen, Stinktiere und die Wölfe hatte er sich gewöhnt. Dies aber war ein anderes Geräusch. Hoffentlich wollte sich nicht ein weiteres menschliches Lebewesen auf diesem Hügel niederlassen. Seine Hütte stand auf der erhöhten Ebene ganz allein. Es gab noch andere Hütten, doch sie lagen etwas tiefer und mindestens eine halbe Meile entfernt. Außer im Sommer zum Wandern kam niemand bis hierher. Jetzt war es Mitte April. Noch gab es keine Wanderer. Er hob erneut seine Axt. Mitten in der Bewegung hielt er inne, als er das Geräusch erneut vernahm.
Es hörte sich wie ein verzweifelter Schrei an – von einem jungen Kätzchen? Aber das wäre absurd. Dennoch zog er sich sein Flanellhemd und die Daunenjacke über. Er beugte sich vor und hob die Axt auf. Das Gewicht fühlte sich gut an. Hatte ein Fremder seinen Berg erklommen?
Er stand bewegungslos und ließ die Stille auf sich wirken, bis er mit ihr zu verschmelzen schien. Er fühlte die kühle Nachmittagsbrise in seinem Haar. Dann hörte er es wieder, ein leises, wimmerndes Geräusch, etwas undeutlicher dieses Mal, mittendrin unterbrochen, als ob man es gespalten habe.
Als ob das Lebewesen dem Tod nahe sei.
Er rannte über die flache Wiese vor seiner Hütte, rannte in den Kiefernwald, der seine hoch gelegene Wiese umsäumte, verlangsamte wegen des Unterholzes und hoffte, sich in die richtige Richtung zu bewegen, war sich aber noch während des Rennens unsicher.
Er hörte nur seinen eigenen Atem. Spärlich drangen Sonnenstrahlen durch die dichten Bäume. Es war jetzt später Nachmittag und im dichten Wald schon fast dunkel. Keinerlei Geräusche. Nichts. Er hörte ein gleitendes Scharren. Er wirbelte herum und erblickte eine Prärieklapperschlange, die sich ihren Weg unter einen moosbewachsenen Felsen bahnte. Selten verirrten sich Schlangen in diese Höhe der Berge.
Er verharrte ebenso reglos wie die Bäume um ihn herum. Er spürte einen Krampf in seinem rechten Oberarm. Langsam setzte er die Axt auf dem Boden ab.
Plötzlich hörte er erneut das Geräusch, ziemlich in der Nähe, erstickt und schwach, ein Geräusch, das fast wie sein eigenes Echo schien, wie eine Erinnerung an etwas, was bereits vergangen war.
Mit weit ausgreifenden Schritten und die Augen geradeaus gerichtet, ging er weiter und kam an eine kleine Lichtung. Dort schien die Nachmittagssonne immer noch hell. Üppiges hohes Gras wogte im Wind. Taubenblaue Akelei, das Wahrzeichen Colorados, blühte wild und zart und hieß jetzt schon den Frühling willkommen. Es war ein schöner Platz und einer, den er bisher auf seinen täglichen Wanderungen noch nicht entdeckt hatte.
Er blieb stehen, sein Gesicht lauschend zu der schräg einfallenden Sonne erhoben. Ein Eichhörnchen kletterte einen Baum hinauf, ein eindeutiges Geräusch, das er schnell einzuordnen gelernt hatte. Das Eichhörnchen huschte einen dünnen Ast entlang, der sich dabei nach unten bog, wobei die Blätter unter dem Gewicht und der Bewegung raschelten.
Dann war nichts mehr, außer Stille.
Die Sonne würde nicht mehr lange scheinen. Die Schatten begannen bereits lang zu werden und schluckten das Licht. Schon bald würde der Wald so dunkel sein wie Susans Haar. Nein, er wollte nicht an Susan denken. Es war schon lange her, dass er an Susan gedacht hatte. Es war Zeit nach Hause zu gehen, zurück zu seiner Hütte, wo er im Kamin bereits am Morgen das Holz ausgelegt hatte, das nur noch auf ein Streichholz wartete. Im Schichten von Holz in Kamin und Herd hatte er sich einiges Geschick erworben. Er würde sich ein paar frische Tomaten aufschneiden und etwas von dem Eisbergsalat, den er vor zwei Tagen bei Clement gekauft hatte, darunter mischen und dazu etwas Gemüsesuppe aufwärmen. Er trat wieder in den Kiefernwald.
Aber was hatte er gehört?
Es war jetzt dunkler als noch vor zwei Minuten. Er musste vorsichtig laufen. Sein Ärmel verfing sich in einem Ast. Um sich loszumachen, musste er die Axt abstellen.
In diesem Augenblick bemerkte er zu seiner Rechten etwas Gelbes. Einen Augenblick starrte er das helle Gelb an. Es bewegte sich nicht, genauso wenig wie er.
Schnell hob er seine Axt auf. Er bewegte sich auf den gelben Flecken zu und strengte seine Augen an zu erkennen, um was es sich handelte.
Es war ein Häufchen Etwas.
Aus einem Meter Entfernung erkannte er, dass es ein Kind war, ein reglos auf dem Bauch liegendes Mädchen. Ihr braunes Haar fiel ihr zerzaust über den Rücken und verdeckte das Gesicht.
Er sackte neben ihr auf die Knie. Einen Moment lang fürchtete er, sie anzufassen. Dann betastete er leicht ihre Schulter und schüttelte sie sacht. Sie bewegte sich nicht. Der Puls an ihrem Hals schlug langsam, aber regelmäßig. Gott sei Dank war sie lediglich bewusstlos und nicht tot. Er befühlte erst ihre Arme, dann die Beine. Nichts war gebrochen. Doch sie konnte innerliche Verletzungen erlitten haben. In diesem Fall würde er nur wenig ausrichten können. Vorsichtig drehte er sie um.
Auf ihren Wangen waren zwei lange Kratzer, das Blut getrocknet und verschmiert. Wieder legte er seinen Finger an den Puls in ihrem Nacken. Immer noch langsam, immer noch regelmäßig.
Er hob sie so umsichtig wie möglich auf, dann griff er nach seiner Axt. Er drückte das Mädchen an sich, um sie vor den niedrigen Kiefernästen und dem Unterholz zu schützen. Sie war klein, vermutlich nicht älter als fünf oder sechs. Ihm fiel auf, dass sie keine Jacke trug, lediglich ein gelbes T-Shirt und dreckige gelbe Jeans. Sie trug weiße Turnschuhe, von denen sich einer der Schnürsenkel gelöst hatte und die Enden herabhingen. Keine Socken, keine Handschuhe, keine Jacke, keine Mütze. Was machte sie ganz allein hier draußen? Was war ihr zugestoßen?
Er stoppte mit angehaltenem Atem. Er hätte schwören können, schwere Schritte im Unterholz gehört zu haben. Doch vermutlich bildete er sich das nur ein. Er drückte die Kleine fester an sich und legte an Tempo zu, wobei ihn das Geräusch knirschender Schritte verfolgte.
Es war schon tiefe Dämmerung, als er durch die Tür seiner Hütte trat. Er legte das Mädchen auf das Sofa und deckte es mit einer afghanischen Decke zu, ein altes, rotblaues Wollviereck, vermutlich betagter als er selbst und sehr warm. Er knipste alle Lampen an.
Dann wandte er sich um und blickte stirnrunzelnd auf die Eingangstür. Mit raschen Griffen verriegelte er sie. Er brummte, als er zusätzlich die Kette vorlegte. Lieber auf Nummer Sicher gehen, die Kette konnte nicht schaden. Dann zündete er den Kamin an. Innerhalb von zehn Minuten war das kleine Zimmer warm.
Das Kind war immer noch bewusstlos. Er strich ihr sacht über die Wange, dann lehnte er sich zurück und wartete.
Sein Tag endete völlig anders, als er erwartet hatte. »Wer bist du?«, fragte er das Kind. Ihr Gesicht lag von ihm abgewandt. Die Kratzer wirkten im Lampenschein tief und brutal.
Er holte eine Schüssel mit lauwarmem Wasser, die den ganzen Nachmittag auf dem Ofen gestanden hatte, ein Paar weiße Turnsocken, ein Stück Seife. Er wusch ihr Gesicht so vorsichtig, wie es mit dem über die Hand gezogenen Socken möglich war, und entfernte das Blut von den langen Kratzern.
Er holte eines seiner flauschigen weißen Unterhemden, das warm und von der jahrelangen Wäsche sehr weich geworden war, dann zog er sie aus. Er musste sie, so gut er konnte, untersuchen. Erst war er schockiert, dann wütend über das, was er entdeckte.
Sie war mit blauen Flecken und Schrammen übersät, manche von ihnen mit Blut verkrustet. Blut war zwischen ihren Beinen verschmiert. O Gott. Eine gequälte Sekunde schloss er die Augen.
Dann wusch er sie sorgfältig, wobei er keine weiteren Wunden oder Schnitte feststellte, lediglich Hautabschürfungen und Blutergüsse. Er drehte sie auf den Bauch. Lange, dünne Striemen überzogen von den Schultern bis zu den Füßen die Haut des Kindes. Es waren Striemen, die einander nicht überlappten. Sie waren sorgfältig platziert, als ob der Täter jeden Millimeter der kindlichen Haut habe markieren wollen, um so ein ganz bestimmtes Ziel, einen bestimmten Effekt zu erreichen. Sie war dünn und so weiß wie das saubere Unterhemd, das er ihr über den Kopf streifte. Das Unterhemd reichte ihr bis zu den Füßen. Er strich die Decke über ihr glatt und kämmte ihre Haare mit den Fingern durch. So behutsam wie möglich versuchte er die schlimmsten Verknotungen zu lösen. Es war gut, dass sie nicht wach war, während er sie versorgte. Seufzend lehnte er sich wenig später zurück und starrte das bewusstlose Kind an.
Er spürte, wie er vor Wut bebte. Welches Ungeheuer hatte diesem Kind das angetan? Er wusste, leider aus eigener Erfahrung, dass es zahlreiche dieser Bestien gab. Sollte er so einem Individuum mal begegnen, würde er sich gleichzeitig übergeben und den Mistkerl umbringen wollen.
Er wünschte, sie würde aufwachen. Sie lag da wie tot. Er überlegte, ob er sie ins Krankenhaus fahren sollte. Er hatte kein Telefon, konnte also niemanden anrufen. Sogar sein Handy hatte er zu Hause gelassen. Außerdem war es spät. Er wusste nicht, wo das Krankenhaus lag, wie weit es bis dahin war. Und er wusste nicht, wer ihr das angetan hatte, wer sie missbraucht und geschlagen hatte oder wo derjenige sich aufhielt. Er würde sie erst morgen zum Arzt bringen, heute würde er bei ihr bleiben und sie nicht aus den Augen lassen. Morgen würde er sie zur Polizei fahren. In Dillinger musste es einen Polizisten geben. Heute Abend jedoch würde er sich um sie kümmern. Wenn sie allerdings aufwachte und Schmerzen haben sollte, würde er sie ins Krankenhaus fahren, egal zu welcher Stunde. Aber nicht jetzt.
Hatte sie sich selbst gerettet, war sie irgendwie geflüchtet und in den Wald gerannt? War sie über eine Wurzel oder einen Stein gestolpert und hatte sich den Kopf verletzt? Oder hatte das Ungeheuer, das sie missbraucht hatte, sie dort abgelegt und dem Wald zum Sterben überlassen? Er beugte sich über sie und streichelte ihr zärtlich über den Kopf. Er konnte keine Beulen ertasten. Der Puls an ihrem Hals schlug nach wie vor langsam und regelmäßig.
Wenn sie dem Mann, der ihr das angetan hatte, entkommen war, so bedeutete das, dass der Schuft nach ihr suchte. Das hatte er bereits intuitiv erfasst, als er sie in seine Hütte getragen hatte. Aus diesem Grund hatte er auch die Tür verriegelt. Er überprüfte sein Browning Savage 99 Gewehr. Es war bereits mit einem .243-Magazin geladen. Auf dem Tisch neben dem Sofa lag seine Smith & Wesson .357 Magnum. Diesen Revolver liebte er, seit sein Vater ihn ihm an seinem vierzehnten Geburtstag geschenkt und ihm seine Handhabung erklärt hatte. Wegen ihrer schwarzen Verkleidung aus rostfreiem Stahl wurde die Waffe »Schwarze Magie« genannt. Er schoss gerne, hatte die Waffe jedoch noch niemals gegen einen Menschen gerichtet.
Er nahm sie in die Hand. Wie gewohnt war sie durchgeladen. Mit dem Revolver in der Hand blickte er zur Tür.
Was für ein Kerl tat so etwas?
Er bereitete sich einen Salat zu und verspeiste ihn, ohne den Blick von dem Kind zu nehmen. Dann wärmte er die Suppe auf. Sie duftete wunderbar. Er hielt ihr einen Löffel davon unter die Nase. »Nun komm schon, möchtest du nicht ein wenig kosten? Campbell ist eine gute Marke, und die Suppe kommt heiß von einem alten Holzkohleofen. Es dauert zwar geraume Zeit, bis die Sachen warm werden, aber es klappt. Mach schon, meine Kleine, wach auf.«
Ihre Lippen bewegten sich. Er holte einen kleineren Löffel, tauchte ihn in die Suppe und presste ihn sanft gegen ihre Unterlippe. Zu seiner Überraschung und Erleichterung öffnete sie den Mund. Er flößte ihr die Suppe ein. Sie schluckte, und er gab ihr mehr.
Sie aß fast die halbe Schüssel. Erst dann öffnete sie die Augen. Sie machte einen verwirrten Eindruck. Zögernd wandte sie ihm ihr Gesicht zu und schaute zu ihm auf. Er lächelte und sagte: »Hallo, hab keine Angst. Ich heiße Ramsey. Ich habe dich gefunden. Du bist jetzt in Sicherheit.«
Sie öffnete die Lippen und machte das merkwürdigste Geräusch, das er jemals gehört hatte, ein leises Wimmern, das tiefe Angst und Hilflosigkeit signalisierte.
»Ist schon gut. Keiner wird dir hier wehtun. Bei mir bist du sicher.«
Ihr Mund öffnete sich, doch es kam kein Ton heraus. Ihre Arme schossen unter der afghanischen Decke hervor, und wortlos drosch sie auf ihn ein. Das einzige Geräusch, das ihre Kehle von sich gab, war ein grauenhaftes Wimmern. Er wollte dieses entsetzte Häuflein Mensch an sich drücken, sie beschützen.
Eilig setzte er die gefährdete Suppenschale ab und nahm das tobende Kind an den Handgelenken. Ihre Augen schlossen sich schmerzerfüllt. Beide Handgelenke waren aufgeschürft. Man hatte sie gefesselt. »Es tut mir leid, meine Kleine. Es tut mir wirklich leid. Bitte wehre dich nicht gegen mich. Ich werde dir nichts tun.«
Sie rollte sich zu einer Kugel zusammen und drehte ihm, die Hände über dem Kopf, den Rücken zu. Sie bewegte sich nicht mehr.
Er lehnte sich zurück und überlegte, was er tun sollte. Sie war total verängstigt. Sie hatte Angst vor ihm. War sie taub?
Sehr leise und in der Hoffnung, dass sie ihn hören würde, sagte er: »Deine Handgelenke und Fesseln sind verletzt. Soll ich sie dir verbinden? Dann wirst du dich besser fühlen.«
Hatte sie ihn gehört? Sie blieb stumm und reglos. Er zog ein altes Unterhemd unter einem mitgebrachten Kleidungsstapel hervor und zerriss es zu Streifen. Er fühlte ihre Anspannung, als er ihre Hand- und Fußgelenke säuberte, sie mit einer desinfizierenden Heilsalbe einrieb und anschließend mit den weichen Stoffstreifen verband. Nun hatte er alles getan, was momentan in seiner Macht stand. Langsam und jede abrupte Bewegung vermeidend erhob er sich und schaute auf sie herunter. Sie war wieder zu einer Kugel zusammengerollt, ihre Hände hatte sie unter die Decke gesteckt.
Zumindest hatte sie genügend Suppe gegessen. Verhungern würde sie nicht. Sie war warm. Sie war sauber. Er hatte ihr eine antibiotische Salbe auf die schlimmsten Verletzungen gestrichen. Umsichtig verschloss er die Läden und zog die Vorhänge zu. Niemand konnte nun hereinspähen. Er verrammelte die Fenster mit Bolzen. Wenn jetzt jemand hereinkommen wollte, würde er sie einschlagen müssen. Er ging zur Hintertür und verriegelte sie ebenfalls. Die Tür besaß jedoch keine Kette. Deshalb zog er einen der Küchenstühle heran und schob ihn unter den Türgriff. Falls jemand die Tür gewaltsam öffnen wollte, würde ihn das Poltern über den Fußboden wecken.
Ein letztes Mal betrachtete er sie. »Wenn du aufwachst, ruf mich. Ich heiße Ramsey. Ich wohne hier. Du bist völlig in Sicherheit. Okay? Wenn du auf die Toilette musst, sie ist gleich hinter der Küche. Sie ist sauber. Ich habe sie gerade gestern erst geputzt.«
Die Decke bewegte sich ein wenig. Gut, sie schien ihn verstanden zu haben. Aber sie gab keinen Laut von sich, nicht einmal dieses steinerweichende Wimmern.
Sein Bett stand auf der anderen Seite des Raums. Er zog sich nicht aus. Das Gewehr und seinen Smith & Wesson-Revolver legte er auf den kleinen Tisch neben dem Bett, unmittelbar neben die Leselampe. Er markierte sorgfältig die Seite seines Krimis, ehe er das Buch zuklappte.
Die Lampe ließ er brennen. Falls die Kleine in der Nacht aufwachte, sollte sie sich nicht vor der Dunkelheit fürchten.
Lange Zeit konnte er nicht schlafen. Als er schließlich doch eindöste, träumte er vom Gesicht eines Mannes, der durch das Fenster hindurch auf das kleine Mädchen glotzte. Im Traum wachte er auf und stolperte ans Fenster, durch das kein Gesicht starrte, denn die Gardinen waren fest zugezogen, die Läden geschlossen. Doch er konnte nicht anders, er musste sie aufreißen. Er spähte in die Dunkelheit – und entdeckte statt einer mordlüsternen Männerfratze das Gesicht einer Frau, das ihm Gift und Galle entgegenspuckte und drohte, ihn umzubringen.
In der Morgendämmerung wurde er vom herzzerreißenden Wimmern des Kindes geweckt.
2
Aus dem Antlitz des Mädchens war jegliche Farbe gewichen, das konnte er selbst im fahlen, vom Licht der Lampe notdürftig erhellten Morgenlicht erkennen. Ihre Augen waren weit aufgerissen und starrten ihn an. Ihre Angst war so offensichtlich, dass sie ihm unter die Haut ging.
»Nein«, sagte er sehr langsam und ohne sich zu bewegen. »Es ist alles gut. Ich bin es, Ramsey. Ich bin hier, um für dich zu sorgen. Ich werde dir nicht wehtun. Hattest du einen Alptraum?«
Sie bewegte sich nicht, sie lag nur da und starrte ihn an. Dann schüttelte sie sehr langsam den Kopf. Er beobachtete, wie ihre Arme sich unter der Decke bewegten, sah, wie ihre kleinen Hände auftauchten. Sie waren zu Fäusten geballt. Die Verbände an ihren schmalen Gelenken sahen geradezu obszön aus.
»Hab keine Angst. Bitte.«
Er knipste das Licht aus. Es wurde rasch heller. Ihre Augen waren himmelblau, riesig in dem zierlichen Gesicht, ihre Pupillen geweitet. Sie hatte eine schmale, gerade Nase, dunkle Wimpern und Augenbrauen, ein rundes Kinn und zwei Grübchen. Sie war ein hübsches kleines Mädchen, und sie würde schön sein, wenn sie lachte und sich die Grübchen vertieften. »Hast du Schmerzen?«
Sie schüttelte den Kopf.
Er spürte eine tiefe Erleichterung. »Kannst du mir deinen Namen sagen?«
Sie sah ihn an, vollkommen verkrampft, als ob sie nur auf eine Gelegenheit wartete, ihm zu entkommen.
»Möchtest du auf die Toilette?«
Er konnte es in ihrem Blick erkennen und lächelte. Ihre Nieren arbeiteten. Alles schien gut zu arbeiten bis auf die Tatsache, dass sie nicht reden konnte. Er wollte sie berühren, um ihr auf die Beine zu helfen, unterließ es jedoch. Er sprach mit leiser, sachlicher Stimme. »Das Badezimmer ist auf der Rückseite der Küche. Die Küche ist gleich hinter dir. Brauchst du Hilfe?«
Zögernd schüttelte sie den Kopf. Er wartete. Sie bewegte sich nicht. Offenbar wollte sie nicht aufstehen, während er sie beobachtete.
Er lächelte und sagte: »Ich koche jetzt Kaffee. Und dann schaue ich nach, ob ich etwas im Haus habe, das ein kleines Mädchen gerne essen würde, okay?«
Da er wusste, dass sie ihm nicht antworten würde, nickte er lediglich und ließ sie allein.
Bis die Badezimmertür ins Schloss fiel, vernahm er kein Geräusch. Er hörte, wie sie den Riegel vorschob.
Er ließ ein paar Cornflakes in eine der leuchtend blauen Schüsseln rieseln und stellte die entrahmte Milch daneben. Ihre Arterien jedenfalls würde sie nicht verstopfen. Er ging zu seinem Vorrat an frischem Obst. Nur noch zwei Pfirsiche waren übrig. Er hatte ein halbes Dutzend gekauft, den Rest jedoch bereits aufgegessen. Er schnitt einen auf und verteilte ihn über den Cornflakes.
Er wartete. Er hörte die Toilettenspülung, dann nichts mehr. War etwas passiert?
Er wartete weiter. Er wollte sie nicht ängstigen, indem er an die Tür klopfte. Aber schließlich dauerte es ihm doch zu lange. Er klopfte leicht mit den Fingern gegen die Badezimmertür. »Kleines? Ist alles in Ordnung?«
Er hörte nicht das geringste Geräusch und runzelte über die verschlossene Tür die Stirn. Nun, da war ihm eine Dummheit unterlaufen. Sie fühlte sich vermutlich jetzt vor ihm sicher. Aus freien Stücken würde sie wahrscheinlich überhaupt nicht mehr herauskommen.
Er schenkte sich eine Tasse schwarzen Kaffee ein, setzte sich neben die Badezimmertür und streckte die Beine aus, die beinahe die gegenüberliegende Wand berührten. Seine schwarzen Stiefel waren abgetragen und bequem wie ein paar alte Pantoffeln. Er kreuzte die Beine.
Dann begann er zu sprechen. »Ich würde wirklich zu gerne deinen Namen erfahren. ›Kleines‹ ist ja ganz nett, aber es ist nicht dasselbe wie ein richtiger Name. Ich weiß, dass du nicht reden kannst. Das ist nicht weiter schlimm. Ich könnte dir ein Blatt Papier und einen Stift geben, und du schreibst mir deinen Namen auf. Das hört sich doch ganz gut an, oder nicht?«
Nicht der leiseste Mucks.
Er nahm einen Schluck von seinem Kaffee, rollte die Schulterblätter und lehnte sich dann entspannt gegen die Wand. »Ich wette, du hast eine Mama, die sich schreckliche Sorgen um dich macht. Ich kann dir nicht helfen, wenn du mir nicht deinen Namen und die Adresse aufschreibst. Erst dann kann ich deine Mutter anrufen.«
Wieder hörte er das grausige Wimmern. Er nippte an seinem Kaffee. »Ich glaube, dass deine Mama krank ist vor Sorge um dich. Warte mal, bist du vielleicht zu jung, um schreiben zu können? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Kinder.«
Kein Ton.
»Nun ja, so weit, so gut. Komm jetzt raus und iss etwas zum Frühstück. Ich habe Cornflakes und einen aufgeschnittenen Pfirsich. Es gibt zwar nur entrahmte Milch, aber sie schmeckt auch. Du darfst sie bloß nicht genauer ansehen. Sie ist nämlich ganz dünnflüssig. Der Pfirsich ist wirklich gut und herrlich süß. Seit ich ein paar vor zwei Tagen gekauft habe, habe ich schon vier davon gegessen. Du bekommst den zweitletzten. Du kriegst auch Toast, wenn du möchtest. Außerdem habe ich etwas Erdbeermarmelade da. Komm schon. Du hast doch sicher Hunger. Hör zu, ich werde dir nicht wehtun. Ich habe dir doch gestern auch nicht wehgetan, oder? Oder gestern Nacht? Und heute Morgen habe ich dir auch nicht wehgetan. Du kannst mir vertrauen. Als ich jung war, war ich Pfadfinder, und zwar ein richtig guter. Dieser Mensch, der dir wehgetan hat, wird dich hier nicht finden. Wenn er es doch tut, erschieße ich ihn. Da wird ihm die Scheiße aus den Ohren spritzen. Oh, entschuldige. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber weißt du, ich bin nur selten mit Kindern zusammen. Ich habe drei Nichten und zwei Neffen, die ich mindestens ein Mal im Jahr sehe, und ich mag sie sehr. Sie sind die Kinder meines Bruders. Letztes Weihnachten habe ich den Mädchen das Fußballspielen beigebracht. Magst du Fußball?«
Stille.
Er erinnerte sich an seine Schwägerin Elaine, als diese Ellen zugejubelt hatte, nachdem sie fast ein Tor geschossen hatte. »Ich werde jetzt etwas mehr auf meine Ausdrucksweise achten. Aber auf eines kannst du dich verlassen. Wenn dieses Ungeheuer auch nur seine Nasenspitze hier in die Gegend steckt, wird ihm das sehr leidtun. Das verspreche ich dir. Und jetzt schau doch mal – der Sonnenaufgang ist wunderschön. Möchtest du ihn nicht sehen? Es gibt jede Menge Rosatöne und etwas Grau und sogar etwas Orange.«
Das Schloss bewegte sich. Langsam öffnete sich die Tür. Sie stand in seinem Unterhemd da, das bis zu den kleinen Füßen reichte und ihr fast von den Schultern glitt.
»Hallo«, sagte er einfach, ohne sich zu bewegen. »Möchtest du jetzt ein paar Cornflakes?«
Sie nickte.
»Kannst du mir aufhelfen?« Er streckte ihr seine Hand entgegen.
Er sah die Angst, die wilde Panik in ihrem Blick. Sie betrachtete seine Hände, als ob sie eine Schlange wären, die gleich zubeißen wollte. Sie flitzte an ihm vorbei und rannte in die Küche. Es war also noch zu früh für sie, um ihm zu vertrauen. »Die Milch steht auf dem Tisch«, rief er ihr hinterher. »Kommst du da heran?«
Bedächtig ging er in die Küche. Sie saß, an die Wand gepresst, in einer Ecke und hielt die Schüssel mit den Cornflakes gegen die Brust gepresst. Ihr Gesicht war fast eingetaucht in die Schüssel, und dicke, dunkelbraune Haarsträhnen verdeckten ihr Gesicht.
Er schwieg und schenkte sich etwas Kaffee nach. Dann steckte er zwei Scheiben Weizenbrot in den Handtoaster und hielt ihn über das Holzkohlefeuer. Jede Seite des Toastes brauchte nur zwei Minuten zum Bräunen. Er setzte sich auf einen der Küchenstühle. Der andere stand immer noch unter den Türgriff geklemmt.
In diesem Augenblick wurde ihm klar, dass er sie nicht irgendwelchen Fremden überlassen würde. Sie war jetzt in seiner Verantwortung, und er war bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Er wollte sich gar nicht erst vorstellen, was sie mit ihr im Krankenhaus alles anstellen würden: Ärzte, Schwestern, Laboranten. Und alle würden an ihr zerren, sie erschrecken, Psychologen würden ihr Puppen vorlegen und sie fragen, was denn der Mann genau getan habe. Sie würden sie wie andere kleine verletzte Mädchen behandeln, obwohl ihr Fall doch außergewöhnlich war. Nein, das konnte er ihr nicht antun. Später würde sich die Polizei einschalten. Natürlich würde er mit der Polizei reden, nur jetzt noch nicht. Sie sollte sich erst etwas beruhigen. Sie sollte ihm vertrauen, ein klein wenig zumindest.
»Möchtest du eine Scheibe Toast? Mittlerweile kann ich mit diesem Toasthalter richtig gut umgehen und verbrenne kaum mehr eine Scheibe.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Also gut, dann esse ich beide Toasts. Aber wenn du es dir anders überlegst – ich habe tolle Erdbeermarmelade, die hier in Dillinger von Frau Harper hergestellt wurde. Sie hat ihre gesamten vierundsechzig Jahre in diesem Ort verbracht.
Ich bin jetzt schon fast zwei Wochen hier. Ich komme aus San Francisco. Dieses Holzhaus hat der Großvater einer meiner Freunde gebaut. Er hat es mir geliehen. Ich bin zum ersten Mal hier. Es ist ein schöner Ort. Vielleicht willst du mir ja später erzählen, wo du herkommst. Ich wollte ganz allein sein, alles und jeden hinter mir lassen. Weißt du, was ich meine? Nein, ich glaube das verstehst du nicht, oder?
Wer hat gesagt, dass das Leben nicht so einfach ist? Vielleicht war ich das und habe es vergessen. So viele Dinge können geschehen, wenn man erwachsen ist, aber dann ist man eher in der Lage, sie zu meistern. Du aber bist ein kleines Mädchen. Nichts Böses sollte dir zustoßen. Ich werde die Dinge so gut ich kann wieder gutmachen.
Aber weißt du«, fuhr er behutsam fort, musterte die Streifen an ihren Hand- und Fußgelenken, dachte an ihren kleinen, geschundenen Körper, wissend, dass sie vergewaltigt worden war. »Ich glaube, wir sollten einen Arzt aufsuchen. Vielleicht in ein, zwei Tagen. Und dann sollten wir auch zur Polizei gehen. Hoffentlich gibt es in Dillinger einen Polizisten.«
Das Wimmern setzte ein. Sie stellte die leere Schüssel neben sich auf den Boden und sah angsterfüllt zu ihm auf. Sie schüttelte unablässig den Kopf, während das Wimmern hässlich und rau tief aus ihrer Kehle drang.
Eine Gänsehaut überzog ihn. »Du möchtest nicht zum Arzt?«
Sie drückte sich gegen die Wand, zog die Beine an und wickelte das Unterhemd wie ein weißes Zelt um sich. Ihren Kopf presste sie auf die Knie, und sie schaukelte vor und zurück.
»Also gut, wir gehen nirgendwo hin. Wir bleiben einfach hier, ganz sicher und gemütlich. Ich habe jede Menge zu essen. Habe ich dir erzählt, dass ich erst vor zwei Tagen in Dillinger war? Ich habe ein paar Sachen geholt, die sogar einem Kind gefallen könnten. Ich habe Hot Dogs und ein paar von diesen Brötchen, die nach gar nichts schmecken, französischen Senf und Baked Beans. Ich schneide ein paar Zwiebeln in die Bohnen, füge etwas Senf und Ketchup hinzu und stelle das Ganze für zwanzig Minuten auf das Feuer. Das klingt doch gut, oder?«
Sie hörte zu schaukeln auf.
Langsam wandte sie ihm ihr Gesicht zu und schob die Haare zurück.
»Magst du Hot Dogs?«
Sie nickte.
»Gut. Ich auch. Dann habe ich noch diese altmodischen Kartoffelchips gekauft. Die richtig fettigen, bei denen einem die Hände ganz ölig werden. Magst du Kartoffelchips?«
Wieder nickte sie. Sie entspannte sich ein wenig.
Das Kind aß gerne. Das war zumindest ein Anfang. »Mochtest du die entrahmte Milch?«
Sie schüttelte den Kopf.
Was jetzt? »Macht es dir etwas aus, wenn ich meinen Toast esse? Er wird sonst kalt.« Er wartete ihr Nicken nicht erst ab, lächelte sie an und schmierte Butter auf den Toast. Als er auf einer der beiden Scheiben Erdbeermarmelade verteilt hatte, reichte er sie ihr. »Möchtest du?«
Sie starrte auf das Stück Brot, von dem etwas Marmelade bereits auf der einen Seite herunterzukleckern drohte. »Ich lege es auf die Serviette.« Glücklicherweise hatte er Servietten gekauft.
Er reichte ihr den Toast. Sie biss hastig dreimal ab, schlang, fast ohne zu kauen, seufzte und aß endlich langsamer. Sie leckte sich sorgfältig die Erdbeermarmelade von der Unterlippe. Zum ersten Mal machte sie einen zufriedeneren Eindruck.
»Es ist lange her, seit du etwas Anständiges gegessen hast, oder?«
Sie kaute bedächtig auf ihrem Bissen herum und schien darüber nachzudenken. Dann nickte sie zögernd.
»Ich soll dir wohl nur Fragen stellen, die du mit ja oder nein beantworten kannst. Geht es dir heute Morgen etwas besser?«
Erneute Angst ließ jegliches bisschen Farbe aus ihrem Gesicht weichen.
Sie betrachtete ihre bandagierten Handgelenke, die das Stück Toast hielten.
»Wenn du aufgegessen hast, werde ich noch etwas Salbe auf deine Hand- und Fußgelenke schmieren.« Mehr sagte er nicht, sondern aß seinen Toast. Wie stand es um ihren restlichen Körper? Er war sich darüber im Klaren, dass er sie eigentlich nochmals hätte untersuchen müssen, aber er wagte es nicht, nicht solange sie wach und verängstigt war.
Als sie beide aufgegessen hatten, stand er auf und ging ins Wohnzimmer. »Möchtest du baden? Ich kann auf dem Ofen Wasser warm machen und dir ein Bad einlassen. Ich besitze zu diesem Zweck ein paar riesige Töpfe.« Auch ohne sie anzusehen ahnte er, dass sie vermutlich den Kopf schüttelte und sich gegen die Küchenwand presste. »Du bist ein großes Mädchen. Du kannst dich alleine baden, nicht wahr?« Er wandte sich lächelnd zu ihr um.
Vorsichtig stand sie auf. Sie nickte.
»Im Badezimmer habe ich etwas Shampoo. Kannst du dir die Haare selber waschen? Gut. Danach kann ich dich an den Händen und Füßen einreiben. Allerdings haben wir ein Kleiderproblem. Ich schlage vor, nach dem Baden einfach wieder das Unterhemd anzuziehen. Ich schau dann mal, was ich noch für dich auftreiben kann.«
Sie ging hinaus. Diesmal war sie fünf Minuten später wieder da. Er gewann an Boden. Der Pullover reichte ihr bis zu den Füßen, die Ärmel hingen gute dreißig Zentimeter über ihre Hände hinaus. Er krempelte sie ihr bis zu den Ellbogen zurück. Sie sah gleichzeitig albern und rührend aus.
Wie vertrieb man sich mit einem kleinen Kind die Zeit?
»Kennst du die Hauptstadt von Colorado?«
Sie nickte. Er zog eine Landkarte hervor, war sich aber nicht sicher, ob sie lesen und schreiben konnte. Unwichtig. Sie zeigte auf Denver, neben dem sich ein roter Stern befand. Sie lebte also in Colorado.
»Das ist wirklich richtig gut. Meine Nichten und Neffen kennen kaum eine Hauptstadt, noch nicht einmal die von Pennsylvania, wo sie wohnen. Weißt du, wo wir sind?«
Angst, kalte, starre Angst.
Er bemerkte leichthin: »Wir sind in den Rockies, ungefähr zwei Stunden Autofahrt südwestlich von Denver. Hier in der Nähe gibt es keine Skiorte, deshalb ist es ziemlich leer hier. Trotzdem ist es ein schöner Ort. Schaust du dir Star Trek an?«
Sie nickte, und ihr Gesicht bekam wieder etwas Farbe.
»Ich habe mir erzählen lassen, dass die Leute hier die Berge dort drüben als Ferengi-Berge bezeichnen.«
Sie öffnete den Mund und rieb sich mit den Fingern über die Zähne.
Er lachte. »Genau. Die Gipfel sind so krumm und schief und haben ganz merkwürdige Abstände. Eben wie Ferengi-Zähne.«
Die Ärmel ihres Hemdes schleiften schon wieder auf dem Boden. Er beugte sich vor, um sie aufzurollen. Sie stieß ein tiefes Wimmern aus und rannte zur Wand neben dem Kamin. Dann rollte sie sich zusammen, ganz genau so, wie sie es eben gerade in der Küche getan hatte.
Er hatte ihr Angst eingejagt. Langsam stand er auf, ging zum Sofa und setzte sich. »Tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe. Ich hätte dir vorher sagen sollen, was ich vorhatte. Kann ich dir die Ärmel hochkrempeln? In der Küche habe ich in der Schublade ein paar Sicherheitsnadeln. Ich kann sie dir hochstecken, dann brauchst du dich nicht mehr um sie zu kümmern.«
Sie stand auf und kam auf ihn zu. Ein Schritt, dann hielt sie inne. Noch ein Schritt. Wieder eine Pause, während der sie ihn musterte und abzuwägen schien, ob sie ihm vertrauen konnte oder ob er sich auf sie stürzen würde. Schließlich stand sie neben ihm. Sie sah zu seinem Gesicht auf. Er lächelte, hob langsam die Hand und krempelte die Ärmel nach oben. Dann sagte er: »Ich könnte dir die Haare flechten. Es wird zwar nicht besonders gut werden, aber immerhin hast du die Haare dann nicht mehr im Gesicht.«
Der Zopf war gar nicht mal so schlecht. Er band ihn mit einem Schnippgummi ab, das vorher die Pfirsichtüte verschlossen hatte.
»Die Sonne scheint ziemlich stark. Draußen ist es nicht zu kalt. Wenn ich dich einpacke, willst du dann nach draußen gehen?«
Er hätte es wissen sollen. Wie der Blitz war sie in die Küche verschwunden. Er wusste, dass sie sich gegen die verdammte Wand presste. Immerhin schloss sie sich nicht im Badezimmer ein.
Was sollte er tun?
Was auch immer er mit ihr anstellte, er musste es behutsam tun, ganz behutsam.
Gott sei Dank befanden sich in der Hütte ein paar Zeitschriften. Er sagte: »Möchtest du dir ein paar Fotos ansehen? Wenn du willst, könnten wir sie uns gemeinsam anschauen, und ich könnte dir vorlesen, was unter den Fotos steht.«
Schließlich nickte sie. »Aber lass mich erst einmal die Sicherheitsnadeln holen, um dir die Ärmel hochzukrempeln.«
Danach folgte sie ihm ins Wohnzimmer. Es war nicht einfach, denn sie wollte nicht zu dicht an ihn herantreten. Die Zeitschrift lag schließlich zwischen ihnen auf dem Sofa. Immerhin hatte er sie überreden können, sich die Decke umzuwickeln.
Er betrachtete sie und sagte: »Socken.«
Sie blinzelte und legte den Kopf zur Seite.
»Ich mache mir Sorgen, dass du barfuß herumläufst. Möchtest du ein Paar von meinen Socken anprobieren? Sie werden lustig aussehen und dir bis zum Hals gehen. Vielleicht solltest du dich darin üben, ein Clown zu sein. Du könntest dir meine Socken anziehen und sehen, ob ich lache. Was meinst du?«
Die Socken waren ein voller Erfolg. Sie versuchte nicht, komisch zu wirken, aber sie lächelte einmal kurz auf, als sie sie sich über die Knie zog.
Sie brauchten fast eine Stunde, um die Zeitschrift People von vergangenem Oktober durchzublättern. Er würde wohl nie wieder ein Bild von Cindy Crawford sehen wollen, die auf jeder zweiten Seite abgebildet war. Nachdem er von einem Kinostar vorgelesen hatte, der seinen lange verlorenen Bruder wieder gefunden hatte, blickte er auf. Sie war eingeschlafen, ihr Gesicht auf die Hände gestützt und sich an das Sofa anlehnend. Er steckte die Decke um sie fest und kehrte wieder zu seiner Schreibmaschine zurück.
Fast hätte er seine Brille heruntergeschlagen, so heftig schnellte er hoch. Dieses grauenhafte Wimmern war diesmal noch lauter. Sie hatte einen Alptraum, wand sich unter der Decke, ihr schmales Gesicht war gerötet und vor Angst verzerrt. Er musste sie anfassen, er hatte gar keine andere Wahl.
Er schüttelte sie an der Schulter. »Wach auf, Kleines. Komm schon, wach auf.«
Sie öffnete die Augen. Sie weinte.
»O nein.« Er dachte nicht darüber nach, er setzte sich einfach und zog sie zu sich auf den Schoß. »Es tut mir so leid, Kleines. Alles ist wieder gut.« Er hielt sie fest und drückte ihren Kopf sanft gegen seine Brust, dann zog er die Decke um sie herum, damit sie es warm hatte. Einer der Socken baumelte an ihrem linken Fuß. Er zog ihn wieder hoch und drückte sie noch fester an sich.
»Es ist jetzt alles gut. Niemand wird dir wehtun. Das verspreche ich dir. Niemand wird dir jemals wieder wehtun.«
Ihm war bewusst, dass sie erstarrte. Er hatte sie erschreckt. Aber er ließ nicht locker. Wenn sie jemals wirklich jemanden gebraucht hatte, dann jetzt. Und er war der Einzige, der verfügbar war. Er flüsterte weiter auf sie ein, sagte ihr wieder und wieder, dass sie nun in Sicherheit war und dass er es nicht zulassen würde, dass jemand ihr noch einmal weh tat. Er redete weiter und weiter, bis er spürte, wie sie sich entspannte. Schließlich hörte er ihr tiefes Seufzen, und dann, Wunder aller Wunder, schlief sie wieder ein.
Es war früher Nachmittag. Allmählich wurde er hungrig, aber das konnte warten. Er wollte sie nicht stören. Sie hatte sich an ihn gekuschelt, ihr Kopf lag fast in seiner Armbeuge. Er schob ihn ein wenig zur Seite, dann nahm er sein Buch zur Hand. Sie wimmerte leise im Schlaf. Er drückte sie an sich. Sie roch süß, diese einzigartige kindliche Süße. Mit zornigem Blick sagte er in Richtung des Fensters: »Wenn du dich hier auch nur in die Nähe traust, du Mistkerl, jage ich dir eine Kugel durch den Kopf.«
3
Der morgendliche Regen, von einem böigen Westwind getrieben, peitschte gegen die Fenster der Hütte. Ramsey saß neben ihr auf dem Sofa. Er hielt einen der zahlreichen mitgebrachten Romane in der Hand und las ihr leise vor, wie er es bereits die vergangenen drei Tage über getan hatte. Sie fing an, sich in seiner Gegenwart wohler zu fühlen, und zuckte nicht mehr zurück, wenn er sie versehentlich erschreckte.
Gute dreißig Zentimeter Abstand waren jedoch zwischen ihnen. Seine Stimme beim Vorlesen klang ruhig und tief. Er sagte: »›Herr Phipps wusste nicht, was er tun sollte. Er konnte zu seiner Frau zurückkehren und die Probleme mit ihr ausfechten, oder aber er konnte aufgeben und sie all jenen Männern überlassen, die sie begehrten, all jenen reichen Männern, die ihr geben konnten, was sie wollte. Andererseits jedoch hatte er in seinem Leben noch niemals leicht aufgegeben.‹« Er hielt inne. Beim flüchtigen Durchblättern konnte er erkennen, dass die nächsten Seiten nicht für ihre Ohren bestimmt waren. Er hätte dieses Buch gar nicht erst anfangen sollen. Er räusperte sich.
Seine Worte verschwammen, als er ruhig fortfuhr und so tat, als ob er immer noch vorlese. »Aber dann wurde ihm klar, dass er noch eine andere Wahlmöglichkeit besaß. Seine kleine Tochter wartete zu Hause auf ihn. Er liebte sie mehr als alles auf der Welt. Er liebte seine kleine Tochter sogar mehr, als er jemals irgendetwas oder irgendjemanden in seinem Leben geliebt hatte.«
Schweigend saß sie neben ihm. Der Abstand zwischen ihnen hatte sich nicht verringert. Er hatte keine Ahnung, ob sie ihm zuhörte. Immerhin war sie gut durchgewärmt. Sie trug eines seiner Unterhemden, ein graues mit einem V-Ausschnitt, darüber eine Jacke, die fast den Boden berührte, und die Decke hatte sie bis zum Kinn hochgezogen, um sich gegen die Kühle des Dauerregens und des Windes zu schützen. Im Zöpfeflechten wurde er allmählich besser. Wenn sie nicht so still wäre und ab und zu etwas lächeln würde, hätte man sie für irgendein Kind halten können, das neben seinem Vater saß, der ihm eine Geschichte vorlas.
Aber sie war nicht irgendein Kind. Langsam lenkte er den Blick auf das Buch zurück. Mit einem plötzlich eindeutigen, klaren Gefühl sagte er: »Und er wollte sie beschützen und lieben, solange er lebte. Sie war süß und freundlich, und er wusste, dass sie ihn liebte. Aber sie hatte Angst. Das wiederum konnte er gut verstehen. Sie hatte so viel durchgemacht, mehr als kleine Mädchen durchmachen sollten. Doch sie hatte es überlebt. Sie war das tapferste Mädchen, das er kannte. Ja, sie hatte es überlebt. Und jetzt war sie bei ihm.
Er dachte an eine kleine Berghütte in den Rockies, mit einer Wiese voller leuchtender, blühender Akelei und scharlachroter Kastilea. Er wusste, dass es ihr dort gefallen würde. Sie war befreit worden, und er würde sie wieder lachen hören. Es war schon lange her, seit er sie lachen gehört hatte. Er ging ins Haus und sah sie mit einem Spielzeugaffen in der Küchentür stehen. Sie lächelte ihn an und streckte ihm ihre Arme entgegen.«
Er drehte sich zu ihr und berührte langsam und nur sehr zaghaft ihr Ohr. »Besitzt du ein Spielzeugtier?«
Sie sah ihn nicht an, sondern starrte weiterhin aus dem Fenster in den grauen Regen, der anscheinend nie mehr enden wollte. Dann nickte sie.
»Ist es ein Affe?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ein Hund?«
Sie drehte sich mit Tränen in den Augen zu ihm und nickte.
»Ist schon gut. Aber er ist gar nicht ausgestopft, nicht wahr? Ist es ein richtiger Hund? Ich verspreche dir, dass du schon bald wieder bei deinem Hund sein wirst. Was für ein Hund ist es denn?«
Diesmal griff sie nach dem Stift und dem Papier, die er am letzten Abend auf den Sofatisch gelegt hatte. Es war das erste Mal, dass sie diese Sachen überhaupt beachtete. Hoffnung stieg in ihm auf. Sie malte einen Hund mit Punkten.
»Ein Dalmatiner?«
Sie nickte. Dann lächelte sie, zaghaft nur, aber ein Lächeln war es dennoch. Sie zupfte an seinem Ärmel. Sie hatte ihn tatsächlich berührt.
»Soll die Geschichte weitergehen?«
Sie nickte. Sie rückte ein klein wenig zu ihm hinüber und kuschelte sich in ihre Decke. Er sagte: »Komisch, aber sie wollte einen Hund, obwohl sie den Spielzeugaffen über alles liebte. Er hieß Geek. Er hatte sehr lange Arme und ein gewitztes braunbehaartes Gesicht. Sie nahm ihn überallhin mit. Eines Tages, als sie mit ihrem Vater zusammen über die Wiese in den Bergen lief, hörten sie ein lautes Geräusch. Es war der Milchmann. ›Warum kommt er denn bis hier hoch in die Berge?‹, fragte das kleine Mädchen ihren Vater. ›Er bringt uns unsere wöchentliche Milchlieferung‹, erwiderte der Vater. Und richtig, auf dem Wagen war Milch. Aber was der Mann eigentlich mitgebracht hatte, war ein ganzer Wurf kleiner Welpen, die alle schneeweiß waren. Schon bald bellten die Welpen sich gegenseitig an und jagten über die Wiese, versteckten sich hinter Blumen und rollten sich auf den Rücken. Sie amüsierten sich einfach großartig.
Geek jedoch war nicht glücklich. Er saß auf der Terrasse, seine langen Arme baumelten an der Seite, und er beobachtete, wie die Welpen die Aufmerksamkeit des Mädchens in Anspruch nahmen. Er hörte sie lachen und sah, wie sie mit den Welpen spielte, sah die Welpen über sie krabbeln und ihr Gesicht ablecken und wimmern, wenn sie ihre Bäuchlein nicht schnell genug streichelte. Der Kopf des Affen sank ihm bis tief zwischen die Beine. Er war sehr unglücklich.
Aber plötzlich kam sie zu ihm auf die Terrasse. Sie hob ihn auf und küsste ihn auf sein haariges Gesicht. ›Komm und spiel mit den Welpen, Geek‹, sagte sie. ›Papa meint, sie müssten schon bald wieder nach Hause zurück. Der Milchmann hat sie nur mitgebracht, damit wir mit ihnen spielen können.‹
Als Geek später darüber nachdachte, wurde ihm klar, dass er die Welpen eigentlich ganz gern gehabt hatte, nachdem er sich erst einmal an sie gewöhnt hatte. Eigentlich waren sie sogar ausgesprochen niedlich. Vielleicht konnte er einen Welpen finden und ihn dem Mädchen mitbringen. Dicht an sie gekuschelt, schlief er ein und träumte von einem weißen Welpen, der einmal, wenn er älter wurde, schwarze Flecken bekommen würde.«
Mit dramatischer Geste schloss Ramsey das Buch. »Nun, wie findest du Geek, den Affen?«
Sie nahm Papier und Stift, arbeitete eine Weile lang, dann lehnte sie sich zurück. Er sah ein Strichmädchen mit etwas im Arm, das offenbar Geek sein sollte. Sie drückte ihn fest an sich, und sie lächelte.
»Das ist prima«, sagte er. Saß sie wirklich dicht neben ihm? Verdammt noch mal, ja, das tat sie.
Er war es, der einschlief und dessen Kopf zurück auf das Sofa fiel. Als er ein paar Stunden später aufwachte, lag sie an ihn gekuschelt, ihr Kopf auf seiner Brust und ganz und gar weich, wie vollkommen entspannte Kinder es sind. Er beugte sich herunter und küsste sie auf den Kopf. Sie roch nach einer Mischung aus seinem Shampoo und Kind. Es gefiel ihm. Er schob sie von sich herunter, deckte sie gut zu und ging in die Küche. Er machte sich etwas Kaffee, setzte sich an den Küchentisch und hörte dem Regen zu, der auf das Dach der Hütte prasselte.
Jetzt war sie schon fast vier Tage bei ihm. Er hatte keine Menschenseele in der Nähe der Hütte bemerkt. Aber er wollte, dass der Mann, der sie missbraucht hatte, hier aufkreuzte. Er hätte gerne die Gelegenheit gehabt, ihn umzubringen. Wo war der Mistkerl? Vermutlich schon über alle Berge. Wie lange noch sollte er sie hier bei sich behalten, sie vor der Welt dort draußen verstecken? Um ihre Gesundheit musste er sich keine Sorgen machen. Am zweiten Tag hatte er ihr eine seiner Schlaftabletten gegeben. Als sie tief geschlafen hatte, hatte er sie noch einmal untersucht, all die blauen Flecken und Striemen, hatte nochmals die antibiotische Salbe aufgetragen und sie wieder gut zugedeckt. Die Wunden heilten gut. Sie hatte sich nicht einmal bewegt, Gott sei gedankt.
Ob sie tatsächlich einen Dalmatiner besaß? Ihm wurde klar, dass er die Rolle ihres eigentlichen Vaters übernahm. Aber egal, solange sie bei ihm war, gehörte sie ihm. Was aber war mit ihren Eltern? Waren sie während ihrer Entführung dabei gewesen? Vielleicht waren sie sogar Schuld, vielleicht hatten sie es zugelassen? Was für Menschen waren sie? Es war bedeutungslos, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Eigentlich aber war es überhaupt nicht bedeutungslos. Er fühlte sich gut. Sie hatte zum ersten Mal seine Nähe gesucht. Er hatte zwar erst einschlafen müssen, damit sie sich traute, aber es war ein Anfang, eindeutig ein Anfang.
Er lächelte, stand auf und öffnete eine Dose Hühnersuppe mit Nudeln. Sie mochte die Suppe mit getoastetem Käsebrot. Nachdem sie am Abend die letzten beiden Hot Dogs geröstet, die restlichen Baked Beans gegessen hatten und es ihm gelungen war, eine Götterspeise ohne Klumpen herzustellen, sagte er: »Ich nenne dir jetzt mal ein paar Mädchennamen. Wenn ich auf deinen Namen stoße, dann nickst du dreimal oder aber zupfst an meinem Ärmel oder stößt mir gegen das Schienbein. Abgemacht?«
Sie verharrte regungslos. Ihr Gesichtsausdruck zeigte keinerlei Veränderung. Ihre mangelnde Begeisterung ließ nichts Gutes erahnen.
»Also gut, lass es uns versuchen. Wie wäre es mit Jennifer? Das ist ein wirklich schöner Name. Heißt du so?«
Sie machte keine Bewegung.
»Wie ist es mit Lindsey?«
Nichts.
»Morgan?«
Sie drehte ihm den Rücken zu und demonstrierte so ihre Gefühle in aller Deutlichkeit. Sie wollte das Namenspiel nicht spielen. Aber warum nicht?
»Zeichne mir ein Bild von deiner Mama.«
Augenblicklich drehte sie sich wieder um. Ihre Finger wischten über das weiße Blatt Papier. Sie sah ihn nicht an, starrte nur das Papier an. Dann begann sie zu zeichnen. Es war ein Strichmännchen mit einem Rock, Turnschuhen und jeder Menge Locken. Die Frau hielt so etwas wie einen Kasten mit einem Knopf darauf.
Dann sagte er: »Das ist sehr schön. Ist ihr Haar so braun wie deines?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Rot?«
Sie lachte breit und nickte. Dann malte sie noch mehr Locken um den Kopf der Strichfigur.
»Ich habe Rot geraten, weil es meine Lieblingsfarbe ist. Hat sie richtig lockiges Haar? Ist es lang?«
Sie zuckte mit den Schultern.
»Ah, es ist schulterlang. Hält sie einen Karton in der Hand?«
Sie schüttelte den Kopf. Sie deutete auf ein Titelmädchen einer Zeitschrift auf dem Couchtisch. Dann presste sie Zeigefinger und Daumen aufeinander.
»Ach so«, erwiderte er. »Das ist ein Fotoapparat. Sie ist Fotografin?«
Sie nickte und deutete wieder auf die Bilder.
»Und sie fotografiert Menschen?«
Sie nickte zufrieden. Plötzlich wurde ihr Gesicht ernst. Sie dachte an ihre Mutter, vermisste sie, fragte sich, wo sie war. Dagegen konnte er nichts tun. Er sagte: »Und nun male mir ein Bild von deinem Vater.«
Sie umklammerte den Bleistift, wie man einen Dolch umklammern würde. Dann drang wieder dieses schreckliche Wimmern aus ihrer Kehle.
»Ist schon gut, Kleines. Ich bin ja da. Du bist in Sicherheit.«
Zu seiner Überraschung malte sie ein Strichmännchen, das Gitarre spielte und dessen Mund geöffnet war. War ihr Vater Sänger? Sie presste den Stift so kräftig auf das Papier, dass die Spitze abbrach. Konnte es ihr Vater gewesen sein, der sie missbraucht hatte? Kein Vater würde das seinem eigenen Kind antun. Unsinn! Bei allem, was er über das Leben erfahren hatte, was er gesehen und verhandeln musste, wusste er sehr wohl von dieser Möglichkeit. Er wollte sie über ihren Vater ausfragen, aber nachdem sie so reagiert hatte, würde er damit noch warten.
Sie knüllte das Papier zusammen. Langsam zog sie sich von ihm zurück und rollte sich am anderen Ende des Sofas zu einer Kugel zusammen.
Es würde viel Zeit brauchen, soviel war ihm klar. Zeit. Doch wie lange sollte er sich Zeit lassen?
»Ich lasse dich nicht hier allein im Jeep. Es ist nicht sicher. Du wirst mit mir mitkommen. Hier, nimm meine Hand. Kannst du das?« Er wartete kurz und strich ihr mit den Fingerspitzen leicht über die Wange. »Ist schon gut, Kleines. Ich weiß, dass dich das hier alles beunruhigt, aber es wird schon werden. Niemand wird dir wehtun. Jetzt hast du mich, und ich bin groß und stark. Ich kann Karate. Ich bin sogar richtig gut. So ähnlich wie Chuck Norris. Hast du schon mal von ihm gehört? Er kann mehr Bösewichte umlegen als Godzilla.«
Sie machte ein paar schneidende Geräusche mit ihren Händen.
»Genau so meine ich es. Ich weiß, dass du diese Kleidung nicht anziehen willst, aber es wird nicht für lange sein, nur so lange, bis wir dir neue Sachen gekauft haben. Dann kannst du dich gleich umziehen, und wir schmeißen diese Sachen weg. Noch besser, wir lassen sie gleich hier im Laden zurück.« Er hatte die gelben Jeans und das blassgelbe T-Shirt zusammen mit seiner Unterwäsche und seinen eigenen T-Shirts in der Wanne gewaschen. Es war ihm verhasst, ihr diese Sachen anzuziehen, doch er hatte keine andere Wahl. Unmöglich konnte er sie in seinen Unterhemden und Pullovern und dann auch noch barfuß in Herrn Peetes Gemischtwarenhandel mitnehmen. Er zwickte sie ins Kinn. »Komm schon, lass uns gehen. Es wird ein Abenteuer. Mach dir keine Sorgen, ich beschütze dich. Stell dir vor, ich wäre dein eigener Geek, der Affe, nur viel größer. Kannst du dir vorstellen, was Geek tun würde, wenn dir jemand ans Leder wollte? Sicher kannst du das. Geek und ich, wir sind die guten Affen. Bist du so weit?«
Sie lächelte, nur ein sehr kurzes Lächeln, doch ihm wurde klar, dass sie nicht aus dem Jeep aussteigen wollte. Aber er konnte sie selbst bei abgeschlossenen Türen nicht im Wagen zurücklassen. »Je eher wir in den Laden gehen, desto eher können wir auch wieder zurück«, ermunterte er sie.
Endlich nickte sie. Er hob sie aus dem Jeep, setzte sie auf dem unebenen Bürgersteig ab, schloss die Autotür ab und streckte ihr seine Hand entgegen. Zögernd nahm sie seine Hand.
»Sehr gut«, sagte er und drückte ihre Hand ein wenig. »Lass uns einkaufen gehen, bis wir umfallen.«