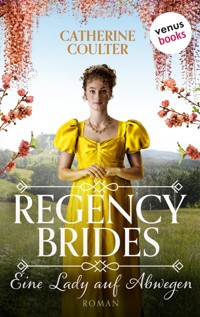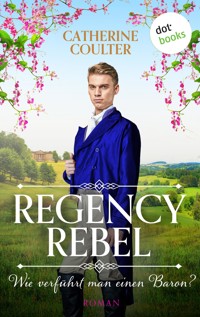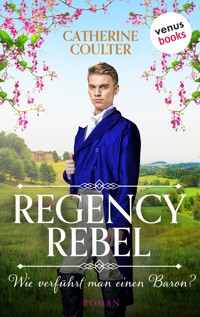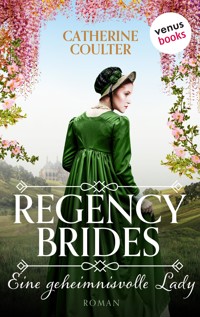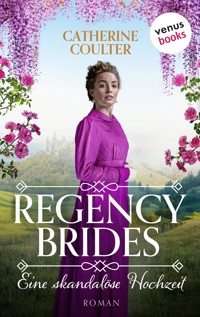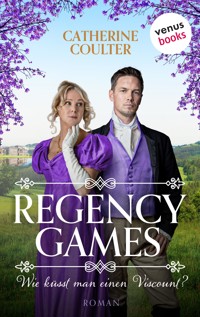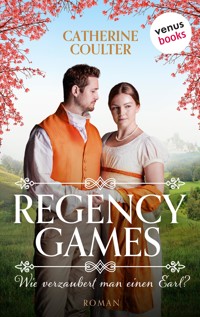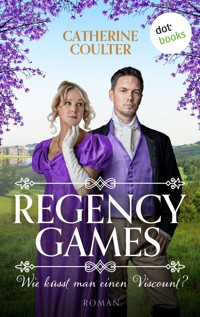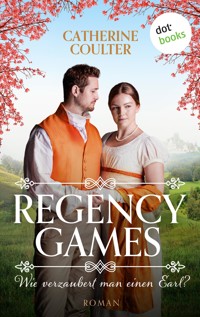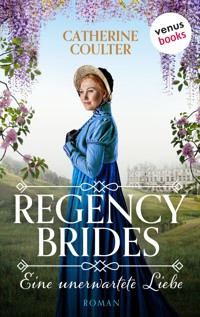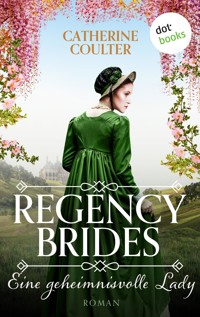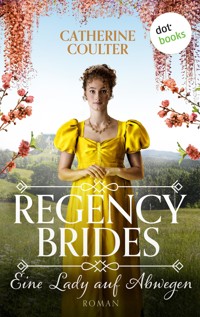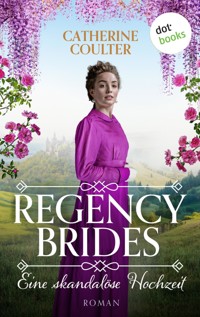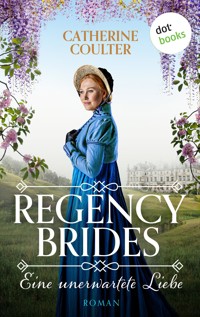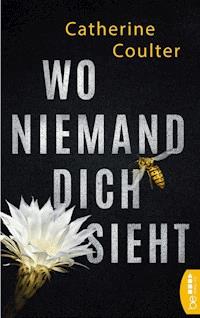4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein FBI Thriller mit Dillon Savich und Lacey Sherlock
- Sprache: Deutsch
Eine blutige Spur ...
FBI-Agent Dillon Savich ist am Boden zerstört: Seine Schwester Lilly ist mit ihrem Auto gegen einen Baum gerast. War es wirklich der zweite Selbstmordversuch nach dem Tod ihrer Tochter sieben Monate zuvor? Dillon kann dies nicht glauben, vor allem als er herausfindet, dass Lilly äußerst wertvolle Bilder geerbt hat - und mehr als die Hälfte davon durch wertvolle Kopien ersetzt wurden. Was steckt hinter dem mysteriösen Kunstraub?
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
1
Maryland Unweit des Plum River
2
Hemlock Bay, Kalifornien
3
4
Hemlock Bay, Kalifornien
5
Eureka, Kalifornien
Hemlock Bay, Kalifornien
6
Hemlock Bay, Kalifornien
7
8
9
10
Eureka, Kalifornien The Mermaid’s Tail
11
Washington D.C. Drei Tage später
12
13
Quantico
Washington D.C.
14
New York City
15
Quantico
Eureka, Kalifornien
16
Washington D.C. Das Hoover-Gebäude Fünfter Stock, Abteilung für gezielte Täterermittlung
17
Eureka, Kalifornien The Mermaid’s Tail
Washington D.C. Hoover-Gebäude
Quantico, Virginia FBI-Akademie
18
Eureka
19
Saint John’s, Antigua Öffentliches Verwaltungsgebäude, nahe Reed Airport
20
Eureka, Kalifornien
Hemlock Bay, Kalifornien
21
Saint John’s, Antigua
Hemlock Bay
Washington D.C.
22
Hemlock Bay, Kalifornien
Washington D.C. FBI-Hauptquartier
23
24
Bar Harbor, Maine
Göteborg, Schweden
25
Bar Harbor, Maine
Göteborg, Schweden
26
Washington D.C.
Göteborg, Schweden
27
28
Washington D.C.
29
30
Washington D.C.
Zwei Tage später
DANKSAGUNG
Über dieses Buch
Eine blutige Spur ...
FBI-Agent Dillon Savich ist am Boden zerstört: Seine Schwester Lilly ist mit ihrem Auto gegen einen Baum gerast. War es wirklich der zweite Selbstmordversuch nach dem Tod ihrer Tochter sieben Monate zuvor? Dillon kann dies nicht glauben, vor allem als er herausfindet, dass Lilly äußerst wertvolle Bilder geerbt hat - und mehr als die Hälfte davon durch wertvolle Kopien ersetzt wurden. Was steckt hinter dem mysteriösen Kunstraub?
Über die Autorin
Catherine Coulter wuchs auf einer Ranch in Texas auf und schrieb nach ihrem Uniabschluss Reden an der Wall Street, bevor sie sich voll und ganz dem Schreiben widmete. Inzwischen hat sie mehr als 70 Romane veröffentlicht – darunter viele Regency Romances, aber auch einige Thriller. Ihre Bücher stürmen regelmäßig die Bestsellerlisten der New York Times. Catherine Coulter lebt mit ihrem Ehemann und drei Katzen in Nordkalifornien.
Catherine Coulter
Wer nie die Wahrheit sagt
Aus dem Amerikanischen von Gertrud Wittich
beTHRILLED
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2001 by Catherine Coulter
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Hemlock Bay
Originalverlag: G. P. Putnam’s Sons, a member of Penguin Putnam Inc., New York
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2003 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH
Übersetzung: Gertrud Wittich
Lektorat/Projektmanagement: Anne Pias
Covergestaltung: © www.buerosued.de
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-4493-6
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1
MarylandUnweit des Plum River
Es war ein kalter Tag Ende Oktober. Ein kräftiger Wind zerrte die letzten bunten Herbstblätter von den Bäumen. Die Sonne brannte grell auf die verfallene rote Scheune herunter; seit mindestens vierzig Jahren schien sie nicht mehr gestrichen worden zu sein. Nur noch ein paar verblichene rote Streifen waren vom letzten Anstrich übrig. Ein trostloser Anblick.
FBI Special Agent Dillon Savich schlich um die Ecke, seine SIG Sauer schussbereit in der rechten Hand. Er bewegte sich vollkommen lautlos, nicht einmal eine Maus hätte ihn hören können – eine Fertigkeit, die er sich über die Jahre mit viel Übung und eiserner Disziplin erworben hatte. Etwa fünf Meter hinter ihm näherten sich drei weitere Agenten, darunter seine Frau, bereit, ihn zu decken oder falls nötig auszuschwärmen. Alle trugen kugelsichere Westen. Ein Dutzend Agenten näherten sich von der anderen Seite der Scheune; sie hatten jedoch Befehl, auf ein Signal von Savich zu warten, bevor sie etwas unternahmen. Sheriff Dade vom Jedborough County und drei seiner Deputies lagen zehn Meter hinter ihnen in einem dichten Ahorngehölz verborgen. Einer der Deputies, ein Scharfschütze, hatte die Scheune fest im Visier.
Soweit lief alles nach Plan, was, wie Savich annahm, wohl alle überraschte, obwohl niemand etwas sagte. Er hoffte inständig, dass es auch weiterhin glatt ging, was jedoch nicht allzu wahrscheinlich war. Nun ja, er würde damit fertig werden, schließlich blieb ihm gar nichts anderes übrig.
Die Scheune war größer, als Savich lieb sein konnte – mit einem riesigen Heuboden und viel zu vielen finsteren Winkeln. Zu viele Ecken und Nischen für einen Hinterhalt, zu viele Plätze, von denen aus die Agenten getroffen werden konnten.
Ein perfektes Versteck für Tommy und Timmy Tuttle, von den Medien »die Hexer« genannt. Eine blutige Spur quer durchs ganze Land ziehend, waren sie hier in Maryland untergetaucht, doch nicht ohne sich zuvor zwei neue Opfer zu fangen, zwei junge Brüder, die sie geradewegs aus der Turnhalle entführt hatten, wo die beiden nach der Schule noch Basketball trainierten. Das war in Stewartville, etwa vierzig Meilen von hier gewesen. Savich glaubte, dass sie sich nach Maryland abgesetzt hatten, er hätte nicht sagen können, warum, es war nur so ein Bauchgefühl, aber er war sich ziemlich sicher. Die FBI-Profiler konnten dazu nicht viel sagen, außer dass Maryland an der Atlantikküste lag und ihre Flucht nach Osten somit vorerst vom Meer abgebremst worden wäre.
Dann hatte sich MAX, Savichs Laptop-Superhirn, ins Katasteramt von Maryland gefressen und herausgefunden, dass Marilyn Warluski, eine Cousine ersten Grades der Tuttle-Brüder, die, wie MAX ebenfalls entdeckte, mit siebzehn Jahren ein Kind von Tommy Tuttle bekam, zufälligerweise dort ein kleines Grundstück besaß, in der Nähe eines dichten Ahornwäldchens, unweit des windungsreichen Plum River. Und auf diesem Grundstücksstreifen stand eine Scheune, eine riesige alte Scheune, die schon seit Jahren verfiel. Savich hätte bei dieser Entdeckung vor Freude fast einen Luftsprung gemacht und die Hacken zusammengeschlagen.
Und nun, vier Stunden später, waren sie also hier. Ein Auto war nirgends zu sehen, doch das beunruhigte Savich nicht weiter. Wahrscheinlich war der alte Honda in der Scheune versteckt. Er beruhigte seinen Atem und lauschte. Die Vögel waren verstummt. Eine schwere, ja drückende Stille lag über der Gegend, als fürchteten selbst die Tiere, dass etwas geschehen würde – und zwar nichts Gutes.
Savich hatte Angst, dass die Tuttle-Brüder längst wieder verschwunden waren. Alles, was sie, trotz der Stille, finden würden, wären ihre Opfer: zwei halbwüchsige Jungen – Donny und Rob Arthur – tot, schrecklich verstümmelt, die Leichen in einem großen schwarzen Kreis liegend.
Nicht noch mehr Blut riechen, nicht noch mehr Tote sehen. Nicht heute. Nie mehr.
Er warf einen Blick auf seine Micky-Maus-Armbanduhr. Höchste Zeit, einen Blick in die Scheune zu riskieren. Mal sehen, ob die bösen Jungs tatsächlich noch dort drin waren. Auf in den Kampf. Die Show konnte beginnen.
MAX hatte in einer Computerdatei des Grundstücksamts einen Hinweis auf einen rohen Grundriss der Scheune gefunden, bereits fünfzig Jahre alt, registriert und hinterlegt. Aber wo? Das war die Frage. Sie fanden den Wisch schließlich in einem alten Aktenschrank im Keller der örtlichen Stadtplanungsbehörde. Aber die Zeichnung war deutlich genug. Es gab einen kleinen, niedrigen Eingang, gleich hier, an der Westseite, hinter einem wild wuchernden, kahlen Busch. Er stand einen Spalt offen, weit genug für ihn, um sich hineinzuzwängen.
Savich warf einen Blick zurück und winkte den drei Agenten, die um die Ecke der Scheune spähten, mit der Pistole zu, als Zeichen, dass sie ihre Position halten sollten. Zentimeter um Zentimeter schob er die schmale Tür auf; alles war von Staub und Schmutz bedeckt, etliche Rattenkadaver lagen herum. Auf den Ellbogen, die SIG schussbereit in der Hand, robbte er hinein.
Im Innern der Scheune herrschte ein geheimnisvolles Zwielicht. Staubflocken tanzten in den Lichtstreifen, die durch die weit oben liegenden Fenster hereindrangen. Das Glas der meisten war zerbrochen, nur mehr einzelne Splitter steckten in den Rahmen. Er blieb ein paar Augenblicke lang regungslos liegen, versuchte seine Augen an das Halbdunkel zu gewöhnen. Heuballen lagen herum, so alt, dass sie beinahe wie versteinert wirkten, daneben rostige Maschinenteile und zwei uralte hölzerne Viehtränken.
Dann sah er sie. Am anderen Ende war noch eine Tür, keine sechs Meter rechts vom großen zweiflügeligen Scheunentor. Wohl ein Geräteraum, dachte er, auf dem Grundriss aber nicht eingezeichnet. Dann sah er die Umrisse des Hondas, in einer dunklen Ecke am anderen Ende der Scheune. Die zwei Brüder hielten sich in dem Geräteraum auf, kein Zweifel. Und Donny und Rob Arthur? Herrgott gib, dass sie noch am Leben sind.
Doch erst musste er wissen, wo wer war, bevor er die anderen Agenten herbeirief. Es war still, totenstill beinahe. Er sprang auf und rannte gebückt auf den Geräteraum zu, die Pistole nach allen Seiten schwenkend, vollkommen lautlos. Dann drückte er sein Ohr an die halb verrottete Holztür des Nebenraums.
Eine klare, zornige Männerstimme erklang dahinter, plötzlich laut werdend.
»Das junge Blut muss in den Kreis! Los! Die Ghule wollen euch haben; sie haben gesagt, wir sollen uns beeilen. Sie wollen euch mit ihren Messern und Äxten zerschneiden und zerhacken – Teufel, wie sie das lieben –, aber diesmal wollen sie euch in ihre Taschen stopfen und mit euch fortfliegen. He, vielleicht landet ihr am Ende sogar in Tahiti, wer weiß? So was haben sie bis jetzt noch nie gemacht. Aber uns kann’s egal sein. Da kommen sie, die Ghule!« Und er lachte, das Gelächter eines jungen Mannes, nicht sehr tief, aber vollkommen irrsinnig. Savich drohte das Blut in den Adern zu gefrieren.
Dann erklang die Stimme eines anderen Mannes, eine tiefere Stimme. »Jep, fast bereit für die Ghule. Wir wollen sie doch nicht enttäuschen, oder? Los, vorwärts das junge Blut!«
Er hörte sie näher kommen, hörte das Schlurfen von Schritten, hörte das erstickte, panische Schluchzen der Jungen, hörte die Tuttles fluchen, hörte, wie sie die beiden Jungen mit Gewalt vorwärts trieben. Erst da fiel sein Blick auf den riesigen Kreis, der mit schwarzer Farbe grob auf einen sauber gefegten Bereich des hölzernen Scheunenbodens gemalt worden war.
Keine Zeit. Keine Zeit, um die anderen herzuholen.
Savich konnte gerade noch hinter einen Heuballen hechten, als die Tür des Geräteraums aufging und einer der Männer einen schmächtigen, leichenblassen Jungen vor sich her trieb. Die Hose des Jungen war total verdreckt und rutschte ihm fast vom Hintern. Das war Donny Arthur. Man hatte ihn geschlagen, ihn wahrscheinlich auch hungern lassen. Er war starr vor Angst. Dann wurde ein zweiter, ebenfalls vollkommen verängstigter Junge aus dem Geräteraum gestoßen: Rob Arthur, erst vierzehn Jahre alt. Savich hatte noch nie eine solche Angst in zwei so jungen Gesichtern gesehen.
Wenn Savich den Tuttles jetzt Einhalt gebot, konnten sie die Jungen als Schutzschilde benutzen. Nein, besser noch warten. Was sollte all das irre Gerede über Ghule? Er beobachtete, wie die beiden Männer die Jungen vor sich her stießen und dann buchstäblich mit Fußtritten in den Kreis beförderten.
»Keiner von euch bewegt sich, oder ich nagle dich mit meinem Messer hier an den Boden, direkt durch den Arm. Tammy hier übernimmt mit ihrem Messer den anderen. Hört ihr, junges Blut?«
Tammy? Ihr Messer? Nein, es waren doch zwei Brüder – Tommy und Timmy Tuttle, genug Alliteration, selbst für die Presse. Nein, er musste sich verhört haben. Er hatte zwei junge Männer vor sich, beide ganz in Schwarz, lange, hagere Gestalten in klobigen schwarzen, fast bis zu den Knien reichenden Schnürstiefeln. Sie hatten Messer und Pistolen bei sich.
Die beiden Jungen lagen weinend auf den Knien und klammerten sich aneinander. Ihre Gesichter waren blutverschmiert, aber sie konnten sich bewegen, was wohl bedeutete, dass noch alle Knochen heil waren.
»Wo sind die Ghule?«, kreischte Tammy Tuttle, und da war Savich plötzlich klar, dass er sich nicht verhört hatte; es waren nicht zwei Brüder, es waren Bruder und Schwester.
Was sollte das mit diesen Ghulen, die kommen und die Jungen ermorden sollten?
»Ghule«, schrie Tammy mit zurückgeworfenem Kopf, und ihre Stimme ließ die alten Scheunenwände erbeben, »wo seid ihr? Wir haben hier zwei Leckerbissen für euch, genau wie ihr’s gern habt – zwei wirklich süße kleine Leckerbissen! Junges Blut, alle beide. Kommt und bringt eure Messer und Äxte! Kommt, ihr Ghule.«
Wie einen Singsang wiederholte sie ihre Worte, einmal, zweimal, dreimal. Immer lauter wurde sie dabei, immer wilder, immer irrer, lächerliche Worte eigentlich, wenn sie nicht so erschreckend und hasserfüllt geklungen hätten.
Tammy Tuttle versetzte einem der beiden Jungen einen wütenden Tritt, als dieser versuchte, aus dem Kreis zu kriechen. Savich wusste, dass er bald handeln musste. Doch wo waren diese Ghule?
Da hörte er etwas, etwas ganz anderes als die irren menschlichen Stimmen, eine Art hohes Winseln, fast ein Zischen, das nicht hergehörte, nicht in diese Welt. Er merkte, dass er eine Gänsehaut bekam; Eiseskälte durchfuhr ihn. Er wollte gerade aus seinem Versteck springen, als zu seiner Verblüffung die großen Flügel des Scheunentors mit einem Knall nach innen schwangen und blendend helles Licht hereinströmte. Und in diesem Licht tanzten zwei riesige Staubwolken wie zwei kleine Tornados. Das weiße Licht verblasste, und jetzt sahen die Staubwolken mehr aus wie zwei wirbelnde weiße Kegel, zwei einzelne Kegel, die sich wie wahnsinnig drehten und zuckten, die hochschossen und wieder nach unten, die sich vermengten und wieder trennten – nein, nein, das war bloß Staub, weißer Staub, der noch nicht dreckig war, weil er noch nicht mit dem Schmutz vom Scheunenboden in Berührung gekommen war. Aber was waren das jetzt wieder für Geräusche? Irgendwas Komisches, nicht Identifizierbares. Gelächter? Nein, das war verrückt, aber so klang es irgendwie.
Die Jungen sahen die hoch über ihnen wirbelnden Staubwolken und fingen an zu schreien. Rob sprang auf, packte seinen älteren Bruder und schaffte es, ihn aus dem Kreis zu reißen.
Tammy Tuttle, die nach oben geschaut hatte, fuhr plötzlich herum, hob das Messer und schrie: »Zurück in den Kreis, junges Blut! Wagt es ja nicht, die Ghule zu verärgern. Los, in den Kreis! ZURÜCK IN DEN KREIS!«
Die beiden Jungen krochen noch weiter vom Kreis fort, doch Tommy Tuttle war blitzschnell bei ihnen und riss sie zurück. Tammy Tuttle hob gerade ihr Messer, um es Donny Arthur in den Leib zu stoßen, da sprang Savich hinter dem Heuballen hervor und feuerte. Die Kugel durchschlug ihren Oberarm, dicht unter der Schulter. Sie schrie auf und fiel zu Boden, das Messer flog ihr aus der Hand.
Tommy Tuttle fuhr herum, diesmal kein Messer in der Hand, sondern eine Pistole, und diese Pistole war nicht auf Savich gerichtet, sondern auf die beiden gefangenen Jungen. Die Jungen schrien, als Savich Tommy mitten in die Stirn schoss.
Tammy Tuttle wälzte sich stöhnend auf dem Boden, hielt sich den Arm. Die Jungen standen da und klammerten sich aneinander. Sie schwiegen jetzt. Alle drei schwiegen sie und blickten hinauf zu diesen wirbelnden weißen Kegeln, die im hellen Licht, das zum Scheunentor hereinschien, tanzten. Nein, keine Staubwolken, das waren zwei getrennte Erscheinungen.
Einer der Jungen flüsterte: »Was ist das?«
»Ich weiß nicht, Rob«, sagte Savich und zog die Jungen an sich, schützte sie so gut er konnte. »Irgendein komischer Tornado, das ist alles.«
Tammy versuchte sich wüst fluchend aufzurichten, fiel aber wieder zurück. Dann ertönte ein Schrei, ein lauter, hohler Schrei und einer der Kegel schien sich direkt auf sie zu stürzen. Savich überlegte nicht, er schoss einfach auf das Ding, schoss mitten hinein. Es war, als würde man auf Nebel schießen. Der Kegel tanzte wieder nach oben, dann zurück zu dem anderen. Sie verharrten noch für einen Moment, sich wie irre drehend, dann, im nächsten Augenblick, waren sie verschwunden. Fort. Wie vom Erdboden verschluckt.
»Es ist alles gut, Donny, Rob. Alles in Ordnung. Ihr wart toll. Ich bin sehr stolz auf euch, und eure Eltern sicherlich auch. Ja, man darf ruhig Angst haben; hätte mir selbst fast in die Hosen gemacht. Bleibt nur hier, hier bei mir. Ja, genau so. Jetzt seid ihr in Sicherheit.«
Die Jungen pressten sich so fest an Savich, dass er ihre Herzen schlagen fühlte. Sie schluchzten herzzerreißend, raue, abgehackte Schluchzer; jetzt wussten sie endlich, endlich, dass sie nicht sterben mussten, dass es vorbei war.
Er hielt die beiden so, dass sie Tammy Tuttle, die aufgehört hatte zu stöhnen, nicht mehr sehen mussten. In welcher Verfassung sie war, interessierte ihn in diesem Moment kaum, und er hatte auch keine Lust nachzusehen.
»Die Ghule«, stammelte einer der Jungen wieder und wieder mit brechender Stimme. »Sie haben uns alles über sie erzählt, was die Ghule mit den anderen Jungen gemacht haben – bei lebendigem Leib gefressen oder, wenn sie keinen Hunger haben, zerhackt und zerstückelt und an ihren Knochen genagt...«
»Ich weiß, ich weiß«, sagte Savich, doch eigentlich hatte er keine Ahnung, was er da in Wirklichkeit gesehen hatte. Zwei wirbelnde Staubwolken, das war alles. Nirgendwo irgendwelche versteckten Äxte oder Messer. Außer natürlich, diese Dinger verwandelten sich in etwas anderes, etwas Substanzielleres? Nein, das war zu verrückt. Er spürte, wie sich etwas in seinem Innern heftig gegen diese Gedanken und das, was er gesehen hatte, sträubte. So etwas gab es nicht, das war nicht wirklich. Er hatte es nicht gesehen, hatte es sich bloß eingebildet. Es gab keine Ghule, hatte sie nie gegeben. Bestimmt ließ sich das Ganze irgendwie erklären, vielleicht war es ja nur eine Illusion, eine Halluzination, hervorgerufen von zwei Psychopathen, die Ausgeburt ihrer kranken Gehirne. Doch was immer das auch gewesen war, was die Tuttles »die Ghule« nannten, er hatte es gesehen, gar darauf geschossen. Und er konnte es nicht vergessen.
Vielleicht waren es ja doch nur Staubwolken gewesen, die seinen Augen einen Streich gespielt hatten. Vielleicht.
Jetzt kamen auch die anderen Agenten herein, gefolgt vom Sheriff und seinen Deputies. Savich hielt weiterhin die Jungen an sich gedrückt, redete beruhigend auf sie ein und beobachtete währenddessen, wie sich einer über Tammy Tuttle beugte. Kurz darauf wimmelte es nur so von FBI-Agenten, die die Scheune von oben bis unten durchkämmten, jeden Winkel, natürlich auch den Geräteraum.
Man war begeistert, außer sich vor Freude. Man hatte die Jungen gerettet. Man hatte zwei extrem gefährliche Psychopathen überwältigt.
Tammy Tuttle kam wieder zu sich und gab jede Menge wilde Flüche von sich; man musste sie mit Gewalt am Boden festhalten. Sie schrie und brüllte und verfluchte Savich, während sie ihren Arm umklammerte, brüllte, dass die Ghule ihn sich schnappen würden, sie würde sie schon zu ihm führen, sein Leben sei keinen Scheißdreck mehr wert und das des jungen Bluts ebenfalls nicht. Savich merkte, wie die Jungen fast zusammenbrachen, als sie das hörten.
Da versetzte ein Agent der Frau einen harten Kinnhaken. Grinsend blickte er auf und meinte: »Hab sie von ihren Leiden erlöst. Kann nicht zulassen, dass eine so aufrechte, nette Lady sich so quält.«
»Danke«, sagte Savich. »Rob, Donny, sie wird euch nichts mehr tun, nie mehr. Das verspreche ich euch.« Sherlock kam zu ihm. Sie sah aus, als wollte sie Tammy am liebsten an die Kehle gehen. Wortlos nahm sie die Jungen in die Arme.
Dann tauchte der Notdienst auf, mit mehreren Bahren. Big Bob, der Leiter des Trupps, ein wahrer Fleischberg mit einem Halsumfang von fünfundfünfzig Zentimetern, warf nur einen Blick auf die beiden Agenten, die die Jungen im Arm hielten, und hob die Hand. Zu den drei Männern hinter ihm sagte er: »Wartet mal kurz. Ich glaube, diese Jungs kriegen im Moment genau die Medizin, die sie brauchen. Kümmert euch um die Frau. Der Kerl ist hinüber.«
Drei Stunden später war die Scheune wieder leer, alle Spuren gesichert, alle Beweismittel eingesammelt. Hauptsächlich waren es Essensreste, wie Pizzaschachteln, ein paar Ketten und Handschellen und gut vier Dutzend leere Schokoriegelverpackungen. Beide Tuttles waren fortgebracht worden, Tammy lebend, Tommy tot. Die Jungen brachte man umgehend zu ihren Eltern, die im Büro des Sheriffs in Stewartville, Maryland, warteten. Von dort aus würde man sie ins örtliche Krankenhaus zur Untersuchung bringen. Man wollte den Jungen ein paar Tage Zeit lassen, damit sie sich ein wenig beruhigen konnten, bevor das FBI sie befragte.
Alle Agenten fuhren zurück zum FBI-Hauptquartier, zur Criminal Apprehension Unit, kurz CAU, der Abteilung für gezielte Täterermittlung, Savichs Einheit, wo sie ihre Berichte schreiben wollten.
Es herrschte eine wahre Jubelstimmung. Man klopfte sich auf die Schultern, man gratulierte sich. Nichts war schief gelaufen, keine Fehler, keine Schnitzer. Man war rechtzeitig da gewesen, um die Jungen zu retten. »Sieh dir dieses Herumgeprotze an«, sagte Sherlock beim Betreten der Abteilung. Dann musste sie lachen. Es gab nur ein Gesprächsthema: wie Savich mit den Bastarden fertig geworden war.
Savich rief alle Agenten, die an dem Einsatz teilgenommen hatten, im Konferenzzimmer zusammen.
»Als das Scheunentor aufging, hat da irgendwer was gesehen?«
Niemand hatte etwas gesehen.
»Hat irgendjemand was Komisches aus der Scheune kommen sehen, irgendwas?«
Schweigen am großen Tisch. Dann sagte Sherlock: »Wir haben nichts gesehen, Dillon. Die Flügel des Scheunentors schwangen nach innen auf, und es staubte gewaltig, mehr nicht.« Sie warf einen Blick in die Runde. »Wir haben nichts aus der Scheune rauskommen sehen.«
»Die Tuttles nannten sie ›die Ghule‹«, erklärte Savich langsam. »Sie haben so echt ausgesehen, dass ich tatsächlich auf einen geschossen hab. Dann schienen sie sich aufzulösen, einfach zu verschwinden. Ich versuche hier so objektiv wie möglich zu sein. Ihr müsst verstehen, dass ich ganz bestimmt nicht so ein verrücktes Zeug sehen wollte. Aber ich hab’s gesehen. Ich will glauben, dass es nur eine Staubwolke war, die sich in zwei Teile geteilt hat, aber ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht. Wenn sich einer von euch einen Reim darauf machen kann, würd’s mich freuen.«
Fragen wurden gestellt, es wurde hin und her spekuliert, bis schließlich wieder alle stumm dasaßen. Savich sagte zu Jimmy Maitland: »Die Jungen haben sie auch gesehen. Sie reden von nichts anderem. Ich möchte wetten, dass Rob und Donny die Dinger nicht als Staubwolken oder als eine Art Naturerscheinung bezeichnen.«
Jimmy Maitland sagte: »Niemand wird ihnen glauben. Also, diese Ghul-Geschichte sollte besser unter uns bleiben. Das FBI hat auch so schon genug Probleme, da brauchen wir nicht noch zusätzlich zu verkünden, wir hätten zwei übernatürliche Kegel gesehen, die mit zwei irren Psychopathen im Bund standen, Menschenskind.«
Später, als Savich seinen Bericht für Jimmy Maitland tippte, merkte er, dass er »Ghule« automatisch in Großbuchstaben geschrieben hatte. Für die Tuttles waren sie nicht einfach irgendwelche Erscheinungen; sie waren etwas ganz Spezielles.
Eine halbe Stunde später folgte Sherlock Savich aufs Männerklo. Ollie Hamish, Savichs zweiter Mann, stand gerade am Waschbecken und wusch sich die Hände.
»Ach, hallo Leute. Nochmals meine herzlichsten Glückwünsche, Savich. Tolle Arbeit. Wünschte bloß, ich wär dabei gewesen.«
»Freut mich, einen Mann zu sehen, der sich nach dem Pinkeln die Hände wäscht«, bemerkte Sherlock und zwickte ihn in den Arm. »In ein paar Minuten werde auch ich meine Hände waschen. In Unschuld nämlich. Aber erst muss ich meinem Mann, diesem Blödian, ein bisschen Vernunft einbläuen. Also mach, dass du wegkommst, Ollie. Ich weiß, du willst ihn bloß vor mir beschützen, und ich will nicht euch beiden wehtun müssen.«
»Ach, komm schon, Sherlock, er ist ’n verdammter Held. Wieso willst du dem Helden ans Leder? Er hat diese beiden Jungen vor den Hexern und den Ghulen gerettet.«
Savich fragte: »Nach allem, was ich dir von ihnen erzählt hab, würdest du sie im Geiste auch mit Großbuchstaben schreiben?«
»Klaro, du hast doch gesagt, es waren zwei. Ist eine von diesen komischen Sachen, die einen nicht mehr loslassen. Bist du dir sicher, dass du nicht irgendwas geraucht hast? Zu viel abgelagertes Heu eingeatmet, vielleicht?«
»Ich wünschte, es wär so gewesen.«
»Raus, Ollie.«
Als sie allein waren, hielt sie ihm keine Standpauke, sondern ging zu ihm und schlang ihm die Arme um die Taille. »Ich kann nicht gerade behaupten, ich hätte noch nie im Leben solche Angst ausgestanden, denn wir beide haben schon so einiges mitgemacht.« Sie gab ihm einen Kuss auf den Hals. »Aber heute, in dieser Scheune, warst du ganz schön waghalsig. Ich hätte mir fast ins Höschen gemacht vor Angst, genauso wie deine Freunde.«
»Es war keine Zeit«, sagte er, die Wange an ihr lockiges Haar gedrückt. »Keine Zeit, euch zu holen. Herrgott, ich hatte selbst eine Scheißangst, aber es blieb mir keine Wahl. Und dann tauchten plötzlich diese Heuler auf. Ehrlich, ich weiß nicht, was mir mehr Angst machte – Tammy Tuttle oder das, was sie ›die Ghule‹ nannte.«
Sie bog den Oberkörper ein wenig zurück, um ihn ansehen zu können. »Ich kapier das einfach nicht. Du hast alles so klar beschrieben, ich konnte diese wirbelnden Dinger fast sehen, wie sie durchs offene Scheunentor reinkamen. Aber Ghule?«
»So haben die Tuttles sie genannt. Kam mir vor, als wären sie ihre ergebenen Diener oder ihre Jünger oder so was. Ich würde liebend gerne sagen, dass es bloß eine Halluzination war, dass ich der Einzige war, der aus der Rolle fiel, aber die Jungen haben sie auch gesehen. Ich weiß, das klingt verrückt, Sherlock, noch dazu, wo von euch keiner was gesehen hat.«
Und weil er noch ein wenig mehr darüber reden musste, hielt sie ihn einfach umschlungen, während er ihr abermals beschrieb, was da durch die Scheunentore gegeistert war. Dann sagte er: »Wahrscheinlich werden wir nie wieder von dieser Sache hören, aber es war schon beängstigend, Sherlock, das war’s wirklich.«
Jimmy Maitland kam ins Männerklo stolziert.
»He, wo soll ein armer Mann hier pinkeln?«
»Ach, Sir, ich wollte bloß sehen, wie’s Dillon geht, ob er in Ordnung ist.«
»Und, ist er?«
»O ja.«
»Hab Ollie auf dem Weg zur Abteilung getroffen, Savich. Er meinte, Sherlock würde Ihnen im Männerklo die Hucke voll hauen. Die Pressemeute wartet schon.« Jimmy Maitland grinste von einem Ohr zum andern. »Und wisst ihr was? Diesmal keine Prügel von den Herren – nur Streicheleinheiten, Gott sei’s gedankt. Haben ja auch nur tolle Neuigkeiten. Und da Sie sozusagen der Mittelpunkt des Ganzen sind, Savich, möchte ich, dass Sie auch dabei sind. Natürlich wird Louis Freeh das Reden übernehmen. Sie müssen bloß daneben stehen und so heldenhaft wie möglich aus der Wäsche gucken.«
»Und kein Wort von diesen Erscheinungen?«
»Nein, kein Wort von den Ghulen, nicht mal Spekulationen über wirbelnde Staubwolken. Das Letzte, was wir brauchen können, ist, dass die Presse über uns herfällt, weil wir angeblich von ein paar komischen Staubballen attackiert wurden, die zwei irre Psychopathen herbeigerufen haben. Was die Jungen betrifft, spielt es keine Rolle, was sie sagen. Wenn uns die Pressefritzen danach fragen, schütteln wir einfach nur bekümmert und mitleidig die Köpfe. Die werden einen Tag lang einen Wirbel drum machen, dann ist das Ganze wieder vergessen. Und das gesamte FBI steht als Held da. Schon ein tolles Gefühl.«
Savich sagte, während er seiner Frau über den Rücken strich: »Aber in dieser Scheune war was ganz Komisches. Hat mir förmlich die Nackenhaare aufgestellt, Sir.«
»Jetzt reißen Sie sich mal zusammen, Savich. Wir haben die Tuttle-Brüder, oder besser gesagt, wir haben einen toten Bruder und eine Schwester, der gerade der Arm abgenommen werden musste. Was Übernatürliches können wir jetzt am allerwenigsten gebrauchen.«
»Vielleicht möchten Sie mich ja jetzt Mulder nennen?«
»Hätten Sie wohl gern. He, ich sehe gerade, dass Sherlock hier ja auch rote Haare hat, so wie Scully.«
Savich und Sherlock verdrehten die Augen und folgten ihrem Boss aus dem Männerklo.
Die Jungen behaupteten steif und fest, die Ghule gesehen zu haben; sie konnten kaum von etwas anderem reden als davon, wie Agent Savich direkt auf einen dieser Ghule geschossen und sie aus der Scheune vertrieben hatte. Aber die Jungen sahen derart bemitleidenswert aus, waren so am Ende, dass ihnen nicht einmal ihre Eltern glaubten.
Ein Reporter fragte Savich, ob er irgendwelche Ghule gesehen habe, doch Savich sagte nur: »Wie bitte?«
Jimmy Maitland hatte recht. Damit war die Sache erledigt.
Savich und Sherlock spielten an diesem Abend so lange mit Sean, dass er mitten in seinem Lieblingsfingerspiel, Versteck-das-Kamel, einschlief, einen feuchten Grahamcracker halb zerkrümelt in der kleinen Faust. In dieser Nacht läutete gegen zwei Uhr morgens das Telefon. Savich ging ran, hörte kurz zu und sagte dann: »Wir kommen so schnell wie möglich.«
Dann legte er langsam den Hörer auf und blickte seine Frau an, die sich schlaftrunken auf einen Ellbogen stützte.
»Es geht um meine Schwester Lily. Sie liegt im Krankenhaus. Sieht nicht gut aus.«
2
Hemlock Bay, Kalifornien
Hell strömte die Sonne durch die schmalen Fenster herein. Ihre Schlafzimmerfenster waren doch breiter, oder? Auf jeden Fall waren sie sauberer. Nein, Moment, sie war ja gar nicht in ihrem Schlafzimmer. Eine vage Panik keimte in ihr auf, fiel jedoch rasch in sich zusammen. Eigentlich konnte sie kaum etwas fühlen, bis auf eine leichte Verwirrung, die sicher unwichtig war, und ein vages Stechen im linken Arm, dort, wo die Infusionsnadel steckte.
Die Infusionsnadel?
Das bedeutete, dass sie im Krankenhaus lag. Sie konnte atmen. Sie spürte das Kitzeln der Sauerstoffschläuche in der Nase, ein wenig irritierend, aber nicht weiter schlimm. Das beruhigte sie. Sie war noch am Leben. Aber wieso sollte sie nicht am Leben sein? Wieso war sie überrascht?
Ihr Kopf fühlte sich ganz benebelt und leer an, und selbst die Leere war irgendwie neblig. Vielleicht lag sie ja im Sterben und war deshalb allein gelassen worden. Wo war Tennyson? Ach ja, er war vor zwei Tagen nach Chicago geflogen, irgendwas Berufliches. Sie war froh, ihn los zu sein, erleichtert, schlicht und einfach zutiefst erleichtert, seinen beruhigenden Ton nicht mehr hören zu müssen, der ihr so furchtbar auf die Nerven ging.
Ein Mann mit Glatzkopf und weißem Kittel, ein Stethoskop um den Hals, kam herein. Er beugte sich dicht über sie. »Mrs. Frasier, können Sie mich hören?«
»O ja. Ich kann sogar Ihre Nasenhaare sehen.«
Er richtete sich lachend auf. »Ach, das war wohl zu nahe, wie? Nun, wie fühlen Sie sich? Haben Sie Schmerzen?«
»Nein, ich kann nicht mal mein Hirn fühlen. Mein Kopf ist ganz dumpf und benebelt.«
»Das liegt am Morphium. Sogar mit einem Bauchschuss bräuchten Sie bloß genug Morphium und würden selbst Ihrer Schwiegermutter alles verzeihen. Ich bin Ihr behandelnder Chirurg, Dr. Ted Larch. Ich musste Ihnen leider die Milz rausnehmen, und weil das eine ziemlich schwere Operation ist, bekommen Sie bis heute Abend reichlich Morphium. Dann werden wir mit der Dosis allmählich runtergehen. Wir müssen zusehen, wie wir Sie wieder auf die Beine bekommen, Mrs. Frasier.«
»Und was fehlt mir sonst noch?«
»Ich will mich kurz fassen. Zunächst mal kann ich Ihnen versichern, dass Sie wieder ganz gesund werden. Was die fehlende Milz betrifft, das schadet Ihnen langfristig nicht. Als Erwachsener braucht man die Milz nicht unbedingt. Aber die Operationsschmerzen werden Sie noch ein Weilchen verfolgen – ein paar Tage zumindest. Sie müssen aufpassen, wann und was Sie essen und wie gesagt, wir müssen Sie wieder auf die Beine bekommen.
Außerdem haben Sie sich zwei Rippen geprellt, dazu ein paar Schnitte und Abschürfungen, alles in allem aber nichts Lebensbedrohliches. Narben werden Sie keine zurückbehalten. Ich würde sagen, Sie halten sich wunderbar, wenn man bedenkt, was geschehen ist.«
»Was ist denn geschehen?«
Dr. Larch schwieg einen Augenblick, den Kopf nachdenklich zur Seite geneigt. Die Sonne strömte durch die Fenster herein und spiegelte sich auf seinem Kahlkopf. Langsam sagte er, den Blick durchdringend auf sie gerichtet: »Sie erinnern sich nicht mehr?«
Sie überlegte und überlegte, bis er ihr leicht die Finger auf den Unterarm legte. »Nein, bloß nichts erzwingen. Dabei holen Sie sich bloß Kopfschmerzen. Was ist das Letzte, woran Sie sich erinnern, Mrs. Frasier?«
Abermals überlegte sie und antwortete schließlich: »Ich erinnere mich, wie ich unser Haus in Hemlock Bay verließ. Da wohne ich, in der Crocodile Bayou Avenue. Ich weiß noch, dass ich nach Ferndale fahren wollte, um bei einem gewissen Dr. Baker ein paar medizinische Unterlagen abzuliefern. Ich weiß auch noch, dass ich Angst hatte, im Dunkeln die 211 zu nehmen. Das ist eine furchtbar kurvenreiche Straße, führt mitten durch einen Wald von Sequoias, die türmen sich so über und um einen auf, dass einem angst und bange wird. Man hat fast das Gefühl, lebendig begraben zu sein.« Sie hielt inne, und er merkte, wie frustriert sie wurde; deshalb unterbrach er sie.
»Nein, das ist schon in Ordnung. Interessante Metapher, mit diesen Sequoias. Mit der Zeit werden Sie sich bestimmt wieder an alles erinnern, Mrs. Frasier. Sie sind mit Ihrem Explorer direkt gegen einen Mammutbaum gefahren. Also, ich werde jetzt noch einen anderen Arzt hinzuziehen.«
»Was für einen Arzt?«
»Einen Psychiater.«
»Aber wieso sollte ich...« Sie runzelte die Stirn. »Ich verstehe nicht. Einen Psychiater? Wieso denn?«
»Na ja, es könnte sein, dass Sie absichtlich gegen diesen Mammutbaum gefahren sind. Keine Panik, machen Sie sich keine Sorgen. Ruhen Sie sich einfach nur aus und kommen Sie wieder zu Kräften. Ich komme dann später noch mal zu Ihnen, Mrs. Frasier. Wenn Sie in den nächsten Stunden Schmerzen bekommen sollten, drücken Sie nur auf diesen Knopf hier, und die Schwester erhöht dann die Morphiumdosis in der Infusion.«
»Ich dachte, das dürfte der Patient selber machen.«
Er war einen Moment platt, das sah sie deutlich. Dann sagte er: »Tut mir Leid, aber das dürfen wir Ihnen keinesfalls erlauben«.
»Wieso nicht?«, fragte sie leise.
»Weil hier möglicherweise ein Selbstmordversuch vorliegt. Wir können nicht riskieren, dass Sie sich mit einer tödlichen Dosis Morphium vollpumpen und wir Sie nicht wiederbeleben können.«
Sie wandte den Blick von ihm ab und den Fenstern zu, wo die Sonne so hell hereinschien.
»Alles, woran ich mich erinnere, ist gestern Abend. Welcher Tag ist heute? Welche Tageszeit?«
»Es ist Donnerstag, später Vormittag. Sie sind dazwischen immer mal wieder zu Bewusstsein gekommen. Ihr Unfall passierte gestern Abend.«
»Eine ganz schöne Zeitlücke.«
»Das wird schon wieder, Mrs. Frasier.«
»Da bin ich mir keineswegs sicher«, sagte sie langsam und schloss dann die Augen.
Dr. Russell Rossetti blieb einen Moment in der Tür stehen und blickte zu der jungen Frau hinüber, die so still auf dem schmalen Krankenbett lag. Sie sah aus wie eine Prinzessin, die den falschen Frosch geküsst hatte und das nun übel büßen musste. Ihr blondes Haar war blutverklebt und schaute strähnig unter dem Verband hervor. Sie war dünn, zu dünn, und er fragte sich, was sie wohl dachte, jetzt, in diesem Moment.
Dr. Ted Larch, der Arzt, der ihre Milz entfernt hatte, meinte, sie könne sich an den Unfall nicht mehr erinnern. Er meinte außerdem, er glaube nicht, dass es ein Selbstmordversuch gewesen sei. Dafür sei sie einfach viel zu »präsent«, wie er sich ausdrückte. Der Dummkopf.
Ted war eine romantische Seele, etwas Seltenes bei einem Chirurgen. Natürlich hatte sie versucht, sich umzubringen. Keine Frage. Ein geradezu klassischer Fall.
»Mrs. Frasier.«
Lily wandte den Kopf beim Klang dieser eher hohen Stimme, einer Stimme, die ohne Zweifel weinerlich werden konnte, wenn sie nicht ihren Willen bekam, und die im Moment versuchte, beruhigend und tröstlich zu klingen, einladend, doch ohne Erfolg.
Sie sagte nichts, blickte nur den übergewichtigen Mann an, der den Raum betrat – groß, gut gekleidet, dunkler grauer Anzug, dicke lockige schwarze Haare, Doppelkinn und dicke weiße Wurstfinger. Er trat zu ihr, stellte sich dicht an ihr Bett. Zu dicht.
»Wer sind Sie?«
»Ich bin Dr. Rossetti. Dr. Larch hat Ihnen doch gesagt, dass ich nach Ihnen sehen würde, nicht?«
»Sie sind der Psychiater?«
»Ja, der bin ich.«
»Er hat’s mir gesagt, aber ich will nicht mit Ihnen reden. Es ist unnötig.«
Negierung, na herrlich, dachte er. Er war sie leid, all die Depressiven, die zu ihm kamen und heulten und jammerten, die sich selbst bemitleideten und um Tabletten bettelten, damit sie sich betäuben konnten. Tennyson hatte ihm zwar gesagt, dass Lily nicht so war, doch er glaubte das nicht.
Die Ruhe selbst, sagte er: »Offenbar brauchen Sie mich doch. Sie haben Ihren Wagen gegen einen Redwood gefahren.«
Hatte sie? Nein, das passte irgendwie nicht zu ihr. Sie sagte: »Die Straße nach Ferndale ist sehr gefährlich. Sind Sie die Strecke je gefahren, im Dunkeln, meine ich?«
»Ja.«
»Und fanden Sie nicht, dass man sehr vorsichtig sein muss?«
»Sicher. Aber ich bin nie gegen einen Mammutbaum gefahren. Das Forstamt sieht sich den Baum momentan an, um festzustellen, wie schwer er beschädigt ist.«
»Nun, wenn mir ein paar Splitter fehlen, dann dem Baum sicherlich auch. Ich möchte, dass Sie jetzt gehen, Dr. Rossetti.«
Doch anstatt zu gehen, zog er sich einen Stuhl heran und setzte sich zu ihr ans Bett. Er schlug die fetten Schenkel übereinander, verschränkte die dicken weißen Finger. Sie konnte seine Hände nicht ausstehen, weiche, schwammige Hände, aber sie konnte auch nicht den Blick davon abwenden.
»Es dauert nicht lange, Mrs. Frasier. Oder darf ich Sie Lily nennen?«
»Nein. Ich kenne Sie nicht. Gehen Sie.«
Er beugte sich vor und versuchte ihre Hand zu ergreifen, doch sie zog sie weg und schob sie unter die Decke.
»Wir sollten wirklich zusammenarbeiten, Lily ...«
»Mein Name ist Mrs. Frasier.«
Rossetti runzelte die Stirn. Gewöhnlich mochten es Frauen – alle Frauen –, beim Vornamen genannt zu werden. Dann hatten sie das Gefühl, dass er mehr ein Freund war, jemand, dem sie vertrauen konnten. Und sie wurden dadurch verwundbarer, angreifbarer für ihn.
Er sagte: »Sie haben schon mal versucht, sich umzubringen, vor sieben Monaten, nach dem Tod Ihres Kindes.«
»Sie ist nicht einfach gestorben. Sie ist von einem Auto angefahren und fast zehn Meter weit in einen Straßengraben geschleudert worden. Sie wurde umgebracht.«
»Und Sie geben sich die Schuld.«
»Haben Sie Kinder?«
»Ja.«
»Würden Sie sich die Schuld geben, wenn Ihr Kind stirbt und Sie nicht bei ihm waren?«
»Nein, nicht wenn ich nicht in dem Auto saß, das es anfuhr.«
»Und Ihre Frau? Würde sie sich die Schuld geben?«
Elaines Gesicht tauchte vor seinem inneren Auge auf, und er runzelte die Stirn. »Wahrscheinlich nicht. Sie würde bloß weinen. Sie ist eine sehr schwache Frau, sehr abhängig. Aber darum geht’s nicht, Mrs. Frasier.« Nein, wirklich nicht. Er würde Elaine zum Glück bald los sein.
»Worum geht es denn?«
»Sie gaben sich die Schuld, so sehr, dass Sie ein ganzes Röhrchen Schlaftabletten genommen haben. Sie wären gestorben, wenn Ihre Haushälterin Sie nicht rechtzeitig gefunden hätte.«
»So hab ich es auch gehört«, sagte sie und hätte in diesem Moment schwören können, dass sie denselben Geschmack im Mund hatte wie damals, als sie im Krankenhaus erwacht war, vollkommen desorientiert, vollkommen verwirrt und so schwach, dass sie nicht mal ihre Hand hatte heben können.
»Sie erinnern sich nicht, die Tabletten genommen zu haben?«
»Nein.«
»Und jetzt erinnern Sie sich nicht mehr daran, mit dem Wagen gegen den Mammutbaum gefahren zu sein. Der Sheriff schätzt, dass Sie mindestens sechzig Meilen draufhatten, vielleicht sogar mehr. Sie hatten großes Glück, Mrs. Frasier. Ein Mann fuhr gerade um die Ecke und hat gesehen, wie Sie gegen den Baum rasten. Er hat sofort den Notarzt gerufen.«
»Wissen Sie, wer das war? Ich würde mich gerne bei dem Mann bedanken.«
»Das ist jetzt nicht wichtig, Mrs. Frasier.«
»Was ist dann wichtig? Ach ja, haben Sie vielleicht einen Vornamen?«
»Ich heiße Russell. Dr. Russell Rossetti.«
»Nette Alliteration, Russell.«
»Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich Dr. Rossetti nennen würden«, sagte er steif. Seine Wurstfinger zuckten, und da wusste sie, dass sie ihn verärgert hatte. Er fand, dass sie zu weit gegangen war. Das war sie vielleicht auch, aber es kümmerte sie nicht die Bohne. Sie war so müde, so hundemüde, wollte einfach nur die Augen schließen und das Morphium noch ein Weilchen länger wirken lassen.
»Gehen Sie, Dr. Rossetti.«
Er rührte sich eine ganze Zeit lang nicht.
Lily wandte den Kopf ab und suchte Zuflucht im Vergessen. Sie hörte nicht einmal, wie er ging.
Als fünf Minuten später Dr. Larch hereinspazierte, die kahle Birne rosa angelaufen, gelang es ihr, ein Auge aufzumachen und zu sagen: »Dr. Rossetti ist ein eingebildeter Idiot. Er hat Wurstfinger. Bitte, ich will ihn nicht noch mal sehen.«
»Er ist der Meinung, dass Sie in ziemlich schlechter Verfassung sind.«
»Im Gegenteil, ich bin in blendender Verfassung. Was man von ihm nicht behaupten kann. Er sollte dringend mal ein Fitnessstudio aufsuchen.«
Dr. Larch lachte. »Er meinte außerdem, Ihre Abwehrhaltung und Unhöflichkeit ihm gegenüber seien sichere Zeichen dafür, dass Sie total überreizt sind und dringendst seine Hilfe benötigen.«
»Soll das ein Witz sein? Ich bin so überreizt – von all den Schmerzmitteln –, dass ich jeden Moment einschlafen könnte.«
»Ah, Ihr Mann ist da.«
Sie wollte Tennyson nicht sehen. Seine Stimme, so volltönend, so selbstbewusst – sie klang viel zu sehr nach Dr. Rossetti, als hätten die beiden denselben Stimmbildungskurs auf der Seelenklempneruni belegt gehabt. Sie wäre glücklich, keinen von beiden je mehr zu Gesicht zu bekommen.
Sie blickte an Dr. Larch vorbei und sah ihren Mann, den Mann, mit dem sie seit elf Monaten verheiratet war, mit bleichem Gesicht, die dichten Brauen zusammengezogen, die Arme vor der Brust verschränkt, in der Tür stehen. So ein gut aussehender Mann, so groß und muskulös, welliges, dickes Haar, nicht kahlköpfig wie Dr. Larch. Er trug eine Pilotenbrille, was richtig cool wirkte, und jetzt sah sie, wie er sie nach oben schob, eine liebenswerte Angewohnheit – zumindest hatte sie das geglaubt, als sie ihm das erste Mal begegnete.
»Lily?«
»Ja«, sagte sie und wünschte, er würde in der Tür stehen bleiben. Dr. Larch richtete sich auf und wandte sich ihm zu. »Dr. Frasier, wie gesagt, Ihre Frau kommt wieder ganz in Ordnung, sobald sie sich von der Operation erholt hat. Aber sie braucht noch viel Ruhe. Ich würde deshalb vorschlagen, dass Sie Ihren Besuch kurz halten.«
»Ich bin furchtbar müde, Tennyson«, sagte sie und hasste das Zittern in ihrer Stimme. »Könnten wir uns vielleicht ein andermal unterhalten?«
»O nein«, sagte er. Und dann wartete er, schweigend, bis Dr. Larch, der nervös an seinem Stethoskop herumnestelte, den Raum verlassen hatte. Wieso war er nervös? Lily konnte sich keinen Reim darauf machen. Tennyson machte die Tür zu, blieb kurz stehen, musterte sie und kam dann schließlich zu ihr ans Bett. Sanft holte er ihre Hand unter der Decke hervor, was ihr gar nicht gefiel. Nachdem er ihre Handfläche ein paar Augenblicke lang gestreichelt hatte, sagte er leise: »Warum, Lily? Warum hast du das getan?«
Lächerlich. »Ich weiß nicht, ob ich überhaupt etwas getan habe, Tennyson, denn, weißt du, ich erinnere mich überhaupt nicht mehr an den Unfall.«
Er wischte ihre Worte mit einer Handbewegung beiseite. Er hatte starke Hände, selbstbewusste Hände. »Ich weiß, und das tut mir leid. Schau, Lily, vielleicht war es ja wirklich ein Unfall, vielleicht bist du ja irgendwie ins Schleudern geraten und mit dem Wagen gegen den Baum gerast. Eine Schwester hat mir erzählt, dass das Forstamt ein paar Leute hingeschickt hat, um festzustellen, wie stark die Schäden an dem Baum sind.«
»Dr. Rossetti hat es mir schon erzählt. Armer Baum.«
»Das ist nicht lustig, Lily. Also, du wirst noch zwei, drei Tage hier bleiben müssen, bis die Ärzte sicher sind, dass du wieder in Ordnung kommst. Ich möchte, dass du mit Dr. Rossetti sprichst. Er ist ein neuer Mann mit einer ausgezeichneten Reputation.«
»Ich hab ihn schon getroffen. Ich will ihn nicht noch mal sehen, Tennyson.«
Seine Stimme veränderte sich, wurde noch leiser, noch sanfter, und sie wusste, dass sie normalerweise zu weinen angefangen hätte, zusammengebrochen wäre, sich von ihm hätte trösten, beruhigen, versichern lassen, dass der schwarze Mann weg war und nicht wiederkommen würde. Aber nicht diesmal. Nicht jetzt. Vielleicht lag’s ja am Morphium, dass sie sich beinahe euphorisch fühlte, irgendwie leicht und losgelöst. Aber auch stark, auf eine arrogante Weise stark, und das musste ja eine Wahnvorstellung sein.
»Da du ja selbst sagst, dass du dich an nichts mehr erinnern kannst, Lily, kann es doch bestimmt nicht schaden, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, nicht? Ich möchte wirklich, dass du dir von ihm helfen lässt.«
»Ich mag ihn nicht, Tennyson. Wie soll ich mir von jemandem helfen lassen, den ich nicht mag?«
»Du wirst dir von ihm helfen lassen, Lily, oder ich fürchte, wir müssen eine Einweisung in Betracht ziehen.«
»Ach ja? Wir müssen eine Einweisung in Betracht ziehen? Eine Einweisung wohin? In die Klapsmühle?« Wieso fürchtete sie sich nicht vor diesem Wort, das alle möglichen Konnotationen hervorrief? Aber sie hatte keine Angst. Ihre Augen, mit denen sie ihn anblickte, strahlten geradezu. Dieses Morphiumzeug war schweinegut. Sie merkte, wie ihre Müdigkeit zunahm, der Nebel in ihrem Hirn wieder dicker wurde, sie zu verschlingen drohte, ihre Konzentration zerfaserte, aber noch nicht gleich. Nein, in diesem Augenblick, vielleicht auch noch im nächsten, wurde sie mit allem fertig.
Er drückte ihre Hand. »Ich bin Psychiater, Lily, ein Doktor wie Russell Rossetti. Du weißt, dass es unethisch wäre, wenn ich dich selbst behandeln würde.«
»Das Elavil hast du mir aber verschrieben.«
»Ein weit verbreitetes Antidepressivum, das ist was anderes. Nein, ich könnte dir nicht so helfen, wie Dr. Rossetti es kann. Aber du sollst wissen, dass ich nur das Beste für dich will. Ich liebe dich, und ich habe gebetet, dass es wieder aufwärts geht mit dir. Immer ein Tag nach dem anderen, habe ich mir gesagt. Und es gab Tage, da wusste ich, dass du auf dem Weg der Besserung bist, aber ich habe mich geirrt. Ja, du musst dich mit Dr. Rossetti treffen, oder ich fürchte, ich habe keine Wahl, als dich zu einer Beurteilung einweisen zu lassen.«
»Entschuldige, dass ich dich darauf hinweise, Tennyson, aber ich glaube nicht, dass das in deiner Macht steht. Ich bin hier – ich kann sehen, ich kann reden, und ich kann denken. Was mit mir geschieht, das entscheide ich.«
»Das wird sich zeigen. Lily, bitte sprich mit Dr. Rossetti. Sprich mit ihm über deinen Kummer, deine Schuldgefühle, die Tatsache, dass du zu akzeptieren beginnst, was dein Ehrgeiz angerichtet hat.«
Ihr Ehrgeiz? Sie war so ehrgeizig, dass es ihre Tochter das Leben gekostet hatte?
Auf einmal wollte sie es ganz genau wissen. »Was bitte meinst du damit, Tennyson?«
»Du weißt schon – Beths Tod.«
Das war wie ein Faustschlag ins Gesicht. Schuldgefühle überrollten sie wie eine Flutwelle. Nein, Moment mal, das wollte sie nicht zulassen. Nicht jetzt. Nicht schon wieder. Unter dem Morphium und allem anderen war sie immer noch da, war immer noch sie selbst, wollte gesund werden, wieder ganz werden, wollte wieder Cartoons über den Aalglatten Remus zeichnen, wie er mal wieder einen Politikerkollegen aufs Kreuz legte, wollte ... War das der übergroße Ehrgeiz, der ihre Tochter umgebracht hatte? »Ich kann mich jetzt nicht damit befassen, Tennyson. Bitte geh. Morgen geht’s mir bestimmt besser.«
Oder eher nicht; nein, morgen würde es ihr miserabel gehen, denn morgen wollte man die Schmerzmittel herabsetzen, aber darüber wollte sie sich jetzt keine Gedanken machen. Jetzt wollte sie nur schlafen, sich regenerieren, Körper und Seele wieder zu Kräften kommen lassen. Sie wandte sich von ihm ab, hatte keine Worte mehr, konnten nicht mehr reden, nicht mehr klar denken. Sie fiel, fiel ganz sanft, so sanft, in den Bauch des Wals, den weichen, warmen, tröstlichen Bauch. Rück ein Stück, Jonas. Sie würde keine Alpträume haben, das Morphium würde sie davor bewahren.
Sie starrte die Infusionsnadel in ihrem Arm an, ließ den Blick am Schlauch entlang nach oben wandern bis zu dem Beutel mit der Flüssigkeit. Er verschwamm vor ihren Augen, langsam fielen ihr die Lider zu, und sie hörte noch, wie Tennyson sagte: »Ich komme heute Abend noch mal, Lily. Schlaf gut.« Er beugte sich zu ihr herunter und gab ihr einen sanften Kuss auf die Wange. Wie sehr hatte sie doch seine Hände geliebt, seine Berührungen, seine Küsse, aber jetzt nicht mehr. Ihre Gefühle waren tot, abgestorben, schon seit so schrecklich langer Zeit.
Als sie wieder allein war, dachte sie: Was soll ich bloß tun? Aber das wusste sie doch, ja, sie wusste es. Sie versuchte die Lähmung, den Nebel abzuschütteln, kämpfte gegen die betäubende Wirkung des Morphiums an. Sie nahm den Telefonhörer ab und wählte die Nummer ihres Bruders in Washington D.C. Es klickte mehrmals, dann hörte sie Atemgeräusche, aber nichts geschah. Deshalb wählte sie die Neun, dann noch mal dieselbe Nummer. Sie versuchte es abermals, kam aber nicht durch. Und auf einmal war die Leitung tot.
Eine vage Furcht keimte in ihr auf, während sie sich langsam ins Vergessen sinken ließ, eine tief in ihrem Inneren verwurzelte Furcht, die sich nicht recht greifen ließ, und es war keineswegs die Furcht davor, gegen ihren Willen in eine Anstalt eingewiesen zu werden.
3
Lily spürte, wie jemand zart wie ein Schmetterling über ihre Augenbrauen strich. Sie hörte eine Männerstimme, eine Stimme, die sie ihr Leben lang geliebt hatte, tief und leise und herrlich süß, und sie freute sich riesig darüber.
»Lily, ich will, dass du die Augen aufmachst, mich anschaust und mir ein Lächeln schenkst. Geht das, Schätzchen? Komm, mach die Augen auf.«
Sie machte die Augen auf und blickte zu ihrem großen Bruder auf. Und schenkte ihm ein Lächeln. »Mein großer Bruder, der FBI-Cop. Ich bewundere dich, seit du mir beigebracht hast, was ich mit Billy Clapper anstellen soll, wenn er wieder versucht, mir unter den Rock zu greifen. Weißt du noch?«
»O ja, sehr gut sogar. Du warst zwölf, und der kleine Scheißer mal gerade vierzehn, als er dir zwischen die Beine gefasst hat.«
»Na ja, Dillon, er konnte nach dem zweiten Versuch ’ne ganze Zeit lang nicht mehr aufrecht gehen. Hat’s nie wieder versucht.«
Er lächelte, ein wunderschönes Lächeln, strahlend weiße Zähne. »Ich erinnere mich.«
»Ich hätte den Kerlen auch weiterhin in die Eier treten sollen. Dann wäre nichts von alledem hier passiert. Bin ich froh, dass du da bist.«
»Ich bin da, und Sherlock ebenso. Wir haben Sean bei Mutter gelassen. Mann, die hat bis über beide Ohren gegrinst und ein Halleluja gesungen, als wir davonfuhren. Wir haben ihr gesagt, du hättest einen Unfall gehabt, dass es dir aber den Umständen entsprechend gut geht und wir dich einfach nur besuchen wollen. Du kannst sie ja später anrufen und sie selbst beruhigen. Den Rest der Familie übernimmt Mutter dann schon.«
»Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Es stimmt, Dillon, mir geht’s ganz gut. Ich vermisse Sean. Ist so lange her, seit ich ihn zuletzt gesehen habe. Hab mich total gefreut über all die Fotos, die du mir per E-Mail geschickt hast.«
»Ja, aber das ist nicht dasselbe wie der leibhaftige Racker, wenn er auf deinem Daumen rumkaut, dir seine Cracker an den Pulli schmiert und dir den Hals voll sabbert.«
Sherlock ergänzte: »Egal wo du bei uns hinfasst, überall Grahamcrackerbrösel.«
Lily lächelte, denn sie konnte ihn vor sich sehen, diesen süßen kleinen Racker, wie er überall seine feuchten Brösel hinterließ, und der Gedanke ließ ein tiefes Wohlgefühl in ihr aufsteigen. »Mama ist sicher froh, ihn eine Weile haben zu können.«
»Und wie«, bestätigte Savich. »Sie verwöhnt ihn immer nach Strich und Faden. Wenn wir ihn dann wieder heimholen, ist er für die ersten ein, zwei Tage kaum zu genießen.«
»Er ist ein so süßer kleiner Knopf, Dillon. Er fehlt mir.«
Verstohlen wischte Savich eine Träne fort. »Ich weiß, Sherlock und mir auch, und wir sind kaum einen Tag von ihm getrennt. Wie fühlst du dich, Lily?«
»Es ist wieder dunkel.«
»Ja. Fast sieben Uhr, Donnerstagabend. Und jetzt mal heraus damit, Süße. Wie fühlst du dich?«
»Als hätten sie mir das Morphium bereits runtergedreht.«
»Stimmt. Dr. Larch sagte, sie hätten gerade angefangen, die Dosis leicht zu reduzieren. Du wirst ein, zwei Tage höllische Schmerzen haben, aber dann wird’s mit jedem Tag besser werden.«
»Wann seid ihr angekommen?«
»Vorhin erst. Der Pfützenhopser von San Francisco zum Flughafen in Eureka hatte Verspätung.« Er sah, wie ihr Blick ein wenig verschwommen wurde, und fügte hinzu: »Sherlock hat für Sean im Flughafen von San Francisco einen Golden-Gate-Ofenhandschuh gekauft.«
»Ich zeig ihn dir später, Lily«, sagte Sherlock, die auf der anderen Seite von Lilys Bett stand und lächelte. Sie hatte sich solche Sorgen um ihre Schwägerin gemacht. »Ich hatte die Wahl zwischen einem Ofenhandschuh mit Alcatraz drauf oder mit der Golden-Gate-Brücke. Und da Sean ja auf allem rumkaut, dachte Dillon, besser die Golden Gate als ein Bundesgefängnis.«
Lily lachte. Sie wusste nicht, woher das jetzt gekommen war, aber sie konnte sogar wieder lachen. Doch ein scharfer Schmerz durchzuckte sogleich ihre Seite mit den geprellten Rippen, und sie schnappte hörbar nach Luft.
»Okay, keine Witze mehr«, sagte Sherlock und gab ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange. »Wir sind da, und jetzt wird alles wieder gut, das verspreche ich dir.«
»Wer hat euch angerufen?«
»Dein Schwiegervater, gestern Nacht um zwei.«
»Ich frage mich nur, wieso.« Sie überlegte.
»Du hättest das nicht erwartet?«
»Ach, jetzt verstehe ich«, fuhr Lily fort, die Augen zu zornigen Schlitzen verengt. »Er hatte Angst, Mrs. Scruggins würde euch anrufen, und dann würdet ihr euch fragen, warum es keiner aus der Familie für wert befunden hat, euch zu informieren. Ich glaube, er hat Angst vor dir, Dillon. Dauernd fragt er mich, was du so machst und wie’s dir geht. Ich glaube, du hast ihm ganz schön Angst eingejagt, als du das letzte Mal hier warst.«
»Aber wieso das denn?«
»Weil du jede Menge Muskel- und Hirnschmalz hast und außerdem Special Agent beim FBI bist.«
Sherlock lachte. »Viele Leute fürchten sich ein bisschen, wenn sie einen FBI-Beamten vor sich haben. Aber der gute Mr. Elcott Frasier? Hab nur einen Blick auf ihn geworfen und mir gedacht, der verspeist wahrscheinlich schon zum Frühstück Nägel.«
»Wäre möglich, echt. Alle denken das, besonders sein Sohn, mein Mann.«
»Vielleicht hat er ja angerufen, weil er wusste, dass wir herkommen und dich besuchen würden«, sagte Savich. »Vielleicht ist er gar kein solcher Eisenfresser.«
»Doch, das ist er. Tennyson war vorhin schon mal da.« Sie seufzte und zuckte zusammen, als sie den scharfen Stich in den Rippen und das Ziehen in der Seite spürte. »Gott sei Dank ist er bald wieder gegangen.«
Savich warf Sherlock einen Blick zu. »Was ist passiert, Lily? Komm, erzähl’s uns.«
»Alle glauben, ich hätte wieder versucht mich umzubringen.«
»Dann lass sie doch. Ist doch egal. Erzähl, Lily.«
»Ich weiß nicht, Dillon, ehrlich nicht. Ich weiß noch, dass ich auf dieser holprigen Straße nach Ferndale fuhr, die 211, weißt du? Das ist alles. An mehr kann ich mich nicht erinnern.«
Sherlock sagte: »Also gut. Alle glauben, du hättest noch mal versucht dich umzubringen, weil du damals, nach Beths Tod, diese Tabletten genommen hast, ja?«
»Denke schon.«
»Aber wieso?«
»Na ja, ich war wohl nicht ganz aufrichtig euch gegenüber, aber ich wollte nicht, dass ihr euch Sorgen macht. Tatsache ist, dass ich in letzter Zeit starke Depressionen hatte. Erst geht’s mir besser, dann, wumm, wieder nach unten. Wurde in den letzten Wochen immer schlimmer. Und wieso? Ich weiß es nicht, aber so war’s. Und dann ist das gestern Abend passiert.«
Savich zog sich einen Stuhl ans Bett und setzte sich. Er ergriff ihre Hand. »Weißt du, Lily, selbst als du noch ein kleines Mädchen warst, hast du dich an einem Problem immer festgebissen, hast nicht locker gelassen, bis du es gelöst hattest. Vater hat das auch immer gesagt, wenn er dir nicht schnell genug Antwort auf eine Frage gab, die dich wirklich brennend interessierte.«
»Ich vermisse ihn.«
»Ich auch, Lily. Aber ich begreife immer noch nicht ganz, wie du das mit dem ersten Selbstmordversuch machen konntest. Das passte so gar nicht zu der Lily, die ich kenne. Beths Tod allerdings ... das würde jede Mutter, jeden Vater umhauen. Aber jetzt sind sieben Monate vergangen. Du bist klug, du bist begabt, du bist niemand, der den Kopf in den Sand steckt. Diese Depressionen ... ich kapier das nicht ganz. Was war da los, Lily?«
Ernüchtert legte sie die Stirn in Falten. »Nichts war los, es war immer nur dasselbe. Wie gesagt, manchmal in den letzten Monaten, da ging’s mir viel besser, ich hatte das Gefühl, die ganze Welt erobern zu können, doch das verging schnell wieder, und dann wäre ich am liebsten nur den ganzen Tag im Bett liegen geblieben.
Na ja, und gestern wurde es dann besonders schlimm. Tennyson hat aus Chicago angerufen und gesagt, ich solle zwei von den Tabletten nehmen. Und das hab ich. Also, eins kann ich dir sagen, viel helfen die nicht. Und dann, auf dieser kurvenreichen Straße nach Ferndale – na ja, vielleicht ist da ja wirklich was passiert. Vielleicht bin ich ja gegen diesen Redwood gebumst. Ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht.«
»Ist schon gut. Und, wie fühlt sich dein Kopf jetzt an?«, fragte Sherlock, die auf der Bettkante saß und nun ein bisschen näher zu Lily hinrutschte.
»Nicht mehr ganz so benebelt wie zuvor. Na ja, jetzt wo nicht mehr so viel Morphium in mir rumschwappt, komme ich wohl wieder zu mir.«
»Und, bist du deprimiert?«
»Nö. Ich bin sauer, hauptsächlich wegen dieses blöden Psychiaters, den sie mir auf den Hals gehetzt haben. Ein schrecklicher Typ, spielt den ach so Verständnisvollen und ist in Wahrheit ein arrogantes Arschloch.«
»Bist ihm wohl frech gekommen, was, Babe?«
»Kann sein. Ein bisschen.«
»Freut mich«, sagte Sherlock. »Warst in letzter Zeit sowieso viel zu brav, finde ich.«
»O nein.«
»Was?«
Aber Lily sagte nichts weiter, blickte nur an den beiden vorbei zur Tür.
Savich und Sherlock drehten sich um und sahen ihren Schwager, Tennyson Frasier, hereinkommen.
Savich dachte: Lily will ihren Mann nicht sehen.
Was ging da vor? Vor sieben Monaten, ein paar Wochen nach Beths Beerdigung, war Lily heim nach Maryland gekommen, um eine Weile bei ihrer Mutter zu bleiben. Savich hatte in dieser Zeit Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, hatte jeden Stein umgedreht, alles versucht, um rauszukriegen, wer Beth überfahren und dann Fahrerflucht begangen hatte. Ohne Ergebnis. Nichts. Und dann war Lily wieder nach Hemlock Bay zurückgekehrt, zu ihrem Mann, der sie liebte und brauchte und – ja, es ging ihr wieder besser.
Es war ein Fehler gewesen, sie dorthin zurückgehen zu lassen, dachte Savich, und den würde er kein zweites Mal machen. Diesmal würde er sie nicht im Stich lassen.
Savich richtete sich auf, als Tennyson mit ausgestreckter Hand auf ihn zukam. Während er Savich eifrig die Hand schüttelte, sagte er: »Junge, Junge, ich bin vielleicht froh, euch zu sehen. Vater hat gesagt, dass er euch mitten in der Nacht angerufen hat.« Dann hielt er inne und schaute Lily an.
Sherlock rührte sich nicht von der Bettkante, sondern sagte lediglich: »Schön, dich zu sehen, Tennyson.« So ein gut aussehender Mann, so groß und stark, und im Moment sah er aus, als würde er sich die größten Sorgen um seine Frau machen. Warum wollte Lily ihn nicht sehen?
»Lily, geht’s dir gut?« Tennyson trat mit ausgestreckter Hand ans Bett.
Lily schob ihre Hand unter die Decke und sagte: »Mir geht’s gut, Tennyson. Weißt du, dass ich zuvor versucht habe, Dillon und Sherlock anzurufen? Und meine Leitung war tot. Geht das Telefon jetzt wieder?«
Sherlock nahm den Hörer ab. Das Freizeichen ertönte. »Jetzt geht’s wieder.«
»Ist das nicht seltsam?«
»Vielleicht«, sagte Tennyson und beugte sich vor, um Lilys bleiches Gesicht zu streicheln, ihr einen zarten Kuss zu geben. »Mit dem ganzen Morphium hast du’s vielleicht nicht richtig gemacht.«
»Zuerst ertönte ein Freizeichen, dann hörte ich Atemgeräusche und es klickte ein paar Mal, danach war die Leitung tot.«
»Hm. Ich werde mich mal erkundigen, aber jetzt geht’s ja wieder, also was soll’s.« Er wandte sich wieder an Savich. »Du und Sherlock, ihr seid aber schnell hergekommen.«
»Sie ist meine Schwester«, erwiderte Savich und nahm seinen Schwager schärfer ins Visier. »Was hast du erwartet?« Er hatte Tennyson immer gemocht, hatte ihn für einen anständigen, vertrauenswürdigen Kerl gehalten, ganz anders als Jack Crane, Lilys erster Mann. Er hatte geglaubt, dass Tennyson genauso erschüttert über Beths Tod gewesen war wie Lily. Tennyson hatte ihm bei der Suche nach dem Unfalltäter nach Kräften geholfen. Der Sheriff dagegen war vollkommen nutzlos gewesen. Was stimmte da nicht? Wieso wollte Lily ihn nicht sehen?
Tennyson nickte nur, dann gab er Lily noch einen Kuss. Mit seidenweicher Stimme sagte er: »Ich kann es kaum erwarten, dich wieder zu Hause zu haben. Bei mir bist du in Sicherheit, Lily, immer.«
Aber sie war nicht in Sicherheit gewesen, dachte Sherlock. Darum ging es doch im Grunde. Sie war mit ihrem Wagen gegen einen Baum gerast. Sicher konnte man das beim besten Willen nicht nennen. Was stimmte nicht mit diesem Bild?
»Was ist mit diesem Psychiater, Tennyson?«
»Dr. Rossetti? Ich wünschte wirklich, du würdest dir von ihm helfen lassen, Lily. Er ist der beste Mann dafür.«
»Du hast gedroht, mich einweisen zu lassen, falls ich mich weigere.«
Savich fiel fast vom Stuhl.
Sherlock lachte. »Lily in eine Anstalt einweisen lassen? Also wirklich, Tennyson.«