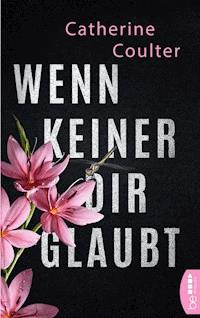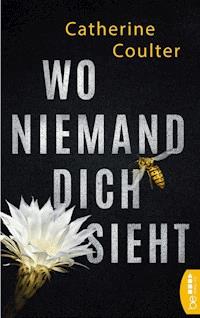
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein FBI Thriller mit Dillon Savich und Lacey Sherlock
- Sprache: Deutsch
Eine idyllische Kleinstadt wird zur tödlichen Falle ...
Als er durch einen Bombenanschlag verletzt wird, hat FBI-Agent Ford MacDougal einen merkwürdigen Traum: Seine Schwester fährt über den Rand einer Klippe und stürzt ins Meer. Sein Albtraum wird wahr, denn am nächsten Morgen erreicht ihn die schreckliche Nachricht: Seine Schwester liegt im Koma. Aber er kann nicht glauben, dass Jilly versucht hat, sich das Leben zu nehmen, und macht sich auf den Weg zu ihr nach Oregon. In der kleinen Küstenstadt lernt er die attraktive Bibliothekarin Laura kennen. Doch sie hat ein düsteres Geheimnis ...
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
Edgerton, Oregon
1
Marinehospital, Bethesda Maryland
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Epilog
Washington, D.C., drei Monate später
Über dieses Buch
Eine idyllische Kleinstadt wird zur tödlichen Falle ...
Als er durch einen Bombenanschlag verletzt wird, hat FBI-Agent Ford MacDougal einen merkwürdigen Traum: Seine Schwester fährt über den Rand einer Klippe und stürzt ins Meer. Sein Albtraum wird wahr, denn am nächsten Morgen erreicht ihn die schreckliche Nachricht: Seine Schwester liegt im Koma. Aber er kann nicht glauben, dass Jilly versucht hat, sich das Leben zu nehmen, und macht sich auf den Weg zu ihr nach Oregon. In der kleinen Küstenstadt lernt er die attraktive Bibliothekarin Laura kennen. Doch sie hat ein düsteres Geheimnis ...
Über die Autorin
Catherine Coulter wuchs auf einer Ranch in Texas auf und schrieb nach ihrem Uniabschluss Reden an der Wall Street, bevor sie sich voll und ganz dem Schreiben widmete. Inzwischen hat sie mehr als 70 Romane veröffentlicht – darunter viele Regency Romances, aber auch einige Thriller. Ihre Bücher stürmen regelmäßig die Bestsellerlisten der New York Times. Catherine Coulter lebt mit ihrem Ehemann und drei Katzen in Nordkalifornien.
Catherine Coulter
Wo niemand dich sieht
Aus dem Amerikanischen von Gertrud Wittich
beTHRILLED
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1999 by Catherine Coulter
Titel der amerikanischen Originalausgabe: The Edge
Originalverlag: G. P. Putnam’s Sons, a member of Penguin Putnam Inc., New York
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2002 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Übersetzung: Gertrud Wittich
Lektorat/Projektmanagement: Anne Pias
Covergestaltung: © www.buerosued.de
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-4491-2
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Curry Eckelhoff,
die mir eine wundervolle, überaus kompetente Freundin ist, mit einem tollen Sinn für Humor, immer großzügig – und außerdem eine Blondine.
Dieses Buch sei all jenen gewidmet, die, wie wir, unbeirrbar im Elfenbeinturm ausharren.
– C.C.
Prolog
Edgerton, Oregon
Es war eine pechfinstere Nacht. Bis auf das leise Schnurren des neu getunten Porschemotors war es vollkommen still. Dennoch hörte sie wieder die leise, schluchzende, flehende Frauenstimme. Sie verfolgte sie jetzt ständig. Nie ließ sie ihr Ruhe.
Niemand sonst war in der Nähe, nur Jilly, die allein über die gewundene Küstenstraße brauste. Weiter unten rauschte das Meer. In der mondlosen Dunkelheit sah es aus wie eine riesige schwarze Fläche. Der Porsche, der auf die kleinste Bewegung reagierte, schwang ein wenig nach links auf die Klippen zu und auf die jenseits davon sich erstreckende, endlose schwarze Fläche. Jilly riss das Lenkrad herum und der Wagen schlingerte zur Fahrbahnmitte zurück.
Die Stimme in ihrem Kopf, Lauras Stimme, begann zu schluchzen, immer lauter, bis ihr der Kopf zu platzen drohte.
»Aufhören!« Jillys Schrei zerriss einen Moment lang die Stille der Nacht. Ihre Stimme klang hässlich und gemein, überhaupt nicht wie Lauras. Lauras Stimme war kindlich, die Stimme eines verlorenen, untröstlichen Kindes. Nur der Tod brächte Ruhe. Jilly spürte, wie die Stimme erneut in ihr anschwoll. Sie packte das Lenkrad fester und starrte geradeaus, betete, flehte innerlich, die Stimme möge schweigen, Laura möge verschwinden.
»Bitte«, flüsterte sie. »Aufhören, bitte. Lass mich in Ruhe. Bitte.«
Aber Laura hörte nicht auf. Die verzweifelte Kinderstimme war verschwunden. Jetzt war Laura wieder sie selber, wütend, voller Hass. Widerliche Worte troffen aus ihrem Mund, spien Hass und Speichel auf Jilly, die den Geschmack tief in ihrer Kehle schmeckte. Sie hämmerte mit den Fäusten aufs Lenkrad, immer fester, rhythmisch, um die bösartige Stimme in ihrem Kopf zu vertreiben. Sie ließ das Seitenfenster herunter, ganz herunter, sodass sie den Kopf hinauslehnen konnte und der Fahrtwind ihr die Haare zerzauste, in ihren Augen brannte, dass sie tränten. Laut kreischte sie in die Nacht hinaus: »Aufhören!«
Und es hörte auf. Schlagartig.
Jilly holte tief Luft und zog den Kopf wieder ins Auto. Der Wind peitschte ins Wageninnere, und sie schnappte nach Luft wie eine Ertrinkende. Herrliche, eiskalte, belebende Luft. Einfach wundervoll. Es war vorbei. Gott sei Dank, es war endlich vorbei. Sie blickte sich um. Wo war sie überhaupt? Seit Stunden schon, so schien es ihr, fuhr sie nun ziellos herum, doch die Digitaluhr in ihrem Auto zeigte lediglich Mitternacht an. Sie war erst vor einer halben Stunde von zu Hause aufgebrochen.
Ständig, andauernd hörte sie dieses Flüstern und Wispern, dieses Geschrei, bis sie glaubte, es nicht mehr ertragen zu können. Doch jetzt herrschte Stille, vollkommene Stille. Gesegnete Stille.
Jilly begann zu zählen. Eins, zwei, drei – keine Hasstiraden, kein Flüstern, keine flehende Kinderstimme, nichts, nur das Geräusch ihres Atems und das sanfte Schnurren des Autos. Sie warf den Kopf in den Nacken, schloss einen Moment lang die Augen und genoss die herrliche Stille. Dann begann sie wieder zu zählen. Vier, fünf, sechs – gesegnete Stille.
Sieben, acht – ein hauchzartes, unendlich fernes Rascheln, wie von Blättern, das langsam näher kam. Nein, kein Rascheln, ein Flüstern. Laura flüsterte schon wieder, flehte sie an, sie am Leben zu lassen, bat und bettelte, schwor, es wäre nie ihre Absicht gewesen, mit ihm zu schlafen, es sei einfach passiert und es sei seine Schuld. Aber Jilly glaubte ihr nicht.
»Aufhören, bitte aufhören, bitte«, flehte Jilly wie ein Mantra, um die Flüsterstimme in ihrem Kopf zu übertönen. Da begann Laura zu keifen, Jilly wäre ein erbärmliches Miststück, eine Närrin, die nicht sehen könne, was sie in Wirklichkeit war. Jilly trat hart aufs Gaspedal. Der Porsche machte einen Satz, schnellte auf siebzig Meilen pro Stunde, auf achtzig, auf fünfundachtzig. Die Küstenstraße schien zu schlingern. Sie hielt den Wagen direkt auf dem Mittelstreifen. Sie fing an zu singen. Laura schrie immer lauter und Jilly sang immer lauter. Neunzig. Fünfundneunzig.
»Verschwinde. Verdammt noch mal, verschwinde!« Jilly umklammerte das Steuer so fest, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. Ihr Kopf war vorgesunken, berührte fast das Lenkrad. Das Vibrieren des Motors verlieh Lauras schriller Stimme eine unheimliche Macht.
Einhundert.
Jilly sah die scharfe Kurve, aber Laura kreischte gerade, dass sie bald vereint sein würden, sehr bald. Sie könne es nicht abwarten, Jilly in die Finger zu kriegen. Dann würden sie schon sehen, wer gewänne.
Jilly schrie, vielleicht um Laura zu übertönen, vielleicht aber auch wegen des schroffen Klippenrands, der fast fünfzehn Meter tief steil zum Meer und den spitzen, düsteren Felsen hin abfiel. Der Porsche durchbrach die Leitplanke aus Holz und Stahl, gewann noch an Geschwindigkeit und schoss in die weite, schwarze Leere hinaus.
Ein weiterer Schrei zerriss die trügerische Ruhe, bevor der Porsche mit der Motorhaube voran im bleischwarzen Wasser versank. Es gab kaum ein Geräusch, nur das Pfeifen des Fahrtwinds beim Hinausschießen des Autos, dann ein lautes, klares Aufklatschen und ein kurzes Gurgeln, während sich das Meer über seinem Opfer schloss, um wieder so bewegungslos dazuliegen wie Sekunden zuvor.
Dann gab es nur noch die pechfinstere Nacht. Und Stille.
1
Marinehospital, Bethesda Maryland
Ich fuhr panisch im Bett hoch, griff mir an den Hals, krümmte mich vor Schmerzen. Ein Mann brüllte etwas, direkt neben mir, fast in mein Ohr. Ich bekam keine Luft mehr, drohte zu ersticken. Und ein Typ, der überhaupt nicht da war, schrie mich an. Ich war kurz vor dem Exitus. Endlich gelang es mir, wieder Luft zu kriegen. Ich schnappte danach wie ein Fisch auf dem Trockenen.
Ein riesiger Schwall eiskalten Wassers hatte mich verschlungen, wie Jonas vom Wal verschluckt worden war. Aber ich war nicht ertrunken. Ich wusste, wie das war zu ertrinken, wusste es so genau, als wäre es erst gestern passiert. Ich war sieben Jahre alt, war mit meinem älteren Bruder Kevin beim Baden gewesen. Kevin hatte mit ein paar Mädchen herumgealbert. Ich war währenddessen mit den Füßen in irgendwelche Unterwasserpflanzen geraten und hängen geblieben. Jilly hatte mich am Ende herausgezogen, meine Schwester Jilly. Hatte mir kräftig auf den Rücken geklopft, während ich würgte und nach Luft rang, bis schließlich das ganze Wasser in einem Schwall wieder herauskam.
Aber dieser Traum hier war anders. Es kam mir so vor, als hätte mich das Wasser verschlungen, nur für eine Sekunde, und dann war nichts mehr gewesen, einfach nichts mehr. Nur Stille, keine Schmerzen, keine Fragen, keine Furcht, einfach ein vollkommenes Nichts.
Ich schwang meine Beine aus dem Bett und stampfte hart auf den alten, schäbigen Linoleumboden. Heftige Schmerzen durchzuckten meine Schultern, meine Rippen, mein Schlüsselbein, liefen hinunter in mein rechtes Bein und in andere Körperteile, die sich mittlerweile wieder so weit erholt hatten, dass ich sie von meiner »Hitliste« von Verletzungen hatte streichen können. Die scharfen, köstlichen Schmerzen klärten schlagartig meinen benebelten Verstand, rissen mich ins Hier und Jetzt zurück, in mein Zimmer in meinem Lieblingskrankenhaus. Der schreckliche Albtraum, die Panik zu ertrinken, dann das Nichts, das alles war in eine etwas sicherere Distanz zurückgewichen.
Trotzdem, als ich so heftig mit den Füßen auftrat, haute mich das beinahe um, und nur mein schnelles Reaktionsvermögen – ein rascher Griff ans stählerne Kopfteil des Bettes – rettete mich davor, flach auf die Nase zu fallen. Ich holte erst mal tief Luft und blickte mich dann um. Ich stand noch mit beiden Beinen auf dem grauen Linoleumboden, der mir in den letzten zwei Wochen ebenso verhasst geworden war wie die kakigrünen Wände. Typisch Armeekrankenhaus. Aber Abscheu empfindet nur der, der noch am Leben ist, also war ich im Grunde froh, denn schließlich waren diese Gefühle ein Beweis dafür, dass ich den Löffel noch nicht abgegeben hatte.
Alle sagten, ich hätte unwahrscheinliches Glück gehabt. Die Bombe hatte mir nicht den Kopf oder sonstige wichtigen Körperteile abgerissen. Ich fühlte mich jedoch, als wäre ich unter einen Laster geraten – hier ein paar Quetschungen, dort ein gebrochener Knochen, weiter unten ein gezerrter Muskel. Meine Füße und mein Rücken waren relativ heil davongekommen, bloß ein paar leichte Blutergüsse entlang der Wirbelsäule. Meine Weichteile waren ebenfalls unbeschädigt, wofür ich dem Schicksal unendlich dankbar war.
Also stand ich erst mal einfach nur da und sog erleichtert die zwar nicht allzu frische, aber reichliche Luft des Krankenzimmers in mich hinein.
Ich warf einen Blick auf mein zerwühltes Bett. Nein, da wollte ich vorerst nicht mehr rein, der Traum stand mir noch viel zu lebhaft im Gedächtnis, viel zu nahe; ich wusste, er würde wiederkommen, wenn ich jetzt erneut einschliefe. Was ich tunlichst vermeiden würde. Ich streckte mich ganz behutsam und vorsichtig. Jede Bewegung tat höllisch weh. Ich holte tief Luft und trat dann ans Fenster. Mein Zimmer lag im neueren Krankenhausflügel, der etwa Mitte der Achtziger dem alten, in den Dreißigerjahren erbauten Gebäude hinzugefügt worden war. Jeder hier beklagte sich darüber, endlos lange Wege zurücklegen zu müssen, wenn man irgendwohin wollte. Ich wünschte, ich könnte auch nur ein kurzes Stück davon zurücklegen und mitmeckern.
Aus dem fünfstöckigen Parkhaus gegenüber drangen vereinzelte Lichter. Das Parkhaus war, ebenso wie ein halbes Dutzend Nebengebäude, durch lange Korridore mit dem Krankenhaus verbunden. Von dort, wo ich stand, sah ich lediglich ein paar vereinzelte Autos drinnen stehen. Überall auf dem gepflegten Grundstück waren Straßenlaternen aufgestellt worden, selbst zwischen den Bäumen. Ein schlechtes Terrain für Straßenräuber und Sittlichkeitsverbrecher, so viel war klar. Dafür war es überall zu hell.
In meinem Traum dagegen war es dunkel gewesen, eine nasse, unheimliche Dunkelheit. Mit langsamen, mühsamen Schritten schleppte ich mich in das kleine Bad, beugte mich vor, hielt die Hände schüsselförmig unters laufende Wasser und trank tief und gierig. Als ich mich wieder aufrichtete, rann mir das Wasser übers Kinn und tropfte mir auf die Brust. Ich hatte geträumt, ich würde ertrinken, aber meine Kehle war ausgedörrt, als wäre ich noch immer in der staubtrockenen, sandigen Luft Tunesiens. Verrückt.
Außer ich war nicht derjenige, der ertrunken war. Ganz plötzlich wusste ich es, wusste es ohne jeden Zweifel. Ich war nicht derjenige, der ertrunken war. Aber ich war dabei gewesen.
Ich blickte mich um, in der Erwartung, jemanden hinter mir stehen zu sehen, jemanden, der mich gerade antippen wollte. Seit über zwei Wochen, seit mich diese Bombe über den Wüstensand gepustet hatte, war ständig irgendjemand an meiner Seite gewesen, hatte beruhigend auf mich eingeredet, hatte mir eine Spritze gegeben, so viele Spritzen, dass mir die Arme schon wehtaten und mein Hintern an einigen Stellen ganz taub war.
Ich trank noch ein wenig mehr, hob dann langsam meinen Kopf, stets darauf bedacht, ja keine schnellen Bewegungen zu machen. Ich starrte den Mann im Spiegel über dem Waschbecken an. Ich sah zum Kotzen aus, grau wie Haferschleim und total eingefallen, fast wie ein Gespenst. Normalerweise glotzte mir ein kerngesunder, ziemlich großer und muskulöser Kerl aus dem Spiegel entgegen, aber dieser Typ da sah ja aus wie ein Handtuch. Wie ein Klappergestell. Eine Ansammlung von Knochen. Ich grinste ihn an. Na, zumindest hatte ich noch alle Zähne, und gerade waren sie obendrein. Ich konnte von Glück reden, dass mir die Beißerchen nicht aus dem Kiefer geklickert waren, als die Bombe explodiert war und mich wie einen leeren Sack fast fünf Meter weit über den Sand geschleudert hatte.
Wenn mich mein Freund Dillon Savich, auch FBI-Agent wie ich, so im Fitnessstudio sah, würde er wahrscheinlich nur den Kopf schütteln und mich fragen, wo zum Teufel ich meinen Sarg geparkt hätte. Es dauerte mindestens noch sechs Monate, bis ich wieder so weit war, auch nur annähernd mit diesem Kraftbolzen im Fitnessraum mitzuhalten.
Ich holte tief Luft, trank noch ein paar Schlucke und knipste dann das Licht im Bad wieder aus. Die Gestalt im Spiegel war jetzt nur noch schemenhaft zu erkennen. Eine eindeutige Verbesserung. Ich drehte mich um, schleppte mich zurück ins Zimmer, wo in einem deutlichen Umriss das Bett auf mich lauerte, daneben die riesige rote Zahl auf der Digitaluhr, die mir Freunde mitgebracht hatten, mit einer dicken roten Schleife drum herum. Ich warf einen Blick auf die Uhr. Sieben Minuten nach drei. Mir fiel wieder ein, was Sherlock, Savichs Frau und ebenfalls FBI-Agentin, gesagt hatte, als ich gerade einen klaren Moment in meinem morphin-induzierten Dämmerzustand hatte. Jede Minute, die diese Uhr verschlang, würde mich ein wenig näher an den Zeitpunkt bringen, an dem ich dieses Scheißkrankenhaus endlich wieder verlassen und zur Arbeit zurückkehren könnte, wo ich gefälligst hingehörte.
Ich schlurfte zum Bett und drapierte meine einzelnen Gliedmaßen vorsichtig in die Waagerechte. Mit der linken Hand zog ich mir das Laken und die dünne Decke über den Körper. Ich versuchte mich zu entspannen, vor allem meine verkrampften Muskeln. Nein, ich hatte nicht die Absicht, wieder einzuschlafen. Ich schloss die Augen und versuchte klar und logisch über den Traum nachzudenken. Ja, ich hatte Wasser gespürt, aber nicht so, als wäre ich wirklich ertrunken, lediglich den Schock des Eintauchens in eiskaltes Wasser. Ich hatte etwas davon geschluckt, aber nicht viel. Und dann war da nur noch dieses Nichts.
Ich kratzte mir die Brust. Na, wenigstens mein Herz hatte sich wieder beruhigt. Erneut atmete ich ein paarmal tief durch. Nur die Ruhe, Junge. Hör auf mit dem Zirkus und denk nach. Kühl überlegen, das war uns auf der Akademie immer wieder eingetrichtert worden. Keine Panik. Ich musste kühl überlegen.
Erst nachdem ein paar Minuten vergangen waren, begann ich mich zu fragen, ob das Ganze eventuell gar kein Traum gewesen war, sondern was ganz anderes. So deutlich, wie ich die Digitaluhr auf meinem Nachtkästchen leuchten sah, sah ich Jillys Gesicht vor mir. Ich hatte Jilly in meinem Traum oder was immer es auch gewesen war, gesehen.
Das gefiel mir gar nicht. Es war hirnrissig, einfach hirnrissig. Ein komischer Traum, in dem ich ertrank und doch nicht ertrank, und aus irgendeinem Grund schoss mir der Gedanke an Jilly durch den Kopf. Ich hatte Jilly zuletzt bei Kevin zu Hause in Chevy Chase, Maryland gesehen. Das war Ende Februar gewesen. Zugegeben, sie war ein bisschen komisch gewesen, man konnte es nicht anders bezeichnen, aber ich hatte nicht allzu sehr darauf geachtet, hatte es eigentlich nur registriert und sofort wieder verdrängt. Zu viel war zu der Zeit in meinem Leben los gewesen, wie zum Beispiel der Einsatz in Tunesien.
Ich konnte mich erinnern, mit Kevin über Jilly geredet zu haben, am Tag, nachdem sie aus Oregon hergeflogen war. Kevin, mein älterer Bruder, hatte aber nur den Kopf geschüttelt. Jetzt, da Jilly an der Westküste lebe, sei sie eben einfach ein bisschen exzentrisch geworden, hatte er gemeint, kein Grund zur Sorge. Das war alles. Kevin war Berufssoldat, hatte vier Jungs und nicht gerade viel Zeit, um über die Schrullen seiner drei Geschwister nachzudenken. Seit acht Jahren gab es nur noch uns vier, seit unsere Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren. Ein Betrunkener war in sie hineingerast.
Ich erinnere mich, dass Jilly über alles Mögliche geredet hatte, fast ohne Punkt und Komma – über ihren neuen Porsche, das neue Kleid, das sie sich bei Langdon’s in Portland gekauft hatte, irgendein Mädchen namens Cal Tarcher, das sie offenbar nicht leiden konnte, und deren Bruder, Cotter, der, laut Jilly, ein übler Schläger und Choleriker war. Ja, sie hatte sogar erwähnt – mehrmals –, wie gut der Sex mit Paul wäre, ihrem Mann, mit dem sie seit acht Jahren verheiratet war. Damals hatte ich nicht viel daran finden können. Doch nun erschien mir das, was sie da von sich gegeben hatte, mehr als nur ein bisschen exzentrisch.
War Jilly in meinem Traum ertrunken?
Nein, daran wollte ich gar nicht denken, aber nun, da sich der tückische Gedanke in mein Hirn geschlichen hatte, ließ er sich nicht mehr so leicht abschütteln. Ich war hundemüde, aber lange nicht so müde wie gestern oder gar die Tage davor. Es ging aufwärts mit mir. Wenn das Ärztegeschwader auftauchte, nickten sie einander meist lächelnd zu, lächelten auch mich an und tätschelten mir die gesunde rechte Schulter. Sie hatten erwähnt, dass ich möglicherweise nächste Woche schon wieder heimkönnte. Ich beschloss, meine Entlassung noch ein gutes Stück vorzuverlegen.
Ich wusste genau, dass ich nicht wieder einschlafen wollte, nicht nachdem dieser Traum auf mich wartete. Ich wusste, dass er wartete, war mir dessen todsicher. Ich wusste, dass er wartete, weil er sich eigentlich nicht wie ein Traum angefühlt hatte, sondern nach etwas anderem. Ich musste damit fertig werden.
Plötzlich wusste ich, was mir fehlte. Ein kühles Bier. Ein kühles Bierchen musste her, und wenn ich meinen rechten Hoden dafür opfern müsste. Der Gedanke schoss mir ganz plötzlich durch den Kopf, und ich dachte nicht weiter darüber nach, drückte einfach auf die Klingel. Nach vier Minuten, laut meiner Digitaluhr mit der riesigen roten Leuchtanzeige, streckte Midge Hardaway, die Nachtschwester, den Kopf durch die Tür.
»Mac? Was ist los? Es ist spät. Sie sollten längst schlafen. Was gibt’s?«
Midge war etwa Mitte dreißig, groß, hatte kurzes honigblondes Haar und ein spitzes Kinn. Sie war verlässlich und klug; auf sie konnte man in einer Notlage zählen. Am Anfang, als ich hier lag, war sie stets bei mir gewesen, wenn ich mal aus meinem halb bewusstlosen Zustand erwachte, hatte ruhig auf mich eingeredet und mir dabei den Arm gestreichelt.
Ich grinste sie an. Mein bestes jungenhaftes Grinsen, hoffte ich wenigstens. Das unwiderstehliche. Ich war nicht sicher, ob sie es überhaupt sehen konnte, da es im Zimmer recht finster war und nur das Licht vom Gang hinter ihr hereinschien. Aber ich hoffte, dass zumindest das Flehen bei ihr ankam, das ich in meine Stimme legte. »Midge, erlösen Sie mich. Ich kann’s nicht länger aushalten. Bitte, Sie müssen mich retten. Sie sind meine einzige Hoffnung.«
Im Licht des Korridors sah ich ein ebenso mitfühlendes wie vergnügtes Lächeln. Sie versuchte es gar nicht zu verbergen. Dann räusperte sie sich. »Mac, hören Sie. Sie liegen seit zwei Wochen flach. Jetzt, da Sie sich allmählich besser fühlen, könnte sich das zu einem Problem auswachsen. Aber leider bin ich verheiratet. Was würde Doug von mir denken? Er kann ganz schön eifersüchtig werden.«
So viel zum jungenhaften Charme. Ich versuchte es auf die Mitleidstour. »Aber wieso sollte es Doug etwas ausmachen? Er muss es ja nicht mal erfahren, wenn’s ihn so aufregen würde. Obwohl ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, wieso.«
»Wissen Sie, Mac, wenn ich nicht verheiratet wäre, dann würde ich mir die Sache ernsthaft überlegen, obwohl Sie physisch alles andere als auf der Höhe sind. He, ich fühle mich geschmeichelt. Sie sind ’n gut aussehender Kerl, oder waren’s zumindest, wenn man nach dem Foto geht, das von Ihnen in der Zeitung war. Außerdem können Sie auch wieder beide Hände benutzen. Aber so, wie die Dinge stehen, Mac, muss ich leider passen.«
»Aber ich halt’s einfach nicht mehr aus, Midge. Echt wahr. Nur dieses eine Mal, und dann frag ich nie wieder – jedenfalls nicht bis morgen Nacht. Ausnahmsweise, Midge. Ich mach auch ganz langsam. Mir läuft ja schon das Wasser im Mund zusammen.«
Sie stand kopfschüttelnd da, die Hände in die Hüften gestemmt, sehr hübsche Hüften, wie ich vor neun Tagen bemerkt hatte, als mein Verstand nicht mehr gar so benebelt war von all den Medikamenten. Ich seufzte. »Also gut, wenn’s so gegen Ihre Moralbegriffe oder Dougs Moralbegriffe verstößt. Aber ich will Ihnen was sagen, Midge, ich kapier einfach nicht, was so schlimm daran sein soll. Und was Ihr Mann dagegen haben könnte, ist mir schleierhaft. Er würde in meiner Lage wahrscheinlich genauso betteln. He – vielleicht könnten Sie ja Mrs. Luther rufen, vielleicht lässt die sich ja überreden. Ich glaub, sie mag mich, vielleicht ...«
»Mac, haben Sie nicht mehr alle Tassen im Schrank? Mrs. Luther ist fünfundsechzig. Um Himmels willen, so schlimm kann’s doch nicht sein. Ellen Luther? Die würde Sie wahrscheinlich nicht mehr so schnell wieder loslassen.«
»Aber wieso nicht? Was meinen Sie?«
»Mac«, sagte sie mit sichtlicher Geduld, »Sie sind einfach geil, nach zwei Wochen Enthaltsamkeit ganz verständlich. Aber Mrs. Luther?«
»Ich glaube, Sie haben mich falsch verstanden, Midge. Ich will nicht mit Mrs. Luther ins Bett. Mit Ihnen schon, aber Sie sind ja verheiratet, also denk ich nicht weiter dran, höchstens mal alle fünf Minuten, wie jeder normale Mann, eventuell auch öfter, seit es mir wieder besser geht. Nein, was ich mir sehnlichst wünsche, mehr als alles auf der Welt, ist ein kühles Bierchen.«
»Ein Bier?« Sie starrte mich einen endlosen Moment fassungslos an, dann fing sie an zu lachen, immer lauter, bis sie gezwungen war, die Tür hinter sich zuzuziehen, um die anderen Patienten nicht aufzuwecken. Sie hielt sich den Bauch vor Lachen. »Sie wollen ein Bier? Das ist alles? Ein beschissenes Bier? Und Sie machen ganz langsam?«
Ich schenkte ihr meinen treuesten, besten Unschuldsblick.
Sie blieb kopfschüttelnd und nach wie vor lachend im Türrahmen stehen. Über die Schulter gewandt fragte sie: »Wie wär’s mit einem Bud Light?«
»Dafür könnte ich sogar jemanden umbringen.«
Die Bierdose war so kalt, dass ich fürchtete, meine Finger würden dran festkleben. Aah, etwas Besseres gibt’s einfach nicht, dachte ich, während mir das kühle Nass durch die Kehle zischte. Ich fragte mich, welche Schwester wohl Bier im Kühlschrank hortete. Ich trank auf einen Zug die halbe Dose aus. Midge stand am Bett und schaute auf mich hinunter. »Ich hoffe, dass Ihnen bei all den Medikamenten nicht schlecht wird von dem Bier. He, immer schön langsam. Sie haben versprochen, es rauszuzögern. Typisch Männer, man kann ihnen nicht trauen, besonders nicht, wenn’s um Bier geht.«
»Es ist ’ne ganze Weile her«, erklärte ich und leckte mir den Bierschaum von den Lippen. »Ich konnte einfach nicht anders. Jetzt geht’s mir schon viel besser.« Ich stieß einen zutiefst dankbaren Seufzer aus und nahm einen kleineren Schluck, da mir in diesem Moment klar wurde, dass sie mir wahrscheinlich kein Zweites spendieren würde. Wenigstens war der Albtraum jetzt weit weg, irgendwo im Hintergrund, und saß mir nicht länger im Nacken wie ein Schachtelteufel. Ich hatte noch etwa eine Vierteldose. Ich stellte die Büchse auf meinem Bauch ab.
Midge trat näher und prüfte meinen Puls.
»Mein Nachbar, Mr. Kowalski, gießt meine Pflanzen, wenn ich dienstlich weg bin – oder wie jetzt im Krankenhaus. Und er putzt auch ein bisschen. Er war früher mal Klempner. Jetzt ist der alte Knabe längst im Ruhestand, aber geistig noch voll auf Zack. James Quinlan – er ist auch ein FBI-Agent – singt seinen Usambaraveilchen immer was vor. Gesündere Pflanzen haben Sie nie gesehen. Seine Frau fragt sich schon, ob sie nicht eines Morgens mit ’nem Blumentopf auf dem Nachbarkopfkissen aufwacht. Ach, Scheiße, Midge, ich will heim.«
Sie legte sanft ihre Hand an meine Wange. »Ich weiß, Mac. Bald. Ihr Puls ist prima. Und jetzt will ich noch Ihren Blutdruck überprüfen.« Sie sagte mir nicht, wie der war, aber sie summte leise vor sich hin, etwas von Verdi, glaube ich, also war er wohl in Ordnung. »Sie müssen jetzt wieder schlafen, Mac. Alles klar, nach dem Bier? Hat’s Ihr Magen gut verkraftet?«
Ich nahm den letzten Schluck, unterdrückte einen Rülpser und grinste sie an wie ein Honigkuchenpferd. »Mir geht’s prima. Ich bin Ihnen was schuldig, Midge. Ehrlich.«
»Werd’s nicht vergessen, keine Sorge. He, wie wär’s, wenn ich Mrs. Luther für Sie hole?«
Ich wimmerte, und sie ging, aber nicht bevor sie mir noch mal grinsend von der Tür aus zugewinkt hatte. Im nächsten Moment schoss mir Jilly wieder durch den Kopf.
»Finde dich damit ab, Mac«, sagte ich leise in die Stille des Zimmers hinein und blickte dabei zum Fenster, das auf den nun nahezu leeren Parkplatz hinausging. »Also gut. Lassen wir die Katze aus dem Sack. War das ein Traum oder eine Art Prophezeiung? Ist Jilly in irgendwelchen Schwierigkeiten?«
Nein, das war Blödsinn. Und ich erkannte Blödsinn, wenn ich ihn bemerkte.
Ich konnte nicht wieder einschlafen. Weil ich Schiss hatte, um die Wahrheit zu sagen. Ich wünschte, ich hätte noch ein Bier. Midge schaute um vier Uhr noch mal rein, runzelte die Stirn und verpasste mir eine Schlaftablette.
Nun, zumindest träumte ich nichts in den drei Stunden, die man mich schlafen ließ, bis der Kerl mit dem Blutwägelchen auftauchte, mich an der verletzten Schulter rüttelte, um mich zu wecken und mir das obligatorische Blutopfer abzunehmen. Dabei quasselte er nonstop, erzählte mir, dass er kurz vorm Millennium, wenn alle Computer kaputtgingen, nach Montana ziehen und sich mit ’nem Generator und ’ner Knarre verschanzen würde. Danach klatschte er mir, immer noch redend, ein Pflaster auf den Einstich und zog pfeifend mit seinem Folterwägelchen von dannen. Er hieß Ted, und ich glaube, er war das, was die Psychologen einen Gelegenheitssadisten nennen.
Als es zehn Uhr wurde, hielt ich es nicht länger aus. Ich musste Gewissheit haben. Ich wählte Jillys Nummer in Edgerton, Oregon. Ihr Mann Paul nahm schon nach dem zweiten Klingeln ab.
»Jilly«, sagte ich mit zitternder Stimme. »Paul, wie geht’s Jilly?«
Stille.
»Paul?«
Ich hörte einen zittrigen Atemzug. Dann: »Sie liegt im Koma, Mac.«
Ich verspürte ein ganz komisches Gefühl, als würde sich ein Paket, dessen Inhalt ich längst kannte, langsam öffnen. Das hatte ich zwar nicht gewollt, aber überraschend kam es nicht. Bang erkundigte ich mich: »Wird sie’s überleben?«
Ich konnte hören, wie Paul mit der Telefonschnur herumspielte, wahrscheinlich wand er sie sich um den Finger. Schließlich sagte er mit ausdrucksloser Stimme: »Keiner will was sagen, Mac. Man hat sie geröntgt und auch ein MR-Bild gemacht. Die Ärzte sagen, ihr Gehirn hätte bis auf ein paar winzige Gerinnsel und ein paar Schwellungen fast keine Schäden davongetragen, jedenfalls nichts, das schwerwiegend genug wäre, um ihr Koma zu erklären. Sie wissen’s einfach nicht. Man hofft, dass sie bald wieder aufwacht. Wir müssen einfach abwarten, mehr kann ich dir auch nicht sagen. Zuerst wirst du irgendwo in der Wüste in die Luft gepustet und jetzt Jilly und dieser lächerliche Unfall.«
»Was ist passiert?« Aber ich wusste es. Ja, ich wusste es.
»Ihr Auto ist heute kurz nach Mitternacht über die Klippenstraße gerast. Sie saß in dem neuen Porsche, den ich ihr zu Weihnachten geschenkt hatte. Sie wäre tot, wenn nicht zufällig ein Polizist vorbeigekommen und das Ganze beobachtet hätte. Er berichtet, dass sie sogar noch mal Gas gegeben hat, als sie durch die Leitplanke donnerte. Er sagt, der Porsche sei in hohem Bogen über die Klippe geschossen und dann mit der Schnauze voran im Meer versunken. An der Stelle, wo sie versank, ist das Wasser nicht mehr als fünf, sechs Meter tief. Gott sei Dank waren die Scheinwerfer noch an und das Fahrerseitenfenster war offen. Er hat sie gleich beim ersten Versuch rausgekriegt, ein reines Wunder, sagt er. Keiner kann fassen, wie er das geschafft hat und dass sie noch am Leben ist. Ich ruf dich an, sobald ich mehr weiß – so oder so. Es tut mir leid, Mac, sehr leid. Geht’s dir wenigstens wieder besser?«
»Ja, viel besser«, erwiderte ich abwesend. »Danke, Paul. Wir hören voneinander.« Ich legte den Hörer behutsam auf. Paul war offensichtlich viel zu durcheinander, um darüber erstaunt zu sein, dass ich mich um sieben Uhr morgens Ortszeit nach Jilly erkundigte. Am Tag nach dem Unfall. Ich fragte mich, wann Paul das wohl auffallen würde.
Im Moment hatte ich keine blasse Ahnung, was ich ihm als Grund nennen sollte.
2
»Mac, um Himmels willen, was fällt dir ein, aufzustehen? Entlassen wirst du sicher noch nicht. Schau dich doch nur an. Du siehst beschissen aus. Deine Gesichtsfarbe ist so grau wie muffige Stores.«
Lacy Savich, jedermann beim FBI als »Sherlock« bekannt, stieß mich leicht vor die Brust, um mich in Richtung Bett zurückzuschubsen. Als sie hereinkam, hatte ich es gerade geschafft, mich in meine Jeans zu manövrieren und war dabei gewesen, mich in ein langärmeliges Hemd zu quälen.
»Husch, husch ins Bettchen, Mac. Du gehst nirgendwohin. Wie bist du bloß in diese Jeans gekommen?« Sherlock klemmte sich unter meine Achsel und versuchte mich umzudrehen, zurück zu diesem verdammten Bett.
Ich blieb wie angewurzelt stehen, und sie kriegte mich keinen Millimeter weiter. »Hör zu, es geht mir gut, Sherlock. Lass los. Ich will dich nicht unter meiner Achselhöhle haben. Ich hab noch nicht geduscht.«
»Na, so miefig bist du auch wieder nicht. Ich rühre mich nicht vom Fleck, bis du dich nicht wenigstens hingesetzt und mir gesagt hast, was los ist.«
»Also gut, ich werd mich setzen«, gab ich nach. Und um die Wahrheit zu sagen, war Hinsetzen zurzeit ohnehin die beste Idee, aber nicht auf das blöde Bett. »Also schön, wenn du drauf bestehst, Sherlock.« Ich lächelte auf sie hinab. Sie war ein zierliches Persönchen mit üppigen roten Locken, die sie heute Morgen mit einer Goldspange im Nacken zusammengefasst trug. Sie hatte eine schneeweiße Haut und das hübscheste Lächeln, das man sich vorstellen kann, warm und süß. Außer wenn sie in Fahrt kam, dann konnte sie notfalls Metall zerbeißen. Wir hatten zusammen die FBI-Akademie besucht und waren dann vor zwei Jahren bei dem Verein angestellt worden.
Sie war eine überraschend starke Stütze, hielt mich aufrecht, führte mich zum nächsten Stuhl und wich dann seitlich zurück, um mich darauf plumpsen zu lassen. Sobald ich saß, grinste ich zu ihr auf. Ich musste an unsere Abschlussprüfung im Seilklettern an der Akademie denken. Ich war mir nicht sicher gewesen, ob sie’s schaffen würde und war deshalb nicht von ihrer Seite gewichen, hatte sie vom Nachbarseil aus angefeuert, ermutigt, mit Schimpfnamen bedacht und sonst wie beleidigt, bis sie es mit ihren Spinnenärmchen tatsächlich bis nach oben schaffte. Sherlock besaß nicht gerade viel Muskelschmalz im oberen Bereich, aber sie hatte etwas, das viel besser war – ein großes Herz und jede Menge Mumm. Sie mochte mich wahrscheinlich mehr, als ich es verdiente.
»Jetzt mal raus mit der Sprache. Die Ärzte schütteln nur die Köpfe. Sie haben sich schon mit deinem Boss in Verbindung gesetzt, und ich wette, dass sie dich lieber in diesen wunderhübschen Linoleumboden stampfen, als dich jetzt schon rauszulassen. Ah, da kommt die Verstärkung. Dillon, komm rein. Du musst mir helfen, rauszufinden, was in Mac gefahren ist. Schau, er hat sogar eine Hose an.«
Dillon Savich blickte mich bei diesen Worten mit hochgezogener Braue an. Sein Glück, schien seine Miene zu sagen.
Ich lehnte mich zurück. Warum nicht noch fünf Minuten warten? Ich würde früh genug die Fliege machen. Außerdem war es nur gut, wenn meine Freunde Bescheid wussten.
»Schaut, Leute, ich muss sofort heim und packen. Ich muss einen Flug nach Oregon kriegen. Meine Schwester hatte letzte Nacht einen Unfall. Sie liegt im Koma. Ich kann nicht länger hier rumhängen.«
Sherlock ging in die Hocke und nahm eine meiner großen Pranken in ihre zierlichen Hände. »Jilly? Sie liegt im Koma? Was ist passiert?«
Ich schloss für einen Moment die Augen, denn dieser abartige Traum, oder was immer es auch gewesen war, überfiel mich unversehens. »Ich hab heute früh in Oregon angerufen«, erklärte ich. »Ihr Mann Paul hat’s mir erzählt.«
Sherlock legte den Kopf zur Seite und blickte mich ein paar Sekunden lang schweigend an. Dann fragte sie: »Wieso hast du angerufen?«
Sherlock hatte nicht nur ein großes Herz und jede Menge Mumm, sie hatte darüber hinaus einen messerscharfen Verstand.
Savich stand nach wie vor in der offenen Tür, groß und topfit wie immer. Und tough, das vor allem. Er musterte seine Frau, die ihrerseits mich aufmunternd ansah und darauf wartete, dass ich ihr mein Herz ausschüttete, was ich auch gleich zu tun gedachte. Gegen sie war ich ohnehin machtlos.
»Lehn dich einfach zurück und mach die Augen zu, Mac, ja genau. Niemand wird uns stören, das verspreche ich dir. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen was von Dillons kostbarem Kentucky-Whiskey da. Der würde dich schneller weich machen, als Sean Dillon mit seinem besten Schrei aus dem Bett kriegt.«
»Das versteh ich zwar nicht so genau, aber ich will dir mitteilen, dass Midge mir letzte Nacht ein Bier gebracht hat«, sagte ich. »Mir wurde nicht schlecht davon. Es schmeckte einfach himmlisch.« Eine Untertreibung. Nicht mal Sex hätte besser sein können als diese Dose Bud Light.
»Das freut mich für dich«, bemerkte Sherlock und wartete. Ich sah, wie sie ihrem Mann einen aufmerksamen Blick zuwarf, der entspannt am Türrahmen lehnte, die Arme über der Brust verschränkt. Es war eine Schande, dass es beim FBI nicht mehr Kerle wie ihn gab, anstelle all der angepassten Bürokraten, die Schiss hatten, auch nur einen Finger zu rühren, wenn nicht alles von oben abgesegnet war. Ich hasse eine solche Einstellung und kann nur hoffen, dass ich später nicht auch mal so werde. Vielleicht nicht, in der Terrorismusbekämpfung hatte ich jedenfalls eine gute Chance. Die Bürokraten hockten alle in Washington, aber draußen, im Außendienst, da lief’s absolut anders. Da war man allein und auf sich gestellt, zumindest dann, wenn man einen verdeckten Einsatz gegen eine terroristische Gruppierung in Tunesien hatte.
»Ein Traum«, gestand ich schließlich. »Damit fing’s letzte Nacht an. Ich träumte, ich würde ertrinken oder jemand würde ertrinken. Ich glaube, es war Jilly.« Ich erzählte ihnen alles, woran ich mich erinnern konnte. Schulterzuckend fügte ich hinzu: »Und das ist der Grund, warum ich in aller Frühe heute angerufen habe. Ich fand heraus, dass der Traum, oder was immer es war, tatsächlich geschehen ist. Sie liegt im Koma.« Erneut fragte ich mich, was das wohl bedeuten mochte. Würde sie überleben, aber massive Hirnschäden davontragen? Würden wir entscheiden müssen, ob wir den Stecker rauszogen oder nicht?
»Ich hab Angst«, gestand ich und blickte Sherlock dabei an. »Mehr Angst als je in meinem Leben. Diesen Terroristen mit nur einer .450er Magnum entgegenzutreten, lässt sich damit nicht mal vergleichen. Auch von ’ner Autobombe durch die Luft gepustet zu werden, ist ein Kinderspiel dagegen.«
»Du hast zwei von denen erwischt, Mac«, erinnerte Savich ruhig, »einschließlich des Anführers, und du wärst in tausend Stücke gerissen worden, hättest du nicht so viel Glück gehabt – der Explosionswinkel war steiler als beabsichtigt – und wäre da nicht diese Sanddüne gewesen.«
Ich schwieg einen Moment und nickte dann. »So viel verstehe ich schon, aber diesen Traum verstehe ich nicht; er macht mir Angst. Ich fühlte, wie sie unterging. Ich fühlte ihre Schmerzen und dann gar nichts mehr, als wäre ich tot.
Irgendwie war ich mit ihr verbunden oder war ein Teil von ihr oder so was. Es ist verrückt, ich weiß. Aber ich kann nicht so tun, als wär’s nicht passiert. Ich muss einfach nach Oregon. Nicht nächste Woche oder in zwei Tagen, sondern jetzt gleich. Heute.«
Einfach weil Sherlock da war und weil ich solchen Schiss hatte, dass ich am liebsten gejault und geheult hätte wie ein Schlosshund, beugte ich mich vor und zog Sherlock an meine gesunde Schulter. Ein Spinnenärmchen schlang sich um meinen Hals. Ich merkte, wie mir die Tränen kamen, aber ich beherrschte mich eisern. Das wäre mir zu peinlich gewesen, selbst wenn die beiden keiner Menschenseele was verraten hätten. Nein, ich drückte sie einfach nur an mich, fühlte, wie ihr weiches Haar mich an der Nase kitzelte. Ich warf Savich einen Blick zu. Die beiden waren jetzt anderthalb Jahre verheiratet. Ich war Sherlocks Trauzeuge gewesen. Savich war bekannt und beliebt beim FBI. Er und Sherlock arbeiteten beide in der Abteilung für gezielte Täterermittlung. Savich war der Abteilungsleiter, hatte die Abteilung selbst vor gut drei Jahren gegründet. Es gelang mir allmählich, mich wieder in den Griff zu bekommen. »Da hast du eine besonders Gute erwischt«, bemerkte ich heiser zu Savich.
»O ja, abgesehen von allem anderen hat sie mir den besten kleinen Jungen in ganz Washington geschenkt. Du hast Sean nicht mehr gesehen, seit er einen Monat alt war, Mac. Zeit, dass du mal wieder vorbeischaust. Er ist jetzt schon fast fünf Monate.«
»Das werde ich nachholen, sobald ich kann.«
»Tu das. He, Sherlock, mit dir alles in Ordnung? Keine Sorge um Mac. Er wird nach Oregon fliegen und dort nach dem Rechten sehen. Wir sind hier, falls er Hilfe braucht. Nur einen kleinen Fünf-Stunden-Flug entfernt.«
»Mac, bist du sicher, dass du schon wieder in den Sattel kannst? Du siehst noch immer reichlich angeschlagen aus. Wie wär’s, wenn du für ein paar Tage zu uns kämst, bevor du aufbrichst? Wir verfrachten dich in das Zimmer neben Sean. Zu schade allerdings, dass du nicht stillen kannst. Das würde uns wenigstens für die Mühen, die wir mit dir hätten, entschädigen.«
Am Ende blieb ich dann doch noch anderthalb Tage länger im Krankenhaus, bis ich es einfach nicht mehr aushielt. Ich telefonierte zweimal täglich mit Paul. An Jillys Zustand hatte sich nichts geändert. Die Ärzte sagten nach wie vor, dass sie nichts tun könnten und man einfach abwarten müsse. Kevin und seine Jungen befanden sich in Deutschland und meine Schwester Gwen, eine Einkäuferin für Macy’s, in Florida. Ich versprach ihnen, sie auf dem Laufenden zu halten.
Am Freitag nahm ich dann schließlich vom Washington-Dulles Airport einen Frühflug nach Westen. Nach der Ankunft gelang es mir ohne größere Schwierigkeiten, einen Mietwagen, einen hellblauen Ford Taurus, zu kriegen – meiner Erfahrung nach durchaus nicht selbstverständlich.
Es war ein wunderschöner Tag, klar und sonnig, kein Wölkchen am Himmel, milde dreiundzwanzig Grad und eine leichte Brise. Ich mochte die Westküste schon immer, vor allem Oregon mit seinen rauen, zerklüfteten Bergen und tiefen Schluchten, in die sich tosende Wasserfälle ergossen. Und ich mochte das Meer, das in Oregon an eine über dreihundert Meilen lange, meist wild zerklüftete Küstenstrecke brandete.
Ich ließ mir Zeit, denn ich kannte meine Grenzen und wollte mich nicht so weit treiben, dass ich drohte, jeden Moment umzukippen. Bei einem Wendy’s in Tufton, einem kleinen Städtchen nahe der Küste, legte ich einen kurzen Zwischenstopp ein. Anderthalb Stunden später erreichte ich das Hinweisschild nach Edgerton, das vom Highway 101 abzweigte. Es gab nur diese eine Abzweigung, 101 W, eine schmale Teerstraße, die über vier Meilen bis zur Küste führte. Im Gegensatz zu den meisten anderen Städtchen, die von der Küstenautobahn durchschnitten wurden, war Edgerton diesem Schicksal entronnen, da man an dieser Stelle beschlossen hatte, die Straße mehr ins Landesinnere zu verlegen. Einige wenige Schilder an der Straße kündigten drei Frühstückspensionen an. Das Schild für das »Buttercup B&B« war das größte davon. Es hatte die Form einer psychedelischen Blume, gelb-lila und zeigte eine Art gotisches Dracula-Gemäuer, trostlos und unheimlich. Wenn ich mich recht erinnerte, hatte Paul mir einmal erzählt, dass die Bewohner von Edgerton es das »Psycho-B&B« nannten. Dann gab es noch ein kleineres Schild eines bescheidenen Speiselokals namens Edwardian, das von sich behauptete, die beste englische Küche zu servieren, in meinen Augen ein Widerspruch in sich, hatte ich doch während meines einjährigen Studiums an der London School of Economics, der Schule für Wirtschaftswissenschaft, so meine Erfahrungen mit dem britischen Fraß gemacht.
Ich erinnerte mich, dass es früher einmal ein kleines Strandhotel in Edgerton gegeben hatte, das aber während eines Wintersturms im Jahre 1974 einfach fortgespült worden war. Ich versuchte mir das vorzustellen, aber es gelang mir nicht. Ich musste an diesen Film über einen riesigen Tsunami denken, eine Flutwelle, die ganz Manhattan plattgemacht hatte, und grinste. Damals hatte ich mich gefragt, ob die Indianer in so einem Fall vielleicht Interesse hätten, die Halbinsel zurückzukaufen. Ich streckte den Kopf aus dem Fenster und sog den Geruch des Meeres tief in mich ein, ein herber, klarer und salziger Geruch. Ich liebte diesen Geruch, dieses wundervolle Gefühl, das mich immer überkam, wenn ich mich dem Meer näherte. Herrlich. Der tiefe Atemzug tat nur ein bisschen weh. Vor einer Woche hätte ich mir so etwas noch nicht erlauben können.
Ich bremste ab, um ein tiefes Schlagloch zu umkurven. Meinen Schwager, Paul Bartlett, Jillys Mann, kannte ich eigentlich nicht sehr gut, obwohl er und Jilly schon seit acht Jahren verheiratet waren. Sie hatten geheiratet, nachdem sie ihr Pharmaziestudium abgeschlossen hatte. Paul hatte seines ein Jahr davor mit einem Doktorgrad absolviert. Er war in Edgerton aufgewachsen, dann aber an die Ostküste und nach Harvard gegangen. Mir kam er ein bisschen steif vor, ein bisschen wie ein kalter Fisch. Aber wer wusste schon wirklich, wie ein Mensch war? Ich dachte daran, wie Jilly von ihm geschwärmt hatte, wie toll es im Bett mit ihm sei. Nicht gerade typisch für einen kalten Fisch.
Ich war sehr überrascht gewesen, als mich Jilly vor sechs Monaten anrief und mir mitteilte, sie und Paul würden zurück nach Edgerton ziehen, Philadelphia und VioTech, die pharmazeutische Firma, bei der sie die letzten sechs Jahre angestellt gewesen waren, verlassen. »Paul gefällt es dort nicht mehr«, hatte sie erklärt. »Sie lassen ihn nicht mit seiner Forschungsarbeit weitermachen. Sie ist sein Baby, Mac, sein Ein und Alles.« Und was ist mit dir?, hatte ich gefragt. Kurzes Schweigen, dann: »Meine biologische Uhr läuft langsam ab, Mac. Wir wünschen uns ein Kind. Ich werde für eine Weile aussetzen und versuchen, schwanger zu werden. Wir haben alles gründlich besprochen und sind uns ganz sicher. Wir ziehen wieder nach The Edge.« Ich musste lächeln, als ich an diesen Namen dachte. Schon vor langer Zeit, noch bevor sie Paul geheiratet hatte, hatte sie mir einmal erklärt, dass Edgerton Ende des achtzehnten Jahrhunderts von einem englischen Marineleutnant namens Davies Edgerton entdeckt worden war. Die Bewohner des Städtchens hatten den Namen im Laufe der Zeit so heruntergeschlampt, dass fast jeder nur noch The Edge sagte, was Sinn ergab, lebte man ja sozusagen an der Kante oder Klippe.
Ich war fast da. Die vier Meilen lange Strecke bis zur Küste war äußerst kurvenreich und bergig, was wohl auch der Grund dafür war, dass die Straßenbauingenieure sich damals entschieden hatten, die Küstenautobahn ins Landesinnere zu verlegen. Es gab tiefe Täler und steile Berge, eine breite Schlucht, die von einer kühnen Brücke überspannt wurde, dazu zahlreiche verkrüppelte und windgebeugte Eichen und Föhren und mindestens ein Dutzend Schlaglöcher, die aussahen, als stammten sie noch aus der Depressionszeit. Es war alles noch ziemlich kahl, da der Frühling gerade erst angefangen hatte. Auf dem Ortsschild stand EDGERTON – 15 METER Ü.M. – 602 EINWOHNER. Meine Lieblingseinwohnerin lag derzeit im Tallshon Bezirkskrankenhaus, gut zehn Meilen nördlich von Edgerton, im Koma.
Jilly, dachte ich und umkrallte das Lenkrad unwillkürlich fester, bist du absichtlich durch die beschissene Leitplanke gerast? Wenn ja, warum?
3
Es gibt nur noch mich, alles andere ist verschwunden, und das ist unheimlich tröstlich. Als mir zum ersten Mal klar wurde, dass ich gar nicht tot war, war das ein Schock für mich. Wie war das möglich? Wie hatte ich das überleben können? Ich war doch mit dem Porsche über die Klippen gerast, war in hohem Bogen durch die Luft geflogen und dann scharf wie ein Messer ins stille, schwarze Meer getaucht.
Was danach kam, weiß ich nicht mehr.
Ich fühle meinen Körper nicht, und das ist wahrscheinlich gut so. Ich weiß, dass da Leute um mich herum sind, Leute, die flüstern, wie man flüstert, wenn man sich in der Nähe eines Todkranken befindet, aber ich kann nicht verstehen, was sie sagen. Komisch, aber sie sind irgendwie nicht richtig da, sind nur vage Schattengestalten. Auch ich bin, so wie diese Schattengestalten, zwar da, aber doch nicht richtig. Wenn ich doch bloß verstehen könnte, was sie reden. Das wäre echt der Hit.
Endlich bin ich allein. Vollständig allein. Laura ist nicht mehr da. Laura hat, so bete ich inständig, ihre Rache bekommen, als ich kreischend wie eine Irre über die Klippe gerast bin. Wenn sie mit mir zurückgekommen wäre, ich glaube, ich hätte einfach aufgehört zu atmen.
Leute kommen und gehen. Sie interessieren mich nicht. Ich nehme an, dass man mich untersucht und irgendwelche Sachen mit mir macht, aber das alles spielt irgendwie überhaupt keine Rolle.
Und dann ändert sich alles schlagartig. Mein Bruder Ford kommt durch die Tür, und ich erkenne ihn klar und deutlich. Er ist real, er ist kein Schatten, und sein Gesicht ist so voller Angst, dass ich alles dafür geben würde, ihn beruhigen zu können, aber natürlich kann ich das nicht. Er ist groß und gut aussehend, mein kleiner Bruder, sogar noch attraktiver als unser Vater, den Mutter immer liebevoll als Ladykiller bezeichnet hat. Mutter und Vater waren tot, oder?
Ford sieht irgendwie nicht wie er selbst aus. Nicht ganz so souverän, nicht ganz so beherrscht, so eindrucksvoll. War er nicht kürzlich verletzt worden? Ich weiß es nicht, kann überhaupt nur schwer denken. Aber Ford ist da, dessen bin ich mir sicher. Was ich ebenfalls sicher weiß, ist, dass ich die Einzige bin, die ihn Ford nennt und nicht Mac. Für mich war er nie Mac.
Wie ist das möglich? Er ist da und ich kann ihn sehen, alle anderen dagegen sind nur schemenhafte Gestalten.
Wenn ich hätte schreien können, um mich ihm bemerkbar zu machen, dann hätte ich es in diesem Augenblick getan. Aber ich kann mich nicht rühren, kann nichts fühlen außer einer stillen Freude darüber, dass mein Bruder gekommen ist, wenn ich ihn am meisten brauche.
Als ich seine Stimme höre, laut und deutlich, nah an meinem Ohr, ist das ein neuerlicher Schock für mich. »Jilly, mein Gott, Jilly, ich halte das nicht aus. Was ist bloß passiert?«
Ich höre seine Worte deutlich, verstehe sie deutlich. Noch schockierter bin ich, als ich seine Hand fühle – richtig fühle –, als er eine von meinen ergreift, ich bin mir nicht sicher, welche. Seine Wärme durchströmt mich, eine Wärme, die meinen Körper nicht mehr verlässt. Erstaunlich. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Warum ist Ford so deutlich und sonst niemand? Warum gerade er?
»Ich weiß, du kannst mir nicht antworten, Jilly, aber vielleicht kannst du mich ja irgendwo tief drinnen hören.«
Ja, will ich ihm sagen, ja, ich kann dich hören. Ich liebe seine Stimme, eine tiefe, volltönende Stimme, eine Stimme, die einen unweigerlich in ihren Bann zieht. Ich glaube, ich habe ihm einmal gesagt, wie prickelnd, wie angenehm und wärmend ich seine Stimme finde. Er hat geantwortet, dass das seine FBI-Verhörstimme wäre, aber das ist Unsinn. Er hat schon immer diese intime, beruhigende Stimme gehabt.
Er setzt sich zu mir, redet dabei weiter beruhigend auf mich ein, mit dieser tiefen, tröstlichen Stimme, lässt auch meine Hand nicht los, und die Wärme seiner Hand macht mich ganz schwindlig. Ich wünsche mir sehnlichst, seine Hand drücken zu können.
»Ich war dabei, Jilly«, sagt er, und mir stockt der Atem.
Was meint er damit?
Dabei? Wo dabei?
»Ich war in dieser Nacht, als du über die Klippe gerast bist, dabei. Hab mir fast in die Hosen gemacht vor Angst. Bin im Krankenhaus aufgewacht, schwitzend wie ein Ochse, hatte eine solche Scheißangst. Ich dachte, ich geh drauf. Ja, ich bin mit dir über diese Klippe gegangen. Jilly. Zuerst dachte ich, ich wär mit dir gestorben, aber keiner von uns beiden ist gestorben. Dieser Polizist hat dich gerettet. Und jetzt muss ich rauskriegen, wie das geschehen konnte. Verflucht noch mal, ich wünschte, du könntest mich hören.«
Ford hält inne, lässt mein Gesicht keine Sekunde aus den Augen, und ich wünsche mir mit jeder Faser meines Seins, ihm ein Zeichen geben zu können, irgendetwas, aber ich kann nicht. Ich liege nur da wie ein lebloser Haufen, liege in diesem Krankenhausbett, das wahrscheinlich ziemlich unbequem ist, wenn ich es nur fühlen könnte. Ich fühle mich tot, nur mein Gehirn lebt noch und die Hand, die er hält.
Was meint er damit, er wäre bei mir gewesen, als ich über die Klippe gerast bin? Das ist doch Blödsinn, obwohl mir eigentlich alles irgendwie keinen Sinn zu ergeben scheint.
Eine weiße, schemenhafte Gestalt tritt in mein Gesichtsfeld. Ford tätschelt meine Hand und legt sie wieder auf die Matratze. Er tritt auf die Gestalt zu und sagt: »Paul, ich bin gerade angekommen. Hab soeben mit Jilly geredet.«
Paul. Er ist hier in meinem Zimmer. Ich verstehe nicht, was er zu Ford sagt, aber aus Fords langem Schweigen schließe ich, dass es eine ganze Menge ist. Er und Ford treten ein wenig beiseite, sodass ich nun nicht einmal mehr Ford verstehen kann. Mehr als alles andere wünsche ich mir, dass Paul verschwindet, aber das tut er nicht. Was sagt er bloß zu Ford? Ich will meinen Bruder wiederhaben. Er ist meine einzige Verbindung zur Außenwelt, meine Rettungsleine.
Nach einer Weile gebe ich auf und schlafe ein. Mein letzter Gedanke ist: Hoffentlich lässt Ford mich hier nicht allein, hoffentlich kommt er wieder zu mir zurück. Es tut mir herzlich leid um meinen geliebten Porsche, der nun auf dem Meeresgrund liegt, als Futter für die Fische.
Ich stellte den Ford Taurus auf einem der sechs leeren Gästeparkplätze vor dem »Buttercup B&B« ab, ein wunderlicher Name für das hässliche, draculaähnliche viktorianische Herrenhaus, das sich fast an den Rand der Klippen zu krallen schien. Eine dicke Steinwand, nicht mehr als sechs Meter vom Haus entfernt, schloss das Grundstück von den Klippen ab, die an dieser Stelle gut zwölf Meter steil bis zu einem schmalen Stück felsigen Strands hin abfielen.
Genauso wunderlich war der Name der Hauptstraße von Edgerton – Fifth Avenue. Als ich diesen Namen bei meinem ersten und einzigen Besuch hier hörte, musste ich mir den Bauch halten vor Lachen. Fifth Avenue, dazu vier beiderseits parallel verlaufende Straßen, die an den Klippen endeten und von weiter auseinander liegenden nordsüdlich verlaufenden Straßen durchschnitten wurden.
Soweit ich sehen konnte, hatte sich nicht viel verändert.
Kleine Häuschen aus den Zwanzigerjahren standen wie Pastellschächtelchen an der Fifth Avenue aufgereiht. Dazwischen gab es Häuser im Bungalow-Stil der Sechziger, von größeren Gartengrundstücken umgeben. Weiter oben, an den zerklüfteten Abhängen und auch in den flachen Seitentälern, die sich zum Meer hin öffneten, prangten moderne kalifornische Villen mit Glas- und Holzfassaden. Doch auch aus den dichten kleinen Wäldchen aus Fichten, Zedern und Schierlingstannen blitzten hie und da noch kleine Häuschen und Cottages heraus.
Ich betrat das »Buttercup B&B«, und eine dürre Dame mit einem unübersehbaren schwarzen Oberlippenbärtchen teilte mir mit, es wäre alles belegt. Ich dachte an all die leeren Parkplätze draußen und sah, dass die Pension absolut ausgestorben wirkte. »Ganz schön was los zurzeit«, stellte ich leicht spöttisch der Frau gegenüber fest, die hinter dem großen glänzenden Mahagonitresen stand und mich argwöhnisch und dickköpfig musterte.
»Wir haben einen Kongress in der Stadt«, erwiderte sie mit einem rosaroten Gesicht und studierte geflissentlich die Tapete mit den großen viktorianischen Rosen über meiner linken Schulter.
»Ein Kongress? Hier in Edgerton? Vielleicht der Rose Bowl?«
»O nein, es handelt sich nicht um Floristen, sondern, na ja, um Zahnärzte, ja genau, Zahnärzte aus allen Teilen des Landes. Tut mir leid, Sir.«
Wenn das die Hochsaison sein soll, fragte ich mich auf dem Weg zurück zum Auto, wie wird es dann erst in der Nebensaison aussehen? Wieso hatte mir die Frau kein Zimmer geben wollen? Hatte es sich etwa schon herumgesprochen, dass ein FBI-Beamter in der Stadt war? Wollte niemand einen Bullen bei sich aufnehmen? Also mir schien es, dass man einen vertrauenswürdigeren Gast als mich gar nicht haben konnte.
Ich bog an der Fifth Avenue links ab und fuhr in nördlicher Richtung die Liverpool Street entlang, eine steile, kurvenreiche Straße, die gute zehn Meilen parallel zur 101 verlief, um dann nach Osten zu schwenken und sich wieder mit dem Highway zu vereinen. Auch an dieser Straße gab es vereinzelte, weit auseinanderliegende Häuser, die meisten davon diskret zwischen Bäumen versteckt. An einer besonders hübschen Stelle, am Fuß einer kleinen bewaldeten Anhöhe, etwa fünfzig Meter von den Klippen entfernt, lag ein großes dunkelrotes Backsteinhaus. Nur ein schmaler Zufahrtsweg führte durch das dichte Föhren- und Pinienwäldchen, das das Haus fast vollständig umgab. An der der Küste zugewandten Seite lehnten sich die Bäume krumm und vom Wind verkrüppelt landeinwärts.
Es war Liverpool Street Nummer zwölf, Paul und Jillys Haus. Es sah nicht älter aus als höchstens drei oder vier Jahre. Wenn ich nicht extra danach Ausschau gehalten hätte, wäre ich sicher daran vorbeigefahren.
Ich war überrascht, wie sehr es ihrem früheren Haus in Philadelphia ähnelte. Erst dann sah ich den Streifenwagen, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkte.
Ich stellte meinen Leihwagen vor dem Haus ab und fragte mich dabei, wie lange Paul wohl noch im Krankenhaus bleiben würde. Dann ging ich zu dem Streifenwagen, einem weißen viertürigen Chrysler mit der grünen Aufschrift SHERIFF.
Ich streckte den Kopf zum Beifahrerfenster hinein. »Was gibt’s? Warten Sie auf Paul?«
Im Wagen saß eine Frau Ende zwanzig, in einer makellos gebügelten beigen Sheriffskluft, einem breiten schwarzen Ledergürtel, in dem eine 9-mm-SIG-Sauer, Modell 220, steckte, eine erstklassige Automatikpistole, die ich selbst sehr gut kannte. Sie erwiderte: »Ja. Und wer sind Sie?«
»Ich bin Ford MacDougal, Jillys Bruder aus Washington D.C. Ich komme, um sie zu besuchen und um herauszufinden, was mit ihr passiert ist.«
»Sie sind also dieser FBI-Agent?«
In ihrer Stimme lag unüberhörbares Misstrauen. »Neuigkeiten sprechen sich hier aber ziemlich schnell rum«, bemerkte ich. Ich streckte meine Hand durchs offene Wagenfenster. »Nennen Sie mich Mac.«
Sie trug schwarze Lederhandschuhe, die sich kühl und butterweich anfühlten, als sie mir die Hand schüttelte. »Ich bin Maggie Sheffield, Sheriff hier in Edgerton. Ich will auch rausfinden, was mit Jilly passiert ist. Kommen Sie gerade aus dem Krankenhaus?« Als ich nickte, fragte sie: »Irgendwas Neues?«
»Nö. Paul ist noch bei ihr. Er ist ganz schön fertig.«
»Kein Wunder. Muss die reinste Hölle für ihn sein. Geschieht ja nicht jeden Tag, dass die eigene Frau über eine Klippe rast und im Krankenhaus endet anstatt im Leichenschauhaus, und ihr Porsche ein feuchtes Begräbnis kriegt.«
Sie klang, als wolle sie jeden Moment in Tränen ausbrechen. Wegen Jilly oder wegen des Porsches?
»Haben Sie Jillys Porsche mal ausprobiert?«
»Ja, einmal. Das Komische dabei ist, dass ich normalerweise kein Raser bin. Aber ich hab mich hinters Steuer gesetzt, den Blick auf die Straße gerichtet und sofort aufs Gas gedrückt. Ich fuhr achtzig, bevor es mir richtig klar wurde. Bloß gut, dass kein Bulle in der Nähe war.« Sie lächelte und wandte den Blick für einen Moment von mir ab. »Jilly war so glücklich über dieses Auto. Sie ist jauchzend und hupend damit über die Fifth Avenue gedüst, ist Schlangenlinien gefahren. Die Leute sind aus den Läden und Häusern gelaufen, haben mit ihr gelacht und gewettet, wann sie die Karre mit ihren Albernheiten wohl zu Schrott fährt.«
»Was sie ja auch getan hat.«
»Ja, aber nicht aus jugendlichem Überschwang. Da muss was ganz anderes passiert sein.« Die Düsterkeit in ihrer Stimme war kurz verschwunden gewesen, doch nun war sie wieder da. Ebenso wie das Misstrauen. Ich war überrascht, als sie nun wütend mit der Faust auf das Lenkrad schlug. »Das macht einfach keinen Sinn. Rob Morrison, der Streifenpolizist, der sie rausgezogen hat, sagte, sie hätte noch mal aufs Gas getreten, als sie auf die Klippe zuraste. An dieser Stelle geht es zum Rand der Klippe ziemlich steil hoch, was bedeutet, sie musste Gas geben, wenn sie durch die Leitplanke wollte. Aber ich begreif das nicht. Jilly hätte nie versucht, sich umzubringen.« Sie hielt einen Moment inne und versuchte stirnrunzelnd, das Kiefernwäldchen auf der anderen Straßenseite zu durchdringen. »Ich nehme nicht an, dass Ihnen was dazu einfällt, oder?«
Ich hätte einfach Nein sagen sollen, weil ich nicht wollte, dass mich das Fräulein Sheriff für verrückt hielt, aber was stattdessen aus meinem Mund kam, war: »Doch, schon. Aber verstehen tu ich’s trotzdem nicht.«
Sie lachte. Es war ein ehrliches Lachen. »Also, das müssen Sie schon ein wenig näher erklären. Hören Sie, Sie sind trotz allem ein Bundesbeamter. Sicher, Sie sind auch Jillys Bruder, aber zunächst mal sind Sie ein FBI-ler. Was geht hier vor?«
»Das alles stimmt schon, aber ich bin im Moment außer Dienst. Ich bin hier als Jillys Bruder, das ist alles. Ich hab nicht die Absicht, hier den großen FBI-Mann rauszukehren, Sheriff.« Mein Magen knurrte vernehmlich. »Ich sag Ihnen was. Paul ist noch immer im Krankenhaus, und ich werde hier bei ihm wohnen, da das ›Buttercup B&B‹ wegen des Zahnärztekongresses ausgebucht ist. Es ist schon Nachmittag, und ich hab seit dem Frühstück nichts mehr gegessen.«
»Zahnärztekongress, hm? Also so ist Arlene Sie wieder losgeworden? Diese Frau hat einfach keine Fantasie.«
»Sie hat sich bemüht. Ich glaube, ich hab ihr Angst gemacht. Aber wieso? Weil ich nicht von hier bin? Weil ich vom FBI bin?«
»Sie haben’s erfasst. Arlene Hicks will Sie nicht mal in der Nähe ihres feinen Etablissements haben. Sie hat was gegen Bullen.«
»Hat sich ja schnell rumgesprochen.«
»Tja. Paul hat Benny Pickle unten im Waffenladen erzählt, dass Sie kommen würden. Mehr brauchte es nicht. Benny ist die größte Klatschbase westlich der Rocky Mountains.«
»Aber was soll so falsch daran sein, wenn man fürs FBI arbeitet? Ich bin reinlich, höflich und ich spucke nicht aufs Trottoir. Auch würde ich nie abhauen, ohne die Rechnung zu bezahlen.«
»Arlene sieht nicht mal mich gerne, obwohl ich ein bekanntes Gesicht bin. Sie schon gar nicht. Wahrscheinlich wirft sie Sie mit den Typen vom Finanzamt in einen Topf. Sie sind doch aus Washington, nicht? Sündenpfuhl und Hort der Korruption.«
»Sie bringen mich da auf einen Gedanken. Vielleicht hat Arlene ja Dreck am Stecken.«
Das wischte sie mit einer Handbewegung beiseite. »Also gut. Nun sind Sie schon mal hier, Mac, und wollen rausfinden, was mit Jilly passiert ist. Das will ich auch. Da ist es nur vernünftig, wenn wir uns zusammentun, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ich frage mich nur, sind Sie auch bereit, mit offenen Karten zu spielen?«
Ich zog eine Augenbraue hoch. »Ans Spielen hab ich dabei überhaupt nicht gedacht. Aber wenn ich spiele, dann gewöhnlich mit offenen Karten. Wieso auch nicht?«
»Na, Sie sind vom FBI. Sie sind’s gewohnt, den Boss zu markieren und uns kleine Ortspolizisten rumzuscheuchen. Aber ich lass mich nicht rumscheuchen.«