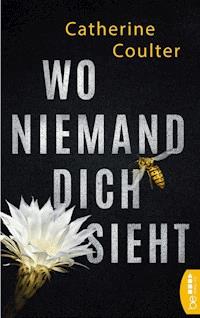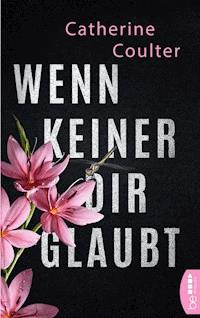
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein FBI Thriller mit Dillon Savich und Lacey Sherlock
- Sprache: Deutsch
Wenn Dein Stalker sich an Dir rächen will - für etwas, das Du nie getan hat ...
Becca erhält Morddrohungen. Der Anrufer will Rache dafür, dass sie Sex mit ihrem Chef hatte - dem Gouverneur von New York. Etwas, das sie nie getan hat. Aber niemand glaubt ihr. Dann tötet der Anrufer einen Unschuldigen und Becca sieht keinen anderen Ausweg, als zu fliehen. Doch plötzlich steht ein Fremder vor ihrer Tür ...
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 612
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
1
New York City, 15. Juni/Gegenwart
Riptide, Maine, sechs Tage später
2
New York City, 15. Juni
3
Riptide, Maine, 22. Juni
4
5
6
7
8
9
10
11
Washington D.C., Sutter Building
Jacob Marleys Haus
Chevy Chase, Maryland
Georgetown, Washington, D.C.
12
The Egret Bar & Grill, Washington, D. C.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Washington, D.C., Restaurant Der Adler ist gelandet
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Über dieses Buch
Wenn Dein Stalker sich an Dir rächen will – für etwas, das Du nie getan hat …
Becca erhält Morddrohungen. Der Anrufer will Rache dafür, dass sie Sex mit ihrem Chef hatte – dem Gouverneur von New York. Etwas, das sie nie getan hat. Aber niemand glaubt ihr. Dann tötet der Anrufer einen Unschuldigen und Becca sieht keinen anderen Ausweg, als zu fliehen. Doch plötzlich steht ein Fremder vor ihrer Tür …
Über die Autorin
Catherine Coulter wuchs auf einer Ranch in Texas auf und schrieb nach ihrem Uniabschluss Reden an der Wall Street, bevor sie sich voll und ganz dem Schreiben widmete. Inzwischen hat sie mehr als 70 Romane veröffentlicht – darunter viele Regency Romances, aber auch einige Thriller. Ihre Bücher stürmen regelmäßig die Bestsellerlisten der New York Times. Catherine Coulter lebt mit ihrem Ehemann und drei Katzen in Nordkalifornien.
Catherine Coulter
Wenn keiner dir glaubt
Aus dem Amerikanischen von Leo Strohm
beTHRILLED
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2000 by Catherine Coulter
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Riptide
Originalverlag: G. P. Putnam’s Sons, a member of Penguin Putnam Inc., New York
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2002 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH
Übersetzung: Leo Strohm
Lektorat/Projektmanagement: Anne Pias
Covergestaltung: © www.buerosued.de
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-4492-9
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Meine ewige Liebe und Dankbarkeit gilt Iris Johansen und Kay Hooper. Und Linda Howard schulde ich eine besonders herzliche Umarmung für eine hervorragende Idee.
CC
1
New York City, 15. Juni/Gegenwart
Es war Nachmittag. Becca schaute sich im Fernsehen eine Seifenoper an, die sie seit ihrer Kindheit verfolgt hatte. Dabei fragte sie sich, ob sie auch einmal ein Kind haben würde, das im einen Monat eine Herztransplantation benötigte und im nächsten eine neue Niere, oder einen Mann, der ihr nicht länger treu wäre als vom Sessel bis zur Tür.
Das Telefon klingelte.
Sie sprang auf, doch dann erstarrte sie in der Bewegung und fixierte das Telefon. Im Fernseher beklagte sich jemand, dass das Leben ungerecht sei. Er hatte ja nicht die geringste Ahnung.
Reglos blieb sie stehen, machte keinerlei Anstalten, den Hörer abzunehmen. Es klingelte noch dreimal. Dann endlich hielt sie es nicht mehr aus – ihre Mutter lag im Lenox Hill Hospital im Koma. Sie sah, wie ihre Hand nach dem Hörer griff. Nur mit großer Mühe konnte sie sich ein einziges Wort abringen: »Hallo?«
»Hallo, Rebecca. Hier ist dein Geliebter. Jetzt habe ich dir schon solche Angst gemacht, dass du dich zwingen musst, überhaupt ranzugehen, stimmt’s?«
Sie schloss die Augen, während die verhasste Stimme mit dem sanften, tiefen Klang sie einhüllte, sich in ihr Innerstes fraß und sie vor Angst zittern ließ. Die Aussprache war akzentfrei, keine lang gezogenen Konsonanten wie in den Südstaaten, keine scharfen Vokale wie in New York, keine verschluckten R wie in Boston. Eine gebildete Stimme mit flüssigen, klaren Sätzen, vielleicht sogar ein klein wenig britisch. Alt? Jung? Sie wusste es nicht, konnte es nicht sagen. Sie musste sich zusammenreißen. Musste aufmerksam zuhören, sich genau einprägen, wie er sprach, was er sagte. Du kannst es. Reiß dich zusammen. Bring ihn zum Reden, vielleicht verrät er sich ja irgendwie, man weiß nie, was als Nächstes zum Vorschein kommt. Das hatte ihr der Polizeipsychologe in Albany geraten, als der Mann mit seinen Anrufen begonnen hatte. Hören Sie genau zu. Lassen Sie sich keine Angst einjagen. Nehmen Sie das Heft in die Hand. Sie müssen ihn unter Kontrolle bekommen, nicht umgekehrt. Becca leckte sich die spröden, rissigen Lippen – eine Folge der heißen, trockenen Luft, die in dieser Woche über Manhattan lag. Der Wetterbericht hatte das als Anomalie bezeichnet. Also betete Becca erneut ihre Fragen-Litanei herunter und versuchte dabei, ruhig und beherrscht zu klingen, überlegen, ganz sie selbst.
»Wollen Sie mir nicht sagen, wer Sie sind? Ich möchte das wirklich gerne wissen. Vielleicht können wir ja darüber sprechen, weshalb Sie mich die ganze Zeit anrufen. Ist das möglich?«
»Kannst du dir nicht mal ein paar neue Fragen überlegen, Rebecca? Immerhin habe ich dich jetzt schon über ein Dutzend Mal angerufen. Und immer fragst du dieselben Sachen. Ach so, das hast du von einem Psycho-Doktor, stimmt’s? Der hat dir gesagt, dass du mir diese Fragen stellen sollst, dass du versuchen sollst, mich durcheinander zu bringen, damit ich irgendwann alles ausplaudere. Tut mir leid, aber das wird nicht funktionieren.«
Sie hatte sowieso nie wirklich daran geglaubt, dass diese Strategie funktionieren würde. Nein, nein, dieser Kerl wusste ganz genau, was er tat und wie er es tat. Sie hätte ihn am liebsten angefleht, er möge sie doch in Ruhe lassen, aber sie ließ es sein. Stattdessen verlor sie die Nerven. Sie drehte einfach durch, und die Wut, die sie so lange in sich hineingefressen hatte, gewann die Oberhand über ihre tief sitzende Furcht. Ihr Griff um den Telefonhörer wurde fest, die Knöchel schneeweiß, und dann brüllte sie los: »Jetzt hör mir mal zu, du miese Ratte! Hör endlich auf, dich als mein Geliebter zu bezeichnen. Du bist nichts weiter als ein kranker Vollidiot. Wie wär’s denn mit dieser Frage: Wieso fährst du nicht zur Hölle, wo du auch hingehörst? Wieso bringst du dich nicht einfach um, das wäre mit Sicherheit kein Verlust für die Menschheit? Ruf mich nie wieder an, du jämmerliches Stück Dreck. Die Polizei ist dir auf der Spur. Das Telefon ist angezapft, hast du das kapiert? Sie werden dich finden, und dann geht’s dir an den Kragen.«
Sie hatte ihn kalt erwischt, so viel war klar. Der Adrenalinstoß versetzte sie in grenzenlose Euphorie, die aber nur einen Augenblick lang anhielt.
Mit ruhiger, vernünftiger Stimme sagte er: »Ist ja schon gut, Rebecca, Schätzchen, du weißt doch genauso gut wie ich, dass die Polizei gar nicht mehr glaubt, dass du belästigt wirst, dass irgend so ein durchgeknallter Typ Tag und Nacht bei dir anruft und versucht, dir Angst einzujagen. Das Telefon hast du selbst anzapfen lassen, weil die Bullen das nicht machen wollten. Und ich bleibe niemals so lange in der Leitung, dass du mich mit deiner veralteten Ausrüstung erwischen könntest. Oh ja, Rebecca, du hast mich beleidigt, und dafür wirst du bezahlen. Bitter bezahlen.«
Sie knallte den Hörer auf die Gabel und hielt ihn krampfhaft umklammert, als wollte sie eine Blutung stoppen, als würde ihr Griff ihn daran hindern, erneut ihre Nummer zu wählen. Dann, endlich, ließ sie den Hörer los und entfernte sich langsam vom Telefon. Sie hörte, wie eine Ehefrau im Fernseher ihren Mann anflehte, sie nicht wegen ihrer jüngeren Schwester zu verlassen. Dann trat sie hinaus auf ihren kleinen Balkon und ließ den Blick über den Central Park wandern, dann ein wenig nach rechts bis zum Metropolitan Museum. Viele Menschen, überwiegend Touristen, die meisten in kurzen Hosen, saßen auf der Treppe, lasen, lachten, unterhielten sich, aßen Hot Dogs vom Theodolphus-Imbiss-Stand. Vermutlich befanden sich unter ihnen auch ein paar Kiffer, ein paar Taschendiebe, und ganz in der Nähe bemerkte sie zwei berittene Polizisten. Die Pferde hoben und senkten unruhig ihre Köpfe, sie waren aus irgendeinem Grund nervös. Die Sonne brannte auf die Erde. Es war erst Mitte Juni, doch die verfrühte Hitzewelle wollte immer noch kein Ende nehmen. Im Inneren der Wohnung war es gut zehn Grad kälter. Zu kalt, zumindest für sie, aber der Thermostat ließ sich nicht regulieren.
Da klingelte das Telefon erneut. Sie konnte es durch die halb verglaste Tür deutlich hören.
Sie fuhr herum und wäre beinahe über das Geländer gestürzt. Nicht, dass sie es nicht erwartet hätte. Das war es nicht, es wirkte nur so unvereinbar mit der Normalität des Lebens da draußen.
Sie nahm alle Kraft zusammen und ließ ihren Blick wieder durch das hübsche, pastellfarbene Wohnzimmer ihrer Mutter schweifen, zu dem Glastischchen neben dem Sofa und zu dem weißen Telefon, das auf dem Tischchen stand und klingelte, klingelte.
Sie ließ es noch weitere sechsmal klingeln. Dann war ihr klar, dass sie den Hörer abnehmen musste. Der Anruf könnte ja auch mit ihrer Mutter zu tun haben, ihrer schwer kranken Mutter, die im Sterben lag. Aber sie wusste natürlich, dass er es war. Doch das spielte keine Rolle. Wusste er eigentlich, wieso sie das Telefon überhaupt noch angeschlossen hatte? Über alles andere schien er Bescheid zu wissen, aber über ihre Mutter hatte er noch kein einziges Wort verloren. Sie wusste, dass sie keine Wahl hatte. Beim zehnten Läuten nahm sie ab.
»Rebecca, ich möchte, dass du noch einmal auf den Balkon hinausgehst. Schau zu der Stelle, wo die Polizisten mit den Pferden stehen. Jetzt, Rebecca.«
Sie legte den Hörer zur Seite und trat noch einmal hinaus auf den Balkon. Die Glastür ließ sie offen stehen und schaute zu den Polizisten hinunter. Sie wandte den Blick nicht ab. Sie wusste, dass etwas Furchtbares geschehen würde, sie wusste es einfach, sie konnte absolut nichts dagegen tun, konnte nur zuschauen und abwarten. Drei Minuten lang wartete sie. Als sie langsam zu der Überzeugung gelangte, dass der Mann sie jetzt mit anderen, neuen Mitteln terrorisieren wollte, gab es eine laute Explosion.
Sie sah, wie beide Pferde sich wild aufbäumten. Einer der Polizisten wurde abgeworfen. Er landete in einem Busch und dicker Rauch stieg auf, der die Szenerie verhüllte.
Als der Rauch sich ein wenig verzogen hatte, sah sie eine alte Obdachlose auf dem Bürgersteig liegen. Ihr Leiterwagen war in Stücke gerissen worden, die, zusammen mit ihren Habseligkeiten, um sie herum verstreut lagen. Papierfetzen flatterten auf den Bürgersteig nieder. Eine große Flasche mit Ginger Ale war zerbrochen, und die Flüssigkeit ergoss sich über die Turnschuhe der alten Frau. Die Zeit schien still zu stehen. Dann, urplötzlich, geriet alles in Bewegung, und ein heilloses Durcheinander entstand. Einige der Menschen, die auf den Eingangsstufen des Museums gesessen hatten, rannten zu der alten Frau.
Die Polizisten waren sofort zur Stelle, derjenige, der von seinem Pferd abgeworfen worden war, humpelte beim Laufen. Sie brüllten und fuchtelten mit den Armen herum – ob wegen des Blutbades oder wegen der herbeieilenden Menschen, das konnte Becca nicht sagen. Sie sah, wie die Pferde die Köpfe hochwarfen und angesichts des Rauchs und des Sprengstoffgeruchs nervös herumtänzelten. Becca stand wie gelähmt da und schaute zu. Die alte Frau bewegte sich nicht. Becca wusste, dass sie tot war. Ihr Verfolger hatte eine Bombe explodieren lassen und diese arme alte Frau getötet. Warum? Nur, um sie noch mehr in Angst und Schrecken zu versetzen? Sie war doch jetzt schon so verstört, dass sie ihr Leben kaum noch bewältigen konnte. Was hatte er eigentlich vor? Sie war aus Albany weggegangen, hatte den Stab des Gouverneurs ohne jede Ankündigung verlassen und sich nicht einmal mehr telefonisch gemeldet.
Langsam ging sie ins Wohnzimmer zurück und schloss die Glastür sorgfältig hinter sich zu. Sie schaute das Telefon an und hörte ihn ihren Namen sagen, immer und immer wieder. Rebecca, Rebecca. Ganz langsam legte sie auf. Sie fiel auf die Knie und riss das Kabel aus der Dose. Das Telefon im Schlafzimmer klingelte und hörte nicht auf.
Sie drückte sich dicht an die Wand, die Handflächen gegen die Ohren gepresst. Sie musste etwas unternehmen. Sie musste mit der Polizei sprechen. Noch einmal. Jetzt, wo jemand ums Leben gekommen war, würden sie ihr doch ganz bestimmt glauben, dass ein Verrückter sie terrorisierte, sie verfolgte, dass er jemanden umgebracht hatte, um ihr zu zeigen, dass er es ernst meinte.
Dieses Mal mussten sie ihr einfach glauben.
Riptide, Maine, sechs Tage später
Sie rollte auf die Zufahrt der Texaco-Tankstelle, winkte dem Mann in der kleinen Glaskabine zu und füllte ihren Tank mit Normalbenzin. Sie befand sich am Rand des malerischen Städtchens Riptide, das sich von einem kleinen Hafen aus in Nord-Süd-Richtung ausgebreitet hatte. Im Hafenbecken lagen zahlreiche Segelboote, Motorboote und Fischerboote. Hummer, dachte sie, und sog den Atem tief ein. Die Luft roch nach Salzwasser, Algen und Fisch, dazu ein Hauch Wildblumen, deren süßer Duft sich leicht über die Meeresbrise gelegt hatte.
Riptide im Bundesstaat Maine.
Sie befand sich meilenweit hinter dem Mond, in der Einöde, an einem Ort, den niemand kannte, mit Ausnahme einiger weniger Sommertouristen. Einhundert Kilometer nördlich von Christmas Cove, einem wunderschönen kleinen Küstenstädtchen, das sie in ihrer Kindheit einmal zusammen mit ihrer Mutter besucht hatte.
Zum ersten Mal seit zweieinhalb Wochen fühlte sie sich wieder sicher. Sie spürte das Kitzeln der salzigen Luft auf ihrer Haut und ließ die warme Brise mit ihrem Haar spielen, sodass es ihr um die Wangen flatterte.
Sie hatte sich die Kontrolle über ihr Leben zurückgeholt. Aber was war mit Gouverneur Bledsoe? Es würde ihm bestimmt nichts geschehen, das durfte nicht sein. Er war ja ständig von Polizisten umgeben, die ihm die Zähne putzten und unter seinem Bett schliefen – ganz gleich, wen er bei sich hatte – und sich in seinem Badezimmer versteckten, das an das große quadratische Büro mit dem riesigen Mahagoni-Schreibtisch angrenzte. Es würde ihm nichts geschehen. Der Wahnsinnige, der sie bis vor sechs Tagen noch tyrannisiert hatte, hatte keine Chance, auch nur in seine Nähe zu kommen. Die Hauptstraße von Riptide hieß West Hemlock, westlicher Schierling. Einen östlichen Schierling gab es nicht, es sei denn, jemand hätte direkt in den Atlantik fahren wollen.
Sie fuhr bis fast ans Ende der Straße und gelangte zu einer Frühstückspension im viktorianischen Stil mit Namen »Errol Flynn’s Hammock«. Auf dem Dachfirst befand sich ein Ausguck mit einem schwarzen Geländer. Die Außenfassade war mit mindestens fünf verschiedenen Farben gestrichen. Perfekt. »›Errol Flynn’s Hängematte‹«, sagte sie zu dem Mann hinter dem voluminösen Mahagonitresen, »das gefällt mir.«
»Ja«, sagte er und schob ihr das Gästebuch hin, »mir gefällt es auch. Ich bin Scotty, schon immer gewesen. Unterschreiben Sie hier, ich beam Sie dann rauf.«
Sie lächelte und unterschrieb mit Becca Powell. Sie hatte Colin Powell schon immer bewundert. Er hatte bestimmt nichts dagegen, wenn sie sich für eine Weile seinen Namen ausborgte. Für eine Zeit lang würde es keine Becca Matlock mehr geben.
Sie war in Sicherheit.
Aber warum, so fragte sie sich immer wieder, warum hatte die Polizei ihr nicht geglaubt? Und trotzdem stand der Gouverneur immer noch unter Sonderbewachung. Das war wenigstens etwas.
2
New York City, 15. Juni
Sie boten Becca einen unbequemen, wackeligen Stuhl an. Sie legte eine Hand auf die zerkratzte Tischplatte, blickte die Frau und die beiden Männer an und wusste, dass sie sie für eine Verrückte hielten oder, höchstwahrscheinlich, sogar für etwas noch Schlimmeres.
Außerdem befanden sich noch drei weitere Männer im Raum. Sie lehnten in einer Reihe an der Wand gleich neben der Tür. Niemand hatte sie vorgestellt. Sie fragte sich, ob sie vom FBI waren. Vermutlich, da sie ja von der Drohung gegen den Gouverneur berichtet hatte, und außerdem trugen sie dunkle Anzüge, weiße Hemden und blaue Krawatten. Noch nie zuvor hatte sie in einem einzigen Zimmer so viele auf Hochglanz polierte Schuhspitzen gesehen.
Detective Morales, ein schmächtiger, gut aussehender Mann mit schwarzen Augen, sagte leise: »Miss Matlock, wir versuchen ja, das alles zu verstehen. Sie behaupten also, er habe diese alte Frau in die Luft gesprengt, nur um Ihre Aufmerksamkeit zu bekommen? Aus welchem Grund? Warum sie? Was will er? Wer ist er?«
Sie wiederholte ihre ganze Aussage noch einmal, dieses Mal noch langsamer, beinahe Wort für Wort. Schließlich, nachdem sie die versteinerten Gesichter der Männer gesehen hatte, versuchte sie es noch einmal. Sie beugte sich nach vorne und legte die gefalteten Hände auf den Holztisch, ohne dabei den Klumpen aus längst schon getrockneten Essensresten zu berühren. »Hören Sie, ich habe nicht die geringste Ahnung, wer er ist. Ich weiß, dass es ein Mann ist, aber ob alt oder jung, kann ich nicht sagen. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich seine Stimme von den vielen Telefonanrufen her kenne. Erst hat er mich in Albany angerufen, und dann ist er mir hierher nach New York gefolgt. In Albany habe ich ihn überhaupt nicht zu Gesicht bekommen, aber hier schon. Er ist allerdings niemals so dicht herangekommen, dass ich ihn genau erkennen konnte, aber ich bin mir sicher, dass er es war. Dreimal habe ich ihn gesehen, zu unterschiedlichen Zeiten. Das habe ich Ihnen doch schon vor acht Tagen erzählt, Detective Morales.«
»Ja«, sagte Detective McDonnell, der aussah, als würde er sich schon zum Frühstück einen Verdächtigen braten. Sein verknitterter Anzug schlotterte an seinem langen, dünnen Körper. Er sagte mit kalter Stimme: »Das kennen wir doch alles schon. Wir haben auch etwas unternommen. Ich habe mit den Kollegen in Albany Kontakt aufgenommen, als wir hier keine Spur von dem Kerl entdecken konnten. Wir haben all unsere Aufzeichnungen verglichen und alles gründlich besprochen.«
»Was kann ich Ihnen denn sonst noch sagen?«
»Sie haben gesagt, er nennt Sie Rebecca und kürzt Ihren Namen niemals ab?«
»Ja, Detective Morales. Er nennt mich immer Rebecca und sich selbst bezeichnet er immer als meinen Geliebten.«
Die zwei Männer wechselten einen Blick. Glaubten sie, dass es sich um einen rachsüchtigen Exfreund handelte?
»Ich habe Ihnen auch schon gesagt, dass ich seine Stimme nicht wiedererkenne. Ich kenne diesen Mann nicht und habe ihn auch früher nicht gekannt. Da bin ich ganz sicher.«
Detective Letitia Gordon, neben Becca die einzige Frau im Raum, war groß gewachsen, hatte einen breiten Mund, sehr kurz geschnittene Haare und einen Minderwertigkeitskomplex. Ihre Stimme klang noch kälter als die von McDonnell: »Sie könnten es ja zur Abwechslung mal mit der Wahrheit versuchen. Ich habe langsam genug von dem ganzen Mist. Sie lügen, Miss Matlock. Hector hat wirklich alles getan, was in seiner Macht stand. Wir alle wollten Ihnen zu Anfang wirklich glauben, aber in Ihrer Umgebung war absolut niemand zu entdecken. Keine Menschenseele. Wir haben unsere Zeit damit verschwendet, drei Tage lang hinter Ihnen herzulaufen, für nichts und wieder nichts. Dann haben wir noch mal zwei Tage damit verbracht, jeden einzelnen Ihrer Hinweise zu verfolgen, wieder ohne Ergebnis. Was ist los mit Ihnen? Haben Sie gekokst?« Sie klopfte sich mit Zeige- und Mittelfinger an die Schläfe. »Sehnen Sie sich nach ein bisschen Aufmerksamkeit? Hat Ihnen Daddy nicht genug davon gegeben, als Sie ein kleines Mädchen waren? Nennt sich dieser Kerl, den Sie sich ausgedacht haben, deshalb Ihr ›Geliebter‹?«
Becca hätte Detective Gordon am liebsten geohrfeigt. Sie konnte sich jedoch bildlich vorstellen, wie diese Frau sie in der Luft zerfetzen würde, also war das wohl keine besonders schlaue Idee. Sie musste ruhig bleiben, logisch denken. Sie war diejenige im Raum, die kühlen Kopf bewahren musste. Mit schief gelegtem Kopf schaute sie die Frau an und sagte: »Warum sind Sie so wütend auf mich? Ich habe nichts verbrochen. Ich versuche einfach nur, Hilfe zu bekommen. Und jetzt hat er diese alte Frau umgebracht. Sie müssen ihn aufhalten. Oder sehen Sie das anders?«
Die beiden männlichen Beamten warfen sich erneut Blicke zu. Die Frau schüttelte angewidert den Kopf. Dann schob sie ihren Stuhl zurück und erhob sich. Sie beugte sich nach vorne und legte beide Hände auf die hölzerne Tischplatte, direkt neben den Klumpen aus getrockneten Essensresten. Ihr Gesicht war nur Zentimeter von Beccas entfernt, ihr Atem roch nach frischen Apfelsinen. »Sie haben sich das alles ausgedacht, stimmt’s? Es gab nie einen Kerl, der Sie angerufen hat und Ihnen gesagt hat, Sie sollen aus dem Fenster schauen. Als diese alte Pennerin von irgend so einem Wahnsinnigen in die Luft gejagt wurde, da haben Sie einfach Ihren Fantasietypen für die Bombe verantwortlich gemacht. Aber jetzt ist Schluss damit. Wir wollen Sie zu unserem Psychiater bringen, Miss Matlock. Jetzt sofort. Sie haben Ihre fünfzehn Minuten Ruhm und Ehre gehabt, jetzt muss das aufhören.«
»Ich werde selbstverständlich nicht zu einem Psychiater gehen, das ist ...«
»Entweder Sie gehen zum Psychiater, oder wir nehmen Sie fest.«
Ein Albtraum, dachte sie. Hier sitze ich also auf einer Polizeiwache und erzähle denen alles, was ich weiß, und die halten mich für verrückt. Langsam, die Augen auf Detective Gordon gerichtet, fragte sie: »Weshalb?«
»Sie sind ein öffentliches Ärgernis. Sie bringen falsche Anschuldigungen zu Protokoll und verschwenden mit Ihren Lügen unsere Arbeitszeit. Ich kann Sie nicht ausstehen, Miss Matlock. Am liebsten würde ich Sie in den Knast werfen, weil Sie uns so viele Scherereien bereitet haben, aber ich bin bereit, darauf zu verzichten, wenn Sie unseren Psychiater aufsuchen. Vielleicht kann er Ihnen ja den Kopf wieder zurechtrücken. Irgendjemand muss es tun, so viel steht jedenfalls fest.«
Langsam stand Becca auf. Sie schaute sich jeden Einzelnen im Raum genau an. »Ich habe die Wahrheit gesagt. Da draußen ist ein Wahnsinniger unterwegs, den ich nicht kenne. Ich habe Ihnen alles erzählt, was ich weiß. Er hat den Gouverneur bedroht. Er hat diese arme Frau vor dem Museum ermordet. Nichts davon habe ich mir ausgedacht. Ich bin nicht verrückt und ich nehme keine Drogen.«
Es hatte keinen Zweck. Sie glaubten ihr nicht.
Die drei Männer, die aufgereiht an der Wand des Verhörzimmers standen, blieben stumm. Einer von ihnen nickte Detective Gordon zu, als Becca den Raum verließ.
Dreißig Minuten später saß Becca Matlock in einem sehr bequemen Sessel, der sich in einem kleinen Raum mit nur zwei schmalen Fenstern befand, die den Blick auf zwei andere schmale Fenster freigaben. Auf der anderen Seite des Schreibtischs saß Dr. Burnett, ein Mann in den Vierzigern. Er war fast glatzköpfig, trug eine Designerbrille und schaute sie aus ernsten, müden Augen an.
»Ich verstehe einfach nicht, wieso die Polizei mir nicht glauben will«, sagte Becca und beugte sich vor.
»Dazu kommen wir noch. Also, Sie wollten nicht mit mir sprechen?«
»Sie sind mit Sicherheit ein netter Mensch, aber ich brauche bestimmt kein Gespräch mit Ihnen, zumindest nicht auf der professionellen Ebene.«
»Die Polizeibeamten sind sich da nicht so sicher, Miss Matlock. Erzählen Sie mir doch bitte mit eigenen Worten ein wenig über sich selbst und wann Sie Ihren Verfolger zum ersten Mal wahrgenommen haben.«
Schon wieder, dachte sie. Sie hatte dieselbe Geschichte schon so oft erzählt, dass ihre Stimme ganz matt wurde. Es war schwierig, überhaupt noch etwas dabei zu empfinden. »Ich bin die persönliche Referentin von Gouverneur Bledsoe und habe ein sehr hübsches Apartment in der Oak Street in Albany. Der erste Anruf kam vor zweieinhalb Wochen. Kein Gestöhne, keine Anmache, nichts dergleichen. Er meinte nur, dass er mich beim Joggen im Park beobachtet habe und dass er mich kennen lernen wolle. Aber er wollte mir nicht sagen, wer er war. Er meinte, ich würde ihn bald sehr gut kennen lernen und dass er mein Geliebter sein wollte. Ich habe gesagt, dass er mich in Ruhe lassen soll und habe aufgelegt.«
»Haben Sie vielleicht Freunden oder dem Gouverneur von diesem Anruf erzählt?«
»Erst, als er mich noch zweimal angerufen hatte. Dabei hat er auch gesagt, ich solle aufhören, mit dem Gouverneur zu schlafen. Er sei jetzt mein Geliebter, und deshalb solle ich nicht mit anderen Männern ins Bett gehen. Mit ruhiger Stimme hat er gesagt, dass er ihn umbringen würde, falls ich nicht damit aufhöre. Als ich dem Gouverneur davon erzählt habe, war natürlich sofort Alarmstufe Rot für jeden im Umkreis von zehn Kilometern, der eine Waffe tragen durfte.«
Er ließ nicht einmal die Andeutung eines Lächelns erkennen, starrte sie einfach nur weiter an.
Doch es machte Becca nichts aus. Sie sagte: »Sie haben sofort mein Telefon angezapft, aber irgendwie hat er es gewusst. Er ließ sich nicht aufspüren. Man hat mir gesagt, dass er irgend so ein elektrisches Gerät verwendet hat, das die Lokalisierung verhindert.«
»Gehen Sie mit Gouverneur Bledsoe ins Bett, Miss Matlock?«
Sie hatte diese Frage schon über ein Dutzend Mal gehört, immer und immer wieder, besonders aus dem Mund von Detective Gordon. Sie brachte sogar ein Lächeln zustande. »Ehrlich gesagt, nein. Vielleicht ist es Ihnen nicht aufgefallen, aber er könnte mein Vater sein.«
»Es gab da auch mal einen Präsidenten, der Ihr Vater hätte sein können, und eine Frau, die sogar noch jünger war als Sie, und beide schienen mit dieser Konstellation keine Probleme zu haben.«
Sie fragte sich, ob Gouverneur Bledsoe eine Monica Lewinsky politisch überleben würde, und musste beinahe lachen. Dann zuckte sie die Schultern.
»Also, Miss Matlock, schlafen Sie mit dem Gouverneur?«
Es war ihr aufgefallen, dass sich, sobald Sex mit ins Spiel kam, alle darauf stürzten – Medien, Öffentlichkeit, Polizisten, Freunde. Es kränkte sie noch immer, aber sie hatte die Frage mittlerweile schon so oft beantwortet, dass es nicht mehr so schlimm war. Sie merkte, dass ihn die Frage beschäftigte, zuckte noch einmal die Schultern und sagte: »Nein, ich habe nie mit Gouverneur Bledsoe geschlafen, und wollte das auch nie. Ich schreibe Reden für ihn, wirklich gute Reden, aber ich schlafe nicht mit ihm. Gelegentlich schreibe ich sogar eine Rede für Mrs. Bledsoe, und mit ihr schlafe ich auch nicht. Ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung, wieso dieser Mann glaubt, dass ich Sex mit dem Gouverneur habe. Ich habe keine Ahnung, wieso ihn das überhaupt interessieren könnte. Wieso hat er sich ausgerechnet den Gouverneur herausgesucht? Weil ich Zeit mit ihm verbringe? Weil er mächtig ist? Ich weiß es einfach nicht. Die Polizei in Albany hat noch nichts über den Mann herausgefunden. Aber dort glaubt man wenigstens nicht, dass ich lüge, anders als hier in New York. Ich hatte sogar einen Termin mit einem Polizeipsychologen, der mir Tipps gegeben hat, wie ich bei seinen Anrufen reagieren sollte.«
»Miss Matlock, die Polizei in Albany glaubt sehr wohl, dass Sie lügen. Zu Anfang war das nicht der Fall, aber mittlerweile schon. Fahren Sie bitte fort.«
Einfach so? Er sagte ihr, dass alle sie für eine Lügnerin hielten, und dann sollte sie einfach fortfahren? »Was soll das heißen?«, fragte sie zögernd. »Man hat mir gegenüber nie eine Andeutung gemacht.«
»Das ist der Grund, warum unsere Beamten Sie zu mir geschickt haben. Sie haben mit den Kollegen in Albany gesprochen. Dort war niemandem ein Verfolger aufgefallen, und so glaubt man, dass Sie aus irgendeinem Grund ein wenig verwirrt sind. Vielleicht hatten Sie ein Auge auf den Gouverneur geworfen und wollten so seine Aufmerksamkeit gewinnen?«
»Ach so, ich verstehe. Vielleicht so eine Art verhängnisvolle Begierde?«
»Nein, ganz bestimmt nicht. Das hätten Sie nicht sagen dürfen. Dafür ist es viel zu früh.«
»Wofür ist es zu früh? Dass ich versuche, das alles zu begreifen?«
In seinen Augen blitzte Wut auf. Sie fühlte sich gleich besser.
»Sprechen Sie einfach weiter, Miss Matlock. Nein, streiten Sie noch nicht mit mir. Erzählen Sie mir erst noch ein bisschen mehr. Ich muss Sie verstehen. Dann können wir gemeinsam klären, was mit Ihnen eigentlich los ist.«
Das glaubst aber auch nur du, dachte sie. Ein Auge auf den Gouverneur geworfen? Na, klar. Das war doch ein Witz! Bledsoe würde mit jeder Nonne schlafen, wenn er nur unter ihre Kutte käme. Neben ihm wirkte Bill Clinton so standhaft wie Eisenhower, oder hatte der auch eine Geliebte gehabt? Männer und Macht – diese Verbindung schien immer Hand in Hand mit unerlaubtem Sex zu gehen. Und Bledsoe? Er hatte bis jetzt einfach Glück gehabt. Er war noch nicht an eine Praktikantin wie Monica geraten, die sich in ihrer Gier nicht einfach wieder ins Unterholz zurückzog, wenn er mit ihr fertig war.
»Also gut«, sagte sie. »Ich bin nach New York gekommen, um diesem Wahnsinnigen zu entfliehen. Ich hatte ... ich habe schreckliche Angst vor ihm und vor dem, was er vorhat. Außerdem lebt meine Mutter hier. Sie ist schwer krank, und ich möchte bei ihr sein.«
»Sie wohnen im Moment im Apartment Ihrer Mutter, nicht wahr?«
»Ja. Sie liegt im Lenox Hill Hospital.«
»Was hat sie denn?«
Becca schaute ihn an und wollte die Worte aussprechen, doch sie blieben ihr im Hals stecken. Sie räusperte sich, und schließlich kam es heraus: »Sie liegt im Sterben. Gebärmutterkrebs.«
»Das tut mir leid. Sie sagen, dass dieser Mann Ihnen hierher nach New York gefolgt ist?«
Becca nickte. »Hier habe ich ihn auch zum ersten Mal gesehen, gleich nach meiner Ankunft in New York, auf der Madison Avenue, ungefähr auf Höhe der fünfzigsten Straße. Er tauchte rechts von mir immer wieder in der Menschenmenge unter und dann wieder auf. Er trug eine blaue Windjacke und eine Baseball-Mütze. Woher ich weiß, dass er es war? Das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß es einfach. Tief im Innersten habe ich gespürt, dass er es war. Und ihm war klar, dass ich ihn bemerkt hatte, da bin ich mir ganz sicher. Leider habe ich ihn nicht deutlich genug gesehen, sodass ich nur eine ungefähre Vorstellung von seinem Aussehen habe.«
»Und wie wäre die?«
»Er ist groß und schlank. Wie alt? Ich weiß es beim besten Willen nicht. Die Baseball-Mütze hat seine Haare verdeckt, und er trug eine Pilotenbrille mit stark abgedunkelten, undurchsichtigen Gläsern, außerdem ganz normale Jeans und die weite Windjacke.« Sie unterbrach sich für einen Augenblick. »Das alles habe ich der Polizei schon zigmal erzählt. Wieso interessiert Sie das?«
Sein Blick sagte alles. Er wollte wissen, wie genau, wie ausgefeilt ihre Beschreibungen waren, wie sorgfältig sie ihren Fantasieverfolger ausgeschmückt hatte. Und jedes einzelne dieser wunderhübschen Details entstammte ihrer Einbildung, ihrer kranken Einbildung.
Sie riss sich zusammen. Auf sein Zögern hin erklärte sie: »Er hat sich weggeduckt, als ich mich nach ihm umgedreht habe. Dann haben die Telefonanrufe wieder angefangen. Ich weiß, dass er mir dicht auf den Fersen ist. Er scheint immer genau zu wissen, wo ich bin und was ich gerade mache. Ich kann ihn regelrecht spüren, verstehen Sie?«
»Sie haben ausgesagt, dass er Ihnen nicht sagen möchte, was er von Ihnen will?«
»Ja, das stimmt, abgesehen davon, dass er den Gouverneur umbringen will, falls ich nicht aufhöre, mit ihm zu schlafen. Ich habe ihn gefragt, wieso, aber er hat nur geantwortet, dass er nicht will, dass ich mit einem anderen Mann Sex habe, dass er mein Geliebter sei. Aber irgendwie klang das eigenartig, als würde er es einfach nur sagen, ohne es wirklich zu meinen. Warum er das alles macht? Ich habe wirklich keine Ahnung. Lassen Sie mich ganz offen sprechen, Dr. Burnett. Ich bin nicht verrückt, ich habe schreckliche Angst. Falls das sein Ziel gewesen ist, dann hat er es auf jeden Fall geschafft. Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, wieso die Polizei mich in die Mangel nimmt, wieso man mir unterstellt, dass ich mir das alles aus irgendeinem verrückten Grund ausgedacht haben soll. Vielleicht können Sie mir jetzt glauben?«
Er war ein Seelenklempner, er hielt sich bedeckt. »Verraten Sie mir doch, warum dieser Mann Sie Ihrer Meinung nach verfolgt, warum er Sie anruft, warum Sie nicht glauben, dass er Ihr Geliebter sein möchte, warum das alles auf seine Obsession, auf seinen Wunsch, Sie zu besitzen, zurückzuführen sein soll.«
Sie schloss die Augen. Wieder und wieder hatte sie über dieses »Warum?« nachgedacht, ohne jedes Ergebnis. Nichts. Er hatte sie ausgewählt, aber wieso? Sie schüttelte den Kopf. »Zuerst hat er gesagt, dass er mich kennen lernen möchte. Was bedeutet das? Wenn er das gewollt hätte, weshalb ist er dann nicht einfach zu mir gekommen und hat sich persönlich vorgestellt? Wenn die Polizei einen Verrückten braucht, den sie zu Ihnen schicken kann, dann sollte sie nach ihm suchen. Was will er wirklich? Ich weiß es einfach nicht. Wenn ich auch nur die geringste Vermutung hätte, ich würde sie Ihnen sagen, glauben Sie mir. Und dass er mein Geliebter sein will? Nein, das glaube ich nicht.«
Er hatte sich vorgebeugt und schaute sie mit aneinander gelegten Fingerspitzen durchdringend an. Was sahen seine Augen? Was dachte er? Klangen ihre Worte verrückt? Ganz offensichtlich, denn als er mit sehr leiser, sanfter Stimme sagte: »Wir beide, wir müssen jetzt über Sie reden, Miss Matlock«, da wusste sie, dass er ihr nicht glaubte, dass er ihr wahrscheinlich keinen Augenblick lang geglaubt hatte. Mit derselben sanften Stimme fuhr er fort: »Wir haben es hier mit einem großen Problem zu tun. Wenn wir nicht eingreifen, dann wird es immer größere Ausmaße einnehmen, und das macht mir Sorge. Sind Sie vielleicht schon bei einem Psychiater in Behandlung?«
Sie hatte ein großes Problem? Langsam stand sie auf und legte die Hände auf seinen Schreibtisch. »Sie haben Recht, Doktor, ich habe ein großes Problem. Nur erkennen Sie es nicht, oder Sie wollen es nicht erkennen. Das macht es vermutlich leichter.«
Sie schnappte sich ihre Handtasche und ging auf die Tür zu. Er rief ihr nach: »Sie brauchen mich, Miss Matlock. Sie brauchen meine Hilfe. Das ist die falsche Richtung. Kommen Sie zurück, und lassen Sie mich mit Ihnen reden.«
Sie sagte über die Schulter: »Sie sind ein Dummkopf, Sir«, und ging weiter. »Und was Ihre Objektivität betrifft: Vielleicht sollten Sie Ihre Haltung einmal mit Hilfe Ihrer ethischen Grundsätze überdenken, Doktor.«
Sie hörte, dass er ihr nachlief, knallte die Tür zu und rannte den langen, schmuddeligen Flur hinunter.
3
Mit gesenktem Kopf ging Becca weiter, zur Vordertür hinaus, die Augen starr auf ihre flachen Lederschuhe gerichtet. Aus dem Augenwinkel bemerkte sie einen Mann, der sich von ihr abwandte – schnell, zu schnell. Sie befand sich an der Police Plaza Nummer eins. Eine Million Menschen waren auf dem Platz, und alle waren in Eile wie alle New Yorker, einzig und allein auf ihr Ziel konzentriert, ohne auch nur einen Moment zu verschwenden. Aber dieser Mann beobachtete sie, das wusste sie. Er war es, er musste es sein. Wenn sie nur nahe genug an ihn herankommen könnte, sodass sie ihn beschreiben könnte. Wo war er jetzt?
Da drüben, an einem Abfalleimer. Er trug eine Sonnenbrille, es war dieselbe abgedunkelte Pilotenbrille, und eine rote Baseball-Mütze, diesmal mit dem Schirm nach hinten. Er war der Bösewicht bei diesem ganzen Theater, nicht sie.
Urplötzlich stieg die kalte Wut in ihr hoch, und sie brüllte: »Halt! Lauf nicht weg, du Feigling!«
Dann kämpfte sie sich durch die Menge, dorthin, wo sie ihn zuletzt gesehen hatte. Dort drüben, vor dem Gebäude, stand er. Er trug ein dunkelblaues Sweatshirt mit langen Ärmeln, dieses Mal keine Windjacke. Sie wandte sich in die gleiche Richtung. Flüche drangen an ihr Ohr, jemand rammte ihr einen Ellbogen in die Seite, aber sie kümmerte sich nicht darum: Sie wurde zur New Yorkerin – alle Aufmerksamkeit auf ein Ziel gerichtet und sofort ruppig, falls jemand es wagen sollte, ihr in den Weg zu treten. Sie schaffte es bis zur Ecke des Gebäudes, aber es war kein dunkelblaues Sweatshirt zu sehen. Auch keine Baseball-Mütze. Keuchend blieb sie stehen.
Wieso glaubte die Polizei ihr nicht? Was hatte sie bloß getan, dass alle sie für eine Lügnerin hielten? Wieso hatten die Polizisten in Albany ihr nicht geglaubt? Und jetzt hatte er diese arme alte Frau vor dem Museum umgebracht. Sie war doch nicht irgendein verrücktes Hirngespinst, sie war äußerst real, und sie lag in der Leichenhalle.
Becca blieb stehen. Sie hatte ihn aus den Augen verloren. Lange Zeit stand sie nur da, schwer atmend inmitten eines Menschenstroms, der sich vor ihr teilte, links und rechts an ihr vorbeischwappte und sich zwei Schritte hinter ihr wieder schloss.
Eine Dreiviertelstunde später saß Becca im Lenox Hill Hospital am Bett ihrer Mutter. Sie lag fast schon im Koma. Die Medikamente waren so stark, dass sie ihre eigene Tochter nicht wiedererkannte. Becca saß nur da und hielt ihre Hand. Sie sprach nicht von dem Verfolger, sondern erzählte von der Rede, die sie für den Gouverneur geschrieben hatte. Es ging um die kontrollierte Abgabe von Waffen, ein Thema, bei dem Becca mittlerweile Zweifel gekommen waren. »In allen fünf Stadtbezirken gelten dieselben, strengen Waffengesetze. Weißt du, ein Ladenbesitzer hat mir gesagt: ›Wer in New York eine Waffe kaufen will, muss sich auf einem Bein in eine Ecke stellen und bitte, bitte rufen.‹«
Sie unterbrach sich für einen Augenblick. Zum ersten Mal in ihrem Leben wünschte sie sich nichts sehnlicher als eine Pistole. Aber es gab keine Möglichkeit, sich kurzfristig eine zu beschaffen. Zunächst bräuchte sie dazu eine Erlaubnis, nach dem Kauf müsste sie dann fünfzehn Tage lang warten, und anschließend wahrscheinlich noch einmal ein halbes Jahr, bis die Behörden ihren persönlichen Hintergrund durchleuchtet hätten. Und dann müsste sie sich auf einem Bein in die Ecke stellen und »bitte, bitte« rufen. Zu ihrer schweigenden Mutter sagte sie: »Noch nie zuvor habe ich daran gedacht, mir eine Waffe zu besorgen, Mom, aber wer weiß? Das Verbrechen ist überall.«
Oh ja, sie wollte eine Pistole kaufen, aber bis sie die endlich in Händen halten würde, hätte ihr Verfolger sie längst schon umgebracht. Sie fühlte sich wie ein Opfer, das auf die Schlachtung wartet und nichts dagegen tun kann. Niemand würde ihr helfen. Sie hatte nur sich selbst, und wenn sie eine Waffe haben wollte, dann musste sie auf die Straße gehen. Und der Gedanke, irgendwelche Typen anzusprechen und nach einer Waffe zu fragen, ließ sie am ganzen Körper zittern.
»Es war eine tolle Rede, Mom. Natürlich musste ich den Gouverneur alles fein säuberlich abwägen lassen, das war klar, aber ich habe ihn sagen lassen, dass er Waffenbesitz nicht verbieten, sondern dafür sorgen will, dass Schusswaffen nicht in die Hände von Kriminellen gelangen. Ich habe die Vor- und Nachteile des Gesetzentwurfs der Regierung abgewogen – du weißt schon, zuerst die Meinung der National Rifle Association, dann die der HCI, die für eine strenge Kontrolle von Handfeuerwaffen eintritt.« Sie redete einfach weiter, tätschelte ihrer Mutter die Hand und ließ die Finger sanft über ihren Unterarm gleiten, immer auf der Hut, damit sie die Infusionsnadeln nicht berührte. »So viele deiner Freunde sind hier gewesen. Und sie machen sich große Sorgen. Sie alle haben dich lieb.«
Ihre Mutter lag im Sterben, das war eine unabänderliche Tatsache. Aber tief in ihrem Innersten, wo ihre Mutter von der ersten Erinnerung an gegenwärtig war, wo sie immer für sie da gewesen war, da konnte sie diese Tatsache einfach nicht akzeptieren. Sie dachte an die Jahre ohne sie, die noch vor ihr lagen, aber sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie das sein würde. Tränen schossen ihr in die Augen. Sie drängte sie zurück.
»Mom«, sagte sie und drückte ihre Wange auf den Unterarm ihrer Mutter. »Ich möchte nicht, dass du stirbst, aber ich weiß, dass der Krebs sehr schlimm ist und du die Schmerzen nicht ertragen könntest, wenn du bei mir bleiben würdest.« So, nun hatte sie es laut ausgesprochen. Langsam hob sie den Kopf. »Ich liebe dich, Mom. Ich liebe dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Vielleicht kannst du mich ja irgendwie hören und verstehen. Du sollst wissen, dass du für mich mein ganzes Leben lang der wichtigste Mensch gewesen bist. Vielen Dank dafür, dass du meine Mutter bist.«
Sie fand keine Worte mehr. Noch eine halbe Stunde lang blieb sie sitzen und blickte in das Gesicht ihrer Mutter, das bis vor ein paar Wochen noch so voller Leben gewesen war. Ein Gesicht, das unzählig viele verschiedene Ausdrücke annehmen konnte, und Becca kannte jeden einzelnen. Es war nun fast vorbei, sie konnte nichts mehr tun. Dann sagte sie: »Ich bin bald zurück, Mom. Ruh dich aus und lass dich nicht von den Schmerzen quälen. Ich liebe dich.«
Es war ihr klar, dass sie eigentlich davonlaufen müsste, dass dieser Mann, wer immer er war, sie irgendwann umbringen würde, und dass sie ihm schutzlos ausgeliefert war, falls sie hier bliebe. Die Polizei würde jedenfalls keinen Finger rühren. Aber, nein, sie würde ihre Mutter nicht verlassen.
Sie erhob sich, beugte sich hinunter und küsste die weiche, bleiche Wange ihrer Mutter. Dann strich sie ihr sanft übers Haar, das so dünn geworden war, dass hier und da sogar die Kopfhaut durchschimmerte. Eine Folge der Medikamente, hatte eine Schwester gesagt. Das kam vor. Ihre Mutter war eine so schöne Frau gewesen, groß gewachsen und mit ungewöhnlich hellblondem Haar, ohne eine Spur von anderen Farbtönen. Sie war immer noch schön, aber so regungslos, als wäre sie schon von dieser Welt gegangen. Nein, Becca würde sie nicht allein lassen. Der Kerl würde sie schon umbringen müssen, damit sie ihre Mutter verließ.
Sie hatte gar nicht bemerkt, dass sie schon wieder weinte, bis ihr eine Schwester ein Papiertaschentuch in die Hand drückte.
»Danke«, sagte sie, ohne den Blick von ihrer Mutter zu wenden.
»Gehen Sie nach Hause und schlafen Sie ein bisschen, Becca«, sagte die Schwester mit ruhiger, sanfter Stimme. »Ich passe auf sie auf. Gönnen Sie sich ein wenig Schlaf.«
Auf der ganzen Welt gibt es sonst niemanden, der für mich da ist, dachte Becca, als sie das Lenox Hill Hospital verließ. Wenn Mom nicht mehr lebt, bin ich ganz allein.
In dieser Nacht starb ihre Mutter. Sie sei einfach eingeschlafen, sagte der Doktor, ohne Schmerzen, ohne den nahenden Tod gespürt zu haben. Ein sanfter Übergang. Zehn Minuten nach dem Anruf klingelte das Telefon erneut.
Dieses Mal nahm sie den Hörer nicht ab. Am nächsten Tag bot sie die Wohnung ihrer Mutter zur Vermietung an, verbrachte die Nacht unter falschem Namen in einem Hotel und veranlasste von dort aus alles Notwendige für die Beerdigung. Dann rief sie alle Freundinnen ihrer Mutter an, um sie zu einer kleinen privaten Totenfeier einzuladen.
Eineinhalb Tage später warf Becca den ersten Klumpen dunkler, satter Erde auf den Sarg ihrer Mutter. Sie sah zu, wie sich die schwarze Erde mit den tiefroten Rosen auf dem Sargdeckel vermischte. Sie vergoss keine Träne, aber alle Freundinnen ihrer Mutter weinten still vor sich hin. Sie ließ sich von jeder umarmen. Immer noch war es sehr heiß in New York, zu heiß eigentlich für Mitte Juni.
Als sie in ihr Hotelzimmer zurückkam, klingelte das Telefon. Ohne nachzudenken, nahm sie den Hörer ab.
»Du hast versucht, vor mir wegzulaufen, Rebecca. Das gefällt mir gar nicht.«
Das reichte. Jetzt hatte er das Fass zum Überlaufen gebracht. Ihre Mutter war tot, und es gab nichts mehr, das sie noch zurückhalten musste. »Auf der Police Plaza neulich, da hätte ich dich beinahe erwischt, du erbärmlicher Feigling. Hast du dich vielleicht mal gefragt, was ich da gemacht habe, du Idiot? Angezeigt habe ich dich, du Mörder. Ja genau, ich habe dich gesehen. Du warst mit dieser lächerlichen Baseball-Mütze und dem dunkelblauen Sweatshirt unterwegs. Das nächste Mal erwische ich dich und verpasse dir eine Kugel genau zwischen deine verrückten Augen.«
»Die Bullen denken doch, du wärst verrückt. Ich bin nicht mal ein Pünktchen auf deren Radarschirm, ich existiere überhaupt nicht.« Seine Stimme bekam jetzt einen tieferen, schärferen Ton. »Hör auf, mit dem Gouverneur zu schlafen, sonst bringe ich ihn um, genau wie die blöde alte Pennerin. Das habe ich dir schon zigmal gesagt, aber du hast nicht auf mich gehört. Ich weiß, dass er dich in New York besucht hat. Alle wissen das. Hör auf, mit ihm zu schlafen.«
Sie begann zu lachen und schien gar nicht mehr aufhören zu können. Doch dann fing er an zu schreien, nannte sie eine Schlampe und eine dumme Nutte und bedachte sie mit noch mehr, zum Teil außerordentlich bösartigen Schimpfwörtern.
Sie keuchte. »Sex mit dem Gouverneur? Spinnst du? Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Zwei davon sind älter als ich.« Und dann, weil es nicht länger wichtig war und weil er in Wirklichkeit vielleicht sowieso nicht existierte, sagte sie noch: »Der Gouverneur schläft mit jeder Frau, die er in das kleine Zimmerchen neben seinem Büro locken kann. Da müsste ich eine Nummer ziehen. Willst du die alle davon abhalten, mit ihm ins Bett zu gehen? Dann bist du bis ins nächste Jahrhundert beschäftigt, und das ist eine lange Zeit.«
»Es geht nur um dich, Rebecca. Du darfst nicht mehr mit ihm schlafen.«
»Jetzt hör mir mal zu, du bescheuerter Vollidiot. Ich würde überhaupt nur dann mit dem Gouverneur schlafen, wenn der Weltfrieden auf dem Spiel stünde. Und selbst dann wäre ich mir nicht hundertprozentig sicher.«
Der Widerling seufzte tatsächlich. »Lüg mich nicht an, Rebecca. Lass es sein, hast du mich verstanden?«
»Ich kann doch nichts sein lassen, was ich gar nicht gemacht habe.«
»Das ist wirklich schade«, sagte er, zum ersten Mal war er es, der die Verbindung unterbrach.
An diesem Abend wurde der Gouverneur vor dem Hilton Hotel durch einen Schuss in den Hals niedergestreckt. Dort hatte er an einer Wohltätigkeitsveranstaltung zu Gunsten der Krebsforschung teilgenommen. Er hatte Glück im Unglück gehabt, denn es waren über hundert Ärzte anwesend. Sie konnten sein Leben retten. Den Berichten zufolge war der Schuss von einem ausgezeichneten Distanzschützen aus großer Entfernung abgefeuert worden. Bislang gab es noch keinerlei Hinweise auf den Täter.
Als sie die Meldung hörte, sagte sie zu der Superman-Zeichentrickfigur, die lautlos über den Bildschirm ihres Fernsehers huschte: »Eigentlich war doch vorgesehen, dass er eine Wohltätigkeitsveranstaltung zu Gunsten gefährdeter Tierarten besucht.«
In diesem Augenblick begann ihre Flucht. Ihre Mutter war tot, und es gab nichts mehr, was sie hier noch hielt.
Auf nach Maine, auf der Suche nach Schutz.
Riptide, Maine, 22. Juni
Becca sagte: »Ich nehme es.«
Rachel Ryan, die Maklerin, strahlte sie an, machte aber sofort einen Rückzieher. »Vielleicht geht Ihnen das alles zu schnell, Miss Powell. Möchten Sie unter Umständen ein bisschen darüber nachdenken? Ich lasse es natürlich noch putzen, aber das Haus ist alt, und das gilt natürlich auch für die Ausstattung und die Badezimmer. Und die Möbel sind auch nichts Besonderes. Es steht ja seit Mr. Marleys Tod vor vier Jahren leer.«
»Das haben Sie mir alles schon gesagt, Mrs. Ryan. Mir ist klar, dass es ein altes Haus ist. Aber ich mag es trotzdem, es hat Charme. Und es ist ziemlich groß. Das gefällt mir, ich habe gerne viel Platz. Außerdem steht es hier ganz für sich am Ende der Straße. Meine Privatsphäre ist mir sehr wichtig.« Das war zwar eine Untertreibung, aber es entsprach voll und ganz der Wahrheit. »Und hier hat also Mr. Marley gelebt?«
»Mr. Jacob Marley, genau. Er ist mit siebenundachtzig Jahren gestorben, ganz friedlich eingeschlafen. Die letzten dreißig Jahre seines Lebens hat er sehr zurückgezogen gelebt. Sein Vater hat im Jahr 1907 die Stadt gegründet, nachdem in einer einzigen heißen Sommernacht etliche seiner Geschäfte in Boston abgebrannt waren. Es hieß immer, dass er Feinde hatte, die dafür verantwortlich waren. Mr. Marley senior war kein beliebter Mann, er war einer der berüchtigten ›Raubritter‹, die alles und jeden schonungslos ausgebeutet haben. Aber dumm war er nicht, und deshalb war ihm klar, dass es gesünder war, Boston zu verlassen. Also hat er sich hier niedergelassen. Ein kleines Fischerdorf gab es schon vorher, und das hat er einfach übernommen und umbenannt.«
Becca klopfte der Frau auf die Schulter. »Schon gut. Ich habe darüber nachgedacht, Mrs. Ryan. Ich gebe Ihnen eine Zahlungsanweisung, weil ich hier im Moment noch kein Bankkonto habe. Können Sie das Haus heute noch reinigen lassen, damit ich morgen Nachmittag einziehen kann?«
»Kein Problem, und wenn ich es selber putzen muss. Aber wir haben ja Sommer, da kann ich ungefähr ein Dutzend Schüler auftreiben und hierher bestellen. Machen Sie sich keine Sorgen. Oh ja, einer von ihnen ist der süßeste kleine Junge, den Sie sich vorstellen können. Er wohnt mit seinem Vater gar nicht weit von hier und sagt ›Tante‹ zu mir, obwohl ich gar nicht seine richtige Tante bin. Er heißt Sam, und ich war bei seiner Geburt dabei. Seine Mutter war meine beste Freundin und ich ...«
Becca hob eine Augenbraue und hörte höflich zu, aber offensichtlich hatte Rachel Ryan nun genug geredet.
»Dann wäre soweit alles klar, Miss Powell. Wir sehen uns dann in ein paar Tagen. Rufen Sie mich an, wenn es irgendwelche Probleme gibt.«
Und damit war es erledigt. Becca war stolze Mieterin eines alten viktorianischen Schmuckstücks mit acht Schlafzimmern, drei großen Badezimmern, einer Küche, die vor 1910 garantiert enormen Eindruck gemacht hatte, und insgesamt zehn offenen Kaminen. Und, genau wie sie zu Rachel Ryan gesagt hatte, lag es abgeschirmt am Ende des nach der Tollkirsche benannten Belladonna Drive, fernab von neugierigen Nachbarn, und genau das wollte sie. Das nächste Haus lag fast einen Kilometer weit entfernt. Ihr Grundstück war an drei Seiten von dicken Ahorn- und Tannenbäumen umgeben, und vom Ausguck auf dem Dachfirst aus hatte man einen spektakulären Blick auf das Meer.
Am Donnerstagnachmittag zog sie ein und summte dabei vor sich hin. Sie kam sogar ein wenig ins Schwitzen. Sie putzte alle acht Schlafzimmer, obwohl sie gar nicht vorhatte, sie zu benutzen. Sie genoss die Großzügigkeit des Hauses. Nie wieder wollte sie nur in einem Apartment wohnen.
Von einem Typen, den sie in einem Restaurant in Rockland, Marine, kennen gelernt hatte, hatte sie eine Pistole gekauft. Sie war damit ein großes Risiko eingegangen, aber Gott sei Dank war alles gut verlaufen. Es war eine schöne Waffe, eine Coonan .357 Magnum Automatik. Der Kerl war mit ihr einfach in das Sportgeschäft nebenan gegangen. Dort gab es einen Schießstand, und er hatte ihr den Umgang mit der Waffe gezeigt. Dann hatte er sie gefragt, ob sie mit ihm ins Motel wollte. Aber er war ein Kinderspiel im Vergleich zu dem Wahnsinnigen in New York. Sie musste nichts weiter tun, als unmissverständlich »Nein« zu sagen. Es gab keinerlei Anlass, die neue Waffe zu ziehen.
Vorsichtig legte sie die Coonan in die oberste Schublade ihres Nachttischchens, ein alter Mahagonischrank mit verrosteten Scharnieren. Als sie die Schublade wieder zuschob, wurde ihr mit einem Mal bewusst, dass sie nicht geweint hatte, als ihre Mutter gestorben war. Und bei der Trauerfeier auch nicht. Aber jetzt, als sie ein Foto ihrer Mutter vorsichtig auf das Nachttischchen stellte, spürte sie, wie ihr die Tränen die Wangen hinunterrannen. Sie stand da und betrachtete das Bild. Es war vor fast zwanzig Jahren aufgenommen worden und zeigte eine wunderschöne junge Frau, zart gebaut und voller Anmut. Sie lachte und drückte Becca an sich. Becca wusste nicht mehr genau, wo sie an jenem Tag gewesen waren, vielleicht oben im nördlichen Teil des Bundesstaates New York. Als Becca etwa sechs, sieben Jahre alt gewesen war, hatten sie einige Zeit dort oben verbracht. »Ach, Mom, es tut mir so leid. Wenn du nur dein Herz nicht an einen Toten gehängt hättest, vielleicht hättest du noch einmal lieben können, was meinst du? Du hattest so viel zu geben, so viel Liebe zu verschenken. Oh Gott, du fehlst mir so schrecklich.«
Sie legte sich auf das Bett, ein Kissen gegen die Brust gepresst, und weinte, bis sie keine Tränen mehr hatte. Dann stand sie auf, wischte die dünne Staubschicht von dem Foto und stellte es vorsichtig wieder hin. »Jetzt bin ich in Sicherheit, Mom. Ich habe keine Ahnung, was das alles zu bedeuten hat, aber zumindest bin ich jetzt vorerst in Sicherheit. Dieser Mann wird mich hier nicht finden. Wie auch? Ich weiß, dass mir niemand gefolgt ist.«
Während sie so mit dem Foto ihrer Mutter sprach, wurde ihr klar, dass sie auch um den Vater trauerte, den sie niemals kennen gelernt hatte: Thomas Matlock, gefallen in Vietnam, als sie noch ein kleines Baby war. Ein Kriegsheld. Aber ihre Mutter hatte ihn nicht vergessen, niemals. Und bevor die Medikamente sie in das künstliche Koma versetzt hatten, hatte sie seinen Namen geflüstert: »Thomas, Thomas.«
Er war jetzt über fünfundzwanzig Jahre tot. Eine lange Zeit, eine andere Welt. Aber die Menschen, die übereinander herfielen, um für sich selbst das größte Stück zu ergattern, waren die Gleichen geblieben – es gab gute und schlechte Menschen, wie immer. Er hatte sie noch getroffen, bevor er in den Krieg gezogen war, hatte ihre Mutter erzählt, er hatte sie getroffen und umarmt und sie geliebt. Aber Becca konnte sich nicht an ihn erinnern.
Sie hängte ihre Kleider auf und richtete sich das altmodische Badezimmer ein, in dem die Badewanne mit den tatzenförmigen Füßen stand. Sogar zwischen den Krallen hatten die Teenager geputzt. Saubere Arbeit.
Es klopfte an die Tür. Becca ließ das Handtuch fallen und erstarrte.
Es klopfte noch einmal.
Das war er nicht. Er hatte keine Ahnung, wo sie war. Er konnte sie unmöglich aufgespürt haben. Das war wahrscheinlich der Kerl, der die Klimaanlage im Wohnzimmer überprüfen wollte. Oder die Müllabfuhr oder ...
»Jetzt krieg nicht gleich Verfolgungswahn«, sagte sie zu dem blauen Handtuch, während sie es aufhob und über den hölzernen Handtuchhalter hängte. »Ist dir übrigens klar, dass du in letzter Zeit ziemlich viel mit dir selbst geredet hast? Und das, was du so von dir gibst, klingt nicht besonders schlau.« Aber andererseits, so dachte sie, während sie die alten, knarrenden Stufen zur Eingangshalle hinunterging, und wenn ich den Handtuchhalter ansingen würde, wen soll das schon interessieren?
Und dann starrte sie den großen Mann an, der in ihrer Haustür stand. Es war Tyler, sie kannte ihn aus dem College. Damals war sie eine seiner wenigen engeren Bekannten gewesen. Er war ein ehrgeiziger Einzelgänger gewesen, und er hatte nur wenige Freunde gehabt, die keine Bücherwürmer waren. Nur – jetzt sah er überhaupt nicht mehr nach Streber aus. Er trug keine schwere Hornbrille mehr, und aus seiner Brusttasche ragte auch kein Füllerdeckel. Keine hängenden Schultern und Hochwasserhosen mehr, unter deren Rand die weißen Socken sichtbar wurden. Er trug enge Jeans, die ihm wirklich ausgezeichnet standen, die Haare waren lang und die Schultern breit genug, um eine Frau zweimal hinschauen zu lassen. Er war durchtrainiert und topfit – in der Tat ein gut aussehender Mann. Verblüffend. Sie musste erst ein paarmal schlucken, bevor sie sich wieder im Griff hatte.
»Tyler? Tyler McBride? Bist du es wirklich? Tut mir leid, dass ich dich so anstarre, aber du siehst so verändert aus. Und trotzdem, du bist es. Um ehrlich zu sein, du siehst sehr sexy aus.«
Er schenkte ihr ein breites Grinsen und nahm ihre Hände zwischen seine. »Becca Matlock, schön, dich zu sehen. Ich bin herübergekommen, um meine neue Nachbarin zu begrüßen, aber ich hätte mir niemals träumen lassen, dass du das bist. Ist Powell der Name deines Mannes? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wieso es dich hierher ans Ende der Welt verschlagen hat. Willkommen in Riptide.«
4
Lachend drückte sie seine Hände und sagte: »Mein Gott, du bist wirklich kein vertrockneter Bücherwurm mehr. Weißt du was, Tyler, wegen dir bin ich hier. Ich hätte dich noch angerufen, ich bin bloß noch nicht dazu gekommen. Sollte ich tatsächlich das Glück haben, dass du mein Nachbar bist?«
Er lächelte sie auf gewinnende Weise an, blieb einfach stehen und wartete. Hatte er eine Zahnspange getragen? Sie konnte sich nicht mehr erinnern. Aber das spielte sowieso keine Rolle, jetzt hatte er wunderschöne Zähne. Was für ein Unterschied. Unglaublich!
»Nun ja, in Riptide sind wir alle Nachbarn, aber es stimmt schon, ich wohne nur eine Querstraße weiter, in der Gum Shoe Lane.«
Sie ließ seine Hände los, auch wenn das eigentlich nicht ihrem Bedürfnis entsprach, und trat zurück. »Komm doch rein. Alles hier ist antik, auch die Möbel, aber der Sofabezug ist noch heil, und es ist schön gemütlich. Mrs. Ryan hat hier eine Armee von Teenagern zum Saubermachen durchgejagt, und sie haben ihre Sache recht gut gemacht. Komm rein, Tyler, komm rein.«
Sie schaffte es, auf dem uralten Herd zwei Tassen Tee zu kochen, während Tyler ihr vom Küchentisch aus zusah. »Wie meinst du das, du bist wegen mir hierhergekommen?«
Sie tauchte einen Teebeutel in jede der beiden Tassen mit heißem Wasser. »Ich habe mich daran erinnert, wie du von deinem Heimatort Riptide gesprochen hast. Du hast es deine Zuflucht genannt.« Sie machte eine kleine Pause und starrte auf ihre Teetasse hinunter. »Ich werde nie vergessen, wie du erzählt hast, dass Riptide mitten in der Einöde liegt, hinter dem Mond, so abgelegen, dass man beinahe vergessen könnte, dass es überhaupt existiert. Am Rand der Welt, sodass es fast ins Meer fällt, und niemand kennt es oder kümmert sich darum. Außerdem hast du noch gesagt, dass die Sonne nirgendwo in den Vereinigten Staaten früher aufgeht als in Riptide und dass der Himmel dann ein orangeroter Ball ist und das Wasser ein Feuerkessel.«
»Das habe ich gesagt? Ich wusste gar nicht, dass ich so eine poetische Ader habe.«
»Fast wortwörtlich, und es stimmt: Deshalb bin ich hierhergekommen. Meine Güte, Tyler, ich finde es noch immer unglaublich, wie sehr du dich verändert hast.«
»Jeder verändert sich, Becca. Auch du. Du bist jetzt noch schöner als damals auf dem College.« Er runzelte für einen Augenblick die Stirn, als wollte er sich das Bild genau ins Gedächtnis rufen. »Deine Haare sind dunkler, und an die braunen Augen und die Brille kann ich mich auch nicht erinnern, aber abgesehen davon würde ich dich jederzeit wiedererkennen.«
Mist, das war keine gute Nachricht. Sie schob die Brille höher.
Er nahm die Tasse mit dem Tee entgegen und sagte nichts mehr, bis sie sich ihm gegenüber an den Tisch gesetzt hatte. Dann lächelte er sie an und meinte: »Weshalb brauchst du einen Zufluchtsort?«
Was sollte sie ihm antworten?
Dass der Gouverneur ihretwegen in den Hals geschossen worden war? Nein, nein, dafür war sie nicht verantwortlich. Der Wahnsinnige hatte auf den Gouverneur geschossen. Sie zögerte.
Er bohrte nicht weiter und sagte stattdessen: »Du bist nach New York gegangen, stimmt’s? Du warst doch Schriftstellerin, wenn ich mich recht entsinne. Was hast du in New York gemacht?«
»Ich habe Reden geschrieben«, sagte sie beiläufig, »für Führungskräfte aus verschiedenen Unternehmen. Kaum zu glauben, dass du noch weißt, dass ich nach New York gegangen bin.«
»Bei Menschen, die ich mag, kann ich mich fast an alles erinnern. Wieso brauchst du einen Zufluchtsort? Nein, warte, wenn es mich nichts angeht, dann vergiss die Frage. Es ist nur ... ich mache mir Sorgen um dich.«
Sie war keine besonders gute Lügnerin, aber sie musste es versuchen. »Nein, nein, ist schon okay. Ich möchte aus einer wirklich schlechten Beziehung ausbrechen.«
»Dein Mann?«
Sie hatte keine Wahl. »Ja, mein Mann. Er ist sehr besitzergreifend. Ich wollte raus aus der Ehe, aber er wollte mich nicht lassen. Da habe ich mich an Riptide und deine Worte erinnert.« Vom Tod ihrer Mutter wollte sie ihm lieber nicht erzählen. Sie brachte es einfach nicht fertig, ihn mit einer Lüge zu verbinden. So zwang sie sich zu einem Schulterzucken und hob ihre Tasse, um sie mit leisem Klicken gegen seine zu stoßen. »Danke, Tyler, dass du auf dem College in Dartmouth warst und mir von deiner Heimat erzählt hast.«
»Ich bin froh, dass du hier bist«, erwiderte er und studierte mit ernstem Blick ihr Gesicht. »Wenn dein Mann hinter dir her ist, woher willst du dann wissen, dass er dir nicht bis zum Flughafen gefolgt ist? Mir ist schon klar, dass der Verkehr in New York wahnsinnig ist, aber wenn man wirklich an jemandem dranbleiben will, dann geht das auch.«
»Gut, dass ich eine ganze Menge Spionagegeschichten gelesen und Krimis gesehen habe.« Sie erzählte ihm, wie sie auf dem Weg zum John F. Kennedy Airport dreimal das Taxi gewechselt hatte. »Als ich dann am Terminal von United Airlines ausgestiegen bin, da war ich mir sicher, dass mir niemand gefolgt ist. Der Fahrer des letzten Taxis war ein gebürtiger New Yorker – von der Sorte gibt es nicht mehr viele. Er hat mir erzählt, dass er Queens genauso gut kennt wie den Liebhaber seiner Exfrau. Er war sich sicher, dass mir niemand gefolgt ist. Dann bin ich nach Boston geflogen und von da nach Portland, wo ich mir bei ›Big Frank’s‹ einen gebrauchten Toyota gekauft habe. Mit dem bin ich dann hierher gefahren, zu deinem Zufluchtsort. Er wird mich niemals aufstöbern.«
Sie hatte keine Ahnung, ob er ihr glaubte oder nicht. Na gut, die ganze Geschichte mit ihrer Flucht aus New York stimmte ja. Gelogen hatte sie nur, was den Grund anging.
»Ich hoffe wirklich, dass du Recht hast. Aber trotzdem werde ich gut auf dich aufpassen, Becca Powell.«