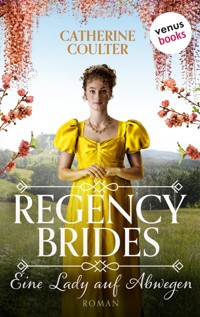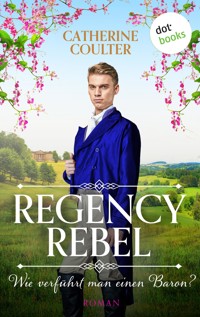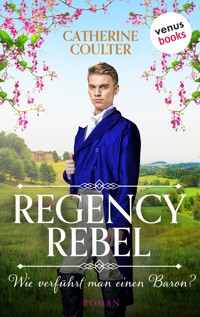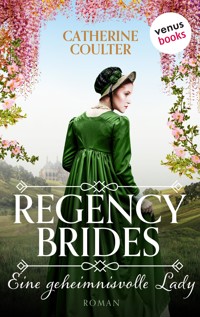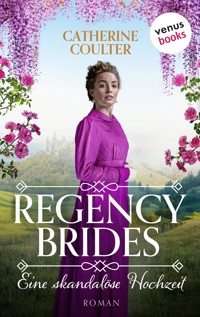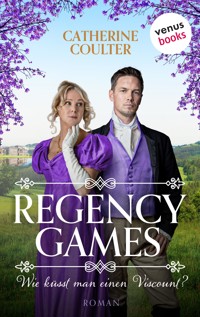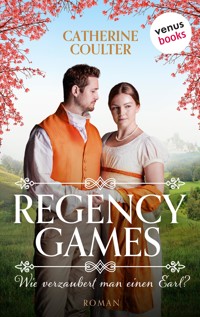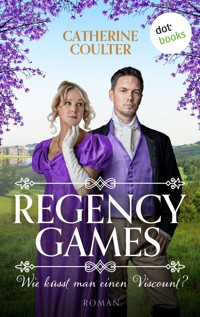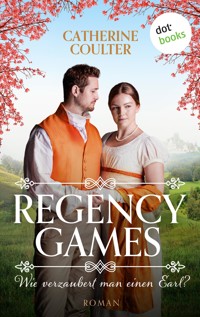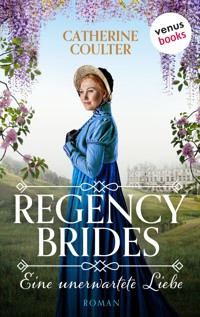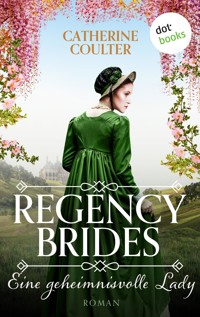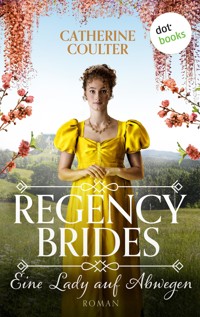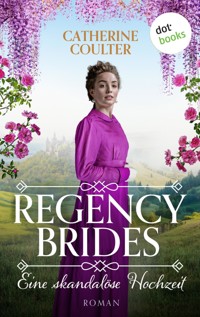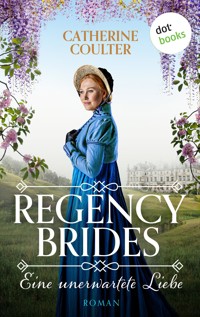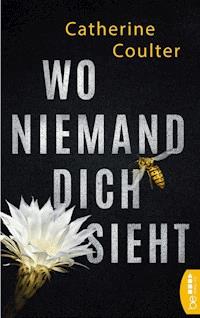4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein FBI Thriller mit Dillon Savich und Lacey Sherlock
- Sprache: Deutsch
Dies wird seine letzte Beichte sein ...
Pater Michael hat unzähligen Sündern die Beichte abgenommen. Doch dies wird seine letzte sein. Der Mann hinter der Trennwand gesteht, dass er zwei Menschen getötet hat - und der Geistliche wird der nächste sein. Der ermordete Pater hat einen Zwillingsbruder, der die FBI-Agenten Dillon Savich und Lacey Sherlock um Hilfe bittet. Sie finden eine Zeugin: die geheimnisvolle Obdachlose Nicola Jones. Doch auch sie steht auf der Liste des Killers ...
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
1
San Francisco
2
Washington D.C.
San Francisco
3
4
5
6
7
8
9
10
Chicago
San Francisco
Chicago
San Francisco
11
Los Angeles
12
13
14
St. Bartholomäus, San Francisco
15
16
17
Los Angeles
18
Chicago
19
Bear Lake, Kalifornien
20
21
22
Chicago
Los Angeles
23
24
Chicago
25
Los Angeles
26
27
28
Bear Lake
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Epilog
Danksagung
Über dieses Buch
Dies wird seine letzte Beichte sein …
Pater Michael hat unzähligen Sündern die Beichte abgenommen. Doch dies wird seine letzte sein. Der Mann hinter der Trennwand gesteht, dass er zwei Menschen getötet hat – und der Geistliche wird der nächste sein. Der ermordete Pater hat einen Zwillingsbruder, der die FBI-Agenten Dillon Savich und Lacey Sherlock um Hilfe bittet. Sie finden eine Zeugin: die geheimnisvolle Obdachlose Nicola Jones. Doch auch sie steht auf der Liste des Killers …
Über die Autorin
Catherine Coulter wuchs auf einer Ranch in Texas auf und schrieb nach ihrem Uniabschluss Reden an der Wall Street, bevor sie sich voll und ganz dem Schreiben widmete. Inzwischen hat sie mehr als 70 Romane veröffentlicht – darunter viele Regency Romances, aber auch einige Thriller. Ihre Bücher stürmen regelmäßig die Bestsellerlisten der New York Times. Catherine Coulter lebt mit ihrem Ehemann und drei Katzen in Nordkalifornien.
Catherine Coulter
Denen man nicht vergibt
Aus dem Amerikanischen von Gertrud Wittich
beTHRILLED
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2002 by Catherine Coulter
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Eleventh Hour
Originalverlag: G. P. Putnam’s Sons, a member of Penguin Putnam Inc. New York
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2004 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Übersetzung: Gertrud Wittich
Lektorat/Projektmanagement: Anne Pias
Covergestaltung: © www.buerosued.de
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-4494-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Phyllis Grann, der besten Herausgeberin, die es gibt.Ich danke dir für zwölf unglaubliche Jahre.
CATHERINE COULTER
1
San Francisco
Nick saß schweigend im Hauptschiff der Kirche. Sie hatte die Oberarme auf die Vorderbank gestützt und den Kopf darauf gelegt. Sie war nur deshalb hier, weil Vater Michael Joseph sie gebeten, ja, angefleht hatte, zu kommen, sich doch um Gottes willen von ihm helfen zu lassen. Da war es wohl das Mindeste, dass sie mit ihm redete, oder? Sie hatte darauf bestanden, spät abends zu kommen, wenn alle Welt schon im Bett lag, die Straßen leer und verlassen waren. Er hatte nichts dagegen gehabt, hatte ihr sogar ein Lächeln geschenkt. Was für ein guter Mensch er war – so freundlich und liebevoll im Umgang mit seinen Mitmenschen, so fest im Glauben an seinen Gott.
Sollte sie noch länger warten? Sie seufzte bei dem Gedanken. Sie hatte ihm ihr Wort geben müssen, auf ihn zu warten. Als wüsste er, dass sie das, mehr als alles andere, hier festhalten würde. Sie sah ihn zu einem der Beichtstühle hinübergehen. Überrascht fiel ihr auf, wie seine Schritte auf einmal schleppend wurden, wie er stehen blieb, fast widerwillig nach dem kleinen Knauf an der Tür des Beichtstuhls griff. Er will überhaupt nicht da rein, schoss es ihr durch den Sinn. Er würde die Tür am liebsten gar nicht aufmachen. Dann jedoch schien er sich einen Ruck zu geben, öffnete die schmale Holztür und betrat den Beichtstuhl.
Abermals versank das große Kirchenschiff in Stille. Selbst die Luft schien zu verharren, seit Vater Michael Joseph den winzigen Verschlag betreten hatte. Nun waren die finsteren Schatten nicht länger zufrieden, nur die Ecken und Winkel der Kirche zu füllen, sie begannen, auch den Mittelgang entlangzukriechen, als wollten sie auch sie verschlingen. Schon bald saß sie in der Dunkelheit, nur von einem dünnen Streifen Mondlicht unterbrochen, das durch die hohen Buntglasfenster hereinfiel.
Es hätte nun vollkommen friedlich sein müssen, aber das war es nicht. Etwas Fremdes schien die Kirche zu erfüllen, etwas ganz und gar nicht Friedvolles oder gar Heiliges. Unbehaglich rutschte Nick auf ihrer Bank hin und her.
Dann hörte sie eine Außentür aufgehen. Sie wandte sich um und sah den Mann, der um diese mitternächtliche Stunde noch seine Beichte ablegen wollte. Mit forschen, energischen Schritten betrat er die Kirche. Er sah recht gewöhnlich aus, ein schlanker, unscheinbarer Mann mit dicken schwarzen Haaren und einem langen Trenchcoat. Sie sah, wie er kurz stehen blieb, sich umschaute und dann weiter zum Beichtstuhl ging, in dem Vater Michael Joseph ihn erwartete. Dort im Dunklen, wo sie saß, war sie nicht zu sehen. Sie beobachtete, wie er im Beichtstuhl verschwand.
Wieder herrschte Totenstille, und sie selbst war jetzt ein Teil der Schatten. Neugierig spähte sie zu dem im Halbdunkel liegenden Beichtstuhl hinüber. Es war nichts zu hören.
Wie lange so eine Beichte wohl dauerte? Sie als Protestantin hatte keine Ahnung. Na ja, je länger und schwerwiegender das Sündenregister, desto länger wohl auch die Beichte, dachte sie, und ein Schmunzeln erhellte wie ein flüchtiger Sonnenstrahl ihre verhärmten Züge.
Plötzlich wurde sie von einem kalten Luftzug erfasst, der sich für einen langen Moment an ihr festzusaugen schien. Seltsam, dachte sie und zog ihre fadenscheinige Jacke enger um sich.
Wieder wanderte ihr Blick zum Altar, vielleicht auf der Suche nach göttlicher Erleuchtung, nach einem Zeichen, irgendetwas. Lächerlich.
Wenn Vater Michael Joseph fertig war und Zeit für sie hatte, was sollte sie ihm sagen? Sich von ihm die Hand halten lassen und ihm ihr Herz ausschütten? Nein, wirklich nicht. Ihr Blick hing am Altar, dessen fließende Umrisse im Halbdunkel seltsam vage, weich, ja überirdisch wirkten.
Vielleicht wollte Vater Michael Joseph einfach, dass sie hier in vollkommener Stille und Ungestörtheit saß, allein mit sich und Gott. Ihr kam der Gedanke, dass es ihm wichtiger war, dass sie mit Gott redete, als mit ihm. Aber sie konnte nicht beten. Es ging einfach nicht. Zumindest nicht jetzt.
So viel war geschehen und gleichzeitig so wenig. Frauen, die sie nicht gekannt hatte, waren tot. Sie lebte noch. Zumindest jetzt noch. Er war so mächtig, hatte überall Verbindungen, überall Augen und Ohren. Doch für den Moment war sie in Sicherheit. Jetzt, wo sie in der stillen Kirche saß, fiel ihr zum ersten Mal auf, dass sie nicht länger voller Panik und Todesangst war wie in den letzten zweieinhalb Wochen. Jetzt war sie lediglich wachsam. Sie musterte jeden Menschen, an dem sie tagsüber vorbei lief. Bei einigen zuckte sie zurück, andere waren ihr ebenso gleichgültig wie sie ihnen.
Sie wartete. Mit einer seltsamen Mischung aus Kummer und Hoffnung blickte sie zum Kruzifix hinauf. Und wartete. Die Luft schien sich zu verändern, schien schaler zu werden, doch nichts, nicht der geringste Laut durchbrach die vollkommene Stille. Kein Geräusch, kein Wispern drang aus dem Beichtstuhl.
Vater Michael Joseph, der im Beichtstuhl saß, holte erst einmal tief Luft, um etwas ruhiger zu werden. Er wollte diesen Mann nicht sehen, nie wieder, solange er lebte. Als dieser Mann Vater Binney angerufen und gesagt hatte, er würde so spät noch kommen – es tat ihm schrecklich leid, aber tagsüber wäre es zu gefährlich für ihn, und er musste einfach beichten, er musste –, da hatte Vater Binney natürlich ja gesagt. Aber es müsse unbedingt Vater Michael Joseph sein, hatte der Mann gesagt, nur er und sonst keiner. Natürlich hatte Vater Binney auch diesem Wunsch nachgegeben.
Vater Michael Joseph fürchtete, zu wissen, warum der Mann schon wieder da war. Er hatte schon zweimal bei ihm gebeichtet, hatte den reuigen Sünder markiert – ein Mann, der sich zerfleischt, der verzweifelt wünscht, mit dem Töten aufhören zu können, ein Mann, der Gottes Beistand erfleht. Beim zweiten Mal hatte er einen weiteren Mord gestanden, hatte sich reuig gezeigt, hatte all die richtigen Worte wie einstudiert heruntergeleiert, aber Vater Michael Joseph wusste, dass er nicht wirklich bereute, dass er – ja, was? Dass dieser Mann aus irgendeinem unerfindlichen Grund mit seinen Taten prahlen wollte, in der Gewissheit, dass der Priester sowieso nichts dagegen unternehmen konnte. Natürlich konnte Vater Michael Joseph dem guten Binney nicht sagen, warum er diesen bösen Mann nie wiedersehen wollte. Er hatte nie wirklich an die Existenz des Bösen geglaubt, jedenfalls nicht bis zu jenem schicksalhaften elften September. Und jetzt dieser Mann. Vor anderthalb Wochen war er zum ersten Mal aufgetaucht, dann noch einmal letzten Donnerstag und jetzt wieder. Vater Michael Joseph wusste ohne jeden Zweifel, dass dieser Mann abgrundtief böse war, vollkommen gewissenlos, bar jeder Menschlichkeit. Er fragte sich, ob dieser Mann überhaupt schon einmal in seinem Leben etwas wirklich bereut hatte. Wohl kaum. Vater Michael Joseph hörte das Atmen des Mannes durch das Gitter. Dann sagte der Mann mit leiser, monotoner Stimme: »Vergebt mir, Vater, denn ich habe gesündigt.«
Diese Stimme würde er überall wiedererkennen, sie verfolgte ihn bis in seine Träume. Er wusste nicht, ob er es noch einmal ertragen konnte. Schließlich sagte er mit fadendünner Stimme: »Wie lauten Ihre Sünden?« Er betete zu Gott, nicht gleich wieder hören zu müssen, dass ein Mensch zu Tode gekommen sei.
Da lachte der Mann, und es lag Irrsinn in diesem Lachen. »Auch Ihnen einen schönen Tag, Vater. Ja, ich weiß, was Sie denken. Sie haben Recht, ich hab den erbärmlichen Wurm umgebracht, genauer gesagt, ich hab ihn garrottiert. Wissen Sie, was das ist, Vater, garrottieren?«
»Ja.«
»Er hat noch versucht, mit den Fingern unter den Draht zu kommen, wissen Sie, um die Schlinge zu lockern, aber es war guter, fester Draht. Gegen Draht hilft kein Weihwasser. Aber ich hab ein bisschen locker gelassen, damit er wieder ein bisschen Hoffnung schöpft.«
»Ich höre keinerlei Reue in Ihrer Stimme, nur die Befriedigung über Ihre böse Tat. Sie haben es aus reiner, böswilliger Freude getan –«
Der Mann sagte mit tiefer, klangvoller Stimme: »Aber Sie haben den Rest meiner Geschichte noch gar nicht gehört, Vater.«
»Und ich will auch nichts mehr hören, kein Wort mehr.«
Der Mann lachte, ein tiefes Lachen aus dem Bauch heraus. Vater Michael Joseph sagte kein Wort. Im Beichtstuhl war es kalt und stickig, man konnte kaum atmen. Dennoch klebte ihm die Soutane schweißnass am Körper. Er roch seinen eigenen Angstschweiß, seine heftige Abneigung vor diesem Monster. Lieber Gott, mach, dass diese Kreatur verschwindet und nie wiederkommt.
»Und als er schon geglaubt hat, er hätte den Draht genug gelockert, um mir entwischen zu können, hab ich plötzlich ganz fest angezogen, wissen Sie, und es hat ihm die Finger bis auf die Knochen durchgeschnitten. Er ist mit seinen verdammten Fingern an seinem Hals krepiert. Ich bitte um Absolution, Vater. Haben Sie die Zeitung gelesen? Wissen Sie, wer der Mann war?«
Das wusste Vater Michael Joseph natürlich. Er hatte es in den Nachrichten gesehen, hatte es im Chronicle gelesen. »Sie haben Thomas Gavin ermordet. Einen Aids-Aktivisten, der in dieser Stadt nur Gutes getan hat.«
»Hatten Sie was mit ihm, Vater?«
Die Frage schockierte ihn nicht, schon seit zwölf Jahren schockierte ihn kaum mehr etwas, aber überrascht war er schon. Diese Tour war neu. Er sagte nichts, wartete nur.
»Kein Protest? Schweigen Sie ruhig, wenn Sie wollen. Ich weiß, dass Sie nichts mit ihm hatten. Sie sind nicht schwul. Aber Tatsache ist, es war Zeit für den Burschen, zu sterben.«
»Es gibt keine Absolution für Sie, nicht ohne aufrichtige Reue.«
»Wieso überrascht mich das nicht? Thomas Gavin war bloß noch so ein erbärmlicher Wicht, der vom Erdboden getilgt gehörte. Wollen Sie was wissen, Vater? Er war gar nicht wirklich real.«
»Was soll das heißen, nicht real?«
»Das, was ich gesagt habe. Er hat gar nicht richtig existiert, wissen Sie? Er war nie richtig hier – hat bloß in seiner eigenen kleinen Welt gelebt. Ich hab ihm da rausgeholfen. Wussten Sie, dass er Aids hatte? Hatte es gerade erst erfahren. Hat ihn wahnsinnig gemacht. Aber ich habe ihn gerettet, habe ihn von seinem erbärmlichen Leben befreit, das ist alles. Ganz schön nobel von mir. So ’ne Art Sterbehilfe, wenn Sie so wollen.«
»Es war ein abscheulicher, kaltblütiger Mord, und das wissen Sie genau. Ein Mensch aus Fleisch und Blut ist tot, und daran sind nur Sie schuld. Versuchen Sie nicht, Ihre Tat zu entschuldigen.«
»Ach, das war doch nur eine Metapher, Vater, keine Entschuldigung. Sie sind ja richtig sauer. Krieg ich denn jetzt keine Buße aufgebrummt? Tausend Rosenkränze vielleicht? Oder soll ich mich geißeln? Wollen Sie denn nicht, dass ich Sie anflehe, beim lieben Gott ein gutes Wort für mich einzulegen?«
»Tausend Rosenkränze würden nichts nützen.« Vater Michael Joseph beugte sich näher ans Gitter, sodass er das Böse dort drüben beinahe berührte, den warmen Atem des Mannes riechen konnte. »Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Das hier ist keine richtige Beichte, es ist eine Verhöhnung des Sakraments. Sie glauben vielleicht, dass ich unter allen Umständen das Beichtgeheimnis zu wahren habe, dass ich nichts weitergeben darf, was ich an diesem Ort erfahre. Aber Sie irren sich. Das Sakrament der Beichte beinhaltet, dass man seine Sünden aufrichtig bereut, dass man die Absolution ersehnt. Das alles tun Sie nicht. Deshalb bin ich auch nicht an das Beichtgeheimnis gebunden. Ich werde mit meinem Bischof über Sie reden. Und selbst wenn er mir nicht beipflichten sollte, bin ich sogar bereit, nötigenfalls meinen Priesterrock abzulegen. Und dann werde ich allen erzählen, was Sie getan haben. Ich werde dem ein Ende bereiten.«
»Sie würden mich wirklich an die Bullen verpfeifen? Das ist ganz schön mutig von Ihnen, Vater. Wie ich sehe, sind Sie wirklich stinksauer. Ich wusste nicht, dass es da ein Hintertürchen im Beichtgeheimnis gibt. Eigentlich wollte ich ja, dass Sie mich anflehen, Himmel und Hölle auf mich herabrufen, nur um festzustellen, dass Sie gar nichts machen können, null, und dass Sie sich deswegen vollkommen zerfleischen. Aber wer kann schon im Voraus sagen, wie ein Mensch reagiert?«
»Man wird Sie für den Rest Ihres Lebens in eine Anstalt stecken.«
Der Mann unterdrückte ein Lachen, brachte einen überzeugenden Seufzer zustande und meinte dann, immer noch lachend: »Wollen Sie damit andeuten, dass ich sie nicht mehr alle habe, Vater?«
»Nicht nur das. Ich halte Sie für einen Psychopathen, nein, ich glaube, die korrekte Bezeichnung für Ihre Störung ist Soziopath, nicht wahr? Hört sich nicht ganz so hässlich, nicht ganz so gewissenlos an, nein? Aber egal, was immer Sie sind, es ist schlimmer als jedes Wort, das die Medizin dafür benutzt. Ihre Mitmenschen sind Ihnen vollkommen gleichgültig. Sie brauchen dringend Hilfe, obwohl ich bezweifle, dass Ihnen noch zu helfen ist. Hören Sie jetzt endlich auf mit diesem Irrsinn?«
»Möchten Sie mich vielleicht erschießen, Vater?«
»Nein, ich bin nicht wie Sie. Aber ich werde dafür sorgen, dass man Ihren Schandtaten ein Ende macht, ein für alle Mal.«
»Ich fürchte, ich kann nicht zulassen, dass Sie zu den Bullen rennen, Vater. Ich versuche, es Ihnen nicht übel zu nehmen, dass Sie sich nicht so verhalten, wie Sie sollten. Also gut, ja. Es ärgert mich schon ein bisschen, dass Sie sich nicht so benehmen, wie Sie sollten.«
»Was soll das heißen – ich benehme mich nicht so, wie ich soll?«
»Das ist unwichtig, zumindest für Sie. Wissen Sie, dass Sie mir was geschenkt haben, was ich nie zuvor in meinem Leben hatte?«
»Und das wäre?«
»Spaß, Vater. Hab noch nie im Leben solchen Spaß gehabt. Bis auf das hier, vielleicht.«
Er wartete, bis Vater Michael Joseph ihn durch das Drahtgitter ansah. Dann schoss er dem Priester eine Kugel mitten durch die Stirn. Man hörte lediglich ein lautes Ploppen, da er einen Schalldämpfer aufgeschraubt hatte. Dann senkte er nachdenklich die Pistole. Vater Michael Joseph war mit dem Rücken gegen die Holzwand des Beichtstuhls gesunken, den Kopf nach hinten geneigt, so dass man sein Gesicht deutlich sehen konnte. In der Miene des Priesters zeichnete sich keinerlei Überraschung ab, aber etwas anderes, etwas Unbegreifliches. Mitleid? Nein, ganz gewiss nicht. Der Priester hatte ihn verabscheut, aber jetzt war er bis in alle Ewigkeit zum Schweigen verdammt, könnte nie mehr zur Polizei gehen, ja, nicht einmal einen so drastischen Schritt unternehmen, wie sein Priesteramt niederzulegen. Es war aus mit ihm. Kein Hintertürchen mehr.
Jetzt brauchte sich Vater Michael Joseph über nichts mehr Gedanken zu machen. Sein zartes Gewissen konnte ihn nicht länger peinigen. Gab es einen Himmel? Falls es so war, blickte Vater Michael Joseph ja vielleicht auf ihn herab und wusste, dass es nichts gab, das er noch tun konnte. Oder vielleicht schwebte der Geist des toten Priesters ja noch verdattert über seiner Leiche und beobachtete alles.
»Leben Sie wohl, Vater, wo immer Sie auch sein mögen«, sagte er und erhob sich.
Als er sich aus dem Beichtstuhl zwängte, die Tür behutsam hinter sich schließend, wurde ihm plötzlich klar, was für ein Ausdruck das auf dem toten Gesicht des Priesters war – er sah aus, als hätte er gewonnen. Aber das war unsinnig. Was sollte er gewonnen haben? Der gute Pfaffe hatte soeben das Zeitliche gesegnet. Er hat, verflucht noch mal, gar nichts gewonnen.
Es war niemand in der Kirche, nicht, dass er das erwartet hätte. Überall Totenstille. Es hätte ihm gefallen, wenn von oben der leise Gesang eines gregorianischen Chors herabgetönt hätte. Aber nein, da war nur das Echo seiner Schritte auf den kalten Steinplatten.
Wieso sah der verdammte Priester so glücklich aus? Er war tot, verflucht noch mal.
Mit raschen Schritten verließ er die Sankt-Bartholomäus-Kirche, blieb draußen einen Moment stehen, um tief die kühle Nachtluft einzuatmen, den Kopf in den Nacken zu legen und den Blick hinauf zu den Sternen schweifen zu lassen. Es war eine schöne, sternenklare Nacht, genau so wie es sein sollte. Von dem Mond war nicht viel zu sehen, aber das war schon in Ordnung. Er würde heute schlafen wie ein Murmeltier. Auf der anderen Straßenseite lehnte ein Betrunkener an einer mickrigen Eiche, die auf dem Grünstreifen am Rande des Gehsteigs wuchs. Sein Kinn war auf die Brust gesunken. Nicht gerade so, wie es sein sollte, aber wen kümmerte das schon? Der Typ hatte keinen Pieps gehört.
Die Bullen würden sich erfolglos die Köpfe zerbrechen. Die Antwort würden sie ja doch nicht finden. Der Priester hatte dafür gesorgt, dass er seine Pläne ändern musste, und das war schade. Nun ja, es wäre sowieso fast geschafft gewesen.
Aber dieser Ausdruck auf dem Gesicht des Pfaffen, der gefiel ihm gar nicht. Aber daran wollte er im Moment nicht denken.
Pfeifend schlenderte er die Filmore entlang, dann noch einen Block bis zu seinem Auto, das er dort in einen engen Parkplatz gezwängt hatte. Aber auch das war so, wie es sein sollte. Immerhin war dies San Francisco.
Blieb nur noch eines. Er hoffte, dass sie zu Hause war und nicht arbeitete.
2
Washington D.C.
Spezialagent Dane Carver sagte zu seinem Boss, dem Leiter der Abteilung, Dillon Savich: »Ich hab da ein Problem, Savich. Ich muss nach Hause. Mein Bruder ist letzte Nacht gestorben.«
Es war noch früh, erst halb sieben an einem eiskalten Montagmorgen, gerade mal zwei Wochen nach Neujahr. Savich erhob sich langsam aus seinem Sessel, den Blick unverwandt auf Danes Gesicht geheftet. Der Mann war bleich, und unter seinen Augen lagen so tiefe Schatten, dass man meinen könnte, er habe eine Sauftour hinter sich. Auf seinen Zügen lag ein Ausdruck von Schock und tiefer Verzweiflung. »Was ist passiert, Dane?«
»Mein Bruder –« Einen Moment lang konnte Dane nicht weitersprechen, nur stumm im Türrahmen verharren. Er hatte das todsichere Gefühl, wenn er es jetzt laut aussprach, würde es Wirklichkeit werden, und das wäre so furchtbar, dass er einfach zusammenklappen und sterben müsste. Er schluckte schwer und wünschte, es wäre noch gestern Nacht, vor vier Uhr morgens, bevor er diesen Anruf von Inspektor Vincent Delion vom SFPD, dem Polizei-Department von San Francisco, erhalten hatte.
»Schon gut«, sagte Savich ruhig, trat zu ihm und nahm ihn sanft beim Arm. »Komm rein, Dane. Ja, genau, machen wir die Tür zu.«
Dane stieß die Tür mit einem Fußtritt zu und meinte dann mit betäubter, hohler Stimme: »Man hat ihn ermordet. Mein Bruder wurde ermordet.«
Savich war entsetzt. Schlimm genug, wenn einem der Bruder durch natürliche Ursachen wegstarb, aber das? Savich sagte: »Mein tiefstes Beileid. Ich weiß, dass du deinem Bruder sehr nahe standest. Bitte setz dich doch, Dane.«
Dane schüttelte den Kopf, aber Savich führte ihn kurzerhand zu einem Stuhl und drückte ihn sanft darauf nieder. Dane saß mit kerzengeradem Rücken da und blickte ins Leere, dorthin, wo man vom Fenster aus einen Blick auf das Justizgebäude hatte.
Savich sagte: »Dein Bruder war Priester, nicht wahr?«
»Ja, das ist er – war er. Ich muss mich jetzt um alles Nötige kümmern, weißt du.«
Dillon Savich, Chef einer Spezialeinheit für besondere Täterermittlung beim FBI, nahm unweit von Dane auf der Schreibtischkante Platz. Er beugte sich vor, drückte Dane die Schulter und sagte: »Ja, ich weiß. Eine furchtbare Sache, Dane. Natürlich musst du hin und dich um alles kümmern. Du bekommst selbstverständlich bezahlten Urlaub. Er war dein Zwillingsbruder, nicht wahr?«
»Ja. Wir waren eineiige Zwillinge. Er ist mein Spiegelbild. Obwohl wir von der Art her sehr unterschiedlich waren, waren wir auf gewisse Weise doch sehr gleich.«
Savich konnte sich kaum vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man seinen Zwillingsbruder verliert. Dane war seit fünf Monaten bei der Einheit, hatte sich auf eigenen Wunsch und auf ausdrückliche Empfehlung von Jimmy Maitland, Savichs Vorgesetztem, von Seattle hierher versetzen lassen. Maitland hatte Savich erzählt, dass er den Mann schon eine ganze Weile im Auge gehabt habe. Ein guter Mann, meinte er, blitzgescheit, ohne falsche Skrupel, hartnäckig, wenn auch manchmal ein wenig draufgängerisch, was nicht allzu gut war, aber ansonsten das, was man als »treue Seele« bezeichnet. Wenn Dane Carver einmal sein Wort gab, konnte man die Sache als so gut wie erledigt betrachten.
Er hatte, wie Savich wusste, am 26. Dezember, zwei Stunden nach Mitternacht, Geburtstag. Auf der Betriebsweihnachtsfeier am dreiundzwanzigsten hatte er jede Menge alberner Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke bekommen. Er war dreiunddreißig geworden.
Savich sagte: »Wie gut sind die Cops dort? Haben sie schon was? Nein, Moment mal, ich weiß ja gar nicht, wo dein Bruder lebt.«
»In San Francisco. Ich habe heute Morgen kurz vor vier zwei Anrufe gekriegt, einen von einem Inspektor Delion vom SFPD, dann zehn Minuten später von meiner Schwester Eloise, unten aus San José. Delion sagt, man hat ihn spät nachts im Beichtstuhl ermordet. Kannst du dir das vorstellen, Savich?« Jetzt endlich sah Dane seinem Boss in die Augen, und dieser las darin eine Wut, die fast an Irrsinn grenzte. Außer sich schlug Dane mit der Faust auf die Stuhllehne. »Kannst du dir vorstellen, dass ihn irgend so ein Arschloch einfach im Beichtstuhl umgenietet hat? Um Mitternacht? Was musste er auch um Mitternacht noch die Beichte abnehmen!«
In diesem Moment fürchtete Savich, Dane würde zusammenbrechen. Er keuchte wie ein Blasebalg, die Pupillen geweitet, die Hände zu Fäusten geballt. Es war knapp, aber er fing sich wieder. Etwas wie ein Schluchzer entrang sich seiner Brust, dann hielt er einen Moment die Luft an, um dann ein paar Mal tief ein- und auszuatmen. Savich sagte: »Nein, unsereins kann so was nicht verstehen; das macht wohl bloß für den Mörder einen Sinn. Und wir werden rauskriegen, wer das getan hat, und warum. Nein, bleib ruhig noch einen Moment sitzen, Dane, und lass uns überlegen. Dein Bruder hieß Michael, ja?«
»Ja, Vater Michael Joseph Carver, so hieß er. Ich muss nach San Francisco. Ich kenne das dortige Revier vom Hörensagen. Haben einen guten Ruf, die Jungs, aber sie kannten meinen Bruder nicht. Nicht mal meine Schwester kannte ihn wirklich. Nur ich kannte ihn. Mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass ich das je sagen würde, aber es ist wahrscheinlich besser, dass meine Mutter letztes Jahr gestorben ist. Sie hat sich immer gewünscht, dass Michael mal Priester wird, hat ihr Leben lang dafür gebetet, jedenfalls hat sie das immer gesagt. Das hätte sie zerstört, weißt du? Ihre Seele hätte es zerstört.«
»Ja, ich weiß, Dane. Wann hast du zuletzt mit ihm geredet?«
»Vorgestern Abend. Er – er war so happy, weil er einen Halbstarken beim Sprayen an die Kirchenmauer erwischt hat. Hat gemeint, er würde aus dem Jungen einen ordentlichen Katholiken machen, dann würde er das nie wieder tun, weil er die Schuldgefühle nicht ertragen könnte.« Der Hauch eines Lächelns huschte über Danes bleiche Züge, dann schwieg er wieder.
»Hattest du das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt?«
Dane schüttelte den Kopf, runzelte dann jedoch die Stirn. »Ich würde sagen, nein, mein Bruder war fast immer gut drauf, sogar als ihm mal ein Journalist einen unsittlichen Antrag machte.«
»Ein Journalist? Ein Mann?«
»Genau, ein Mann.«
Savich lächelte nur.
»Ist ihm nicht das erste Mal passiert, aber meistens kamen die Anträge doch von Frauen. Aber Michael ist immer freundlich geblieben, egal, ob es nun eine Frau oder ein Mann war, der sich an ihn ranmachte.« Dane verfiel in Schweigen.
»Jetzt, wo du so darüber nachdenkst, war wohl doch was?«
»Na ja, ich bin nicht sicher. Er sagte neulich was von wegen, er käme sich so hilflos vor und dass er das hasst. Sagte, er würde was dagegen unternehmen.«
»Hast du eine Ahnung, was er damit gemeint haben könnte?«
»Nein, mehr hat er dazu nicht gesagt. Vielleicht war’s eine besonders abscheuliche Beichte oder vielleicht ein Schäfchen, dem er nicht helfen konnte. Aber das war überhaupt nichts Ungewöhnliches. Michael hat über die Jahre mit jeder Menge Problemfällen und Irren zu tun gehabt.« Dane machte abermals eine Faust. »Vielleicht war da ja was, vielleicht hat ihm ja irgendwas Angst eingejagt, ich weiß nicht. Ich hätte ihn zurückrufen, hätte nachhaken sollen, als er nichts weiter sagte. Wieso, zum Teufel, hab ich das nicht getan?«
»Jetzt halt aber mal die Luft an, Dane. Mit unnötigen Schuldgefühlen kleisterst du dir bloß das Gehirn zu.«
»Du hast leicht reden. Du bist nicht katholisch so wie ich. Unsereinem werden die Schuldgefühle schon in die Wiege gelegt.«
Ein schwacher Witz; das war immerhin ein Anfang. Savich sagte: »Nichts davon war deine Schuld. Du musst rauskriegen, wer ihn getötet hat. Schuld daran ist nur dieses Schwein, dieser Killer, und sonst niemand, hörst du? Also, ich werde Millie veranlassen, dir ein Flugticket zu reservieren. Ach ja, wie hieß der Inspektor, der den Fall bearbeitet, noch mal?«
»Vincent Delion. Wie gesagt, er hat mich kurz vor Eloise angerufen und gemeint, er wüsste, dass ich beim FBI bin und wahrscheinlich alles über den Fall erfahren will. Viel hatten sie noch nicht. Er war sofort tot, Kopfschuss, mitten durch die Stirn. Sieht aus wie einer von diesen unschuldigen roten Punkten, die gläubige Hindus auf der Stirn tragen, weißt du?«
»Ja, ich weiß.«
»Aber am Hinterkopf war’s nicht bloß ein kleiner Punkt. Gott, nein, am Hinterkopf nicht.« Seine Augen wurden glasig.
Savich wusste genau, dass er nicht zulassen durfte, dass Dane sich diese Dinge allzu genau ausmalte, die schreckliche Wunde, die eine austretende Kugel am Kopf zurücklässt. Das würde ihn nur noch tiefer in die Verzweiflung stürzen. Deshalb sagte er langsam und deutlich, wobei er auch gestikulierte, um den Augenkontakt zu erzwingen: »Ich nehme nicht an, dass der Killer seine Waffe am Tatort zurückgelassen hat?«
Dane schüttelte den Kopf. »Nein. Die Autopsie findet heute statt.«
Savich sagte: »Ich kenne Chief Kreider. War letztes Jahr hier und hat vor dem Kongress von den neuen Ansätzen der Stadt San Francisco bei der Bekämpfung von rassistisch motivierten Straftaten erzählt. Hab mich unten auf dem Schießstand in Quantico mit ihm getroffen. Der Mann ist ein ausgezeichneter Weitschütze. Und mein Schwiegervater ist Bundesrichter in San Francisco. Kennt ’ne Menge Leute. Was kann ich also tun, um dir zu helfen?«
Dane sagte gar nichts. Savich merkte, dass er immer noch unter Schock stand und das soeben Gesagte wahrscheinlich gar nicht richtig mitbekommen hatte. Aber das würde sich sicher bald ändern. Das Gute war, dass Dane ein ausgebildeter Polizist war, was hieß, dass ihm sein Training und seine geschärften Instinkte bald helfen würden, mit dieser Sache fertig zu werden. Er sagte: »Egal. Ich will dir was sagen: Du fliegst jetzt umgehend nach San Francisco und redest mit Delion. Finde heraus, was die haben und was sie zu unternehmen gedenken. Vielleicht kann dir ja auch unser dortiges Büro behilflich sein. Kennst du Bert Cartwright, Special Agent Commissioner in San Francisco?«
»Allerdings«, sagte Dane mit einer Stimme, die nicht wirklich ausdruckslos war. »Ja, ich kenne ihn.«
Seine Miene hatte einen feindseligen Ausdruck angenommen. Zumindest wurde dadurch sein Kummer ein wenig in den Hintergrund gedrängt. »Tja, ich sehe schon, dass er nicht gerade ein guter Freund von dir ist«, meinte Savich gedehnt.
»Ganz bestimmt nicht. Ich will nichts mit ihm zu tun haben.«
»Wieso nicht? Was ist denn zwischen euch beiden vorgefallen?«
Dane schüttelte abwehrend den Kopf. »Nicht weiter wichtig.«
»Also gut, dann geh jetzt nach Hause und pack ein paar Sachen zusammen. Wie ich schon sagte, ich werde Millie bitten, sich um alles zu kümmern. Möchtest du in der Stadt übernachten oder lieber bei deiner Schwester?«
»Ich nehme mir ein Zimmer in der Stadt. Aber nicht im Pfarrhaus, dort ganz bestimmt nicht.«
»Also gut, dann eben in einem Hotel in der Innenstadt. Aber mach dich auf was Einfaches gefasst, mehr springt beim FBI nicht raus. Und ruf mich an, wenn ich irgendwas tun kann.«
»Ja, danke, Savich. Was meine Fälle betrifft –«
»Ich sorge dafür, dass sie auf die anderen verteilt werden. Und jetzt geh.«
Die beiden Männer gaben einander die Hände. Savich beobachtete durch die Glasscheibe seines kleinen Büros, wie Dane sich zwischen den neun mit Computern bestückten Arbeitsinseln des Großraumbüros, von denen im Moment allerdings erst sechs besetzt waren, zum Ausgang hindurchschlängelte. Seine Frau, Spezialagentin Lacey Sherlock Savich, war gerade in einem Meeting mit Jerry Hollister, oben im dritten Stock bei der DNA-Analyse, wo sie die DNA-Probe eines Vergewaltigungs- und Mordopfers mit der DNA-Probe des Hauptverdächtigen verglichen. Wenn die Proben übereinstimmten, war dem Typen der Stuhl so gut wie sicher.
Ollie Hamish, sein Stellvertreter, befand sich derzeit in Wisconsin, um zusammen mit der örtlichen Polizei eine besonders abscheuliche Mordserie aufzuklären, die mit einem lokalen Radiosender, der ausschließlich Golden Oldies spielte, in Zusammenhang stand. Na, so was, hatte Ollie gemeint und war, »Maxwell’s Silver Hammer« summend, abgerauscht.
Savich hasste diese Irren. Unaufgeklärten Irrsinn sogar noch mehr. Es erstaunte und entsetze ihn immer wieder, wozu der menschliche Verstand fähig war. Und jetzt auch noch Dans Bruder, ein Priester.
Er wählte Millies Durchwahl und bat sie, alles Nötige für den Flug zu veranlassen. Dann ging er hinüber zu seinem elektrischen Wasserkocher, um sich eine Tasse starken Earl Grey zu machen. Er goss sich den Tee in einen großen FBI-Becher und ging dann zurück zu MAX, seinem Wunderlaptop, um ihn hochzufahren.
Als Erstes schickte er eine E-Mail an Chief Dexter Kreider.
San Francisco
Später an diesem Montag, um halb vier Uhr nachmittags San-Francisco-Zeit, nach einem gut fünfstündigen Flug von Küste zu Küste, eilte Dane Carver durchs Großraumbüro der Mordkommission zu Inspektor Delions übervollem Schreibtisch. Dort blieb er einen Moment stehen und studierte sein Gegenüber. Der ältere Mann mit dem schimmernden Glatzkopf und dem dicken Fahrradlenkerschnurrbart saß über seine Computertastatur gebeugt und tippte wie ein Wilder vor sich hin. Dane setzte sich wortlos auf den Stuhl neben seinem Schreibtisch und beobachtete den Mann. Es war hier wie in jedem anderen Polizeirevier, das er kannte. Polizisten mit aufgerollten Hemdsärmeln, gelockerter Krawatte, das Jackett lässig über die Stuhllehne gehängt, daneben ein Festgenommener hispanischer Herkunft in Handschellen, der sich im Pöbeln versuchte, dazwischen der eine oder andere Anwalt im schicken Zweireiher, eifrig bemüht, einschüchternd zu wirken – alles ganz normal für einen Montagmorgen. Auf der zerkratzten Anrichte der winzigen Küchennische lag eine schon reichlich dezimierte Schachtel Donuts, daneben stand ein Kaffeeautomat, der aussah, als hätte er seine Blütezeit in den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts erlebt. Überall lagen haufenweise Papierbecher und Zuckertütchen herum, dazwischen auch ein halb voller Karton Milch, den Dane nicht einmal mit der Kneifzange angefasst hätte.
»Und wer, zum Teufel, sind Sie?«
Dane erhob sich und streckte dem Mann seine Hand hin. »Ich bin Dane Carver. Sie haben mich letzte Nacht wegen meines Bruders angerufen.«
»Ach ja, richtig.« Er erhob sich und schüttelte Dane die Hand. »Mein Name ist Vincent Delion.« Er setzte sich wieder und bedeutete Dane, es ihm gleichzutun. »Also, das mit Ihrem Bruder tut mir aufrichtig leid. Ich hab Sie angerufen, weil ich mir dachte, Sie wollten sicher Bescheid wissen.«
Dass sich die beiden Carver-Brüder sehr nahe gestanden hatten, wusste Delion bereits von Carvers Schwester, Eloise DeMarks. Und Delion war nicht blind. Dem Mann ging’s richtig dreckig, und er war überdies vom FBI. Alle FBI-Agenten, denen Delion im Laufe seines Berufslebens über den Weg gelaufen war, schienen eiskalte Ärsche gewesen zu sein. Die wollten einem immer nur mit ihren schicken Anzügen ans Leder. Obwohl, er war natürlich noch nie einem von den Typen in einer derartigen Situation begegnet. Wenn einer aus der Familie umgebracht wurde – das war schon ein hartes Stück, das war etwas, das einen traf wie der Blitz aus heiterem Himmel, dagegen konnte man nichts machen. Es war so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren konnte.
Dane sagte mit ruhiger, sonorer Stimme – einer Super-Verhörstimme, wie Delion fand: »Ja, ich muss mich dafür bei Ihnen bedanken. Und jetzt erzählen Sie mir, was Sie haben.«
»Tut mir schrecklich leid, aber ich fürchte, wir müssen als Erstes rüber in die Leichenhalle, um Ihren Bruder zu identifizieren. Nicht, dass es irgendwelche Zweifel gibt, aber es ist nun mal Vorschrift, Sie kennen das ja. Oder vielleicht auch nicht. Waren Sie früher mal bei der Polizei?«
Dane schüttelte den Kopf. »Ich wollte von Anfang an zum FBI. Aber wie’s läuft, weiß ich trotzdem.«
»Ja, so ist das meistens. Ich persönlich wollte immer nur ein ganz normaler Cop werden. Also gut, Dr. Boyd hat heute Vormittag die Autopsie gemacht, und ich war dabei. Wie ich Ihnen schon gestern Nacht sagte, ist Ihr Bruder sofort tot gewesen. Das hat Boyd ebenfalls bestätigt, falls Ihnen das ein Trost sein sollte. Ich habe mit Ihrer Schwester gesprochen. Sie wollte gleich heute raufkommen, aber ich hab ihr gesagt, Sie würden kommen und sich um alles kümmern und dass Sie sie auf dem Laufenden halten. Ich müsste sie erst in ein, zwei Tagen sprechen. Hab mir gedacht, dass Sie das lieber selber regeln.«
»Ja. Ich habe mit Eloise gesprochen. Ich werde sie heute Abend noch mal anrufen. Und jetzt zur Tatwaffe –«
»Keine Spur von der Tatwaffe, weder am Tatort, noch sonst wo in der Kirche. Auch nicht in einem Radius von zwei Blocks um die Kirche herum. Aber die Spurensicherung hat eine Zweiundzwanziger-Kaliber-Kugel aus der Betonwand hinter dem Beichtstuhl geholt. Die Kugel hat den Kopf Ihres Bruders durchschlagen, dann die Wand des Beichtstuhls, und ist etwa zwei Meter dahinter in der Wand stecken geblieben, nicht sehr tief, bloß ein paar Millimeter, und die Kugel ist noch in einem ziemlich guten Zustand. Unser Mann von der Ballistik, Zopp – ja, ja, so heißt er wirklich, Edward Zopp –, hat sich gleich darüber hergemacht. Die Sache ist die, wissen Sie, Ihr Bruder war ein Priester und noch dazu äußerst aktiv und beliebt in der Gemeinde, also hat dieser Fall absolute Priorität vor allen anderen. Die Kugel war noch so intakt, dass sie sich gut vermessen und wiegen ließ. Zopp war richtig happy. Normalerweise sieht’s anders aus. Zopp meint, er hätte die Rillen gezählt und den ganzen Schmus und ist, und nun stellen Sie sich das vor, darauf gekommen, dass es wahrscheinlich eine JC-Higgins, ein Achtziger-Modell, oder eine Hi-Standard, Modell xoi sein muss – beides würde passen.«
»Aber das sind ziemlich antiquierte Waffen. Keine davon wird heute noch hergestellt, obwohl sie noch überall zu haben sind. Es sind billige Waffen, jeder kann sie sich leisten.«
»Das ist richtig. Zopp meint, das wäre komisch, aber genau so eine Waffe scheint auch der Zodiac-Killer Ende der Sechziger, Anfang der Siebziger benutzt zu haben. Ist das nicht der Hammer? Ich weiß noch, dass man den Kerl nie gekriegt hat.«
»Sie glauben, es könnte da ein Zusammenhang bestehen?«
Delion schüttelte den Glatzkopf. »Nein. Wir fragen uns nur, ob unser Kandidat möglicherweise ein Bewunderer des Zodiac-Killers ist. Ist vielleicht ziemlich weit hergeholt, aber wir werden sehen. Jedenfalls haben wir ’ne Kugel, und wenn wir die dazu passende Knarre finden, haben wir einen Fall für den Staatsanwalt.«
Dane lehnte sich zurück und betrachtete seine Schuhspitzen. Er hasste es, das fragen zu müssen, hasste es bis in die tiefste Seele, aber er hatte keine Wahl. »Eintrittswinkel?«
3
»Der Killer saß Ihrem Bruder direkt gegenüber. Sie haben sich angesehen. Der Killer hat die Waffe gehoben und direkt durchs Sichtgitter gefeuert.«
Jesus Christus, dachte Dane und sah Michael vor sich, den Kopf leicht zur Seite geneigt, ein aufmerksamer, einfühlsamer Zuhörer, immer bemüht, sein Gegenüber zu verstehen, zu vergeben. Aber nicht diesem Schwein, da war sich Dane sicher. Sein Bruder hatte sich wegen dieses Schweins den Kopf zerbrochen. Dieser Typ hatte einfach seine beschissene Pistole rausgeholt und ihm einen Kopfschuss verpasst? Einen Moment lang konnte Dane nicht mehr denken. Was Michael zugestoßen war, war so schrecklich, so entsetzlich, dass sich sein Gehirn anfühlte, als wäre es abgestorben. Er wünschte nur, der Rest von ihm wäre ebenso abgestorben, was natürlich nicht der Fall war. Er war innerlich hohl und leer und wund vor Kummer.
Delion ließ Dane ein wenig Zeit, sich wieder zu fassen, dann sagte er: »Wir sind bereits dabei, bei den hiesigen Waffengeschäften die Runde zu machen. Wir wollen sehen, ob einige solche Waffen noch führen oder geführt haben, und wenn ja, wer in den letzten Jahren eine solche Waffe erworben hat. Die Waffenhändler hier sind sehr gewissenhaft; führen über alles Buch.«
Dane konnte sich nicht vorstellen, dass dieser Mord mit einer solchen Waffe verübt worden war. Welcher Trottel kaufte schon seine Knarre in derselben Stadt, in der er einen Mord plante? Man würde ihn doch sofort finden. Aber wo sollte man sonst anfangen zu suchen?
»Wie hat man ihn gefunden?«
»Ein anonymer Anruf in der Notrufzentrale, nur wenige Minuten nach dem Mord.«
»Dann gibt es also einen Augenzeugen«, sagte Dane langsam. »Jemand hat den Mörder gesehen.«
»Kann gut sein. Es war eine Frau. Sie sagt, sie hätte gesehen, wie der Mann, der Ihren Bruder erschoss, den Beichtstuhl verließ, buchstäblich die noch rauchende Pistole in der Hand. Sie sagt, er hätte sie nicht gesehen. Dann brach sie in Tränen aus – und hat aufgehängt. Anrufe in der Notrufzentrale werden, wie Sie ja wissen, aufgezeichnet. Wenn Sie sich den Anruf also anhören möchten, können Sie das gerne tun. Wir haben keine Ahnung, wer die Frau war.«
»Sie hat seitdem nicht mehr angerufen?«
Delion schüttelte den Kopf.
»Sie hat nicht gesagt, ob sie ihn wiedererkennen würde?«
»Sie meinte, nein, aber sie will noch mal anrufen, wenn ihr irgendwas Hilfreiches einfällt.«
Na toll, dachte Dane. Aber es war immerhin etwas. Vielleicht rief sie ja noch mal an. Er sagte: »Haben Sie schon mit den anderen Priestern in der Pfarrei geredet?«
Zum ersten Mal schmunzelte Vincent Delion unter seinem mächtigen schwarzen Schnurrbart, dessen Enden, wie Dane jetzt erst sah, tatsächlich pomadisiert waren. »Wissen Sie, was? Ich dachte mir, Sie würden mir schön aufs Dach steigen, wenn ich damit nicht auf Sie warten würde. Also, Spezialagent Carver, alles klar zum Aufbruch?«
Dane nickte. »Danke. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Ich habe Urlaub bekommen und deshalb genug Zeit. Als Erster kommt Vater Binney dran. In seiner letzten E-Mail hat Michael ihn erwähnt.«
»Ach ja? In welchem Zusammenhang? Hat’s was mit dem Fall zu tun?«
»Ich weiß nicht so recht«, meinte Dane schulterzuckend. »Er erwähnte nur, dass er Probleme mit Vater Binney hätte. Und da ist noch was«, fügte Dane hinzu, hob den Kopf und richtete den Blick auf Delions Schnurrbart. »Mein Bruder hat neulich Abend am Telefon gesagt, er kommt sich so hilflos vor und wie sehr er das hasst. Ich hoffe, dass uns Vater Binney mehr darüber erzählen kann.«
Sie gingen an der kleinen Küchennische mit der Mikrowelle, der Kaffeemaschine und drei Schüsseln mit Erdnüssen vorbei.
»Ach ja, haben Sie Hunger? Wollen Sie vielleicht ’n paar Erdnüsse, ’ne Tasse Kaffee?«
»Erdnüsse, keine Donuts?«
»Bullen, die den ganzen Tag nur Donuts in sich reinstopfen und fette Bäuche vor sich herschleppen, sind out – die gibt’s nur noch im Fernsehen«, erklärte Delion. »Wir haben’s hier nicht so mit den Donuts, wir sind hier alle Sportskanonen. Wir mögen am liebsten ganz frische Erdnüsse in der Schale, aus Virginia. Manchmal auch die gesalzenen.«
»Und was ist das da?«
»Na ja, das ist nur ein Donut, den wahrscheinlich der Putzmann liegen gelassen hat.«
Das besagte Objekt hing halb von einem Pappteller herunter und konnte jeden Moment den Weg zum schmuddeligen Fußboden antreten. Dane hielt es für wahrscheinlicher, dass der Putzmann geflissentlich die Finger davon ließ. Er schüttelte lächelnd den Kopf. »Ich hab im Flugzeug gegessen. Aber danke, Inspektor.«
Als Dane seinen Bruder durch das Sichtfenster des kleinen Identifizierungsraums im Leichenschauhaus erblickte, traf ihn die Realität wie ein Keulenschlag. Dr. Boyd, ein großer, weißhaariger, herrischer Mann mit einer Stimme, die jeden Sünder erzittern ließ, hatte sie durch die Sicherheitsschleuse geführt, dann den kurzen Gang entlang zu diesem Raum, wo er die Vorhänge vor dem Sichtfenster aufzog. Da lag Michael, bis zum Hals mit einem weißen Laken bedeckt. Nur sein Kopf schaute heraus. Dane durchzuckte ein solch scharfer Schmerz, dass er beinahe gestöhnt hätte. Er spürte Delions Hand auf seiner Schulter. Dann sah er den roten Punkt auf Michaels Stirn; er sah so unwirklich aus, als hätte ihn jemand dort aufgemalt, nicht mehr, bloß ein wenig Schminke, wie eine Art Modestatement oder irgendein Tick. Am liebsten hätte er Dr. Boyd gefragt, warum man den Fleck nicht weggewischt hatte.
Mit sanfter Stimme sagte Dr. Boyd: »Er war sofort tot, Agent Carver. Er hat nicht mal mehr die Kugel gespürt, da bin ich sicher.«
Dane nickte.
»Die Autopsie wurde bereits durchgeführt, Fingerabdrücke, DNA-Proben und so weiter.«
»Ja, ich weiß.«
Delion trat mit vor der Brust verschränkten Armen einen Schritt zurück und musterte Agent Dane Carver. Er wusste, wie ein Mensch aussieht, der unter Schock steht. Und er erkannte auch tiefsten Schmerz. Beides sah er im Gesicht dieses Mannes. Als Dane schließlich nickte, sagte Delion: »Chief Kreider möchte uns jetzt sprechen.«
Chief Dexter Kreiders Sekretärin führte sie ins Chefbüro. Es war kein allzu großer Raum, aber die Aussicht war umwerfend. Durch ein Fenster, das die ganze Länge einer Wand einnahm, hatte man einen atemberaubenden Blick über die Bucht und hinaus auf die Bay Bridge. Ins Auge fielen auch ein riesiges Yahoo-Plakat sowie eine Cola-Light-Werbewand. Im Zimmer standen ein mächtiger Schreibtisch und zwei große Vitrinen voller Schnickschnack. Dane musste unwillkürlich lächeln, als er das sah. In fast jedem Büro von einem der hohen Tiere, sei es nun bei der Polizei oder beim FBI, das er je gesehen hatte, stand mindestens eine solche Vitrine. Nun, der Chief schien überdies ein wenig schrullig zu sein, was ihn in Danes Augen nur sympathischer machte: In einer Ecke stand ein bunt bemaltes hölzernes Karussellpferd. Ein zweckmäßiges und schrulliges Büro. Nette Kombination.
Aber eines wusste Dane: Chief Kreider selbst konnte sich auf keinen Fall auf dieses Karussellpferd setzen. Er war ein Riese von einem Mann, fast zwei Meter groß und gut zweihundertsechzig Pfund schwer, dabei jedoch keineswegs dick, nicht mal um die Gürtellinie. Er hatte einen militärisch kurzen Haarschnitt, grau meliert und dicht wie bei einem Dachs. Dazu trug er eine Pilotenbrille. Dane schätzte ihn auf Mitte fünfzig.
Er lächelte nicht zur Begrüßung. »Carver? Dane Carver? Spezialagent?«
Dane nickte knapp und schüttelte die dargebotene Pranke.
»Freut mich, Sie kennen zu lernen. Kommen Sie, setzen Sie sich. Tina, bringen Sie uns Kaffee.«
Delion und Dane nahmen an dem kleinen runden Tisch in der Mitte des Büros Platz. Der Chief selbst setzte sich nicht, sondern stand hoch aufgetürmt vor ihnen, die Arme über der fassähnlichen Brust verschränkt. Dann begann er, unruhig auf und ab zu laufen, bis Tina, eine ältere Dame, die dieselbe militärische Präzision an den Tag legte wie ihr Chef, den Kaffee eingeschenkt, dem Boss zugenickt hatte und wieder verschwunden war. Endlich sagte er: »Hab eine E-Mail von Dillon Savich, Ihrem Boss drüben in Disneyland East, gekriegt.«
»Ein guter Mann«, sagte Delion.
Kreider meinte: »Ja, typisch für ihn. Savich schreibt mir, Sie wären ein ziemlich schlaues Kerlchen und hätten ’ne unschlagbare Nase. Er bittet mich, Sie in den Fall mit einzubeziehen. Was halten Sie davon, Delion? Möchten Sie mit den FBI-Fritzen gemeinsame Sache machen?«
»Nein«, wehrte Delion ab. »Das ist mein Fall. Aber Carver kann mitmachen, wenn er will. Vorausgesetzt, er weiß, dass ich das Sagen habe.«
»Ich will Ihnen den Fall nicht wegnehmen«, beschwichtigte Dane, »das liegt mir fern. Alles, was ich will, ist helfen, den Mörder meines Bruders zu finden.«
Kreider sagte: »Also gut. Delions Partner, Marty Loomis, liegt ausgerechnet mit ’ner Gürtelrose im Bett. Wird noch ’n paar Wochen nicht zu gebrauchen sein. Inspektor Marino arbeitet seit Sonntagnacht mit Delion an dem Fall. Ich hab mir die Sache durch den Kopf gehen lassen.« Er unterbrach sich einen Moment und lächelte. »Ich kannte Dillon Savichs Vater, Buck Savich. Das war vielleicht ein Wilder, dabei aber so gerissen, der konnte einen Gauner bis nach Lettland scheuchen. Wie ich höre, ist sein Sohn kein solcher Wilder – nicht wie sein Vater –, aber er hat den Grips von seinem Alten und ist außerdem ein Vollprofi bis in die Fingerspitzen. Ich habe seinen Vater geachtet, und ich achte den Sohn. Sie, Carver, kenne ich nicht, aber im Moment werde ich mich mit Savichs Wort begnügen und es mit Ihnen versuchen.«
»Wie gesagt«, meinte Delion, »ich hab nichts dagegen, wenn er mitmacht, Sir. Vielleicht gibt er ab und zu sogar was Brauchbares von sich.«
»Das denke ich auch«, meinte Kreider. Er ging noch ein paarmal hin und her und blieb dann direkt vor Dane stehen. »Oder möchten Sie lieber einen Alleingang machen?«
Dane blickte zu Delion hinüber. Die Miene des Mannes verriet keine Regung. Er starrte ungerührt zurück. Dane war kein Dummkopf. Langsam schüttelte er den Kopf. »Nein, ich würde lieber mit Delion zusammenarbeiten.«
»Umso besser.« Chief Kreider nahm seine Kaffeetasse, trank einen Schluck und stellte sie wieder ab. »Ich werde Marino woanders einteilen. Delion, ich erwarte zweimal täglich einen Statusbericht.«
Nachdem sie entlassen worden waren, sagte Delion auf dem Weg zur Garage: »Wir von der Einheit fragen uns oft, wie Kreider es mit dem Sex hält, weil er andauernd rumläuft. Ist schwer, was zustande zu kriegen, wenn man nie stillhält.«
»Kennen Sie nicht diesen Film mit Jack Nicholson – Five Easy Pieces?«
Delion verdrehte die Augen und lachte. Gekonnt steuerte er seinen Dienstwagen, einen Ford Crown Victoria, Baujahr 1998 mit weißblauen Sitzpolstern, in den dichten Verkehr auf der Bryant Street. Von dort fuhr er nördlich, überquerte die Market Street und kämpfte sich durch den Verkehr zum Nob Hill hinauf. In der Clay fanden sie einen Parkplatz.
Delion sagte: »Die Notrufzentrale hat einen Polizeibeamten aus dem zehnten Distrikt hingeschickt. Der hat dann das Morddezernat informiert, und die haben mich und die Sanitäter benachrichtigt. Bei uns sind es die Sanitäter, die den Gerichtsmediziner holen. Und weil das so ein wichtiger Fall ist, ist Dr. Boyd persönlich zur Kirche gekommen. Ich weiß nicht, wie gut Sie sich in San Francisco auskennen, aber wir sind hier nahe am Schwulenviertel. In der Polk Street, ein paar Straßen weiter, ist immer was los.«
»Ja, ich weiß«, sagte Dane. »Und mein Bruder war übrigens nicht schwul, falls Sie sich das gefragt haben.«
»Das hat mir Ihre Schwester auch schon gesagt«, meinte Delion. Er hielt einen Moment inne und blickte hinauf zum Glockenturm. »Sankt Bartholomäus wurde nach dem Erdbeben neunzehnhundertsechs erbaut. Die alte Kirche brannte ab. Damals hat man diesen Backsteinbau errichtet. Sehen Sie sich mal den Glockenturm an – einer der einflussreichsten Bürger der damaligen Zeit, Mortimer Grist, hat den finanziert. Ist fast zehn Meter höher als das Dach.«
»Sieht alles ziemlich gut erhalten aus.«
»Gehen wir erst mal in die Kirche«, schlug Delion vor. »Dann sehen Sie alles.«
Ja, dann konnte er sehen, wo sein Bruder gestorben war. Dane nickte, doch während sie den breiten Mittelgang entlangschritten und je näher sie dem Beichtstuhl kamen, dem dritten, dem, der an der entferntesten Wand stand, desto schwerer fiel es Dane, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Es schnürte ihm förmlich die Brust ab, sodass er kaum noch Luft bekam. So schwer es auch gewesen war, seinen Bruder im Leichenschauhaus zu identifizieren, dies hier war noch schwerer. Auf einmal traf ihn ein Lichtstrahl von oben, ein feuriger, bunter Farbfunken. Er blieb unwillkürlich stehen. Als er aufblickte, sah er eines der riesigen Kirchenfenster, das durch die hereinscheinende Sonne in brillanten Farben erstrahlte. Dane stand direkt in diesem Lichtkegel. Er regte sich nicht, stand einfach nur da, den Blick nach oben gerichtet, das Gesicht im warmen Licht badend. Erst jetzt erkannte er die dargestellte Szene. Es waren Marla und Josef mit dem Jesuskind in der Krippe. Umgeben waren sie von singenden Engeln, überall Engel. Er glaubte, ihren überirdischen Gesang zu hören. Da holte er tief Luft. Ihm wurde ein klein wenig wärmer, und auch sein Kummer wurde ein klein wenig erträglicher. Der Beichtstuhl war nicht zu sehen. Anstatt den Tatort mit gelbem Plastikband abzusperren, hatte man den Beichtstuhl mit einem dicken schwarzen Vorhang vor neugierigen Blicken und Händen verborgen. Delion schob den Vorhang beiseite und enthüllte den Beichtstuhl – ein alter, ehrwürdiger Beichtstuhl, aus altem, dunklem, teilweise schon ein wenig zerkratztem Holz. Hoch und schmal, mit zwei schmalen Türen, die erste für den Beichtenden, die andere für den Priester. Der funkelnde bunte Lichtstrahl fiel jetzt direkt auf diesen Beichtstuhl und ließ ihn beinahe durchscheinend wirken.
Langsam öffnete er die Tür und setzte sich auf die harte Bank. Er blickte durch das zerstörte Sichtgitter. Sein Bruder war noch vor kurzem hier gewesen, hatte gesprochen, hatte intensiv zugehört. Er bezweifelte, dass der Mann die Kniebank benutzt hatte; bei diesem Eintrittswinkel war das höchst unwahrscheinlich. Ob Michael gewusst hatte, dass der Mann ihn töten würde?
Dane erhob sich und ging zur anderen Seite. Auch diese Tür öffnete er und setzte sich auf den gepolsterten Sitz, wo sein Bruder gesessen hatte. Er wusste nicht, was er sich davon erwartet hatte, an dem Platz zu sitzen, wo sein Bruder gestorben war, tatsächlich jedoch verspürte er keinerlei Furcht, keine Kälte oder Schwärze, bloß eine Art Frieden, der ihn bis ins Innerste durchflutete. Er holte tief Luft und neigte den Kopf. »Michael«, sagte er.
Als Spezialagent Dane Carver wieder aus dem Beichtstuhl herauskam, trat Delion einen Schritt zurück. Er sagte nichts, denn er sah, dass der Mann Tränen in den Augen hatte.
»Kommen Sie, gehen wir jetzt ins Pfarrhaus«, sagte Dane, und Delion nickte nur.
Sie gingen um die Rückseite der Kirche herum zur Pfarrei, die hinter ein paar Eukalyptusbäumen und einem hohen Zaun versteckt lag. Es war stiller hier, als Dane vermutet hätte, der Verkehr war kaum zu hören. Das Pfarrhaus war ein hübsches zweistöckiges Gebäude, die roten Backsteinwände waren mit dichtem grünem Efeu überwuchert. Im Hintergrund stand leise plätschernd ein Springbrunnen. Alles roch so frisch.
Michael war tot, und alles roch frisch.
4
Als er die beiden Männer hereinkommen sah, erhob sich Vater Binney sofort von dem kleinen Empfangstisch, hinter dem er saß. Er war ein geradezu winziger Mann mit dem Kopf eines Leprechauns, eines irischen Kobolds. Solche flammend roten Haare hatte Dane noch nie gesehen, nicht das kleinste bisschen Grau oder Weiß in Sicht. Damit konnte es nicht mal Sherlock aufnehmen. Und dabei war Vater Binney fast sechzig. Erstaunlich.
Er streckte die Hand aus, als er Delion sah, doch im nächsten Moment schien es, als wolle er in Ohnmacht fallen. Er hielt sich an der Stuhllehne fest und starrte Dane an wie einen Geist.
»Mein Gott, haben Sie mich erschreckt.« Er griff sich an die Brust. »Sie müssen Vater Michael Josephs Bruder sein, ja genau. Jesus, Maria und Josef, sie sehen sich vielleicht ähnlich. Hat mir einen richtigen Schock versetzt. Aber kommen Sie doch rein, meine Herren, kommen Sie rein. Inspektor Delion, wie nett, Sie wiederzusehen. Sie müssen müde sein.«
»Hab ’ne lange Nacht hinter mir«, bestätigte Delion, während er Vater Binney folgte. Zu Dane sagte er: »Ich war heute Morgen, kurz vor acht, schon mal bei Vater Binney. Das war, nachdem die Jungs von der Spurensicherung endlich fertig waren und die Kirche wieder freigegeben haben.«
Und mir hast du kein Sterbenswörtchen davon gesagt, dachte Dane. Aber es hätte ihn auch überrascht, wenn Delion die Pfarrei nicht sofort aufgesucht hätte.
»Er hat mit allen gesprochen«, meinte Vater Binney. »Sie haben nichts in Vater Michael Josephs Zimmer gefunden, oder, Inspektor Delion?«
»Nein, nichts Ungewöhnliches jedenfalls.«
Vater Binney führte sie kopfschüttelnd in ein kleines Empfangszimmer. Es war voller alter, verkratzter, dunkler, aber dennoch eleganter chinesischer Möbel. Den Boden bedeckte ein noch älterer persischer Teppich, der an manchen Stellen derart fadenscheinig war, dass Dane sich fürchtete, draufzutreten. Auf den schweren roten Vorhängen prangten schwarze Drachen. »Bitte setzen Sie sich doch, meine Herren.« An Dane gewandt sagte er: »Mein aufrichtiges Beileid, Mr. Carver, zum Tod Ihres Bruders. Wir alle leiden sehr unter dem schrecklichen Verlust. Und wir alle mochten Vater Michael Joseph sehr. Einfach furchtbar, diese Sache, furchtbar. Meine Güte, Sie sehen ihm so ähnlich, es ist wie ein Schock. Obwohl ich natürlich schon Bilder von Ihnen beiden gesehen habe – wie ein Ei dem andern, genau dasselbe Lächeln. Meine Güte, das ist sehr schwer. Wie ich Inspektor Delion heute Morgen schon sagte, bin ich an allem schuld. Hätte ich dem Mann bloß nicht erlaubt, so spät noch zur Beichte zu kommen.«
Vater Binney sackte auf einem dicken roten Brokatpolstersessel zusammen, schwarze Soutane auf rotem Grund. Nur sein weißer Priesterkragen setzte noch einen anderen Farbtupfer. Seine Haare nicht. Auf einmal vergrub er das Gesicht in den Händen. Auf seinen Handrücken wucherten rote Härchen. Endlich blickte er auf. »Bitte entschuldigen Sie, aber ich kann Sie kaum anschauen, Mr. Carver, weil Sie so sehr wie Vater Michael Joseph aussehen. Dass er einfach so von uns gegangen ist, ist kaum zu ertragen. So etwas ist in Sankt Bartholomäus noch nie vorgekommen, und es ist alles meine Schuld.«
Dane sagte mit seiner tiefen, ruhigen Stimme: »Es ist nicht Ihre Schuld, Vater, genauso wenig wie meine. Nur dieser Wahnsinnige trägt die Schuld – nur er. Und jetzt erzählen Sie uns bitte, was Sie über diesen Mann wissen, Vater.«
Danes Worte schienen Vater Binney gut getan zu haben. Langsam hob er den Kopf. Bei Danes Anblick überlief ihn noch einmal ein heftiger Schauder. Dane merkte, dass er mit seinen kleinen Füßen kaum den Teppich berührte, was vielleicht ganz gut war, bei diesem abgetretenen Lappen.
»Wie ich Inspektor Delion heute Morgen schon sagte, hat der Mann Sonntagabend, etwa gegen acht Uhr, glaube ich, noch angerufen. Er meinte, es wäre dringend, dass er sehr krank sei, und wenn er nicht mit Vater Michael Joseph reden könnte, würde er vielleicht in die Hölle kommen, wenn er stirbt. Er war sehr überzeugend, wirklich. Natürlich haben wir geregelte Zeiten für die Beichte, aber der Mann hörte nicht auf, mich anzuflehen.«
»Was für einen Namen nannte Ihnen der Mann, Vater?«, erkundigte sich Dane.
Vater Binney antwortete: »Er sagte, er heiße Charles DeBruler. Er schwor mir, er habe schon zwei Mal bei Vater Michael Joseph gebeichtet, und dass der Vater ihm wirklich geholfen habe. Er sagte, er vertraue Vater Michael Joseph.«
»Was hat mein Bruder dazu gesagt?«
Vater Binney runzelte die Stirn. »Um ehrlich zu sein, er war ziemlich zornig. Er sagte, er kenne den Mann und dass er nie mehr mit ihm reden wolle, nie mehr. Ich war überrascht und habe ihm gesagt, dass ich noch nie erlebt hätte, dass er einem Bedürftigen seine Hilfe versage. Er wollte nicht, aber sehen Sie, ich habe ihm das Gefühl gegeben, er würde in seinen Pflichten versagen, wenn er dem Mann nicht die Beichte abnähme. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich es noch nie erlebt hätte, dass er jemandem die Beichte verweigere, egal, ob spät abends oder nicht, und egal, was er von der jeweiligen Person hielt. Vater Michael Joseph wollte nicht mit mir über diesen Mann reden, aber er meinte, er würde sich noch ein einziges Mal mit ihm treffen. Wenn er dann nichts tun könne, um den Mann zu ändern, dann wäre das das letzte Mal. Dann sagte er noch, er müsse eine wichtige Entscheidung treffen, eine Entscheidung, die sein ganzes Leben ändern könnte.« Vater Binney sagte nichts mehr.
»Was glauben Sie, hat er damit gemeint, Vater, eine Entscheidung, die ›sein Leben ändern könnte‹?«
»Ich weiß nicht«, seufzte Vater Binney. »Ich habe keine Ahnung.«
Dane nickte langsam. »Der Mann hat dreimal ausdrücklich nach meinem Bruder verlangt. Wieso? Wenn er nicht wirklich beichten wollte, wieso wollte er dann unbedingt zu meinem Bruder?«
»Das habe ich mich selbst schon tausendmal gefragt«, sagte Vater Binney. »Dreimal war er bei Vater Michael Joseph. Wieso wollte Vater Michael Joseph nichts mehr mit ihm zu tun haben? Wieso hat er gesagt, er müsste eine Entscheidung treffen, die sein ganzes Leben verändern könnte?«
»Klingt mir ganz danach, als ob dieser Mann nicht die Absicht hatte, wirklich zu bereuen«, erklärte Delion. »Vielleicht wollte er mit seinen Taten ja nur vor Ihrem Bruder prahlen, wollte mit seinen Verbrechen vor jemandem angeben, der nichts dagegen machen konnte. Vielleicht war Ihr Bruder deshalb so wütend, Dane, vielleicht wollte er deshalb nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er wusste, dass der Mann bloß mit ihm spielt. Was glauben Sie? Es würde erklären, warum Vater Michael Joseph nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. Oder ist das zu weit hergeholt?«
»Ich weiß nicht«, grübelte Dane. »Der Mann kam dreimal.« Er schwieg. »Beim dritten Mal hat er meinen Bruder getötet.«
Vater Binneys Augen füllten sich mit Tränen. »Ach, aber wieso sollte dieser Mann Vater Michael Joseph quälen wollen? Wieso?« Vater Binney stand auf und begann, erregt auf und ab zu laufen. »Ich werde Vater Michael Joseph nie wiedersehen. Alle sind schrecklich traurig und, ja, zornig. Bischof Koshlap ist zutiefst bekümmert. Erzbischof Lugano ist außer sich. Ich glaube, er hat sich heute früh mit Chief Kreider getroffen.«
»Ja«, bestätigte Delion, »das stimmt.« Dann wandte er sich Dane zu. »Orin Ratcher, der Hausmeister, hat Vater Michael Joseph gefunden, kurz bevor die Polizei kam, richtig?«
»Ja«, meinte Vater Binney. »Orin hat Schlafstörungen und putzt zu allen möglichen und unmöglichen Zeiten. Er sagt, er hat gerade die Sakristei gewischt, als er ein Geräusch hörte, hat aber nicht weiter darauf geachtet. Kurz danach kam er dann ins Hauptschiff, und dort hat er Vater Michael Joseph im Beichtstuhl gefunden.«
»Und er hat niemanden gesehen?«
»Nein«, sagte Vater Binney. »Er sagt, da war niemand, nur eine finstere Stille und Vater Michael Joseph, der mit zurückgelegtem Kopf im Beichtstuhl saß. Gleich darauf kam ein Streifenpolizist herein und meinte, hier sei ein Mord gemeldet worden. Orin hat ihm Vater Michael Josephs Leiche gezeigt. Orin ist völlig fertig, der arme Mann. Wir behalten ihn die nächsten Tage hier bei uns, denn er soll nicht allein sein.«
Delion sagte: »Ich hab schon mit ihm gesprochen, Dane. Er hat die Frau, die den Mord meldete, auch nicht gesehen. Er hat niemanden gesehen.
Vater Binney, haben Sie schon diese Aufstellung von Vater Michael Josephs Freunden und Bekannten gemacht?«
»Es sind so viele.« Vater Binney griff seufzend in seine Tasche. »Mindestens fünfzig, Inspektor Delion.«
Delion steckte die Liste ein. »Man kann nie wissen, Vater«, meinte er.
»Vater Binney, könnten Sie uns sagen, wann die beiden anderen Male waren, an denen mein Bruder diesen Charles DeBruler traf?«
Vater Binney, froh darüber, etwas tun zu können, war fünf Minuten verschwunden. Als er wieder ins Empfangszimmer zurückkehrte, sagte er: »Vater Michael Joseph hat letzten Dienstag bis zweiundzwanzig Uhr die Beichte abgenommen und dann noch letzten Donnerstag bis einundzwanzig Uhr.«
Dane wollte sich gern noch das Zimmer seines Bruders ansehen, obwohl Delion es bereits durchsucht hatte. Nach fast einer Stunde hatten sie nichts gefunden, was irgendwelche Hinweise ergeben hätte. Sie fanden einen ganzen Stapel mit Danes E-Mails an seinen Bruder, beginnend mit dem Januar letzten Jahres, die er ausgedruckt und aufbewahrt hatte. Damals war er endlich auch online gegangen und prompt E-Mail-verrückt geworden. »Habt ihr Burschen euch den Computer meines Bruders vorgenommen?«