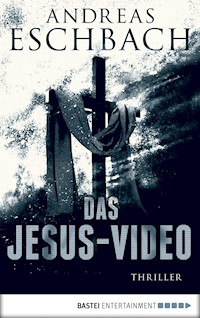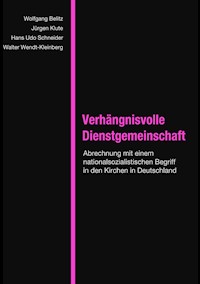
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Edition | Kultur der Arbeit
- Sprache: Deutsch
Die Kirchen beanspruchen seit Gründung der Bundesrepublik einen arbeitsrechtlichen Sonderstatuts für ihre Mitarbeitenden. Dieser mit dem Begriff "Dienstgemeinschaft" etikettierte Sonderstatus ist jedoch nicht, wie lange unterstellt, theologisch begründet, sondern es handelt sich um eine verhängnisvolle Übernahme aus dem nationalsozialistischen Arbeitsrecht. In politischen Fragen haben sich beide große Kirchen heute sehr klar für Menschenrechte und gegen faschistische Politikmodelle positioniert. Die Glaubwürdigkeit dieser Positionierungen leidet jedoch unter dem völlig unverständlichen Festhalten der Kirchen und ihrer Wohlfahrtsverbände an einem nationalsozialistischen antigewerkschaftlichen Arbeitsrechtskonzept. Die Autoren dieses Bandes fordern daher die Kirchen auf, sich im Interesse ihrer Glaubwürdigkeit 75 Jahre nach der Niederschlagung des Nationalsozialismus endlich von dem aus dem nationalsozialistischen Arbeitsrecht übernommenen Konzept der Dienstgemeinschaft loszusagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Edition | Kultur der Arbeit
————————————————————————
Band 3
„Wörter sind nicht unschuldig, können es nicht sein, sondern die Schuld der Sprecher wächst der Sprache selber zu. Fleischt sich ihr gleichsam ein.“
Dolf Sternberger, Gerhard Storz, Wilhelm E. Süskind: Aus dem Wörterbuch des Unmenschen, München 1968, 3. Aufl. S. →
Inhalt
Einleitung
Sozialethisches Autorenkollektiv
Verhängnisvolle „Dienstgemeinschaft“ – Eingabe an die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 15. Mai 2020
Jürgen Klute
Kirche und Arbeitsrecht: Eine unheilsvolle Geschichte
Grundlinien der Entwicklung kirchlichen Arbeitsrechts von der Weimarer Republik über die nationalsozialistische Diktatur bis zur Bundesrepublik
Hans-Udo Schneider
Das Phantom der Dienstgemeinschaft und der Irrweg der Kirchen.
Ein faschistisch geprägter Begriff darf zu keinem christlichen Leitbild werden!
Walter Wendt-Kleinberg
Arbeitswelt Diakonie
Dienstgemeinschaft: eine Wirklichkeit mit hoher Belastung und ohne echte Mitbestimmung
Wolfgang Belitz (1978)
"Es gibt keine zwingenden Gründe gegen Tarifverträge in der Kirche"
Wolfgang Belitz (1992/2020)
Arbeitswelt Kirche
Autoren
Einleitung
Das Konzept der „Dienstgemeinschaft“ als arbeitsrechtlicher Sonderweg der Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland galt lange als Reaktion der Kirchen auf die so genannte Gleichschaltung aller gesellschaftlichen Organisationen durch die Nationalsozialisten ab 1933. Deshalb „muss die Kirche auf dem uneingeschränkten Recht, den kirchlichen Dienst in freier, ihren Wesensgesetzen entsprechender Selbstverantwortung regeln zu können, unbedingt bestehen.“ So formulierte es Bischof Otto Dibelius in einem Brief vom 12.06.1951 an den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer. Dass die Kirchen sich der Gleichschaltung keineswegs entgegengestellt, sondern sie willfährig vollzogen haben, bleibt dabei unerwähnt.
Den Kirchen gelang es tatsächlich, sich mit ihrem Interesse durchzusetzen. Sie wurden sowohl aus dem Geltungsbereich des Betriebsverfassungsgesetzes wie auch aus dem des Bundespersonalvertretungsgesetzes ausgenommen.
Zwar gab es bis Anfang der 1960er Jahre auch Stimmen, die sich für Tarifverträge der Kirchen mit den Gewerkschaften aussprachen. So etwa das Wendland-Gutachten von 1957, die „Leitsätze betreffend Abschluss von Tarifverträgen für Arbeitnehmer in der Kirche“ der vom Rat der EKD berufenen Theologenkommission von 1959 und die von Konrad Stopp 1963 im Auftrag des Wissenschaftlichen Instituts des Diakonischen Werks in Bonn erstellte Studie „Dienst- und Arbeitsrecht in der Kirche“.
Diese Papiere hielten im Gegensatz zu dem Kirchenrechtler Werner Kalisch Tarifverträge aus einer theologischen Perspektive für vertretbar und zum anderen auch für zeitgemäß. Kalisch, der den Nationalsozialisten sehr nahegestanden hat, argumentierte mit Bezug auf das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg, dass Tarifverträge im Widerspruch zur christlichen Lehre stünden und daher die Dienstgemeinschaft das einzig akzeptable arbeitsrechtliche Konzept für Kirche und Diakonie und zu dem aus Art. 137 (3) der WRV – aufgenommen in 140 GG – abzuleiten sei.
Auch in den folgenden Jahrzehnten gab es noch wiederholt Versuche der Gewerkschaft ÖTV und ihrer Nachfolgerin Verdi, Tarifverträge und vor allem das Streikrecht in kirchlichen Einrichtungen durchzusetzen. Letzteres gelang dann 2012 im Rahmen eines Arbeitsgerichtsverfahrens.
Trotz aller Kritik an der „Dienstgemeinschaft“ gab es jedoch kein Hinterfragen der Herkunft dieses Konzepts und seiner Etikettierung. Allzu bereitwillig und völlig unkritisch ist man – selbst in der Gewerkschaft – den Thesen von Kalisch und Debelius und der offiziellen Lesart der Kirchen gefolgt, dass die Dienstgemeinschaft ein kirchlich-theologisches Konzept sei und deshalb einer Kritik von außen nicht zugänglich sei. Erst der Sozialwissenschaftler Herrmann Lührs1 hat die Frage nach dem ursprünglichen „Sitz im Leben“ des Begriffs „Dienstgemeinschaft“ gestellt. Die Antwort, die Lührs im Rahmen seiner Forschungsarbeit fand, lautet: Dieser Begriff ist kein theologisch-kirchlicher Begriff. Sein Ursprung ist nicht die Bibel, wie Kalisch wider besseres Wissen glauben machen wollte, sondern das nationalsozialistische Arbeitsrecht, das ab 1934 entwickelt wurde.
Das hat allerdings nicht zu einem Aufschrei in den Kirchen geführt und noch viel weniger zu einer Revision des kirchlichen Arbeitsrechts und zu einer Tilgung dieses genuin nationalsozialistischen Begriffs. Vielmehr beobachten wir in den letzten Jahren Anstrengungen der Kirche, den Begriff der Dienstgemeinschaft als normatives Leitbild zu etablieren. sondern zu einem bis heute andauernden Herumlavieren der Kirchen in diesem Punkt.
Erfreulicherweise finden die Kirchen heute – anders als 1933 – klare Worte, um sich von rechten Parteien und ihrer menschenverachtenden Politik zu distanzieren. Umso unverständlicher ist uns, dass die Kirchen bis heute an einem arbeitsrechtlichen System und dessen Etikettierung durch den Begriff „Dienstgemeinschaft“ festhalten, dessen Ursprung eindeutig dem Nationalsozialismus zuzurechnen ist und eben nicht der christlichen Lehre.
Dies hat die Autoren dieses Bandes, die als Sozialpfarrer und Sozialwissenschaftler für die Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) gearbeitet haben, dazu bewogen, eine Eingabe an die Kirchenleitung der EKvW zu richten machen, in der sie die Kirchenleitung auffordern, endlich im Interesse ihrer Glaubwürdigkeit – gerade auch in den aktuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen mit rechten Politikmodellen – dieses unsägliche und verhängnisvolle nationalsozialistischem Erbe abzustreifen.
In dem vorliegenden Band ist einerseits diese Eingabe vom 15. Mai 2020 dokumentiert. Zum anderen enthält der Band Beiträge zum historischen, theologischen und sozialwissenschaftlichen Hintergrund des gegenwärtigen kirchlichen Arbeitsrechts, die die Grundlage für die Eingabe an die Kirchenleitung der EKvW bilden.
Die Diskussion um Tarifverträge begann innerhalb der EKvW bereits 1978 mit dem Beitrag von Wolfgang Belitz „Es gibt keine zwingenden Gründe gegen Tarifverträge in der Kirche“.
Aus 1992 stammt ein Vortrags text von Wolfgang Belitz, der die Probleme kirchlicher Arbeitswelt schildert, analysiert und theologisch wertet.
Beide Texte sind als wichtige Etappen der Debatte innerhalb der EKvW ebenfalls noch einmal in diesem Band dokumentiert.
Ziel dieses Bandes ist es, diese Debatte über den engen innerkirchlichen Raum hinaus zu beleben, unsere Argumentation transparent und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Herne im Mai 2020
Jürgen Klute
1 Hermann Lührs: Kirchliche Dienstgemeinschaft. Genese und Gehalt eines umstrittenen Begriffs. In: Kirche und Recht 2007, S. 220-246.
Sozialethisches Autorenkollektiv KDA 123
Belitz/Klute/Dr. Schneider/Wendt-Kleinberg
Eingabe an die Kirchenleitung der
Evangelischen Kirche von Westfalen
vom 15. Mai 2020
„Verhängnisvolle Dienstgemeinschaft“
An jedes Mitglied persönlich
(Zur Veröffentlichung vorgesehen)
Sehr geehrte Frau Präses Kurschus!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Die Verfasser dieser Eingabe sind Sozialpfarrer und Sozialwissenschaftler i.R. und waren während ihres Berufslebens jahrzehntelang im Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA) der Evangelischen Kirche von Westfalen tätig, insgesamt 123 Jahre.
Seit 1998 treffen wir uns regelmäßig zu Gesprächen über sozialethische Grundfragen in Gesellschaft und Kirche. Daraus sind mehrere gemeinsame Buchveröffentlichungen entstanden.
Kontinuierlich haben wir uns all die Jahre auch mit der Kirche als Arbeitswelt befasst, deren sozialethischen Implikationen und Veränderungsprozessen. Als evangelische Sozialethiker sind wir immer eingetreten für die Teilnahme von Kirche und Diakonie am Tarifvertragswesen wie es in unserer Sozialgeschichte entstanden ist sowie für hoch entwickelte Formen der Mitbestimmung der Mitarbeitenden.
In der Entwicklung der kirchlichen Arbeitswelt spielte und spielt rechtlich und faktisch der Begriff Dienstgemeinschaft eine zentrale Rolle. Die Erkenntnisse und Erfahrungen der letzten Jahre zeigen uns, dass die Verwendung dieses Begriffs vor allem aus historischen, aber auch aus theologisch-ethischen, empirischen und verfassungsrechtlichen Gründen eine nicht tragbare Hypothek für die Kirche darstellt. Wir richten deshalb diese Eingabe an die Kirchenleitun der EKvW.
Wir bitten Sie eindringlich, ja wir fordern Sie nachdrücklich auf, durch entsprechende Beschlussfassungen zu bewirken, dass der Begriff „Dienstgemeinschaft“ in Kirche und Diakonie aufgegeben wird und aus allen einschlägigen Gesetzen, Verlautbarungen und offiziellen Äußerungen in Kirche und Diakonie entfernt wird und zukünftig nie mehr verwendet werden soll.
Wolfgang Belitz, Sozialpfarrer i.R.
Jürgen Klute, Sozialpfarrer i.R.
Dr. Hans-Udo Schneider, Sozialpfarrer i.R.
Walter Wendt-Kleinberg, Sozialwissenschaftler
Zur Begründung unserer Eingabe:
Bereits im Jahre 2007 hat der Sozialwissenschaftler und kirchliche Mitarbeiter Hermann Lührs unter dem Titel: Kirchliche Dienstgemeinschaft. Genese und Gehalt eines umstrittenen Begriffs eine bahnbrechende Untersuchung veröffentlicht2, Sie wirft ein ganz neues Licht auf den kirchlichen „Schlüsselbegriff“ Dienstgemeinschaft.
Wir folgen dem Gang und den Ergebnissen der Lührschen Untersuchung gerne und nehmen immer wieder Erkenntnisse aus ihr in unsere Stellungnahme auf, die wir in fünf Schritte gliedern:
Die Herkunft des Begriffs Dienstgemeinschaft und seine Übernahme in Kirche und Innere Mission
Die Entwicklung nach 1945
Auseinandersetzungen um die „Dienstgemeinschaft“
Entlastungsversuche sind verfehlte Bemühungen
Nachsatz: Wichtige Ansatzpunkte
Die historische Untersuchung Hermann Lührs‘ ergibt als ein erstes Fazit:
„Zum Zeitpunkt 1930 ist die Dienstgemeinschaft kein Bestandteil des kirchlichen Lebens oder Glaubenslehre beider Konfessionen – und zwar weder in der Weite theologisch-enzyklopädischer Zusammenfassungen noch im engeren Funktionsbereich von Diakonie und Caritas. Die Dienstgemeinschaft kommt als Kategorie des kirchlichen Selbstverständnisses schlechterdings nicht vor.“3
1. Die Herkunft des Begriffs Dienstgemeinschaft und seine Übernahme in Kirche und Innere Mission
Das Wort Dienstgemeinschaft ist eine genuine Neukonstruktion des Nationalsozialismus mit exklusivem Ursprung im nationalsozialistischen Arbeitsrecht und geprägt von der nationalsozialistischen Weltanschauung. Von dort ist es in die kirchliche Sphäre gelangt und dort bis heute geblieben.
Am 20. Januar 1934 hat die Reichsregierung das „Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit“ beschlossen und verkündet und gestaltet damit die Arbeitswelt gemäß nationalsozialistischer Weltanschauung nach dem Führer-/Gefolgschaftsprinzip:
„§1: Im Betrieb arbeiten der Unternehmer als Führer des Betriebes, die Angestellten und Arbeiter als Gefolgschaft gemeinsam zur Förderung der Betriebszwecke und zum gemeinsamen Nutzen von Volk und Staat.
§2: 1. Der Führer des Betriebes entscheidet der Gefolgschaft gegenüber in allen betrieblichen Angelegenheiten …
2. Er hat für das Wohl der Gefolgschaft zu sorgen. Diese hat ihm die in der Betriebsgemeinschaft begründete Treue zu halten.“
Als Konkretion dieses Gesetzes speziell für den öffentlichen Dienst hat die Reichsregierung am 23. März 1934 „Das Gesetz zur Ordnung der Arbeit in öffentlichen Betrieben und Verwaltungen“ beschlossen und verkündet. Dementsprechend ist der Paragraf 2 analog formuliert:
„1. Der Führer einer öffentlichen Verwaltung … entscheidet gegenüber den beschäftigten Arbeitern und Angestellten als der Gefolgschaft in allen Angelegenheiten, die durch dieses Gesetz geregelt werden …
2. Der Führer sorgt für das Wohl der Beschäftigten. Diese haben ihm die in der Dienstgemeinschaft begründete Treue zu halten und eingedenk ihrer Stellung im öffentlichen Dienst in ihrer Diensterfüllung allen Volksgenossen Vorbild zu sein.“
1938 wurden die Tarifverträge der Weimarer Zeit ersetzt durch die „Allgemeine Tarifordnung“ (ATO), die vom nationalsozialistischen Staat erlassen wurde. Vom Treuhänder für den öffent-lichen Dienst wurden auf dieser Grundlage die „Tarifordnung A für Gefolgschaftsmitglieder im öffentlichen Dienst“ (TOA) festgesetzt und überwacht. In beiden Ordnungen gibt es einleitend eine textgleiche Präambel:
„Im öffentlichen Dienst wirken zu allgemeinen Nutzen von Volk und Staat alle Schaffenden zusammen. Die ihnen gestellte Aufgabe erfordert eine Dienstgemeinschaft im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung, vorbildliche Erfüllung der Dienstpflicht und ein ihrer öffentlichen Stellung angemessenes Verhalten in und außer dem Dienst.“
Diese Tarifordnungen galten nicht unmittelbar in den Kirchen. Dazu bedurfte es ausdrücklicher Beschlüsse kirchenleitender Organe. Schon 1936 und 1937 gab es spezielle Tarifordnungen je für Innere Mission und Caritas mit gleichlautenden Präambeln:
„Betriebsführer und Gefolgschaft bilden eine Dienstgemeinschaft im Sinne des §2 des Gesetzes zur Ordnung der Arbeit in öffentlichen Verwaltungen und Betrieben vom 23. März 1934.“
Ein entsprechender Übernahmebeschluss für die verfasste Kirche findet sich im Gesetzblatt der Deutschen Evangelischen Kirche4 und lautet:
„Auf die bei der Deutschen Evangelischen Kirche und den deutschen evangelischen Landeskirchen einschl. der Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände beschäftigten Gefolgschaftsmitglieder finden die vom Reichstreuhänder für den öffentlichen Dienst erlassenen Tarifordnungen … nach Maßgabe dieser Anordnung Anwendung.“
Damit wird die gesamte evangelische Kirche mit all ihren Gliederungen einschließlich der Inneren Mission zur „Dienstgemeinschaft im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung“ erklärt mit folgenden Merkmalen:
• Verbot und Zerschlagung der Gewerkschaften seit 1933
• Abschaffung des Betriebsrätegesetzes von 1920 durch das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 21. Januar 1934
• Abschaffung der Tarifverträge und der Tarifautonomie (Streikverbot) durch die Allgemeine Tarifordnung (ATO) von 1938
• Einführung des Führer-/Gefolgschaftsprinzips (1934)
Von kirchlichen Bedenken gegen eine Übernahme des Gedankens der „Dienstgemeinschaft im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung“ und der Transformation in die Wirklichkeit ist nichts bekanntgeworden. Das Gegenteil zeigen zwei Zitathinweise von Lührs:
„Innere Mission und Nationalsozialismus gehören in Deutschland zusammen!“ (Losung des 9. Diakonietages im September 1933 in Hamburg)
„Wie tief greift das Gesetz für die Ordnung der nationalen Arbeit hinein in unseren praktischen Dienst! Da sehen wir ursprüngliche Gedanken der christlichen Ethik Gestalt gewinnen.“ (Bodelschwingh 19355)
Mehr Identifikation und Zustimmung gehen nicht.
Formell galt die Weimarer Verfassung auch im nationalsozialistischen Staat fort, wurde jedoch durch „verfassungsbrechende Gesetze“ (Reichstagsbrandordnung und Ermächtigungsgesetz 1933) weitgehend außer Kraft gesetzt.
2. Die Entwicklung nach 1945
Mit den Kontrollratsgesetzen Nr. 40 vom 30. November 1946 und Nr. 56 vom 30. Juni 1947 wurden die nationalsozialistischen Gesetze zur Ordnung der Arbeit beseitigt. Die darauf be-ruhenden Tarifordnungen im öffentlichen Dienst blieben zunächst in Kraft. An ihre Stelle sollten nach dem im April 1949 beschlossenen Tarifvertragsgesetz Tarifverträge treten. Die Verhand-lungen zogen sich 14 Jahre hin. Erst am 1. April 1961 wurden die nationalsozialistischen Tarifordnungen durch den BAT abgelöst.6
Im Caritasverband und in der Inneren Mission traten nach 1949 an die Stelle der Tarifordnungen Richtlinien für Arbeitsverträge (1951).