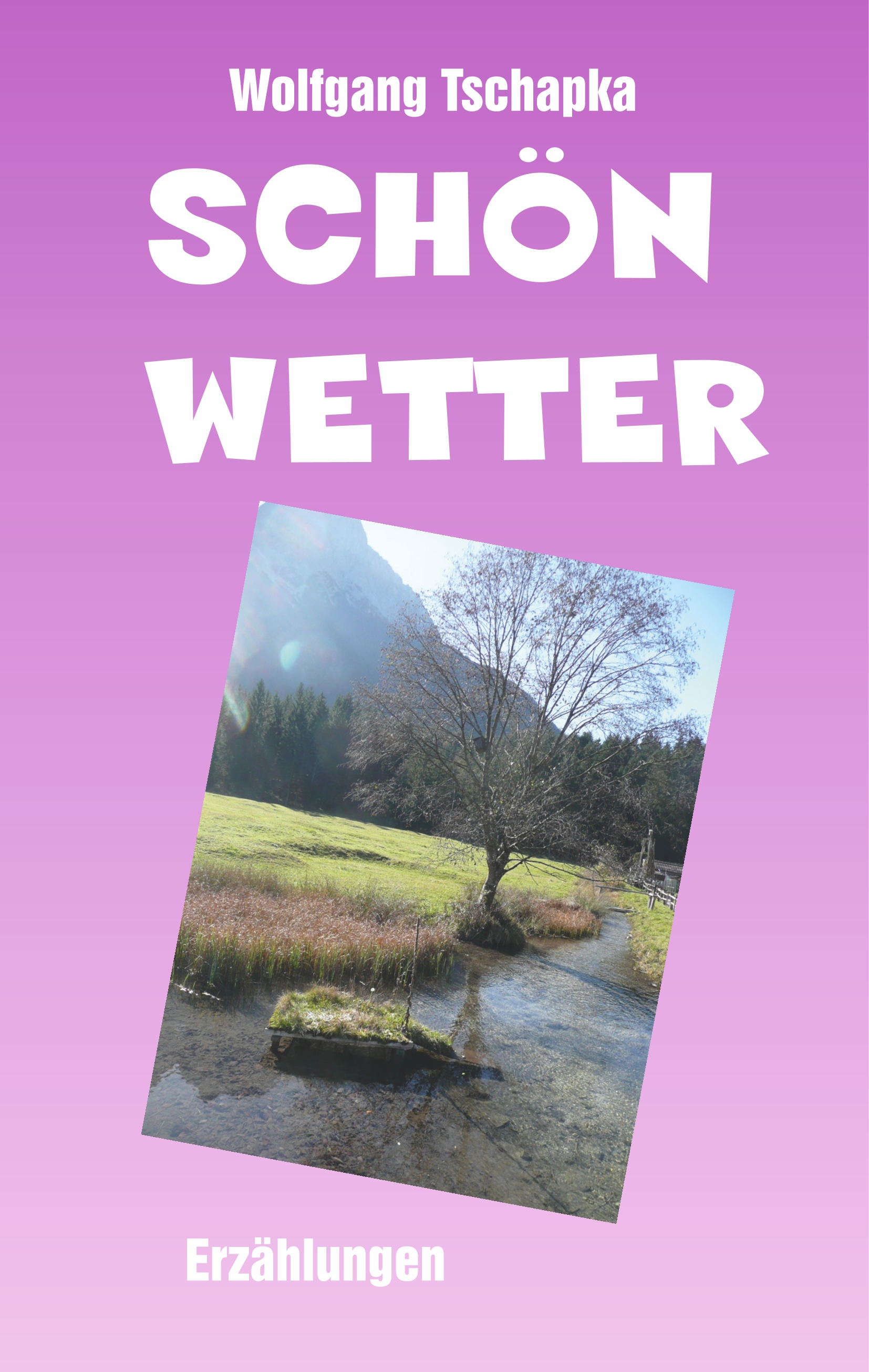Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Fast jeder kennt die Geschichten von Orpheus und Eurydike, Daidalos und Ikaros oder Pyramos und Thisbe. Aber was ist zum Beispiel mit Phaethon, der mit dem Sonnenwagen die Welt in Brand steckte? Oder Teiresias, der zur Frau und dann wieder zum Mann wurde? Oder Narkissos, der sich in sein Spiegelbild verliebte? Oder Pythagoras, der vermutlich der erste Vegetarier der Welt war? Bei Ovid kommen sie alle vor, und noch ein paar Hundert mehr...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 683
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Erstes Buch
Die Erschaffung der Welt, wie wir sie kennen
Die vier Weltepochen
Giganten, Lykaon und die tödliche Flut
Die Knochen der mächtigen Mutter
Phoibos Apollon, der große Held
Der Hundertäugige, die Kuh und das singende Rohr
Zweites Buch
Eine himmlische Katastrophe und ihre Folgen
Zeus und die Jägerin
Allerlei Vögel
Von Pferden und Kühen
Hermes und der Neid
Der Ritt auf dem Stier
Drittes Buch
Die Zähne des Drachens
Wenn eine Göttin zornig wird
Der zweimal geborene Dionysos
Nur eine Stimme
Verliebt in ein Spiegelbild
Ein neuer Gott und ein Schiff im Efeu
Blutrünstige Frauen
Viertes Buch
Wie die Maulbeeren schwarz wurden
Geschichten von Sonne und Liebe
Die Quelle der halben Männer
Wie Hera den Wahnsinn brachte
Ein liebendes Schlangenpaar
Ein neues Gebirge am Ende der Welt
Die Gefesselte und ihr fliegender Retter
Fünftes Buch
Das Blutbad von Aithiopia
Auch Musen haben Angst
Pallas Athene lauscht
Entführung in die Welt der Toten
Die keusche Quelle
Triumph der Musen
Sechstes Buch
Über Weben und Spinnen
Letos mörderische Rache
Neues Leben im Sumpf
Blutsschwestern
Der verliebte Nordwind
Siebentes Buch
Die Hexe von Kolchis
Alter Mann wird wieder jung
Die Hexe zeigt ihr wahres Gesicht
Gemischte Gefühle in Athen
Die Pest und die Ameisen
Tödliche Verwechslung
Achtes Buch
Der Raub der Purpurlocke
Ein verhängnisvoller Flug
Das böse Schwein von Kalydon
Ein Ende im Feuer
Die tragische Liebe eines Flussgottes
Ein göttlicher Besuch
Die Rache der Demeter
Neuntes Buch
Das verlorene Horn
Das giftige Kleid
Eine schwere Geburt
Das Ende einer geliebten Schwester
Erotische Träume und ihre Folgen
Wie Isis ein Mädchen glücklich machte
Zehntes Buch
Die traurigste Geschichte der Welt
Von Zypressen und anderen verbotenen Liebschaften
Das Mädchen aus Elfenbein
Im Bett des Vaters
Ein Rennen auf Leben und Tod
Elftes Buch
Die wilden Weiber von Thrakien
Es ist nicht alles Gold, was glänzt
Was Peleus alles erlebte
Die Schrecken des Meeres
Der Tote im Traum
Zwölftes Buch
Der Schwan von Troia
Vom Mädchen zum Mann
Mord und Totschlag – Kentauren gegen Menschen
Der größte Held wird erschossen
Dreizehntes Buch
Wer erbt die Waffen des Achilles?
Die Rache einer Königin
Woher der Tau kommt
Die große Flucht beginnt
Die tödliche Liebe des Einäugigen
Skylle will keinen halben Fisch
Vierzehntes Buch
Hexenkunst und höllische Magie
Die Flucht der Troianer geht weiter
Im Land des Menschenfressers
Zu Schweinen geworden
Die Singende und der Specht
Aineias will Italiener werden
Götterfrieden
Ein verliebter Gott verkleidet sich
Römer und Sabiner
Fünfzehntes Buch
Die Stadt des Flüchtlings
Verwandlungen und vegetarische Kost
Leid kann man nicht mit Leid vergleichen
Die wundersamen Hörner
Ein Gott wird nach Rom geholt
Mord in Rom – A Star is Born
Erstes Buch
Jetzt habe ich mir also in den Kopf gesetzt, die Geschichten von den Körpern, die sich in neue Gestalten verwandelten, zu erzählen. Ihr Götter, ihr habt ja diese Verwandlungen bewirkt – helft mir, mein Werk zum Leben zu erwecken, und führt es ohne Unterbrechung vom Anfang der Welt bis herunter in meine Zeit!
1. Die Erschaffung der Welt, wie wir sie kennen
Bevor es ein Meer gab und Kontinente und einen Himmel, der alles bedeckt, schaute auf der ganzen Welt alles gleich aus, und diese Welt hat man Chaos genannt: ein roher, ungeordneter Klumpen, nichts als eine leblose Masse, und Urstoffe, die ohne sinnvolle Verbindung miteinander Krieg führten. Die Sonne, dieser strahlende Titan, beleuchtete noch nicht den Tag in dieser Welt, und Phoibe zeigte noch nicht ihre zunehmende Sichel. Nicht einmal die Erde schwebte noch mit all ihrem Gewicht in der umgebenden Luft, und Amphitrite, die Mutter aller Ozeane, hatte noch nicht ihre Arme um den Rand der Erde geschlungen. Selbst dann, als es schon festes Land, Meer und Luft gab, war das Festland unbegehbar, das Meer unbefahrbar, und die Luft ohne jedes Licht. Nichts behielt seine Form, eine ständige Schlacht tobte zwischen den Elementen, denn in jedem Stück Materie kämpfte Heißes mit Kaltem, Feuchtes mit Trockenem, Weiches mit Hartem, Massives mit Flüchtigem.
Diesen Streit schlichtete eine freundlichere Natur, oder – sagen wir es ruhig – ein Gott. Denn er trennte die Erde vom Himmel und das Wasser vom Land und schuf einen Unterschied zwischen dichter Atmosphäre und himmlischem Weltall. Er holte all das aus dem undurchdringlichen Haufen des Chaos, und dann gab er einem Jeden seinen Platz in Frieden und Einigkeit. Das muss man sich so vorstellen: Das Feuer, dieses Element ohne Gewicht, steigt auf und bezieht seinen Platz ganz oben auf der himmlischen Burg. Als Nächstes folgt die Luft, die nicht ganz so leicht ist. Dichter als beide ist die Erde, und die unterliegt ihrer Schwerkraft und zieht alle festen Bestandteile an sich. Das Wasser schließlich nimmt den letzten Platz ein und begrenzt die solide Welt mit seiner strömenden Umarmung.
Wer auch immer von den Göttern es war, jedenfalls hatte er das undurchschaubare Chaos beseitigt und in geordnete Teile zerlegt. Und jetzt formte er die Erde als große Kugel – von allen Seiten betrachtet, sollte sie gleich aussehen. Dann befahl er dem Wasser, sich zu teilen, in den Stürmen Wellen zu schlagen und die Küsten der Erde zu umgeben.
Er fügte Quellen dazu, Teiche und große Seen, Flüsse auf ihrem Weg bergab sperrte er zwischen steile Ufer. Diese Flüsse, weit voneinander entfernt, versickern teils in der Erde selbst, teils münden sie ins Meer, wo sie als Teil der unermesslichen Weite mit ihren Wellen nicht mehr gegen enge Ufer, sondern gegen gewaltige Küsten schlagen.
Ebenen ließ er sich dehnen, Täler sich senken, Wälder sich mit Laub bedecken, Felsgebirge sich erheben. Und so wie es am Himmel fünf Zonen gab, je zwei in beiden Richtungen und eine fünfte, heißere, in der Mitte, so erzeugte der Plan des Gottes die gleiche Anzahl auch auf der Erde unter dem Himmel, und auch mit den gleichen Eigenschaften. Also ist die mittlere Zone vor Hitze nicht bewohnbar. Zwei Zonen bedeckt dickes Eis und tiefer Schnee. Nur dazwischen setzte der Gott gemäßigte Bereiche, wo Frost und Glut sich mischen.
Und über all dem hängt die Luft, die genau so viel schwerer ist als das Feuer, wie die Erde schwerer ist als das Wasser. Auch Nebel ließ der Schöpfer entstehen, Wolken sich formen, den Donner schuf er, der die Gemüter der Menschen erschüttern sollte, und Blitze sowie die Stürme, die die Blitze hervorrufen.
Diesen Stürmen aber erlaubte er nicht, sich auszutoben, wo immer sie wollten. Zwar sind sie nicht zu bremsen, aber jeder von ihnen muss auf seiner eigenen Bahn wehen, sonst würden sie die Welt zerreißen. So heftig tobt zwischen den Brüdern der Streit. Euros zog sich gegen den Sonnenaufgang zurück, nach Arabien und Persien, zu den Gebirgen, die in den morgendlichen Sonnenstrahlen glühen. Der Westen, wo die abendlichen Küsten im Licht der untergehenden Sonne feucht glitzern, ist Zephyros‘ Reich. In den Norden, unter die Sieben Sterne von Skythien, zog Boreas, der furchtbar Frostige. In der entgegengesetzten Richtung, wo ständig Dunst und Regenfälle herrschen, wird die Erde nass von Auster. Und über ihnen allen wurde der Aether geschaffen, der ganz klar und ganz frei von jeglichem Gewicht ist, und der nichts hat an irdischem Bodensatz.
Kaum hatte der Gott das alles in seine bestimmten Grenzen gesetzt, als die Sterne, die schon lange hinter undurchdringlicher Dunkelheit verborgen gewesen waren, am ganzen Himmelszelt zu strahlen begannen. Und damit kein Teil der Welt leer bliebe von beseeltem Leben, schreiten auf dem Boden des Himmels Götter und Sternenwesen, die Gewässer bieten den Fischen eine Heimat, die Erde hat sich der wilden Tiere angenommen und die Luft der Vögel.
Noch aber fehlte ein erhabeneres Geschöpf, das tiefe Gedanken denken und die Übrigen beherrschen konnte. So entstand der Mensch. Vielleicht zeugte ihn der Welterschaffer aus göttlichem Samen, als Beginn einer besseren Welt; vielleicht hatte auch die erst kürzlich geschaffene Erde noch etwas vom Samen des verwandten Himmels in sich. Diese Erde mischte Prometheus, der Sohn des Iapetos, mit Regenwasser, formte daraus ein Wesen nach dem Bild der alles lenkenden Götter, und während alle anderen Tiere gebückt zur Erde schauen, gab er dem Menschen ein Gesicht, das in die Höhe blickt, zum Himmel sollte er schauen und aufrecht seine Augen zu den Sternen richten. So verwandelte sich die Erde, die eben noch roh und formlos gewesen war, und füllte sich mit bis dahin unbekannten Menschengestalten.
2. Die vier Weltepochen
Golden war das Zeitalter, das als Erstes entstand. Freiwillig, ohne dass Druck ausgeübt wurde, pflegte es ohne Vorschriften Recht und Treue. Furcht vor Strafe war unbekannt, keine erzenen Gesetzestafeln drohten, und das Volk zitterte nicht demütig vor den Sprüchen eines Richters. Wie gesagt, die Menschen waren sicher, auch ohne Rächer. Das Pinienholz stand noch unbehelligt auf seinen Bergen und war noch nicht zu Schiffen verarbeitet worden, die die Welt erkunden sollten. Außer ihren eigenen Küsten war den Sterblichen alles unbekannt. Die Städte mussten sich noch nicht mit steilen Gräben umgeben, die Kriegssignale des gekrümmten Horns und der lang gezogenen Posaune waren nicht zu hören, es gab weder Helm noch Schwert. Ohne Militär lebten die Völker in behaglichem Frieden. Die Erde selbst war noch nicht von Pflügen und Eggen verwundet und schenkte, unberührt, all ihre Gaben von sich aus. Zufrieden mit dem, was die Natur ihnen gab, ohne gezwungen zu sein, pflückten die Menschen die Früchte der Bäume, wilde Erdbeeren, die auf Berghängen wuchsen, Kirschen und die von dornigem Gestrüpp hängenden Brombeeren, und vom Boden sammelten sie die Eicheln auf, die vom mächtigen Baum des Zeus herabgefallen waren.
Ewiger Frühling herrschte, Zephyros und seine milden Winde streichelten mit ihrem sanften Hauch die Blumen, die ohne Samen erblühten. Rasch schenkte der unbearbeitete Boden auch Feldfrüchte, und ohne bäuerliche Schwerarbeit leuchteten die Felder im Glanz reifer Ähren. Ströme aus Milch, Ströme aus Nektar flossen, und von den grünen Eichen tropfte goldgelber Honig.
Als aber Kronos in die Finsternis der Unterwelt verstoßen war und Zeus die Welt beherrschte, folgte das silberne Geschlecht, schlimmer als das Goldene, aber immer noch wertvoller als die rötliche Bronze. Zeus verkürzte den Zeitraum des alten Frühlings und teilte das Jahr in vier Teile: einen Winter, einen Sommer, einen wechselhaften Herbst und nur einen kurzen Frühling. Da geriet zum ersten Mal die heiße Luft in weiße Glut, und dann wieder erstarrte sie im frostigen Sturm zu Eis. Erstmals mussten die Menschen Unterkünfte suchen; ihre Behausungen waren Höhlen, dichtes Gebüsch, oder Reisig, das sie mit Bast zusammenbanden. Da mussten auch zum ersten Mal die Samen der Feldfrucht in langen Furchen vergraben werden, und unter dem Joch stöhnten die geschundenen Ochsen.
Als Drittes folgte darauf das bronzene Geschlecht, mit jähzornigem Gemüt und immer bereit, die tödlichen Waffen zu ergreifen, aber doch nicht ganz frevelhaft.
Das vierte Zeitalter aber war das des harten Eisens. Mit Urgewalt brach jegliches Verbrechen dieses bösartigen Metalls über die Welt herein. Es flüchteten Scham, Ehrgefühl und Wahrhaftigkeit. An ihre Stelle traten Lüge und Betrug, hinterlistige Gewalt und die alles verderbende Habsucht. Jetzt setzten sie die Segel in den Wind, wenn auch der Seemann sie noch nicht gut genug kannte, und die Stämme, die eben noch auf hohen Berggipfeln gestanden waren, tanzten über die unbekannten Fluten als Kiel und Mast. Bisher hatte der Boden, so wie das Sonnenlicht und die Luft, allen gemeinsam gehört. Aber jetzt kam der Landvermesser und markierte das Land mit langen Grenzlinien. Und nicht nur von der Oberfläche der Erde verlangte man pflichtschuldigst Ernten und Nahrung – nein, man drang in die Eingeweide der Erde ein, und was sich dort im Schattenreich des Styx verborgen gehalten hatte, grub man jetzt aus wie einen Schatz. Was für ein Unheil bringender Anreiz! Das muss man sich so vorstellen: Da kommt das schädliche Eisen heraus, und schädlicher noch, das Gold. Was folgt, ist wegen beidem der Krieg, der mit blutigen Händen die Waffen klirrend aufeinander drischt. Der Lebensunterhalt heißt Raub. Kein Gast ist vor dem Freund sicher, kein Schwiegersohn vor seinem Schwiegervater, sogar unter Brüdern gibt es kaum noch Liebe und Vertrauen. Der Mann lauert auf den Tod seiner Gattin, diese wieder will den Mann sterben sehen, mordlüsterne Stiefmütter mischen tödliches Gebräu, und der Sohn kann es kaum erwarten, zu erfahren, wie lange denn sein Vater noch leben wird.
Totgeschlagen lag die Gottesfurcht, und endlich, als Letzte der Himmlischen, verließ die bluttriefenden Länder Astraia, die jungfräuliche Gerechtigkeit.
3. Giganten, Lykaon und die tödliche Flut
Aber auch der Himmel sollte sich nicht sicherer fühlen als die Erde: Es heißt, dass ihre Söhne, die Giganten, Berge bis zu den Sternen aufeinander häuften, um das himmlische Reich anzugreifen. Da schleuderte der allmächtige Vater seinen Blitz, zertrümmerte damit den Olympos und schleuderte den Pelion vom darunter liegenden Ossagebirge. Da lagen nun die grässlichen Riesenkörper, begraben unter ihren eigenen Felsmassen. Von den Blutmengen ihrer Söhne getränkt, begann Mutter Erde die noch warme Feuchtigkeit wieder mit Leben zu erfüllen und daraus Menschen zu formen. So sollte wenigstens ein Denkmal ihrer Kinder bleiben. Aber natürlich hasste dieses Volk die himmlischen Götter und war mörderisch und gewalttätig. Sie konnten nicht verleugnen, dass sie aus Blut entstanden waren.
Der Sohn des Kronos sah das von seiner hohen Festung aus und seufzte. Er dachte an die schreckliche Untat des Lykaon, von der außer ihm noch niemand wusste, weil sie so neu war, und ein Zorn stieg in ihm auf, so mächtig wie ihn nur Zeus empfinden konnte. Er beschloss, eine Versammlung der Götter einzuberufen, und keiner von ihnen blieb fern.
Das muss man sich so vorstellen: Es gibt einen hohen Pfad, in klaren Nächten ist er deutlich zu sehen, der hell leuchtet und Milchstraße heißt. Diesen beschreiten die Himmlischen auf ihrem Weg zum königlichen Palast des großen Donnergottes. Zu beiden Seiten stehen Tore weit offen und erlauben vielen Besuchern Einblick in die Hallen der edelsten Götter. Etwas abgelegener befinden sich die Wohnungen des niederen Volkes. Diesen ganzen Bereich könnte man als Römer, wenn es nicht zu vermessen ist, ohne Weiteres als den Palatin des Himmels bezeichnen. Und hier setzen sich jetzt die überirdischen Mächte im marmorgeschmückten Versammlungssaal zur Beratung nieder.
An einem erhöhten Platz saß er selbst, der Vater, auf den Elfenbeinstab gestützt, und schüttelte langsam dreimal und viermal das wallende Haar seines Schrecken erregenden Kopfes. Mit dieser Bewegung konnte er Erde, Meer und Gestirne zum Beben bringen. Dann begann er mit zorniger Stimme zu sprechen:
„Noch nie war ich so besorgt um das Wohl der Welt. Nicht einmal zu der Zeit, als jeder einzelne schlangenfüßige Gigant begann, seine hundert Arme auszustrecken, um den Himmel zu bezwingen. Denn dieser Feind war zwar wild, der Angriff kam aber aus einer einzigen Quelle. Jetzt aber muss ich, soweit der Ozean die Welt umspannt, das ganze menschliche Geschlecht ausrotten. Das schwöre ich beim Styx und bei allen Flüssen der Unterwelt. Zuerst sollen alle Mittel versucht werden, aber was sich der Heilung entzieht, muss mit dem Messer weggeschnitten werden, um nicht gesunde Teile anzustecken. Ich habe Halbgötter, ich habe ländliche Nymphen, Faune, Satyrn und bergbewohnende Waldgeister. Wir gestehen ihnen zwar noch nicht die Ehre zu, im Himmel zu wohnen, aber zumindest müssen sie auf der Erde in Sicherheit leben dürfen. Oder glaubt ihr, meine Götter, dass sie sicher sein können in einer Welt, in der sogar mir, dem Herrscher über den Blitz und über euch alle, der berüchtigte Lykaon eine Falle zu stellen versucht hat?“
Ein entsetztes Geschrei erhob sich, und alle verlangten mit Nachdruck die Preisgabe dessen, der so etwas versucht hatte. (So ähnlich fürchtete sich die römische Bevölkerung seinerzeit, als eine Verbrecherbande mit Caesars Blut den Namen Roms zu vernichten plante, vor dem Zusammenbruch des Reiches, und die Loyalität zu dir, Augustus, ist nicht geringer als damals die zu Zeus.)
Dieser befahl mit einem knappen Wort und einer Geste, das Gemurmel einzustellen, und augenblicklich verstummten alle. In das gespannte Schweigen hinein begann Zeus wieder zu sprechen:
„Macht euch keine Sorgen, der Mann ist schon bestraft! Aber von seiner Tat und seiner Bestrafung will ich euch berichten. Das Gerücht von der Schlechtigkeit der Welt war zu mir gedrungen. Mit dem Wunsch, es als falsch zu widerlegen, begab ich mich vom Olymp hinunter und durchwanderte in Menschengestalt die Länder. Ich will es kurz machen: Die Wirklichkeit war viel ärger als das Gerücht. Ich kann gar nicht aufzählen, wie viel Frevel ich überall gefunden habe.
Ich hatte Mainala durchquert, die Brutstätte der wilden Tiere, Kyllene und die Pinienwälder des kalten Lykaios, und komme am Abend, als schon die Schatten der Nacht hereinbrechen, zur ungastlichen Residenz des Tyrannen von Arkadien. Ich gebe durch Zeichen zu verstehen, dass ein Gott erschienen ist, und das Volk beginnt zu beten. Lykaon aber macht sich zuerst lustig über die frommen Gebete, dann sagt er: ‚Ich werde durch eine Probe herausfinden, ob dieser ein Gott oder ein Mensch ist. Dann wird es keinen Zweifel mehr geben.‘ Er plante, mich in der Nacht zu überfallen und zu töten, während ich schlief. So wollte er die Wahrheit herausfinden. Damit nicht zufrieden, ließ er eine Geisel vom Volk der Molosser kommen und schnitt dem Mann mit seinem Dolch die Kehle durch. Teile des Toten, die noch warm waren, kochte er in heißem Wasser, andere Teile röstete er am Spieß. Kaum hatte er mir diese Speisen vorgesetzt, da brachte ich mit einem Blitzschlag sein Haus mitsamt den dort ansässigen Penaten zum Einsturz. Sie waren um nichts besser als der Hausherr.
Er selbst aber konnte in Panik flüchten. In der Stille des öden Landes versuchte er vergeblich zu sprechen – er konnte nur mehr heulen. Schaum stand vor seinem Maul. Seine gewohnte Mordlust wandte sich gegen Schafe und Ziegen, immer noch hat er Vergnügen am Blutvergießen. Seine Kleider wurden zu struppigem Fell, seine Arme zu Beinen. Er ist ein Wolf geworden, aber er behält Spuren seines einstigen Wesens: das graue Haar, das grimmige Gesicht, die glühenden Augen, die Bereitschaft zur Gewalt.
So ist ein Haus gefallen, aber nicht nur ein Haus hat es verdient. Soweit sich die Erde erstreckt, regieren die wahnsinnigen Erynnien. Alles hat sich zum Verbrechen verschworen. Und so sollen schnellstens alle die Strafe erleiden, die ihnen zusteht. Mein Entschluss steht fest!“
Einige Zuhörer stimmten Zeus‘ Worten zu und stachelten seinen Zorn sogar noch an, andere nickten nur schweigend. Aber alle bedauerten den Verlust des Menschengeschlechtes, und sie fragten sich, wie wohl die Zukunft der menschenleeren Welt aussehen würde. Wer würde Weihrauch zu den Altären tragen? Wollte Zeus die Erde den wilden Tieren zur Verwüstung überlassen? Auf diese Fragen befahl er ihnen, sich keine Sorgen zu machen, sie sollten ihm vertrauen, und er versprach ihnen eine Bevölkerung von wunderbarem Ursprung, die ganz anders sein sollte als die Menschen davor.
Schon war er bereit, seine Blitze gegen die ganze Welt zu schleudern, als er zu fürchten begann, der heilige Äther könnte ebenfalls in Brand geraten und das gesamte All könnte in Flammen aufgehen. Er erinnerte sich, dass in alten Schicksalssprüchen gesagt worden war, es werde einmal eine Zeit kommen, wo Meer, Erde und selbst der gequälte Himmel Feuer fangen und das gesamte Universum brennen würde. Deshalb legte er die Geschoße, die die Kyklopen geschmiedet hatten, wieder aus der Hand. Eine andere Strafe dachte er sich aus: Regenwolken sollten den ganzen Himmel bedecken, und die Menschen sollten in den Wellen eines uferlosen Meeres ertrinken.
Augenblicklich schloss er Boreas und alle anderen Winde, die die Wolken vertreiben, in den Grotten von Aiolien ein und schickte Notos hinaus.
Mit triefenden Flügeln fliegt Notos los, sein furchtbares Gesicht ist schwarz wie Pech, sein Bart schwer von Wolken, Wasserströme rinnen in seinen grauen Haaren, auf der Stirn sitzen dichte Nebel, und es tropft aus seinem Gefieder und seinem Schoß. Als er mit seiner riesigen Hand gegen die tief hängenden Wolken drückte, krachte der Donner. Und dann entleerten sich die schweren Wolken über die ganze Erde. In bunte Farben gekleidet nahm Iris, die Botin der Hera, das Wasser auf und führte es über den Regenbogen den Wolken als neue Nahrung zu. Die Saaten waren zerstört, die Gebete der Bauern umsonst, die Arbeit eines ganzen Jahres vernichtet.
Aber mit dem Himmel allein gibt sich der Zorn des Zeus nicht zufrieden. Sein meerblauer Bruder Poseidon unterstützt ihn mit hilfreichen Wogen. Der ruft nämlich die Ströme zusammen, und sobald diese unter dem Dach ihres Beherrschers angekommen sind, sagt er zu ihnen: „Wir brauchen jetzt gar keine langen Ermunterungen. Ergießt eure gewaltigen Kräfte! Das muss jetzt sein. Öffnet eure Tore, beseitigt alle hemmendem Dämme, und lasst euren Fluten die Zügel schießen!“
Sie gingen zurück, erweiterten alle Quellen, und wälzten sich wie befohlen hemmungslos, zügellos in die Meere.
Der Gott selbst stieß seinen Dreizack in den Grund, worauf die Erde erzitterte und mit ihrem Beben die Wege freigab für die Wassermassen. Jetzt strömten die Flüsse ungezähmt über die offenen Felder und rissen alles mit sich, Getreide und Obst genauso wie Mensch und Vieh, und mit all dem auch heilige Schreine mitsamt ihrem geweihten Inhalt. Wenn irgendwo ein Haus der Gewalt des Unheils unbeschädigt standhalten konnte und stehen blieb, dann wurde es bis über das Dach überflutet, und selbst hohe Türme verschwanden in den Strudeln. Schon war keine Unterscheidung mehr möglich zwischen Meer und festem Land. Es war einfach alles Meer, und dieses Meer besaß keine Küsten.
Jetzt muss man sich das vorstellen: Hier klettert einer auf einen Hügel, ein anderer setzt sich in ein Boot und rudert dort herum, wo er erst vor kurzem gepflügt hat. Dort segelt einer über die Felder oder das Dach seines überschwemmten Hauses, und der dort – er fängt einen Fisch im Wipfel einer Ulme. Wenn es der Zufall will, verfängt sich ein Anker in der grünen Wiese, oder der krumme Kiel streift die Reben eines Weinberges. Wo gerade noch die zierlichen Ziegen Gras pflückten, da lagern jetzt Robben ihre unförmigen Leiber. Die Nereiden staunen unter Wasser über Städte mit Häusern und Gärten. In den Wäldern schwimmen Delphine, die an die höchsten Äste der mächtigsten Eichen stoßen. Mitten unter den Lämmern schwimmt der Wolf, das Wasser trägt Löwen und Tiger. Was nützt jetzt dem wilden Eber sein blitzschneller Angriff, was nützen dem Hirsch seine schnellen Beine? Sie werden beide abgetrieben. Und nachdem er lange nach einem Platz gesucht hat, an dem er sich niederlassen könnte, fällt sogar der luftige Vogel mit erschöpften Flügeln ins Meer.
Der Großteil der Menschheit ertrank sofort. Wen die Flut verschonte, den tötete aus Mangel an Nahrung der Hunger.
4. Die Knochen der mächtigen Mutter
Zwischen Boiotien und den Gebieten von Oita liegt Phokis, ein fruchtbares Land, solange es noch Land war. In jener Zeit aber war es nur ein Teil des Ozeans, eine grenzenlose Weite aus unerwartetem Wasser. Dort erheben sich die zwei Gipfel des Parnassos steil in den Himmel, und seine Felsspitzen ragen in die Wolken. Als Deukalion mit seiner Frau dort sein kleines Schiff landete – alles andere war nämlich von den Fluten bedeckt – beteten sie zunächst zu den Nymphen von Korykos, zu den Göttern des Berges und zu der schicksalverkündenden Themis, die damals den Orakeln vorstand. Nie gab es einen anständigeren Mann als Deukalion, niemand liebte das Recht mehr als er, und sie war gottesfürchtiger als jede andere Frau.
Als nun Zeus sah, dass die ganze Welt ein stehendes Gewässer geworden war und dass von allen Tausenden nur dieser eine Mann und diese eine Frau übriggeblieben waren, beide unschuldig, beide Verehrer der Götter, da zerteilte er den Dunst und ließ Boreas die Wolken vertreiben, sodass Erde und Himmel einander wieder sehen konnten. Auch die Wut des Meeres legte sich, weil der Herrscher der Ozeane seinen Dreizack weglegte und so das Wasser beruhigte. Auf seinen Befehl erhob sich der gewaltige blaue Triton mit den Schneckenhausschultern über die Oberfläche des Meeres und blies in die laut tönende Muschel, als Signal für Ströme und Fluten, sich zurückzuziehen. Diese besondere Muschel, die mit einer Spirale beginnt und dann zu einem lang gezogenen weiten Trichter anwächst, erfüllt, sobald sie Tritons Atem spürt, mit ihrem Klang alle Küsten vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. So auch damals; als der nasse bärtige Mund des Gottes sie berührte und zum befohlenen Rückzug blies, hörten es alle Wellen des Landes und des Meeres, und so brachte das Muschelhorn alle, die es hörten, unter Kontrolle. Das Meer nahm wieder Küsten an, Flussbetten füllten sich wieder, wie es sich gehört, das Wasser ging zurück und Hügel traten zutage. Der Grund wurde sichtbar, trockener Boden wuchs aus den zurückweichenden Gewässern, und nach einem langen Tag standen auch die Wipfel der Wälder wieder frei da, nur im Laub hielt sich noch ein bisschen Schlamm.
Die Welt war also wieder hergestellt. Dass sie aber menschenleer war und in leblosem Schweigen versunken zu sein schien, das trieb Deukalion Tränen in die Augen, und weinend sagte er zu seiner Frau Pyrrha:
„Du meine liebe Frau, du Einzige, die mit mir leidet, uns verbindet nicht nur die Ehe, sondern auch enge Verwandtschaft, und jetzt teilen wir auch noch die gemeinsame Gefahr. Auf der ganzen Welt, vom äußersten Osten bis zum weiten Westen, scheinen wir zwei die einzigen Überlebenden zu sein. Alle anderen hat das Meer verschlungen. Aber so richtig kann ich auch jetzt noch nicht darauf vertrauen, dass wir in Sicherheit sind. Zu deutlich sehe ich noch die Regenwolken vor mir. Du armer Liebling, wie würdest du dich jetzt fühlen, wenn du allein gerettet worden wärst? Wie könntest du allein diese furchtbare Angst ertragen? Wer würde dich in deinem Schmerz trösten? Glaube mir, mein Schatz, wenn der Ozean dich behalten hätte, ich würde dir folgen und gerne auch ein Opfer des Meeres sein. Ach hätte ich doch die Fähigkeiten meines Vaters Prometheus und könnte aus Lehm Menschen formen, um neue Völker zu schaffen! Jetzt hängt das gesamte Menschengeschlecht nur von uns beiden ab, so wollen es die Himmlischen. Wir bleiben als Beispiele des Menschen übrig.“
Nach diesen Worten weinten die Beiden. Dann beschlossen sie, zu den himmlischen Mächten zu beten und in ihren heiligen Sprüchen Hilfe zu finden. Miteinander gingen sie zum Kephisos, der zwar noch nicht ganz klar, aber immerhin schon halbwegs innerhalb seiner Ufer floss. Aus ihm schöpften sie Wasser und benetzten damit ihre Kleidung und ihr Haar, dann schritten sie zum Heiligtum der Göttin, wo die Altäre Moos angesetzt hatten und schon lange ohne Feuer dastanden. Als sie die Stufen zu dem Tempel erreichten, fielen beide auf die Knie, beugten sich tief zu Boden und küssten mit zitternden Lippen den kalten Stein. Und so beteten sie gemeinsam:
„Es können doch die Gebete der Gerechten den Willen der Götter erweichen und ihren Zorn mildern. Wenn das so ist, dann sag uns, heilige Themis, mit welchen Mitteln das Unheil, das uns Menschen getroffen hat, wieder gut gemacht werden kann. Du Gnädigste, hilf einer untergegangenen Welt!“
Die Göttin war gerührt und erließ folgenden Spruch:
„Geht aus dem Tempel, verhüllt eure Häupter und öffnet die Kleider!
Nehmt und werft hinter euch die Gebeine der mächtigen Mutter!“
Erstarrt standen beide da. Die Erste, die das Schweigen unterbrach, war Pyrrha. Sie weigerte sich, das Gebot der Göttin zu befolgen, und bat mit schüchterner Stimme um Verzeihung, aber sie habe Furcht davor, den Schatten ihrer toten Mutter zu entweihen, indem sie ihre Knochen hinter sich warf.
Immer und immer wieder sagten sie sich die Worte des Orakels vor, die so voll von dunklen verborgenen Bedeutungen zu sein schienen, und dachten lange darüber nach. Und auf einmal begann der Sohn des Prometheus die Tochter des Epimetheus mit diesen tröstlichen Worten zu beruhigen:
„Es kann natürlich sein, dass ich mich täusche, aber die Sprüche eines Orakels sind doch heilig und raten nicht, einen Frevel zu begehen. Ich denke, die mächtige Mutter ist die Erde. Ich glaube, man bezeichnet die Steine in der Erde als ihre Knochen. Also sollen wir einfach diese Steine über unsere Schultern werfen.“
Die Titanentochter war zwar bewegt von dieser Auslegung ihres Mannes, aber in ihre Hoffnung mischte sich noch starker Zweifel. Irgendwie misstrauten die zwei dem göttlichen Gebot. Aber was sollte ein Versuch schon schaden? So machten sie sich auf den Weg.
Jetzt muss man sich das so vorstellen: Sie bedecken ihre Köpfe und öffnen die Gürtel. Und wie befohlen schleudern sie im Gehen Steine hinter sich. Und – wer würde das glauben, wenn nicht uralte Überlieferung es belegen würde? – die Steine beginnen ihre Härte zu verlieren, ihr starres Gefüge wird langsam weich und fängt an, Gestalt anzunehmen. Sie werden größer und biegsamer, und schließlich kann man so etwas wie eine menschliche Form erkennen, noch nicht sehr deutlich, sondern so wie wenn ein Künstler gerade erst begonnen hat, einen rohen Marmorblock zu bearbeiten, und man kann schon die ersten Kennzeichen des endgültigen Werkes sehen. Das, was an den Steinen an Erde und Feuchtigkeit klebt, verwandelt sich zu Muskeln, was hart und unbeweglich war, wird zu Knochen, Adern behalten ihren Namen, und innerhalb kurzer Zeit werden durch göttliches Wirken die Steine, die der Mann geworfen hat, zu männlichen Wesen, was die Frau geworfen hat, wird zur Frau.
Seither sind wir Menschen ein hartes Geschlecht, das Mühe und Plage ertragen kann. Wir sind lebende Beweise dafür, aus welchem Ursprung wir stammen.
5. Phoibos Apollon, der große Held
Alle anderen Lebensformen schuf die Erde von sich aus in verschiedener Gestalt. Als die Hitze der Sonne langsam die Feuchtigkeit erwärmt hatte, begann der Schlamm der Sümpfe zu wachsen, und wie im Schoß einer Mutter entwickelten sich in dem fruchtbaren Humus die Keime des Lebens und begannen im Lauf der Zeit, eine bestimmte Form anzunehmen. Man kann das mit dem Nil vergleichen, wenn er nach der Überschwemmung in sein altes Bett zurückgekehrt ist und der frische Lehm in der Hitze der Sonne zu glühen beginnt; dann finden die Bauern oft beim Wenden der Schollen tierartige Wesen. Manche von ihnen stehen am Beginn ihrer Entwicklung und quasi an der Schwelle zum Leben, manche sind unfertig und haben noch nicht alle Körperteile, in manchen Organismen lebt ein Teil schon, während gleichzeitig andere Teile noch rohes Erdreich sind. Es ist so: Wenn Wärme und Feuchtigkeit sich paaren, dann zeugen sie Leben. Aus diesen beiden Quellen entsteht alles. Obwohl Feuer und Wasser natürliche Feinde sind, bringen Hitze und Feuchtigkeit alle Dinge hervor, und diese zwieträchtige Eintracht ist fähig zur Zeugung von Leben.
Als damals also die Erde, noch feucht von der eben überstandenen Flut, sich in den Strahlen der himmlischen Sonne erhitzte, erschuf sie unzählige Kreaturen. Diese übernahmen zum Teil die ehemaligen Formen, aber teilweise brachte sie neue Arten hervor.
Zum Beispiel – und das hätte sie wohl gerne vermieden – erzeugte sie damals dich, großer Python.
Dieser früher unbekannte Drachen versetzte nämlich die neuen Völker in Angst und Schrecken. Wenn er sich niederlegte, bedeckte er fast die Fläche eines ganzen Gebirges.
Ihn konnte aber Phoibos Apollon, der bogentragende Gott, der seine tödlichen Waffen bis dahin nur gegen Hirsche und flüchtende Ziegen eingesetzt hatte, mit tausend Pfeilen zur Strecke bringen. Sein Köcher war schon fast leer, als das Untier endlich, aus dunklen Wunden giftiges Blut vergießend, starb. Um diese Heldentat nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, gründete der Gott heilige Spiele mit feierlichen Wettkämpfen, die nach dem Namen der getöteten Bestie „Pythische Spiele“ genannt wurden. Jeder junge Mann, der bei diesen Spielen im Boxen, Laufen oder Wagenrennen gewann, bekam als Siegeszeichen einen Kranz aus Eichenlaub. Lorbeer gab es noch nicht, sondern Phoibos schmückte seine Schläfen mit dem wunderschönen langen Haar damals noch mit jedem beliebigen Laub.
Die erste große Liebe des Phoibos Apollon war Daphne, die Tochter des Flussgottes Peneos. Diese Liebe kam ihm nicht zufällig, sondern der boshafte Zorn des Eros hatte sie ihm eingegeben. Das kam so:
Der mächtige Gott aus Delos, noch mit stolzgeschwellter Brust nach seinem Sieg über den Drachen, sah Eros, wie dieser die straffe Saite seines Bogens spannte, und sagte zu ihm: „Was willst denn du ordinäres Bürschlein mit Männerwaffen? Das sind schwere Dinge, die nur auf meine Schultern passen. Nur ich kann damit den wilden Bestien und Feinden tödliche Wunden zufügen. Zum Beispiel habe ich gerade erst mit zahllosen Pfeilen den entsetzlich gefährlichen Python erlegt, der mit seinem geschwollenen Bauch ganze Hektar zudecken konnte. Du sei zufrieden, wenn du mit deiner Fackel irgendwelche Liebschaften entzünden kannst! Maße dir nicht meine Ehre an!“
Darauf erwiderte der Sohn der Aphrodite: „Vielleicht, lieber Phoibos, kann dein Bogen alles Mögliche treffen, aber meiner trifft dich. So wie alle irdischen Lebewesen einem Gott weichen müssen, genau so muss sich dein Ruhm meinem geschlagen geben.“
Mit diesen Worten erhob er sich mit raschen Flügelschlägen in die Luft und landete auf dem schattigen Gipfel des Parnassos. Dort nahm er aus seinem Köcher voller Pfeile zwei Geschoße von gegensätzlicher Wirkung: Der eine vertreibt die Liebe, der andere bewirkt sie. Der sie bewirkt, ist vergoldet und seine geschliffene Spitze glänzt. Der sie vertreibt, ist stumpf und sein Schaft ist schwer von Blei. Mit diesem traf Eros die Nymphe des Peneos, mit dem Anderen aber schoss er Apollon durch die Knochen bis ins tiefste Mark hinein. Und sofort verliebte sich der, während das Mädchen vor jeder Verliebtheit davonlief und sich in den dichtesten Wäldern voll Freude bei den Verstecken des Wildes herumtrieb, das sie jagte und in Fallen fing, ganz so wie die jungfräuliche Göttin Phoibe. Ihr wild wallendes Haar zügelte sie mit einem Band.
Viele waren hinter ihr her, sie aber wies alle Bewerber unwirsch ab und durchstreifte ganz ohne Mann die unwegsamen Forste. Was Eros war, oder gar die Ehe und ihr stiftender Gott Hymen, war ihr völlig egal.
Oft sagte ihr Vater: „Mein Kind, du schuldest mir einen Schwiegersohn.“ Oft sagte er: „Enkelkinder, Töchterchen, bist du mir schuldig.“
Weil sie aber Hochzeitsfackeln so verabscheute, als wären sie ein Verbrechen, wurde sie zwar im ganzen wunderschönen Gesicht auf süße, schüchterne Weise rot, aber sie klammerte sich mit schmeichelnden Armen an den Hals ihres Vaters und bat: „Allerliebster Vater, lass mich die ewige Jungfräulichkeit genießen! Auch der Phoibe hat ihr Vater das gewährt.“
Natürlich musste der Vater nachgeben, aber, arme Daphne, deine Schönheit machte das unmöglich, was du verlangtest, dein Aussehen passte einfach nicht zu deinen Bitten.
Das kann man sich ja jetzt vorstellen: Phoibos ist geil und begehrt die Ehe mit Daphne schon im Augenblick, als er sie sieht. Er hofft auf Erfüllung seiner Begierde, und nicht einmal seine Gabe der Weissagung nützt ihm etwas. Wie die Stoppeln auf den Feldern nach der Ernte, wie dürre Hecken brennen, wenn ein Wanderer seine Fackel zu nahe an sie gehalten oder bei Tagesanbruch achtlos liegen gelassen hat, so ist der Gott in Flammen aufgegangen, so glüht er mit seinem ganzen Herzen und nährt diese Liebe mit sinnloser Hoffnung. Er betrachtet ihre Haare, wie sie ungeordnet über ihre Schultern fallen, und sagt: „Wenn die jetzt noch frisiert wären!“ Er sieht ihre Augen, in denen Funken wie kleine Sterne glühen; ihre Lippen sieht er, aber sie nur zu sehen genügt ihm nicht. Er bewundert ihre Finger, Hände und die Arme, die fast völlig nackt sind. Und alles, was er nicht sehen kann, stellt er sich noch schöner vor.
Sie aber flieht schneller als der Wind, und auch seine Worte, die er ihr nachruft, können sie nicht aufhalten: „Nymphe, bitte, Peneostochter, bleib stehen! Ich bin doch kein Feind, der dich verfolgt! Nymphe, bleib stehen! So flieht doch nur ein Lamm vor dem Wolf, oder eine Hirschkuh vor dem Löwen, so fliehen Tauben mit zitternden Federn vor dem Adler, also jeder vor seinem gewohnten Feind. Aber ich – ich folge dir aus Liebe! Ich Armer! Pass auf, dass du nicht fällst und deine schönen Schenkel von hässlichen Dornen zerstochen werden. Und ich wäre dann schuld an deinem Schmerz! Die Gegend, durch die du läufst, ist rau! Ich flehe dich an, lauf langsamer, ich verspreche dir auch, dass ich dich langsamer verfolgen werde. Und willst du gar nicht wissen, wer da hinter dir her ist, weil du ihm gefällst? Ich bin kein primitiver Bergbauer, ich bin kein Ziegenhirte, ich bin nicht einer, der hier dreckig herumsitzt und Viehherden bewacht. Du hast ja – ohne nachzudenken – du hast ja keine Ahnung, vor wem du fliehst, und deswegen fliehst du. Hör zu: Mir unterstehen das Gebiet von Delphi, Tenedos, und das Königreich von Patara, Zeus ist mein Vater. Durch mich wird alles offenbar, was war, ist und sein wird. Durch mich klingen Saiten musikalisch zusammen. Treffsicher ist mein Pfeil, aber leider ist ein Pfeil noch genauer als meiner, und der hat in mein schutzloses Herz eine tiefe Wunde gebohrt. Die Medizin ist meine Erfindung, die ganze Welt preist mich als Heiler, ich habe Macht über alle Kräuter. Und – weh mir! – trotzdem ist meine Liebe mit keinen Kräutern zu heilen, und die Künste, die allen Menschen helfen, versagen ausgerechnet ihrem Gebieter den Dienst!“
Sicher hätte Apollon noch mehr gesagt, aber Daphne lief von Angst getrieben weiter und ließ ihn mit seiner halb fertigen Rede einfach stehen. Und das Laufen machte sie noch reizvoller: Der Luftzug ließ ihren Körper unter dem feinen Gewand fast nackt erscheinen, ihr langes Haar flog nur so im Wind, und so steigerte die Flucht noch ihre Schönheit. Jetzt hielt es der junge Gott nicht länger aus, er beschloss auf weitere schmeichelnde Worte zu verzichten, und aufgestachelt von Eros‘ Pfeil folgte er der Nymphe im gestreckten Galopp. Er war wie ein gallischer Jagdhund, der am freien Feld einen Hasen erspäht, und jetzt sucht er im Lauf seine Beute, der Andere sein Heil; immer wieder glaubt der Verfolger, den Hasen erwischt zu haben, schon schnappen seine Zähne nach der Ferse des Hasen, dieser wiederum weiß nicht: Ist er jetzt schon gefangen? Und gerade noch kann er dem zuschlagenden Maul des Hundes entkommen. Genau so war der Gott schnell, weil er hoffte, und die Jungfrau, weil sie sich fürchtete. Weil ihn aber das unbarmherzige Geschoß des Liebesgottes antrieb, war er schneller, er gönnte ihr keine Rast und Ruhe, schon war er unmittelbar hinter ihr, sie konnte schon seinen heißen Atem in ihrem Nacken spüren. Jetzt verließen sie die Kräfte, sie wurde blass vor Angst, erschöpft von der anstrengenden Flucht brach sie fast zusammen, als sie endlich das Wasser ihres Vaters Peneos vor sich sah.
„Hilfe!“ schrie sie. „Vater, Hilfe! Wenn es stimmt, dass ihr Flüsse göttliche Kräfte habt, dann mach endlich meine Schönheit kaputt! Ich habe schon zu sehr mit ihr gereizt.“
Das Stoßgebet war noch nicht fertig ausgesprochen, da erfasste eine bleierne Schwere ihre Beine. Ihr weicher Körper umgab sich mit einer zarten Rinde, zwischen ihren Haaren wuchsen belaubte Zweige, und zu Ästen wurden ihre Arme. Die Füße, die sie gerade noch so schnell getragen hatten, hingen an zähen Wurzeln fest, und ihr Gesicht verschwand in einer dichten Baumkrone. Einzig und allein ihre glänzende Schönheit blieb ihr.
Phoibos war auch jetzt noch verliebt in sie. Zärtlich berührte er ihren Stamm mit seiner rechten Hand und glaubte unter der jungen Rinde noch ihr Herz schlagen zu spüren. Da umarmte er die Äste, als ob sie noch menschlich wären, und küsste das Holz, aber sogar das Holz wich noch vor seinen Küssen zurück.
„Leider“, schluchzte er, „leider kannst du nicht meine Frau sein; aber mein Baum wirst du immer sein! Mit dir werde ich mein Haar schmücken, meinen Köcher, und natürlich, geliebter Lorbeer, meine Kithara. Du wirst bei den lateinischen Feldherren sein, wenn die Siegesposaunen zum Triumphzug rufen und die heiligen Prozessionen auf das Capitol ziehen. Als treue Wächterin wirst du vor den Portalen des Augustus stehen und wachsam auf die Eichenlaubkrone blicken, die in der Mitte hängt.
So wie mein Kopf ewig jung und ewig mein Haar ungeschnitten, sollst du die Ehre besitzen des immer grünenden Laubes.“
So endete der Hymnus des Gottes. Der Lorbeerbaum winkte ihm mit seinen neuen Ästen wohlwollend zu, und man hätte meinen können, im Wehen seiner Krone das zustimmende Nicken eines liebenden Gesichtes zu erkennen.
6. Der Hundertäugige, die Kuh und das singende Rohr
Es ist in Thessalien, wo durch ein tiefes, von steilen Wäldern begrenztes Tal, das man Tempe nennt, der Peneos seine Fluten wälzt. Er entspringt am Fuße des Pindos, und an seinen steilen Wasserfällen zerstäubt das Wasser zu Nebelwölkchen, die schimmern wie zarter Rauch, mit seinen schäumenden Kaskaden benetzt er die Wipfel der Bäume, und weithin ist sein Donnern zu hören. Hier haust er, der mächtige Flussgott, hier hat er Wohnstatt und Heiligtum. Von dieser Residenz aus, tief in einer Grotte unter überhängenden Felsen, herrscht er gebietend über das Wasser und die wasserbewohnenden Nymphen.
Hierher kamen nun alle Flussgötter des Landes, unsicher, ob sie dem verwaisten Vater Glück wünschen oder ihr Beileid aussprechen sollten. Alle kamen sie: der von Pappeln gesäumte Sperchios, der rastlose Enipeus, Apidanos, der Alte, sowie der sanfte Amphrysos und Aias. Bald gesellten sich auch andere zu ihnen, die, egal in welche Richtung ihre Strömung sie treibt, ihr Wasser schließlich, müde vom Wandern, in das Meer ergießen.
Inachos fehlte als Einziger. Er saß versteckt in der Tiefe seiner Höhle und vermehrte das Wasser seines Stromes mit seinen Tränen. Der Ärmste trauerte um seine Tochter Io, die er für verloren hielt. Er wusste nicht einmal, ob sie noch am Leben war oder schon tot. Aber da er sie nirgends finden konnte, musste sie wohl auch nirgends sein, und im Geist malte er sich Dinge aus, die ärger waren als der Tod.
Was war geschehen?
Natürlich hatte Zeus sie gesehen, als sie vom Haus ihres Vaters ging, und sie angesprochen: „O Jungfrau! Du bist eines Zeus würdig! Wer weiß, für wessen Ehebett du bestimmt bist, aber jetzt, suche doch“ (so redete er wirklich) „suche doch den Schatten des hohen Waldes,“ (damit deutete er auf eine schattige Stelle im Wald) „solange es so heiß ist und die Sonne in der Mitte des Himmels steht. Vielleicht fürchtest du dich, allein die Verstecke der wilden Tiere zu betreten? Lass dich von einem Gott schützen, wenn du in die geheimsten Zonen des Waldes eindringst, und du wirst sicher sein. Noch dazu nicht von irgendeinem Gott! Ich bin der – du weißt schon – der in seiner Hand das gewaltige Zepter des Himmels hält; der die weithin treffenden Blitze schleudert. So lauf doch nicht davon!“ (Sie lief nämlich davon.) Sie hatte schon die Weiden von Lerna und das bewaldete Lyrkea verlassen, da verhüllte der Gott mit dichtem Nebel das gesamte Land, holte das Mädchen ein und fiel gewaltsam über sie her.
Seine Frau Hera schaute nun zufällig auf das zentrale Argos hinunter und wunderte sich darüber, dass flüchtiger Nebel mitten an einem so strahlenden Tag so plötzlich den Eindruck erweckte, als ob es Nacht wäre. Dass der nicht von einem Fluss stammte, und dass es nicht Ausdünstungen der feuchten Erde waren, merkte sie sofort. Also blickte sie sich um, wo denn ihr Gatte sei. Sie hatte ihn schon so oft bei Seitensprüngen ertappt. Nachdem sie ihn vom Himmel aus nicht entdeckte, sagte sie: „Wenn ich mich nicht täusche, werde ich gerade betrogen.“ Dann schwebte sie vom hohen Äther hinunter und landete auf der Erde.
Das muss man sich so vorstellen: Sie steht da und befiehlt dem Nebel, sich aufzulösen. Ihr Gatte aber hat die Ankunft seiner Frau vorausgeahnt und die Tochter des Inachos in eine junge Kuh verwandelt. Auch als Rind ist sie noch schön. Der Anblick der Kuh gefällt der Göttin, wenn sie es auch nur widerstrebend zugibt. Und als ob sie es nicht ganz genau wüsste, fragt sie, wessen Tier denn das sei und aus welcher Herde es stamme.
Um weiteren Fragen nach der Herkunft vorzubeugen, lügt Zeus ihr vor, es sei aus der Erde entsprungen. Prompt wünscht sich Hera die Kuh als Geschenk.
Was soll er jetzt tun? Seine Liebschaft zuzugeben, wäre grausam, das Geschenk zu verweigern, verdächtig. Die Scham rät ihm zu dem Einen, seine Liebe zum Anderen. Die Scham hätte sich schon von der Liebe besiegen lassen, aber wenn er seiner Schwester und Gattin ein so billiges Geschenk wie eine Kuh verweigert hätte, dann wäre möglicherweise aufgeflogen, dass sie keine echte Kuh ist.
So bekam Hera ihr Geschenk, aber sie legte nicht ihren ganzen Verdacht ab, denn sie befürchtete weitere Schwindeleien von Zeus. So übergab sie das Tier Argos, dem Sohn des Arestor, zur Bewachung. Dieser Argos hatte einen Kopf mit hundert Augen rundherum, von denen jeweils nur immer zwei schliefen, während die anderen auf ihrem Posten blieben und Wache hielten. Wie immer er sich also hinstellte, konnte er auf Io schauen, er hatte Io vor Augen, selbst wenn er sich umdrehte. Bei Tageslicht ließ er sie grasen. Wenn die Sonne unter die Erde gesunken war, schloss er sie ein und band die Ärmste am Hals fest. Ihre Nahrung bestand aus dem Laub der Bäume und bitterem Kraut. Statt auf ein Bett musste sich die Unglückliche auf die Erde legen, und die war nicht einmal immer mit Gras bewachsen. Zu trinken bekam sie schlammiges Flusswasser.
Wenn sie dann einmal flehend ihre Arme zu Argos ausstrecken wollte, stellte sie fest, dass sie gar keine Arme zum Ausstrecken hatte, und wenn sie sich dann zu beklagen versuchte, kam nur ein „Muh“ aus ihrem Maul, so dass sie von ihrer eigenen Stimme in Angst und Schrecken versetzt wurde.
Sie kam auch zu den Ufern ihres Vaters Inachos, wo sie so oft gespielt hatte. Als sie im Wasser das Spiegelbild ihres großen Mauls und ihrer neuen Hörner sah, scheute sie entsetzt vor sich selbst zurück.
Die Nymphen und selbst Inachos wussten nicht, wer sie war. Verzweifelt lief sie ihnen nach, dem Vater, den Schwestern, sie ließ sich berühren und bewundern. Der alte Inachos pflückte Gräser und hielt sie ihr vor das Gesicht. Da leckte sie seine Hände, sie küsste gewissermaßen die Handflächen ihres Vaters und konnte das Weinen nicht zurückhalten. Hätte sie Worte zur Verfügung gehabt, so hätte sie um Hilfe gefleht und ihren Namen und ihr Schicksal verraten. Aber statt gesprochenen Worten malte sie mit Buchstaben, die ihr Huf zeichnete, den traurigen Beweis für ihre Verwandlung in den Sand.
„Ich Ärmster!“ schrie da der Vater und klammerte sich an den schneeweißen Kopf und die Hörner seiner weinenden Tochter. „Ich Ärmster! Bist du die Tochter, die ich in allen Ländern der Welt gesucht habe? Solange ich dich nicht gefunden hatte, hast du mir weniger Schmerz bereitet, als jetzt, wo du gefunden bist! Du bist stumm und antwortest meinen Worten nicht. Du seufzt nur tief, und das Einzige, was du auf meine Anrede erwidern kannst, ist ‚Muh‘! Aber ich habe doch in meiner Unwissenheit schon eine Hochzeit für dich vorbereitet, meine erste Hoffnung war ein Schwiegersohn, meine zweite waren Enkelkinder! Und jetzt? Aus der Herde muss dein Mann sein, dein Kind muss aus der Herde stammen. Und diesen meinen Kummer kann nicht einmal der Tod beenden. Es ist fürchterlich, ein Gott zu sein, weil das verschlossene Tor des Todes unsere Trauer in alle Ewigkeit weiterleben lässt!“
Bei diesen Klagen des Vaters entzog der sternenäugige Argos ihm seine Tochter und führte sie behutsam in entferntere Weidegebiete. Weit entfernt setzte er sich auf den hohen Gipfel eines Berges, von wo er bequem alles um sich her beobachten konnte.
Jetzt konnte auch der Meister der Himmlischen diese großen Leiden seiner Geliebten nicht länger ertragen. Er ließ seinen Sohn kommen, den die strahlende Pleiade geboren hatte – also, um es kurz zu machen, Hermes – und befahl ihm, Argos zu töten. Dieser zögerte kaum: Er streifte die Flügelschuhe an seine Füße, ergriff mit mächtiger Hand den einschläfernden Stab und setzte sich den heiligen Hut auf sein Haar. So ausgestattet, sprang der Sohn des Zeus von der väterlichen Festung hinunter auf die Erde. Dort nahm er den Hut ab und legte seine Flügel beiseite. Nur den Stab behielt er in der Hand. Mit diesem trieb er wie ein Hirte eine Schar Ziegen, die er auf abgelegenen Wegen entführt hatte, vor sich her, dazu spielte er auf der selbst gebauten Flöte. Heras Wächter gefielen die ungewohnten Töne, und er sagte: „He du, wer du auch bist, du könntest dich zu mir auf meinen Stein setzen! Es gibt für dein Vieh kein ergiebigeres Grasland als hier, und wie du siehst, gibt es auch genug Schatten für die Hirten.“
So setzte sich der Enkel des Atlas zu ihm und vertrieb ihm den Tag mit einer Menge Gerede, dazwischen versuchte er mit dem Klang seiner Rohrflöte die wachsamen Augen zu überwältigen.
Argos aber kämpfte gegen das allmähliche Einnicken an, und obwohl sich auf einen Teil seiner Augen schon ein schwerer Schlaf gelegt hatte, war er immer noch teilweise wach. Er erkundigte sich sogar (die Flöte war etwas völlig Neues), wie so etwas erfunden werden konnte.
Und der Gott begann zu erzählen.
„Am Fuß der eiskalten Berge von Arkadien lebte unter den Waldnymphen des Nonakris eine ganz besonders begehrte Naiade. Die Nymphen nannten sie Syrinx. Nicht erst einmal hatte sie die Satyrn, die hinter ihr her waren, zum Narren gehalten, aber auch alle möglichen Götter, die im schattigen Wald und im fruchtbaren Feld hausten. Mit unversehrter Jungfräulichkeit verehrte sie Artemis, die Göttliche von Delos. Gekleidet wie diese, hätte man sie selbst für die Tochter der Leto halten können, wäre nicht ihr Bogen aus Horn gewesen, der der Göttin aber aus Gold. Trotzdem war die Täuschung fast vollkommen.
Eines Tages kam sie gerade von der Anhöhe des Lykaios zurück, als Pan, mit der Krone aus stechenden Pinienzweigen auf dem Kopf, sie erblickte. Er sprach sie an.“
Die weitere Erzählung unterblieb: Wie Pan sie ansprach, wie die Nymphe sein Werben verschmähte und durch unwegsame Wälder floh, bis sie an das Ufer des trägen, sandigen Ladon kam. Wie das Wasser hier ihre Flucht hemmte und sie ihre Wasserschwestern bat, sie zu verwandeln. Wie Pan, der schon glaubte, Syrinx gefangen zu haben, statt des Körpers einer Nymphe nur Sumpfgrasrohre in den Händen hielt. Enttäuscht soll er gestöhnt haben, aber da hörte er, wie der Wind in den Halmen einen zarten, irgendwie klagenden Laut erzeugte. Hingerissen von der völlig neuartigen süßen Stimme, so heißt es, sagte der Gott: „So wird mir wenigstens dieses Zwiegespräch mit dir bleiben!“ Und seit dieser Zeit trägt das Instrument aus ungleich langen Rohren, die mit Wachs verbunden sind, den Namen des Mädchens – Syrinx.
Ja, das alles hätte Hermes noch erzählen können, aber da merkte er, dass bereits alle Augen des Wächters zugefallen und eingeschlafen waren. Deshalb verstummte er sofort und vertiefte den Schlummer noch, indem er die müden Augen sanft mit seinem magischen Stab berührte. Dann gab es kein Zögern mehr: Mit seinem krummen Schwert schlug er genau an die Stelle, wo der Kopf an das Genick stößt, und schmetterte so den blutenden Kopf vom Felsgipfel hinunter. Der ganze schroffe Stein war blutüberströmt.
Da nun, Argos, liegst du, dem alle Lichter gelöscht sind.
Eine Finsternis hat deine hundert Augen bezwungen.
Diese Augen sammelte Hera auf und klebte sie an die Federn ihres heiligen Vogels, bis sein ganzer Schwanz leuchtete wie sternengleiche Edelsteine.
Aber sie war immer noch wütend und ließ ihrem Zorn nun freien Lauf. Vor den Augen ihrer griechischen Rivalin ließ sie die Grauen erregende Furie Erinys erscheinen, und in das Herz legte sie ihr eine blinde, nackte Angst, mit der sie sie über den ganzen Erdkreis verfolgte. Erst der Nil beendete Ios unendliche Mühsal. Als sie an seinem Ufer ankam, fiel sie auf die Knie, beugte gequält ihren Nacken, hob das Einzige, was sie heben konnte, ihr Gesicht, zum Himmel und sandte unter Tränen ihr Gebrüll und ihr klägliches Geheul zu den Sternen. Zeus, der das hörte, verstand es als Klage und Bitte, sie von ihrem Leid zu erlösen.
Also fiel er seiner Gattin um den Hals und bat sie, die Bestrafung endlich zu beenden. Er sagte: „Lege deine Furcht für alle Zukunft ab! Diese Frau wird dir keinen Schmerz mehr bereiten.“ Zur Bekräftigung legte er seinen Eid ab, wie immer beim unterirdischen Styx.
Wirklich war der Zorn der Göttin besänftigt. Io bekam wieder ihre frühere Gestalt zurück. Das muss man sich so vorstellen: Das struppige Fell fällt von ihrem Körper ab, die Hörner bilden sich zurück, der Umfang ihrer Augen wird kleiner, der Mund schmäler, es erscheinen wieder ihre Schultern und Hände, und statt Hufen hat sie wieder gewöhnliche Nägel, auch an den Füßen. Nichts an ihr erinnert noch an das Rind, das sie gewesen ist, außer vielleicht die fast weiße Helligkeit ihrer Haut. Endlich kann sie wieder aufrecht auf zwei Beinen stehen. Aber noch traut sie sich nicht zu sprechen, aus Angst, sie könnte wie eine Kuh „Muh“ sagen. Nur ganz vorsichtig wagt sie nach so langer Zeit wieder einmal ein paar Worte.
Ab jetzt wurde sie von der in Leinen gekleideten Menge wie eine Göttin verehrt. Sie gebar einen Sohn, Epaphos, von dem man glaubte, dass er aus Zeus‘ mächtigem Samen stammte, und der gemeinsam mit seiner Mutter in den Tempeln des ganzen Landes zuhause war.
Dieser Epaphos hatte einen gleichaltrigen Freund, mit dem er sich bestens verstand: Phaethon, Sohn des Sonnengottes. Als dieser einmal das große Wort führte und nicht nachgab, weil er stolz war, der Sohn des Helios zu sein, hielt es der Enkel des Inachos nicht länger aus. Er sagte: „Du Dummkopf glaubst auch alles, was dir deine Mutter erzählt! Jetzt spielst du dich auf, weil du an den falschen Vater glaubst.“
Phaethons Gesicht wurde feuerrot, aber er unterdrückte aufgrund seiner guten Erziehung seinen Zorn. Seiner Mutter Klymene erzählte er von der Schmähung des Epaphos, und fügte hinzu: „Und damit du dich noch mehr ärgerst, liebe Mutter, ich, der sonst alles mutig frei heraus sagt, ich habe dazu geschwiegen. Ich schäme mich, dass so eine Beleidigung ausgesprochen und nicht widerlegt werden konnte. Also bitte! Wenn ich wirklich von göttlicher Abstammung bin, dann liefere mir einen Beweis für meine hohe Geburt! Lass mich teilhaben am Himmel!“
Mit diesen Worten umschlang er den Hals seiner Mutter mit seinen Armen und flehte sie bei seinem Leben, beim Leben des irdischen Vaters Merops und beim Hochzeitslicht seiner Schwestern an, ihm einen sicheren Hinweis auf seinen wahren Vater zu geben.
Vielleicht rührten Phaethons Bitten die Mutter, vielleicht auch der Zorn darüber, dass über sie schlecht gesprochen wurde, jedenfalls streckte sie beide Arme zum Himmel, und zum Sonnenlicht gewandt sprach sie: „Beim glänzenden Licht, bei den schimmernden Strahlen dieses Gestirns, das mich jetzt hören und sehen kann, schwöre ich dir, mein Kind: Von ihm, den du dort siehst, von ihm, der das Weltall beherrscht, von Helios bist du der Sohn! Wenn ich jetzt gelogen habe, dann soll ich ihn nie wieder sehen, dann soll dieser Blick in das Licht der Letzte meines Lebens gewesen sein! Aber es ist nicht sehr anstrengend, das Haus deines Vaters zu finden. Der Sitz, aus dem er aufsteigt, ist nicht weit entfernt von unserer Heimat. Wenn du unbedingt willst, dann geh hin und frage ihn selbst.“
Als Phaethon diese Worte seiner Mutter hörte, sprang er hoch erfreut auf, und im Geist nahm er schon den Himmel in Besitz. Rasch ließ er sein heimatliches Aithiopien hinter sich, durchquerte Indien, das nahe am Sonnenfeuer liegt, und näherte sich eifrig dem Aufgang seines Vaters.
Zweites Buch
1. Eine himmlische Katastrophe und ihre Folgen
Der Palast des Sonnengottes steht hoch auf schwebenden Säulen und strahlt über und über von blendendem Gold und Bronze, die wie Feuer leuchtet. Die Spitzen seines Giebels sind mit schimmerndem Elfenbein verkleidet, und blitzendes Silber ziert die gewaltigen Flügel des doppelten Tores. Die Schönheit dieses edlen Metalls wird nur noch übertroffen von der Kunstfertigkeit seiner Verarbeitung: Denn der Gott Hephaistos selbst hat dort in feiner Ziselierung den Ozean abgebildet, der alle Welt umspült, sowie den ganzen Erdkreis und den Himmel, der über der Erde schwebt. In den Fluten tummeln sich all die blauhäutigen Gottheiten: Triton, der Herr der Muschelhornklänge, der wandelbare Proteus, Aigaion, dessen mächtige Arme die riesigsten Wale überwältigen, schließlich Doris und ihre Töchter, die man teils schwimmend sieht, teils auf Felsriffen sitzend und ihr grünes Haar trocknend, einige auch auf Fischen reitend. Ihre Gesichter sind, wenn auch sehr ähnlich, doch ganz unterschiedlich gebildet, wie es eben bei Schwestern so ist. Das Festland zeigt Menschen und Städte, Wälder mit wilden Tieren darin, Flüsse und deren Nymphen, und all die anderen ländlichen Gottheiten. Über all diesen Szenen gibt es die Abbildung des strahlenden Himmels mit sechs Zeichen des Tierkreises auf dem linken Torflügel, sechs auf dem rechten.
Der Pfad zu diesem Tor ist steil. Auf diesem Pfad stieg jetzt Klymenes Sohn hinauf und betrat das Haus des Gottes, dessen Vaterschaft in Frage stand. Er lenkte seine Schritte sofort vor das Antlitz des Vaters, aber in einiger Entfernung blieb er doch stehen. Denn es war unmöglich, dessen überirdisches Strahlen aus der Nähe zu ertragen.
In einen purpurnen Umhang gekleidet saß Helios da auf seinem Thron, der von hell leuchtenden Smaragden übersät war. Zu seiner Rechten und Linken standen der Tag, der Monat und das Jahr, die Jahrhunderte und in regelmäßigen Abständen die Stunden. Es stand da der junge Frühling mit der Blütenkrone auf dem Kopf, nackt stand da der Sommer mit einer Girlande aus reifem Korn, der Herbst stand da, befleckt vom Saft der frisch gepressten Trauben, und der Winter mit seinem in Frost erstarrten Haar.
Beim Anblick dieser überwältigenden und noch nie gesehenen Gestalten fürchtete der Jüngling sich ziemlich, aber Helios, der in der Mitte thronte, erblickte ihn mit seinen Augen, die alles sehen, und sprach ihn an: „Was führt dich hierher? Was suchst du in dieser Burg, Phaethon, du Sohn, für den sich kein Vater zu schämen braucht?“
Dieser antwortete: „O großes Licht der ganzen Welt, Helios, Vater – wenn du mir erlaubst, dich so anzusprechen, und Klymene nicht irgendeine Schuld hinter falscher Vorspiegelung verbirgt! Bitte, Vater, gib mir einen Beweis, damit man mir glaubt, dass ich dein Kind bin! Nimm diesen Zweifel aus meinem Herzen!“
Als er das gesagt hatte, legte der Vater alle Strahlen ab, die um sein Haupt glitzerten, und befahl dem Burschen, näher zu kommen. Zärtlich umarmte er ihn und sagte: „Du verdienst es nicht, angezweifelt zu werden. Was dir Klymene über deine Abstammung sagt, ist wahr. Aber damit du nicht mehr zweifelst, verlange von mir jedes Geschenk, das du nur willst, du sollst es aus meiner Hand bekommen.
Zeuge für diesen Eid sei der Fluss, bei dem Himmlische schwören,
Styx in der Unterwelt, den selbst meine Augen nicht sehen.“
Kaum hatte er diese Worte gesprochen, da verlangte Phaethon das Recht, einen Tag lang den Sonnenwagen seines Vaters zu führen und die Zügel der flügelfüßigen Pferde, die ihn über den Himmel ziehen, in seinen Händen zu halten.