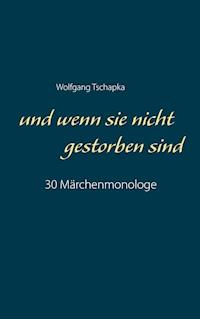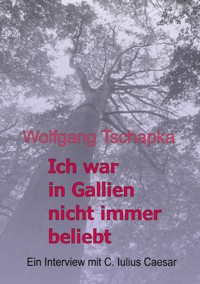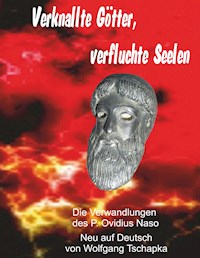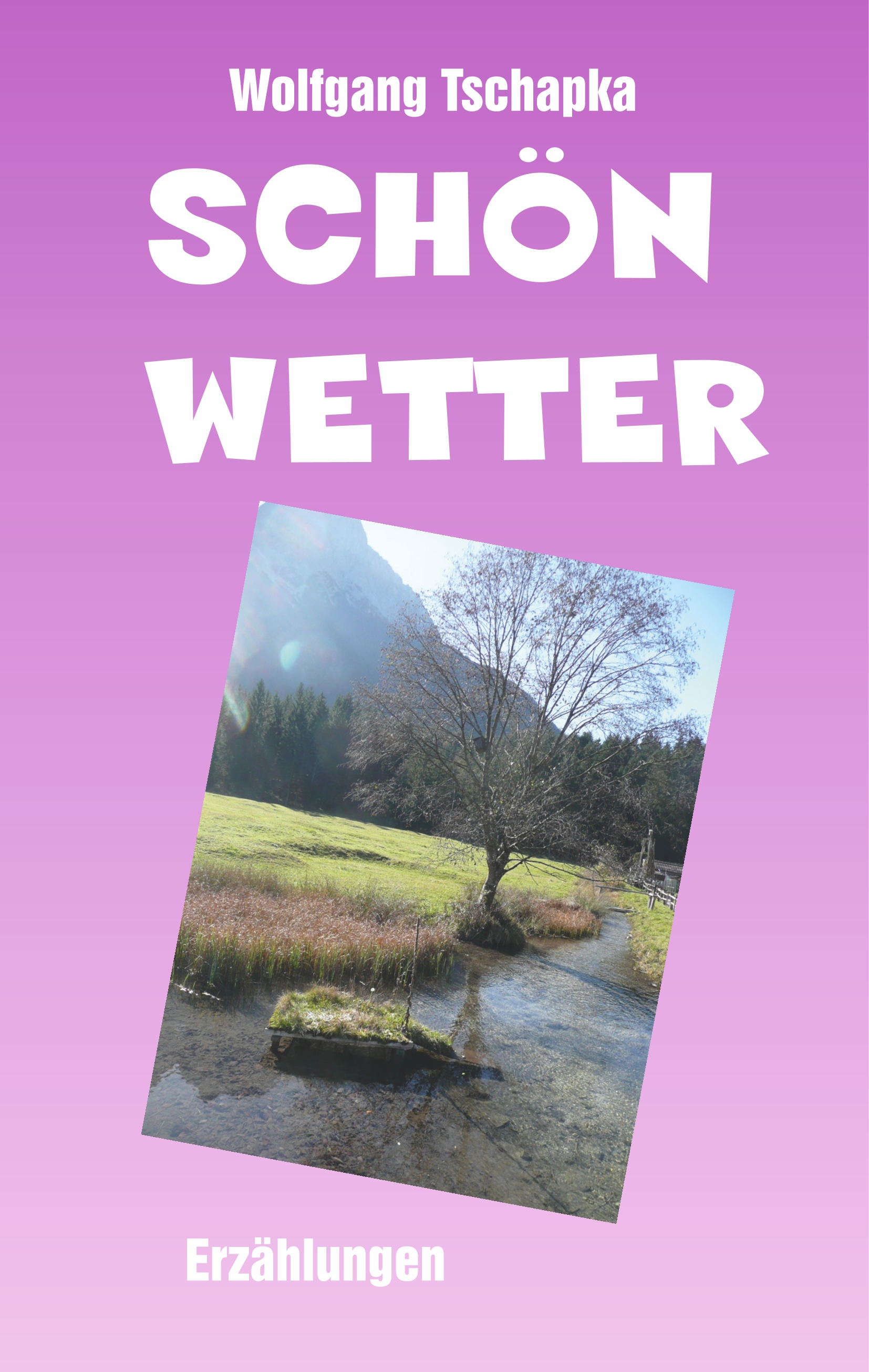
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben besteht aus Erzählungen - von Humor und Unterhaltung über Erotik und Mythologie bis zum Horror.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Für meine Frau Elisabeth, ohne deren Inspiration
einige dieser Erzählungen nicht existieren würden.
Inhalt
Der weiße Hengst
Ein Turm in einem weiten Tal
Der Traum des Daidalos
Der gefallene Engel
Rolf Dörre und das Fernsehen
Schönwetter
Ein kleiner Lungauer Horrorladen
Der weiße Hengst
Der weiße Hengst war schon längst hinter einem undefinierbaren grünen Horizont verschwunden. Oder war es nur so, dass der Prinz abgestiegen und bürgerlich geworden war, so dass die Schatten der häufig am Himmel stehenden Wolken ungehindert auf das Pferd fallen und sein Weiß in ein mildes, aber nicht wegzuleugnendes Grau verwandeln konnten?
Schneewittchen saß, umringt von barocken oder ein bombastisches Barock imitierenden improvisierten Klängen, schmal in einer unbequemen hölzernen Kirchenbank und war ihrem Märchen entrückt. Wenn sie wenigstens die Erinnerung an sieben Zwerge gehabt hätte; aber sie teilte mit so vielen Frauen das Schicksal, vom vielversprechenden Hufgetrappel eines königlichen Pferdes und eines ebensolchen Reiters nur einen Mann geerbt zu haben, ohne Krone und ohne Schwert, einen Mann, der sie nicht in Weiß, Rot und Gold aus dem Tod durch vergiftete Äpfel in das echte, wahre Diesseits trug, in dem alle die noch leben, wenn sie nicht gestorben sind; einen Mann, der selbst getragen werden wollte, gehalten, gezügelt.
Deshalb war ja auch der weiße Hengst nicht gegen den Horizont zu galoppiert, beeindruckend, eine riesige Staubwolke hinter sich erweckend, die, als sie zwischen dem linden Wind und der wuchernden Erde einschlief, den Anblick auf einen grünen, leeren Horizont freigab, vor dem kein Pferd mehr zu sehen war. Nein – sie selbst war, als jener Hengst kam und seine gar nicht prinzliche Last auf sie hernieder ließ, am Horizont gestanden, und es hatte nur eines einzigen, humpelnden Hufschlags bedurft, um das knöchrige, wolkengrau schattierte Ross aus ihrem Anblick verschwinden zu lassen. Aber sie hatte die weichen, armen Nüstern des Tieres geliebt und gewusst, dass sie mit einem strahlenden, adeligen Pferd ohnehin nichts anfangen hätte können. Streicheln hatte sie das triefende Maul und die schmale Kruppe wollen, sich in die dünne Mähne krallen, und danke sagen für die Tatsache, dass ihr kein Prinz beschert war.
Nur in der Erinnerung, in dieser harten, jede Andacht unterbindenden Kirchenbank, in der Umgebung dieser Orgelakkorde, die sie auf eine eigenartige Weise nicht berührten, da wich der Horizont zurück und etwas Weißes schien noch dort zu schimmern. War es ein Pferd?
Verschwunden war der Hengst kindlicher Abende, der Hengst, der aus den Seiten eines Buches aufstieg, aus dem man ihr vorlas, der sich löste aus einer halbdunklen Ecke des Zimmers, sich bäumend und doch auch schmiegend unter ihre Decke wand und ihre zufallenden Augenlider aus der Wirklichkeit trug.
Annemarie war erwachsen geworden.
Ihr Mann saß oben auf der Orgelempore und verfing sich in seiner Musik. Er hatte das Orgelspiel nie wirklich erlernt, aber durch eine große Anzahl seiner sechsunddreißig bisher gelebten Jahre zog sich der Wunsch, einmal an so einem Instrument zu sitzen und eine leere, sein Können also nicht messende Halle mit Klängen zu füllen, die nicht geschrieben waren, die für den Augenblick entstanden und mit dem letzten Nachhall, dem letzten rollenden Echo für immer vergingen. Hier in der kleinen, an den Berg geschmiegten Kirche von Pitten hatte er endlich die Gelegenheit dazu gefunden. Durch ein zufälliges Gespräch mit jemandem, der wiederum den Mann kannte, mit dessen Hilfe man an den Schlüssel herankam, hatte er Zutritt erhalten zu der Kirche und dem Instrument, und jetzt übertönte er mit mächtigem Forte das, was bei leiserem Spiel offenbar geworden wäre an Mängeln sowohl der Orgel als auch seiner Fertigkeit. So fühlte er sich der Orgel fast brüderlich verwandt, und in herrlichem Einverständnis brüllten, trompeteten und donnerten sie ihre Lebensfreude in die Tiefe des Kirchenschiffs, dass die bunten Fenster vibrierten und das Ewige Licht nervös flackerte.
Ab und zu, wenn er einige leisere Akkorde oder Läufe in sein Spiel einstreute, kam es schon vor, dass der eine oder andere Ton sich verhaspelte, dass die Wendigkeit seiner Finger nicht mit dem Tempo seines kompositorischen Wollens mitkam, und auch die Orgel ächzte dann und stöhnte, man konnte förmlich hören, wie die altersschwache Apparatur, die zwischen den Tasten und den Pfeifen die nötige Verbindung herstellte, an die Grenzen ihrer Möglichkeiten ging, diese schnell erreichte, und weiter hetzte von Ton zu Ton, bis der gnädige Organist sie wieder entließ in die sich hinter freudigem Crescendo wohlfühlende Anonymität.
Sonst diente die Orgel ja zur Begleitung des Gesanges, zu dem die Kirchenbesucher ihre Stimmen vereinten. Da war es leicht zu glänzen. Da achtete keiner auf Schwächen. Da war jeder froh, ein Instrument zu haben, an dessen verlässliche Stütze er seine Stimme anlehnen konnte.
Aber das alleinige Konzertieren war die Sache dieser Orgel nicht. Mit dieser Erkenntnis, die allerdings spät kam und im Übrigen das Vergnügen des Spielen-Dürfens nicht sehr trübte, modulierte Norbert Zauner, Annemaries Mann, um einfach zu spielendes C-Dur herum in Richtung auf einen pseudoklassischen Schluss, dessen letzten Akkord er auskostete wie den letzten Tropfen eines edlen Getränks, lehnte sich zurück, und atmete tief durch. Als Bub hatte er sich oft in dieser Situation gesehen. Dann hatte – nach einigen Sekunden ergriffenen Schweigens – Applaus um ihn her gebrandet und er hatte Tränen in den Augen derer sehen können, die seinem Spiel gelauscht hatten.
Doch auch jetzt, als er nur dem Schweigen gegenüber saß, durch das er aus der Tiefe der Kirche Annemaries unverkennbare Schritte hören konnte, war Norbert glücklich. Sorgfältig versperrte er die Orgel, verließ über knarrende Bretter die kleine Empore, und stieg über eine dunkle Wendeltreppe in den Vorraum der Kirche hinunter, wo er auf den Mesner traf. Mit herzlichem Dank gab er diesem den Schlüssel zurück und verbot sich ausdrücklich, sich auszumalen, was der Mann dachte.
Norbert fand seine Frau in einer kleinen Seitenkapelle, wo es die Möglichkeit gab, Kerzen vor irgendeinem durch die Jahrhunderte dunkel gewordenen Heiligenbild anzuzünden. Einige verschieden große Wachsstummel brannten noch auf einem großen schmiedeeisernen Gerüst, die meisten aber waren ausgegangen und warteten, formlose Reste und Spritzer von Wachs, auf jemanden, der sie mit einem Werkzeug wegkratzte oder auf ihnen eine neue Kerze befestigte.
Annemarie neigte zu solchen Dingen; lächelnd und mit einer Wärme ums Herz, die sich mit seiner schon vorher empfundenen Freude zu einem richtigen Glücksgefühl addierte, beobachtete Norbert seine Frau, wie sie einige Sekunden lang in das von ihr soeben entzündete Feuer blickte, oder durch dieses hindurch, wobei er, hinter ihr stehend, nicht sehen konnte, ob sie die Augen auch wirklich offen hatte. Norbert liebte ihre großen, schönen Augen, wenn sie bei Kerzenlicht in tiefem Glanz erstrahlten. Das war immer ein glücklicher Glanz, denn Kerzen waren für sie beide ein Symbol der Harmonie und Freude, sodass Norbert sich gar nicht vorstellen konnte, wie es aussehen würde, wenn im Schein trauter Kerzen Tränen und Zorn die liebe Spiegelung in Annemaries Augen zerrissen.
Norbert wusste, dass seine Frau sich immer etwas ganz intensiv wünschte, wenn sie eine Kerze in einer Kirche anzündete. Das war schon so gewesen, als sie sich noch kaum kannten. Zu einer Zeit, als er sie noch wie ein neues Spielzeug stolz in seinem Freundeskreis herumzeigte, damals, als er sein Chemiestudium beendet und gerade die Anstellung in der Brauerei bekommen hatte, als sie mit ihren knapp zwanzig Jahren kaum mehr war, als fünf, sechs vor ihr schon gewesen waren, damals schon hatte sie es ihm gestanden.
„Verachtest du mich jetzt?“
Diese Frage war so typisch für sie; so oft an der Grenze ihres eigenen Selbstbewusstseins und der Gabe, sich ganz unter seine Anforderungen zu schmiegen, und mit der koketten Art und Weise, eine Frage wie diese so zu stellen, dass im Tonfall die Gewissheit mitklang, sein Gefühl müsse nicht Verachtung, sondern um so größere Liebe sein.
„Wegen einer Kerze?“ hatte er gefragt. „Nein, warum soll ich dich deswegen verachten? Ich liebe dich.“
Womit sie wieder einmal recht gehabt hatte und sie ihr Liebesspiel, in dessen Verlauf sie ihm die Sache mit den Kerzen ganz unvermittelt gestanden hatte, umso inniger und leidenschaftlicher fortsetzten.
Damals hatte sie sich, schon zu diesem sehr frühen Zeitpunkt, gewünscht, es solle alles so bleiben zwischen ihnen. Ein Leben mit ihm hatte sie sich und ihm gewünscht. Ihren Beitrag zu leisten, war sie bereit, und um seinen, um dieses kleinwinzige zustimmende Wiehern des buntscheckigen Märchenrosses, hatte sie durch die Flamme der Kerze hindurch gebetet, an jenem kühlen Herbsttag vor fünf Jahren, in der Votivkirche in Wien, die mit ihren neugotischen Türmen den erst kaum gewagten, dann aber doch das Herz erfüllenden Wünschen Pate gestanden war.
Als Norbert jetzt hinter ihr stand, in der viel kleineren, herzigeren Kirche in Pitten, so viele Realitäten wie unerfüllte Wünsche von der Votivkirche entfernt, als er sie jetzt beobachtete, konnte er den humoristischen Gedanken, der ihm in den Sinn kam, nicht unterdrücken, sie könnte sich wünschen, nie wieder sein Orgelspiel hören zu müssen. Dieser Gedanke brachte ihn fast zum Lachen, und so kam es, dass Annemarie, als sie sich umdrehte, sein Gesicht lächeln sah.
„Du bist glücklich?“ fragte sie ihn, rein rhetorisch, und schaute dabei so drein wie damals, als sie fragte: „Verachtest du mich?“
Also antwortete er (und sie hatte die Antwort fast erwartet): „Nein, ich verachte dich.“
Der Unterschied zu damals war, dass er jetzt, als sie die Kirche verlassen hatten, fragte: „Was hast du dir gewünscht?“ Damals, in jener Zeit absoluten Aufeinander-Ausgerichtetseins, hatte es einer solchen Frage nicht bedurft. Damals hatte er noch sehr stark das Empfinden dafür gehabt, wann Worte, egal ob Fragen oder Antworten, Mauern bauten. Dieses Gefühl war ihm irgendwie verloren gegangen. Doch Annemarie war ihm nicht böse. Sie beantwortete seine Frage nur einfach nicht, und so gingen sie, noch geblendet nach dem Dunkel der Kirche, auf die Bank zu, die jenseits einer kleinen Rasenfläche stand, nahe an dem Holz- und Steingeländer, hinter dem der felsige Absturz kam und der Ausblick auf rollende grüne Landschaft, einen kleinen Ort und so viele gemeinsame Erinnerungen.
„Ob ich mich jemals wirklich hier hinunter stürze?“ Norberts überraschende Frage war nicht wirklich Ausdruck seines manchmal recht eigenartigen Humors, sondern eine Anspielung auf ein Gespräch, das sie auf eben dieser Bank einige Jahre früher geführt hatten. Es hat ja jedes Paar so seine gewissen Punkte in der Landkarte der gemeinsamen Vergangenheit, die, ob positiv oder negativ, Marksteinfunktion besitzen ob der Dichte der mit ihnen verbundenen Erinnerungen. Für Norbert und Annemarie war es dieser stille Punkt vor der Kirche von Pitten, über dem Ort, der in jedem von ihnen lebte als ständig präsente Gemeinsamkeit. Und immer wenn jemand anderer in ihrer Gegenwart zufällig den Namen Pitten erwähnte, lächelte jedes von ihnen und wandte sich dem Anderen zu, wissend, dass die Blicke sich treffen würden. Und wenn es sich so ergab, dann drückten sie sich die Hände und wussten, dass, wenn einmal echte, ernste Probleme ihr Leben belasten sollten, jene Bank am Berg vielleicht wirklich der Ort sein könnte, an dem sie reden oder schweigen oder einander Lebewohl sagen konnten.
Dass der Felsabsturz von Pitten wirklich eine günstige Stelle für einen Selbstmord sein könnte, bezweifelten sie natürlich beide, aber irgendwie lag in ihren fröhlichen Andeutungen so etwas wie die Versicherung, dass sie, gerade sie, etwas derartiges ohnehin nie nötig haben würden.
Als sie jetzt, nach Norberts Orgelspiel und vor einem Abendessen in jenem Gasthof, in dem sie damals übernachtet hatten, auf der Bank saßen, galten ihre Gedanken eigentlich fast nur mehr dem Urlaub, der kurz bevorstand und der sie, so hatte es sich schließlich ergeben, in einen oberitalienischen Badeort führen würde. Das wiederum war ein Kapitel, das im Verlauf der letzten Wochen, ja Monate, schon einigen Zündstoff in ihr Leben und ihre Gespräche gebracht hatte. Schließlich hatte sich Annemarie durchgesetzt. Die von ihr ins Treffen geführten Argumente, dass Österreich teuer sei, dass das Wetter unsicher sei und man sich die wenigen Urlaubstage im Jahr nicht durch Regen vermiesen lassen solle, dass außerdem an mediterranen Stränden halt doch ein wesentlich interessanteres Leben und Treiben herrsche als in einer alpinen Sommerfrische, hatten die Oberhand behalten gegen Norberts durch nichts logisch zu untermauernde Sehnsucht nach Wiesen, weiten Wäldern und einsamen Wegen, nach der Ruhe, die man hat, wenn man zeitig am Morgen, noch vor dem Frühstück, an einem schilfgesäumten Teich entlang läuft, aus dessen Becken ein hauchdünner Nebel aufsteigt; ab und zu plätschert ein Frosch sicherheitshalber vor den Füßen des Läufers in das Wasser, zwischen den Stämmen riecht es nach Pilzen, denen es egal ist, ob sie essbar sind oder nicht, und auf den Blättern der Himbeeren liegen behäbige Tautropfen, wenn der Himmel die Nacht über klar war.
Auch deshalb liebte Norbert Pitten. Er träumte von einer Woche in einem der Häuser, die da zu seinen Füßen lagen; eine verwitwete Pensionswirtin würde zum Frühstück dampfenden Kaffee an einen Tisch servieren, auf den schräg durch ein kleines Fenster ein Sonnenstrahl fiel, und das leuchtende Rot der Pelargonien in den Blumenkästen draußen würde einen wunderschönen Tag versprechen.
Aber auch den Regen liebte Norbert. Wenn man erwachte, konnte man am Klang der fallenden Tropfen erkennen, wie stark der Regen war, ob er senkrecht fiel oder vom Wind getrieben wurde, ja man konnte an den Geräuschen des Regens sogar ablesen, ob er auf Gras fiel oder Asphalt, ob ein Kiesweg unter dem Fenster vorbei führte, oder ob es dort eine hölzerne Bank, ein Blechdach oder einen Tisch aus Stein gab.
Da gab es dann in Norberts Innerem eine sehr direkte Verbindung zu seinen Kindheitserinnerungen, Erinnerungen an unzählige Ferientage, an denen er so erwacht war und sich in der Umgebung seiner Familie, eines stillen, kleinen Ortes und auch des Regens so unendlich geborgen gefühlt hatte. Erinnerungen auch an spätere Tage, an denen er mit seinem Vater oder seinem Bruder Othmar beim intensiven Rauschen des Regens in mancher Berghütte aufgewacht war, beim Rütteln der Fensterläden, fröstelnd beim Herauskriechen aus dem Schlafsack, und unendlich glücklich trotz alledem.
Das alles war Pitten für Norbert, als er da saß auf der Bank und neben sich seine Frau, seine Geliebte spürte, und über ihrem Kopf, an den knorrigen Baumstamm genagelt, die zerknitterte, fast schon farblose, vom Rost neu eingefärbte Blechtafel sah, die seit Jahren verlässlich Wanderer auf einen grün markierten Weg wies.
*
In Othmar lebte eine gewaltige Freude. Es gab für ihn einfach nichts Schöneres als dieses Gefühl der Geborgenheit in der Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten, gleichzeitig das Bewusstsein der Wichtigkeit jedes Einzelnen, der Wichtigkeit auch des Anliegens, um dessen willen sie tage- und nächtelang, bei welchem Wetter auch immer, in entlegenen Wäldern auf alle Annehmlichkeiten eines zivilisierten Lebens verzichteten.
Eine Welle war da im Herzen Europas ins Rollen gekommen, unmerklich zuerst hatte sie sich aufgebaut. Dass Menschen aus der DDR flohen, war eine alte Geschichte; aber dann, im Sommer 89, nahm die Bewegung völkerwanderungsähnliche Ausmaße an, so schien es zumindest den erstaunten Beobachtern. Ein Staat schien sich von der Basis her selbst zu demontieren, während die Führung noch mit schwülstigen Reden und unzeitgemäßen Liedern über eine freie Jugend, die die Zukunft baut, falschen Sauerstoff in ihre verkrusteten Venen tankte.
Europa horchte auf. Hatte man nicht eben erst wehmütig und etwas mitleidig gelächelt, als der amerikanische Präsident in Berlin den sowjetischen Staatschef zum Niederreißen der Mauer und zur Öffnung des Brandenburger Tores aufrief? Und während dieser Staudamm immer noch dichthielt, begannen die Menschen aus dem östlichen Deutschland durch die kleinen, sich neu eröffnenden Schlupflöcher zu sickern, zu fluten bald; Ungarn war offen, Österreich bot sich an, und nachdem der letzte Meter Stacheldraht beseitigt war, gab es kein Halten mehr. Über Wiesen und Felder, durch die Wälder und über Flüsse kamen sie einzeln, in Gruppen, ganze Familien mit dem bisschen Hab und Gut, das man zu Fuß im Dunkeln mitschleppen konnte, immer belastet von dem Risiko, einer ungarischen Grenzpatrouille in die Hände zu laufen, die in Folge der noch nicht ganz eindeutigen Haltung ihrer Regierung da und dort auch von der Feuerwaffe Gebrauch machen würde.
Da brauchte man Menschen wie Othmar Zauner. Kaum einer setzte sich wie er ein, wie besessen ordnete und unterstützte er die vielfältigen Tätigkeiten der zahlreichen Freiwilligen, die im Zusammenwirken mit dem Roten Kreuz an der burgenländischen Grenze zu Ungarn standen, um die ankommenden Flüchtlinge in Empfang zu nehmen. Da waren Zelte aufzubauen, Decken und Matratzen zu verteilen, Fluchtwege waren mit Fähnchen markiert worden, da und dort musste erste Hilfe geleistet werden, manchmal auch in ernsten Fällen die Hilfe eines Arztes in Anspruch genommen werden, wenn etwa ein Mann ankam, der eine Schussverletzung aufwies, oder jemand, der im Dunkeln gestolpert war und sich einen Fuß gebrochen hatte. Einmal hatten sie sogar einer Frau, die eben erst laufend, kriechend, stürzend, sich wieder aufrappelnd und weiterkeuchend ins Lager gekommen und hier erschöpft zusammengebrochen war, Geburtshilfe geleistet.
Dann gab es noch die Küche und die vielen Bäuerinnen und Bauern aus nahe gelegenen Dörfern, die, ohne an Bezahlung zu denken, Fleisch, Früchte und Brot brachten, ganze Wagenladungen voll, von Traktoren gezogen, von Pferden, von Ochsen.
Schließlich musste man den Weitertransport und die Unterbringung der Ankommenden organisieren. Diese Menschen hatten nichts, wussten nicht weiter, standen nur einfach da und waren nicht sicher, ob sie weinen sollten ob der verlorenen, trotz allem geliebten Heimat, oder sich freuen über die, wenn auch ungewisse, so doch immerhin erreichte Freiheit der westlichen Welt. Und mit ihnen lachten und weinten, diskutierten und jubelten, sangen und überlegten all die Helfer, all die Freiwilligen, ob sie nun als Spender auftraten, als Köchinnen, als Sanitäter oder Wegweiser, als Tröster oder als Gastgeber.
Eine große Familie hatte sich gebildet, als deren Mitglied sich Othmar Zauner sah, eine Familie und Arbeitsgemeinschaft, in der er aufblühte, er, der Hagere, dem man, wenn man ihn sah, selbst gerne ein paar Wurstbrote zugesteckt hätte. Aber er fühlte sich stark, gebraucht und geliebt. Zum letzten Mal hatte er dieses warme, erregende Gefühl gehabt, als er mit vielen anderen die Donauauen besetzt hielt, freiwillig angekettet an die Bäume, die es vor dem Umschneiden zu bewahren galt. Damals, ein paar Jahre zuvor, hatten sie gewonnen, und Othmar träumte davon, auch in den Hohen Tauern zu gewinnen, bei den Indios in Mexiko, im Regenwald des Amazonasbeckens.
Hier aber war zunächst ein Kampf im Namen der Menschlichkeit zu gewinnen, und mit jedem Zeitungsartikel, jeder Fernsehnachricht, jedem Interview, das hinausging in die ungläubig staunende Welt, gewannen sie mehr; Schritt für Schritt marschierte jeder einzelne Beteiligte, ob Flüchtling oder Helfer, einem schier unvorstellbaren Ziel entgegen: der Abschaffung von West und Ost auf der politischen Landkarte.
Gerade ging es wieder darum, zu klären, wie eine Gruppe von Ostdeutschen unterzubringen sei. Othmar hatte eine Idee. Er konnte zwar nicht allein entscheiden, zuerst würde er sich in Wien erkundigen müssen, aber er war zuversichtlich und teilte in Gedanken schon ein, welche Flüchtlinge in welchen Fahrzeugen zu ihrem provisorischen Quartier in Österreichs Hauptstadt gebracht werden sollten.
*
Als schon die letzten Sonnenstrahlen gerade noch über die friedlichen Kuppen des Wienerwaldes streiften und die vereinzelt am Himmel stehenden Wölkchen in einem Rosa einfärbten, das sich mit dem abendlichen Blau zu herrlichstem Kitsch verband, kehrten Norbert und Annemarie von ihrem Ausflug nach Pitten in ihre Wiener Wohnung zurück. Diese war geräumig, zu groß fast für zwei, aber – und das war ein Thema, das besonders Norberts Vater bewegte – bei einem jungen Paar bestand ja die Aussicht auf „Aufstockung des Personalstandes“, wie der ältere Herr scherzhaft zu sagen pflegte.
„Vier Zimmer sind vier Zimmer“, bemerkte dann seine Frau, die eigentlich nicht Norberts Mutter war, denn Herr Zauner hatte sich ein zweites Mal verheiratet, ein Umstand, der ihn zu seiner eigenen großen Belustigung zu einem Wortspiel anregte: „Ich verlaufe mich – heißt, ich laufe in die falsche Richtung. Ich verspreche mich – ich spreche falsch. Ich verheirate mich …?!“
So war Herr Zauner senior, und man hatte sich daran gewöhnt.
Norbert und Annemarie also kehrten heim, angenehm müde, glücklich und in der Vorfreude auf das gemeinsame Abendessen. In Zeiten wie jenen wollte man aber auch über die neuesten Ereignisse informiert sein, und so schaltete Annemarie den Fernsehapparat ein. Natürlich gab es einen Bericht über die Flüchtlingssituation, und plötzlich rief Annemarie ihrem Mann, der gerade eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank holte, zu: „ Beeil dich, wenn du deinen Bruder im Fernsehen bewundern willst!“
Norbert lief zu ihr und sah gerade noch, bevor der kurze Filmbericht zu Ende war, wie Othmar mit einer für ihn typischen ausladenden Geste seiner langen, dünnen Arme einigen Leuten, vermutlich Flüchtlingen, den Weg irgendwohin klar zu machen versuchte. Dann wandte er sich zu einer im Bild nicht sichtbaren Person und sagte so, dass man es leise, aber doch deutlich, wenn auch vom Berichterstatter kaum gewollt, hören konnte: „Baba, ich geh Pipi.“
Was wiederum Annemarie zu einem Lachanfall hinriss und Norbert eine Bemerkung entlockte, die sinngemäß ausdrückte, wie stolz er auf einen Bruder sein könne, der auch in Augenblicken ärgster Bedrängnis zuerst Fremden den Weg wies, bevor er an die eigene Erleichterung dachte.
*
Am nächsten Morgen läutete es an der Wohnungstüre. Ein seltenes Ereignis trat ein. Es war Othmar.
Die beiden Brüder, die, wenn auch durch einige Lebensjahre getrennt, immer ein Herz und eine Seele gewesen waren, hatten durch ihre immer verschiedener werdenden Interessen, durch Othmars so völlig anders gearteten Freundeskreis, vor allem vielleicht durch Norberts Heirat, Abstand von einander gewonnen, wobei das Wort gewonnen sicher von beiden abgelehnt worden wäre. Beide litten, wie man an einem dumpfen Schmerz leidet, dessen Herkunft man nicht orten kann und dessen man sich nur manchmal voll bewusst wird, unter dem Umstand, dass ihr Bund sich aufgelöst hatte. Vor allem Norbert erinnerte sich immer wieder gerne und mit so etwas wie Wehmut an Details ihrer gemeinsamen Vergangenheit und ordnete sie unter Rubrik „verlorene Kindheit“ ein. Das Indianerspielen in den Wäldern, die Radtouren, die vergeblichen Versuche, seinem kleinen Bruder das Tarockieren beizubringen, die gemeinsamen Tennisstunden, all das hatte ein wächsernes Band zwischen den Brüdern gebildet, das im Licht des Erwachsenwerdens geschmolzen war. Norbert sah sich manchmal im Rückblick als Daedalus, der den jüngeren Begleiter an die Attraktionen der Welt verloren hatte. Othmar war ihm fremd geworden, es schien, als wäre – in völlig verdrehter Logik – der Altersabstand zwischen ihnen relativ größer geworden, und für Norbert war Othmar halt noch immer der Bub, der leicht für alles zu begeistern war, sich voll dafür einsetzte, und darüber die eigentlichen Ziele übersah, unter denen an wichtiger Stelle das Leben für sich selbst existierte, das Genießen, das lustvolle Verharren im Augenblick, oder, negativ formuliert, die Fähigkeit, sich auch einmal für nichts zu engagieren. In zwiespältiger Weise neidete Norbert seinem Bruder dessen Ungebundenheit, während er ihn gleichzeitig als unfrei ansah, gebunden oder sich selbst bindend an alle Anliegen, die Othmar zu den seinen machte. Der Einsatz, mit dem Othmar für seine Anliegen dann eintrat, nötigte dem älteren Bruder Bewunderung ab, zugleich aber konnte Norbert nur leicht mitleidig-belustigt über Othmars Unwilligkeit sprechen, aus seiner Aktivität zählbares Kapital zu schlagen. Die bedingungslose Hingabe ohne die Frage nach Entlohnung legte er ihm als Schwäche aus, als Zeichen der Unreife, und wahrscheinlich war das der Hauptgrund für die innere Trennung zwischen den beiden Brüdern. Wenn sie sich sahen, was selten genug vorkam, wurde zwar noch wie früher gescherzt, aber es war, als stünden zwei Menschen auf zwei getrennten Gipfeln und riefen sich über ein Tal hinweg gegenseitig ihre Witze zu. Sie mieden einander nicht, sie behinderten einander nicht, aber was sie verband, waren nur mehr gemeinsame Erinnerungen.
Othmar war nach Wien gekommen, um seinen Bruder und seine Schwägerin zu fragen, ob sie bereit wären, ihre geräumige Wohnung für die Dauer ihres Urlaubs als kurzzeitiges Quartier für ostdeutsche Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen, bevor deren Weiterreise, die in der Regel in die deutsche Bundesrepublik führte, in die Wege geleitet war. Für die Sicherheit übernahm er selbst die Verantwortung, ein Umstand, der Norbert wieder einmal zu einer leicht abwertenden Scherzbemerkung hinriss, auf die der Bruder aber überhaupt nicht einging. Statt dessen stellte er noch in Aussicht, dass eventuelle Bezahlung von Lebensmitteln, Stromverbrauch, Telefongebühren oder Ähnlichem kein Problem darstelle, es gebe einen eigens für solche Fälle ins Leben gerufenen Fonds, der aus privaten Spenden und Mitteln der Caritas gespeist wurde.
Mit einer sofortigen Entscheidung schien Othmar nicht hundertprozentig gerechnet zu haben, denn er war nicht überrascht oder enttäuscht, als Norbert, aber auch Annemarie, ihm zu verstehen gaben, dass sie noch überlegen wollten. Eine Einladung zum Abendessen schlug er aus, und so war das Ehepaar nach kaum zwanzig Minuten wieder allein.
Vor allem Norbert war es, der Bedenken hatte, die Bitte seines Bruders zu erfüllen. Die Wohnung war gut und recht teuer eingerichtet, es gab Geräte, von denen anzunehmen war, dass sie für Bürger der DDR nicht alltäglich waren, schon gar nicht für solche, die soeben bei einer Flucht alles, was sie besessen hatten, hinter sich gelassen hatten und mehr oder weniger mittellos dastanden. Annemarie wiederum konnte sich Norberts Argumenten zwar nicht ganz verschließen, aber sie neigte dazu, bei der Beurteilung und Bewertung menschlicher Probleme die Entscheidung dadurch unmittelbarer und für sich einfacher zu machen, dass sie sich vorstellte, die Probleme seien ihre eigenen.
„Stell dir vor“, sagte sie zu Norbert, „du wärest gerade aus deiner Heimat geflohen, hättest fliehen müssen! Und schließlich sind das ja keine unterentwickelten Primitiven.“
Das war eine dezente Anspielung auf Norberts ab und zu zum Vorschein kommenden Rassenstolz, mit dem er gerne Angehörigen jener Völker gegenüber trat, die er aus eigener Anschauung nur als Gastarbeiter kannte.