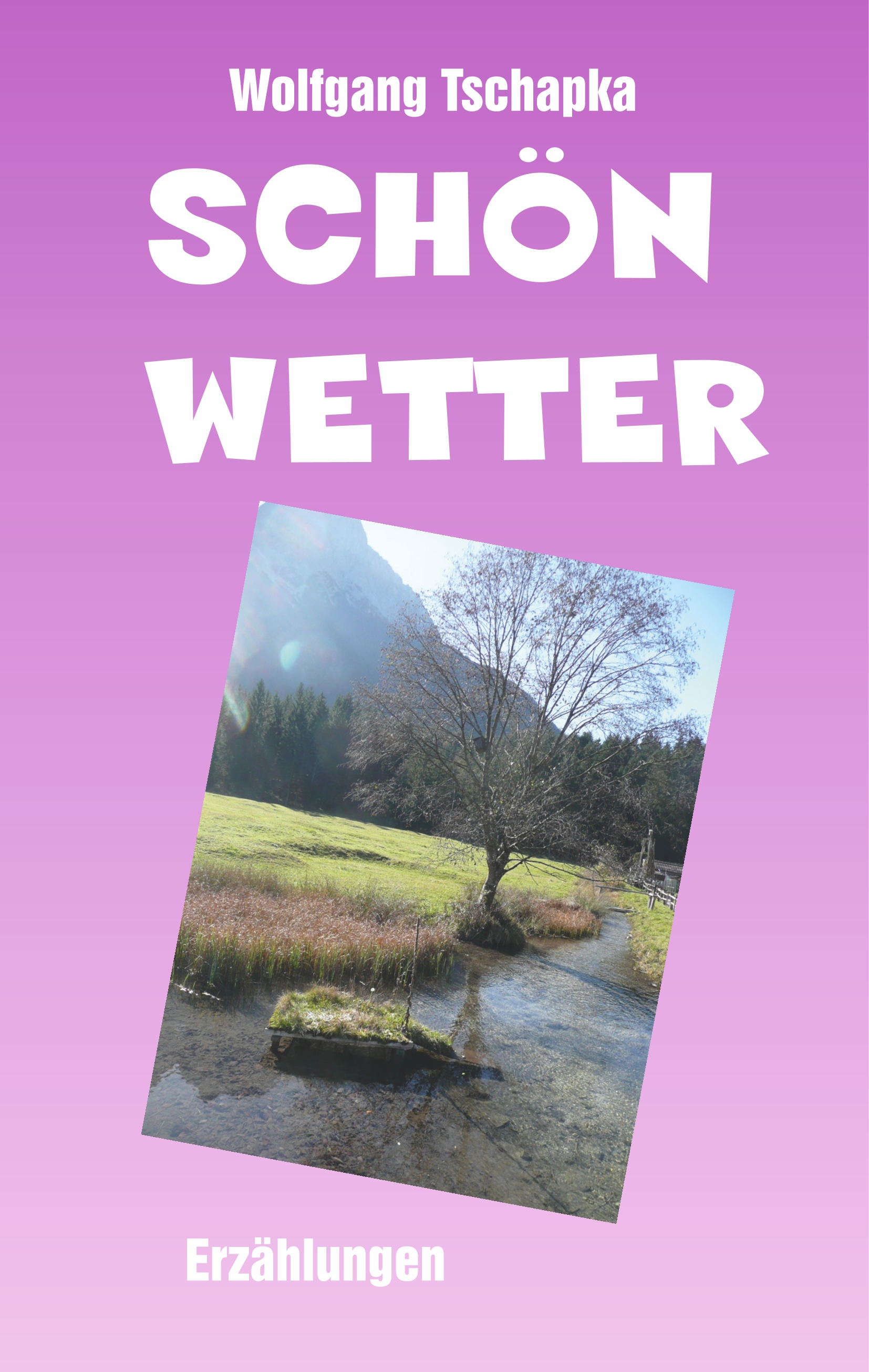Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Schneewittchens gequälte Stiefmutter, Schneeweißchens genervte Schwester, Rapunzels mörderisch eifersüchtige Liebhaberin ... Hier kommen sie alle ganz persönlich zu Wort. Und in ihren Monologen entstehen aus Grimms Märchen auf einmal völlig neue Geschichten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Sneewittchen
Vom klugen Schneiderlein
Rumpelstilzchen
Schneeweißchen und Rosenrot
Hans im Glück
Sechse kommen durch die ganze Welt
Hänsel und Gretel
Das Rätsel
Marienkind
Das singende springende Löweneckerchen
Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen
Das Lämmchen und Fischchen
Aschenputtel
Brüderchen und Schwesterchen
Das tapfere Schneiderlein
Das Meerhäschen
Der Grabhügel
Tischchen deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack
Von dem Machandelboom
Jorinde und Joringel
Hans mein Igel
De drei Vügelkens
Jungfrau Maleen
Das kluge Gretel
Spindel, Weberschiffchen und Nadel
Allerleirauh
Das blaue Licht
Rotkäppchen
Rapunzel
Das Eselein
Sneewittchen
Endlich Frieden! Wie schlafend liegst du da; der Gesang der Vögel und das Rauschen der Baumwipfel im sachten Wind, all diese zarten Geräusche, die von draußen durch das Fenster und die offene Türe hereindringen, werden nicht mehr übertönt von deinem Würgen und Keuchen, von den erstickten Versuchen des Schreiens, während sich dein Körper minutenlang gegen das Sterben wehrte, sich herumwarf, vergeblich ankämpfend gegen das Gift in dem Apfelbissen in deinem Hals. Du konntest ihn nicht mehr hervorwürgen, der Rest der von mir so sorgfältig präparierten Hälfte war schon lange vorher aus deiner Hand gefallen. Ich muss ihn dann gleich sorgfältig entsorgen, wahrscheinlich verbrennen oder vergraben, irgendwo.
Jetzt liegst du da. Wie schön du bist!
Ja, du bist wirklich schön, die bösartigen Botschaften an meinem Spiegel haben nicht gelogen. Und sogar eben jetzt, als du mir den letzten verzweifelten Blick zuwarfst, bevor sich deine Augen verdrehten und du im Tod erstarrtest, ich weiß nicht - war da immer noch Triumph in deinem Blick? Ein letzter, umso gnadenloserer Triumph, die siegessichere Gewissheit eines Menschen, der weiß, dass er dem Anderen nach allen Demütigungen und Schikanen auch diese letzte noch angetan hat, nämlich ihn zum Mörder zu machen?
Hätten wir einander nicht auch lieben können? Und wenn nicht lieben, dann wenigstens gernhaben; und wenn nicht das, zumindest einander akzeptieren, hinnehmen meinetwegen. Hinnehmen, so wie wir nun einmal waren und als was wir einander gegenüberstanden: Tochter und zweite Mutter.
Aber vielleicht habe ich nicht gelernt, dich so zu sehen, wie du wirklich bist; als Menschen, der anderen Unglück bringt; als Frau, die das Unheil wie einen Laden vor sich her trägt und Schlimmes ausstreut über die Häupter derer, die ihr begegnen. Deine eigene Mutter hast du mit deiner Geburt getötet. Ich weiß, du kannst nichts dafür, nicht im eigentlichen Sinn, aber so fing dein Leben an, und so ging es weiter und wäre noch weitergegangen, als hättest du beim Überschreiten jener Schwelle einen boshaften Dämon in deine Welt mitgetragen, ein gemeines Wesen, das auf deiner Schulter hockte und, während dein engelsgleiches Gesicht lächelte, Grimassen schnitt und dir Bosheiten und die übelsten Streiche einflüsterte.
Dein armer Vater konnte dich und deinen Dämon nicht bändigen. Er hat ja als König so viele andere Dinge im Kopf; wollen wir ihm das zugute halten. Und er hat in dir halt auch immer deine Mutter gesehen, seine erste, über alles geliebte Frau. Wir glauben ja immer, an den lieben Verstorbenen weiß Gott was noch alles gut machen zu müssen. So wollte er das an Liebe und Verständnis, dessen er bei deiner Mutter nicht fähig gewesen war, dir, seiner einzigen Tochter, zuteil werden lassen. Schon der Name, den er dir gab, ist ein Kosewort: Sneewittchen hat er dich, in dem eigenartigen Dialekt dieses Landes, genannt. Weiß wie Schnee solltest du sein, mein Gott! Ich weiß, wie Neugeborene aussehen; rot und faltig sind sie, dass man meinen möchte, man müsse sie erst aufbügeln. Aber du warst für ihn schneeweiß. Mit der gleichen blinden Liebe hätte er dich Blutrötchen nennen können, oder, mit deinem dunklen Haar, Ebenhölzchen. Dass sich diese märchenartigen Schönheitsideale doch nie ändern! Schneeweißchen und Rosenrot!
Und jetzt liegst du da und schläfst deinen letzten Schlaf. Im Tod wirkt dein Gesicht noch blasser. Vielleicht hast du recht gehabt mit der Verachtung, mit der du dich über meine Schminke und meine Schönheitswässerchen lustig machtest.
Aber die Mühe, mich zu verstehen, hast du dir ja nie gemacht. Du hast nie versucht, dir vorzustellen, wie das ist, wenn man als Fremde, als Ausländerin, die eine andere Sprache spricht und andere Gedanken denkt, an einen Hof wie den euren kommt. Ich weiß, dass meine Haut eine Nuance anders gefärbt ist als die eure. Ich weiß, dass die Mode, nach der ich mich kleidete, manchen Leuten in eurem Land seltsam vorkam. Ich war doch eigentlich damals eine arme Person, arm nicht im Sinne materieller Not; meine Eltern hatten mich schon sehr gut mit allem versorgt, ich brachte eine ganz schöne Mitgift in die Ehe. Ich war arm, weil ich entwurzelt war; herausgerissen aus dem dichten Nest jahrelangen Behütetseins, hineingestoßen in ein Wirrwarr aus unbekannter Etikette und nie gelernten Bräuchen, aus falscher Unterwürfigkeit und feindseliger Unnahbarkeit vonseiten der Dienstboten. Ich konnte nie ihre Lieder singen. Ich hätte so gerne ihre Lieder gesungen.
Da hätte ich dich gebraucht. Dich in die Arme zu nehmen, war ich bereit, dir Mutter zu sein und vor allem Freundin. Und von dir hätte ich alles lernen wollen, dass du stolz auf mich sein hättest können. All deine Kraft hättest du positiv an mir wirken lassen können, dann wäre ich dein Werk gewesen, von dem du hättest sagen können: Was sie heute ist, ist sie durch mich. Sie ist jetzt eine von uns, ich liebe sie.
Statt dessen sitze ich hier vor deinem kalten, starren Körper und bin dein Werk, aber so, wie nur du mit deinem herzlosen Sinnen und Trachten es hast erdenken können: Du hast mich zur Mörderin gemacht.
Wie klein hier alles ist. Ein eigenartiger Menschenschlag, mit dem du dich umgibst. Man lebt hier vom Bergbau, höre ich. Du wäschst wohl diese eigenartig verkümmerten Hemden und Schürzen. Sieben Berge oder mehr hast du zwischen dich und das Königsschloss gelegt. War dein Hass wirklich so groß?
Dein armer Vater ist über dein Verschwinden nie ganz hinweggekommen. Auch das ist an mir ausgegangen. Das ist wahrscheinlich Frauenlos; die Ärgernisse und Frustrationen der Männer müssen wir ebenso mittragen wie die der Kinder. Kummer, der nicht unser Kummer ist, Sorgen, die nicht unsere Sorgen sind. Das ist die Liebe.
Und, sei ehrlich, wie oft habe ich mich zwischen euch gestellt, wenn es Streit gab, wenn er wieder einmal glaubte, es sei Zeit, mit väterlicher Autorität dein jugendliches Temperament zu zügeln oder dir wegen irgendwelcher Unanständigkeiten Vorhaltungen zu machen. Dir zur Seite habe ich mich gestellt, habe dich in Schutz genommen, habe eigene Fehler erfunden, um deine zu vertuschen; habe ihn oft dazu gebracht, dich verzeihend in die Arme zu nehmen, Entschuldigung gewährend, um die du doch nie gebeten hattest. Ich konnte deine Mutter nicht sein, so wollte ich zumindest dein Schutzengel sein, um mir so dein Zutrauen zu verdienen. Deine Liebe war es, was ich eigentlich ersehnte.
Und du hast es mir ja auch ganz lieb vergolten. Erinnerst du dich noch, wie du mit deinen Freunden und Freundinnen ein kleines Theaterstück einstudiertest, um es anlässlich des Staatsbesuches aus dem Nachbarreich aufzuführen? Alle Gäste hatten sich im goldenen Saal versammelt. Ich war so stolz auf dich, du hattest dich so nett hergerichtet, ich wusste, der Text, den ihr (natürlich ganz geheim) gelernt hattet, war von dir, und ich konnte den Augenblick kaum erwarten, an dem der Vorhang sich öffnete und das Spiel begann. Was kam, war schon in der zweiten Szene dieses Mädchen, das nach deinen Regieanweisungen schielte und hinkte und genau mit meinem Akzent sprach. Peinlich berührt mussten alle mitansehen, wie diese Spottfigur von einer Tollpatschigkeit in die nächste stolperte, bis sie schließlich nach einem schmähenden Reigenlied aller Kinder von dir höchstpersönlich dem Teufel übergeben wurde und mit Gezeter und Gestank in der Hölle verschwand. Du hattest das Stück gut geplant, am Schluss lachten und klatschten alle aus Leibeskräften, und das Gaudium des Publikums erreichte seinen Höhepunkt, als du heraustratest und sagtest: „Sie sahen das Stück 'Die Stiefmutter'." Und dabei trugst du das Ohrgehänge meiner Mutter, meine einzige Erinnerung an sie, das ich dir kurz zuvor zu Weihnachten geschenkt hatte.
Vielleicht habe ich damals zum ersten Mal daran gedacht, dass es herrlich sein müsste, dich einmal für irgendetwas, was du getan hast, zu strafen. Doch bis dahin sollte noch lange Zeit vergehen. Denn immer wieder versuchte ich, alles zu verstehen und zu verzeihen, obwohl noch vieles vorfiel, du weißt. Aber du nahmst mir jedwede Entscheidung zunächst aus der Hand, indem du aus dem väterlichen Schloss verschwandest. Es war ein Akt reiner Bosheit; es war, wie man so bei Kindern zu sagen pflegt, Trotz. Eine Winzigkeit, an die ich mich gar nicht mehr erinnere, nahmst du als Vorwand, deinem Zuhause und deinem Vater den Rücken zu kehren. Hierher bist du gegangen, zu diesen kleinen unbedeutenden Menschen in ihren kleinen unbedeutenden Häusern, die kleinen Tätigkeiten nachgehen, um sich ihren unbedeutenden Lebensunterhalt zu verdienen. Du hättest es sicher nicht ewig hier ausgehalten. Auch diese Zwerge hier waren nur Figuren in deinem Spiel.
Dann kamen die ersten Botschaften von dir. Ich habe bis heute nicht herausgefunden, wer in meinem Haushalt dein Verbündeter ist. Oder bist du selbst in Verkleidung oder im Dunkel der Nacht immer wieder in das Schloss geschlichen, um an den hölzernen Rahmen meines Spiegels deine Briefe zu heften?
„Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier,
aber Sneewittchen hinter den Bergen
bei den sieben Zwergen
ist tausendmal schöner als Ihr."
Ich habe diese Briefe gesammelt, einundzwanzig sind es geworden. Etwa nach dem Zwölften verlor ich zum ersten Mal, seit ich dich kannte, die Beherrschung. Wie von Wespen verfolgt rannte ich in mein Schlafzimmer. Natürlich heulte ich mir zuerst einmal die Seele aus dem Leib. Aber dann kam ich endgültig zu dem Entschluss, dich zu bestrafen. Wenn man wütend ist, findet man nur Befriedigung im Austoben körperlicher Gewalt. Ich wollte dich schlagen.
Um an dich heranzukommen, verkleidete ich mich als alte Bäuerin. Tatsächlich erkanntest du mich nicht, als ich klopfte, und öffnetest die Türe. Auf dem langen Weg zu dir war natürlich die erste Wut verraucht, und als ich dich so vor mir stehen sah, in deinem gewöhnlichen Kleidchen in dieser ärmlichen Umgebung, da wurde in mir wieder die Zuneigung stärker, gemischt mit Mitleid. Ich beschloss, dich vorsichtig zu überreden, mit mir nach Hause zurückzukehren. Um dein Vertrauen zu gewinnen, wollte ich dir eine Freude machen und dir ein buntes Band schenken, das ich bei mir trug. Es gefiel dir und du batest mich, es dir um den Leib zu binden. Ich weiß nicht, was mit mir geschah, aber als ich das Band um deinen schlanken Körper schlang, fiel mir mit einem Mal wieder ein, warum ich eigentlich gekommen war, mir fiel auf, wie zerbrechlich dein Leib war, und ohne zu denken, was ich tat, zog ich das Band fester und fester. Du versuchtest, meinem Angriff zu entkommen, aber ich schnürte und zerrte so lange, bis dir die Luft ausging und du ohnmächtig zusammensacktest.
Da erst wurde mir bewusst, was ich getan hatte. Zu meiner großen Erleichterung stellte ich fest, dass du noch lebtest. Ich lockerte das Band und lief davon, auf der Flucht vor mir selbst, vor dem, wozu ich fähig war. Du hast mich diese Fähigkeit gelehrt. Dein Werk!
Weißt du noch, wie ich zu deinem vierzehnten Geburtstag einen großen Ball organisierte? Du hast einen Maskenball daraus gemacht, und alle Mädchen mussten in der ausgefallenen Tracht meiner Heimat kommen. Das war lange vor deinem Verschwinden, aber vergessen habe ich das alles nicht. Als nach meinem ersten schrecklichen Besuch bei dir die Botschaften am Spiegel weiterhin kamen, wusste ich, dass du deine Lektion nicht gelernt hattest. Du warst immer noch das gemeine, trotzige Kind, das auf alle Versuche von mir, liebevolle wie strafende, nur mit noch mehr Bosheit antwortete.
Du wolltest reiten, ich habe dir die schönsten und edelsten Pferde geschenkt. Aber als ich mit dir ausritt, sprangst du vom Pferd in einen Bach und erzähltest dann allen, ich hätte dich in das Wasser gestoßen. Bei einem anderen Ausflug gabst du deinem Pferd die Sporen und galoppiertest davon. Zwei Tage bliebst du verschwunden, dann tauchtest du mit zerrissener Kleidung und ohne Pferd plötzlich auf und behauptetest, ich hätte dich in der Wildnis an einen Baum gebunden und allein gelassen, weil ich dich aussetzen wollte. All den Hass und alle Wut, mit der du mich verfolgtest, hast du mir angedichtet. Als Opfer wolltest du in die Geschichte eingehen, wo du doch eigentlich Täterin warst, der Bösewicht in diesem grimmigen Lebensmärchen.
All das hatte ich im Sinn, als ich beschloss, dich ein zweites Mal aufzusuchen. Diesmal wollte ich dich so erschrecken, dass dir deine Bösartigkeit ein für alle Mal verging. In anderer Verkleidung kam ich zu deinem Haus. Mitgebracht hatte ich, diesmal mit Bedacht, einen wunderschönen Kamm. Was man auf den ersten Blick nicht sehen konnte, war, dass er mit ätzendem Gift überzogen war. Natürlich konntest du der Schönheit des Kamms nicht widerstehen, denn bei aller Bosheit warst du auch immer recht eitel. Es war also ein Leichtes, dir den Kamm ins Haar zu stecken, ich drückte mit meiner handschuhbewehrten Hand ein bisschen fester zu - und schon begann das Gift zu wirken. Du wusstest natürlich in diesem Augenblick, wer ich war, aber die Erkenntnis kam zu spät. Das Gift erreichte die Blutbahnen und versetzte dich in eine leichte Ohnmacht. Rasch verschwand ich. Dieses Mal war ich nicht mehr so entsetzt über mich und meine kriminellen Gelüste. Dein Werk!
Zwei Tage später hing die nächste Botschaft am Spiegel: „... ist doch noch tausendmal schöner als Ihr." Das war gestern. Das Maß war voll!
Der Apfel hat seine Aufgabe erfüllt. Diesmal wirst du nicht wieder rechtzeitig erwachen. Deine verkrüppelten Beschützer werden dir nie wieder die Warnung eintrichtern können, keine Fremden einzulassen. Du bist tot. Dabei war dein Tod nicht die wahre Erfüllung für mich. Am schönsten war, dass ich dich leiden sehen konnte. Diese endlosen Minuten, in denen du, wissend, was geschah und durch wen, vergeblich versuchtest, dein kleines Leben festzuhalten, diese Augenblicke der ganz bewusst durchlittenen Todesqual, die - ich gebe es zu - die habe ich genossen.
Und jetzt ist endlich Frieden. Wie schön du doch wirklich bist, wenn du so daliegst. So blass, wie Schnee. Sneewitt, würden deine Leute sagen. Du hast verhindert, dass sie auch meine Leute wurden. Warum hast du mir ihre Lieder nicht beigebracht?
Ich hätte dich lieben wollen, ganz als ob ich dich selbst geboren hätte. Aber, verzeih mir, nach allem, was du mir angetan hast, kann ich dir keine Hochzeit mit einem Prinzen mehr vergönnen. Wenn ich auf deiner Hochzeit tanzen müsste, würde ich wie in glühenden Eisenpantoffeln tanzen. Du hast mich so weit gebracht. Und so weit - siehst du - so weit habe ich dich gebracht. In einen gläsernen Sarg sollte man dich legen und auf einen hohen Hügel stellen mit einer Warnung daran für alle des Weges kommenden Prinzen:
„Hänge dein Herz nicht an eine wie sie, o Reiter auf deinem Weg! Schlage ein Kreuz und sprich ein Gebet des Dankes dafür, dass sie dir erspart geblieben ist. Denn sie starb durch die Hand einer Frau, die wie du glaubte, sie lieben zu können."
Schlafe nun, meine Tochter. Du hast deinen Spaß gehabt und ich nun meinen. Wir sind quitt.
Bis auf die Tatsache, dass wahrscheinlich auch in unserem Fall, wie schon so oft, das Gerede der Menschen und die ungenaue Überlieferung im Lauf der Zeit alles Böse auf mich schieben wird.
Eigentlich sollten wir das schon gewohnt sein, wir Stiefmütter.
Vom klugen Schneiderlein
Variante eins: Sie will überhaupt nicht heiraten und denkt sich deshalb solch unlösbare Aufgaben aus für die, die hinter ihr her sind.
Variante zwei: Sie will nur mich nicht heiraten, und wenn einer meiner beiden neunmalklugen Kollegen das Rätsel hätte lösen können, dann wäre sie auf die Zusatzschikane mit dem Bären gar nicht verfallen.
Variante drei: Sie will gerade mich heiraten und plant mit meiner und des Bären Mithilfe der Welt zu beweisen, dass sie mit mir nicht nur den schlauesten, sondern auch den mutigsten Mann bekommt, den Gott auf dieser Erde hat wachsen lassen.
So weit, so gut. Nun geht es darum, mir zu überlegen, wie ich mit diesen drei Varianten umgehe. Jede von ihnen müsste ich irgendwie für mich nutzbar machen können. Also:
Ad drei: Wer im Ruf steht, ein Dummchen zu sein, dem fällt es nicht schwer, mit einfachsten Mitteln als Schlaukopf dazustehen. Man braucht nur völlig unvorhergesehen eine einfache Aufgabe zu lösen, und schon bewirkt die Diskrepanz zwischen der Erwartungs-haltung der Leute und der zutage getretenen Klugheit eine solche Überraschung, dass letztere bei weitem überschätzt wird. Die Welt der Politik ist voll von Männern und Frauen, deren Plattheiten über den grünen Klee gelobt und mit Wählerstimmen honoriert werden, bloß weil man von ihnen bisher nur Unsinn gehört hat und bei der ersten Äußerung, die halbwegs gesundem Menschenverstand entspricht, sagt: „Er wächst sichtlich mit seinen Aufgaben." Oder: „Sie empfiehlt sich mangels Entfaltungsmöglichkeiten im Inneren für Aufgaben am internationalen Parkett." Auf mich angewandt: Ich wollte nie Schneider werden, musste aber Schneider werden, konnte auf Grund meiner ungeschickten Finger gar nicht Schneider werden, durfte aber nichts anderes als Schneider werden und - bin jetzt Schneider. Politisch nicht ganz unbegabt, hegte ich schon früh das Image des tollpatschigen Narren, der für harmlose Neckereien am Stammtisch weitaus geeigneter erschien als dafür, bei ihm eine Hose oder Jacke beziehungsweise auch nur eine geringfügige Änderung einer solchen zu bestellen, geschweige denn fachlichen Rat bei der Planung und beim Entwurf eleganter Damenkleider oder anderer modischer Kreationen einzuholen.
Meine wahren Qualitäten zu erkennen, bedurfte es eines Menschen, den ich bisher noch nie getroffen habe: Jemand, der mich vom Klebeetikett des Schneiderseins loslöste und mit Aufgaben betraute, die mit Nadel, Zwirn und generell jeder Art handwerklichen Tuns nichts zu tun hatten; mich sozusagen als reine Intelligenz betrachtete, als Geist an sich, der weit über stofflichen Niederungen Brücken zu schlagen imstande war in die lichten Gefilde der puren Logik und Abstraktion. Als solcher hätte ich sehr wohl mit der Schere umgehen können, wäre diese nur die Schere der philosophischen Dissertation gewesen, zielvoll schneidend durch die Geflechte von Prämissen und Inventionen, sorgsam zerteilend die zarten Gewebe der Deduktionen und Induktionen. Ja, ich hätte sehr wohl die Nähmaschine bedienen können, wäre diese angetrieben worden durch den Hauch spiritueller Substanz und hätte sie feine Nadelstiche getrieben in Konjekturen und Interpretationen, sachte, aber dauerhaft verbindend die Interdependenzen und Plausibiltäten der großen Denker früherer Zeiten.
Die Prinzessin nun war, respektive ist dieser Mensch. Mit messerscharfem Kalkül hat sie mich durchschaut. Sie wollte eben keinen Schneider. Sie wollte einen wie mich. Nein, viel mehr noch: Sie wollte mich. Daher die fast unlösbar scheinende Frage an alle Bewerber: „Ich habe zweierlei Haar auf dem Kopf. Von was für Farben ist das?" Und dabei hatte sie natürlich so eine Art Kopftuch auf, das in Muster und Machart aus meiner Werkstatt stammen könnte und trotzdem den Blick auf ihr Haupthaar hundertprozentig unmöglich machte.
Welcher Kreativitätsmangel bei meinen beiden phantasielosen Kollegen! Der eine ein gefeierter Modeschöpfer, bei dessen Präsentationen regelmäßig alle Gräfinnen und Herzoginnen über sechzig in Ohnmacht fallen, nur weil seine Kleider von einer solchen Schlichtheit sind, dass die Models, die sie tragen, nackt zu sein scheinen. Er bevorzugt übrigens Mädchen, die sehr fett sind, denn, wie er sagt, man sieht dann mehr Haut, und die blaublütigen begleitenden Herren, die ja für die finanzielle Unterstützung aufkommen sollen, sind dann eher bereit mitzukommen und, wie er salopp sagt, „etwas springen zu lassen". Und dieser Einfaltspinsel hat keine bessere Idee als zu sagen: „Das Haar ist schwarz und weiß." Nur weil seine eigenen Schöpfungen keine anderen Farben kennen! Das hat er jetzt davon!
Der zweite ist ebenfalls ein berühmter Couturier, bei dessen Modeschauen regelmäßig alle Komtessen und Prinzessen unter dreißig in hysterische Kreischorgien verfallen, weil die Kleider, die er entwirft, von einer solchen Opulenz sind, dass man die Models, die sie tragen, gar nicht mehr sieht und weil es von ihm heißt, er sei homosexuell, was ihm ein gewisses perverses Flair einträgt, welches auf junge aufgeregte Frauen offenbar stimulierend wirkt. Er bevorzugt übrigens Mädchen, die sehr mager sind, sodass bei seinen Präsentationen mindestens ebenso viele Models in Ohnmacht fallen wie beim Anderen betagte Aristokratinnen. Und dieser Schwachkopf hat keinen besseren Einfall als zu sagen: „Das Haar ist rot und braun." Nur weil seine Modelle alle in diesen Farben gehalten sind (sie sind nämlich billig in der Herstellung) und er darum hofft, dass sie die Modefarben der kommenden Saison werden. Und was hat er jetzt davon?
Ich hingegen ging kühl berechnend an die gestellte Aufgabe heran. Jemand hat einmal gesagt: „Betrachte die Hände einer Frau und du weißt alles über sie." Nun, ihre Hände konnte ich, da sie Handschuhe trug, nicht betrachten, sehr wohl aber ihre Arme. Sie war nämlich mit einem ärmellosen Machwerk bekleidet, das rot und braun und schlicht und scheußlich war, eines jener Modelle, die es bei Versandhäusern zu kaufen gibt und die von jedem Modeschöpfer irgendetwas übernehmen, um sicherzugehen, dass sowohl pubertierende Prinzessinnen als auch Herzoginnen in Rente etwas bestellen.
Ich betrachtete also die Arme der Prinzessin; und siehe da: Ihre Unterarme waren zart behaart. Im schräg einfallenden Licht der Sonne schimmerte der dünne Flaum bald golden, bald silbern, und da es sich ja außerdem um eine Prinzessin handelte, die bestimmt niemanden mit Fragen nach unscheinbaren Allerweltsfarben belästigt hätte, sagte ich das Einzige, das mir logisch erschien: „Das Haar ist wie Gold und Silber."
Mir ist noch nie bei einer Schau meiner Modelle eine Frau in Ohnmacht gefallen. Noch nie habe ich einem weiblichen Wesen den leisesten Kreischer entlocken können, es sei denn, ich sagte: „Erschrick nicht, aber auf deinem Rücken sitzt eine kleine Spinne." Aber jetzt habe ich es geschafft. Auf meine Antwort hin ließ die Prinzessin einen kleinen Schrei fahren, inszenierte eine kurze Unpässlichkeit - sehr standesgemäß - und kaschierte ihre Freude darüber, dass ich der Auserwählte war, mit der Zusatzbemerkung: „Wenn du eine Nacht im Stall bei meinem gefährlichen Bären überlebst, dann sollst du mein Mann werden." Eine Geste, die stark märchenhafte Züge trägt und sehr stark vermuten lässt, dass es sich bei dem erwähnten Tier wohl um ein dressiertes Zirkustier mit einem Beißkorb und an einer Kette handeln wird, denn sie wird doch nicht wirklich wollen, dass der Mann, auf dessen Intelligenz sie es gerade noch abgesehen hatte, zwischen den Krallen und Zähnen einer geistlosen Bestie zu Biomasse zermahlen wird. Sie will mich der Welt halt als Held erscheinen lassen, um sich dann bei der Hochzeit umso mehr in meinem Glanz sonnen zu können. Ich werde also in den Stall gehen, Abstand von dem Bären halten, ihm vielleicht ein paar Nüsse verfüttern und mich seelisch auf meine Rolle als Prinzgemahl vorbereiten.
So viel zu Variante drei.
Ad zwei: Zugegeben, wenn ich neben meinen beiden Kollegen stehe, bin ich sicher derjenige, den eine adelige Dame am wenigsten wird haben wollen, wenn sie nur ein bisschen Geschmack hat. Der eine in schlichtes Schwarz und Weiß gekleidet, fett und stattlich, im vollen Bewusstsein seiner Berühmtheit bei Hofdamen im fortgeschrittenen Alter; und genaugenommen ist die Prinzessin auch nicht gerade das, was man jung und knusprig nennen könnte. Sie scheint sich, wie man so sagt, ihrem dritten Frühling zu nähern und veranstaltet diese Verheiratungslotterie jetzt wahrscheinlich nur, weil sie sonst das Reich im Falle ihres Ablebens unter ihren jüngeren Brüdern aufteilen müsste, die sie allesamt hasst wie die Pest. (Dem Reich würde in diesem Fall eine ziemlich zweifelhafte Zukunft bevorstehen. Der eine Bruder ist Mönch geworden und würde seinen Anteil in eine Einsiedelei verwandeln. Der zweite ist Straßenmeister und würde seinen Anteil zubetonieren. Der dritte ist Künstler und würde seinen Anteil mit Farbe zuschütten, verpacken, in Stücke schneiden und um teures Geld an alle aufgeschlossenen Kunstsammlungen der Welt versenden.)
Der zweite Kollege steht stramm, wenn auch ein bisschen dünn, neben mir, aber eben aufwendig in jenes Braun und Rot gehüllt, von dem man weiß, dass es die Prinzessin mag und dass es von den führenden Versandhäusern bereits als die Modefarben der kommenden Saison angekündigt wird.
Es erscheint also durchaus denkbar, dass die Prinzessin, hätte einer von den beiden die richtige Lösung gewusst, ihn mit Wonne mir vorgezogen und ohne Übernachtung im Bärenstall in ihr Ehebett geholt hätte, den Homosexuellen vielleicht etwas lieber, weil sie sich mit ihm keine Beeinträchtigung ihrer Nachtruhe eingehandelt hätte. (Obwohl eventuell eine dürre, vertrocknete Prinzessin mit mangelhaft weiblichen Formen auch seinen Geschmack getroffen hätte.)
Aber das Gefühl, eine Notlösung zu sein, quält mich nicht im Geringsten. Besser eine angeheiratet-prinzliche Notlösung in einem florierenden Reich, das von Sonnenauf- bis -untergang alle Spielarten modischen Geschmacks in seinen Grenzen zulässt, als ein unwilliger Schneider in einem Land, das zum Teil aus Beton und kalten, feuchten Eremitengrotten besteht und zum anderen Teil an den Wänden internationaler Kunstmuseen hängt.
Und Variante eins? Wenn es stimmt, dass sie sich eigentlich gar nicht verheiraten will, dann hat sie es ungeschickt angestellt. Man lässt nicht ungestraft Männer auf die Unterarme gaffen. Auch wenn es meine zwei Kollegen als unter ihrer Würde erachten mögen, ich persönlich hätte für einen solchen Anlass ein langärmeliges Modell empfohlen. Ich hätte es zwar nicht anfertigen können, aber als Idee wäre es brauchbar gewesen und würde mich jetzt nicht in so hilfloser Lage dastehen lassen. Denn über dem Urwaldgewirr der Konjunktive des Mögens, Würdens und Hättens hängt wie eine schwere Wolke die schreckliche Realität: Ich fürchte mich vor Bären!
Das bedeutet: Es ist völlig egal, welche Variante die Richtige ist. Ich werde morgen vermutlich nicht mehr leben und bei meinem Begräbnis wird weder eine Ohnmacht noch ein Kreischkonzert stattfinden. Man wird nur sagen: „Für einen Schneider war er zu dumm, nicht einmal zum Prinzen hat es gereicht."
Aber was soll´s? Größere Geister als ich sind von dieser Welt gegangen ohne Erdbeben und Sintflut. Sie und ich korrelieren, befreit von den Parametern irdischer Existenz, in der Kontemplation der Sphären des Pantheons. Und unsere Scheren und Nadeln, Sicheln und Sensen, Hämmer, Zirkel und Lupen fallen irgendwann verrostend von den Wänden.
-------
Randbemerkung eines unvoreingenommenen Beobachters:
Der besagte Schneider war ein landesbekannter Tölpel und wäre ohne die mitleidige Hilfe seiner Zunftkollegen schon in jungen Jahren verhungert. Sein Intelligenzquotient wurde bei einer volkskundlichen Studie mit 47 registriert. Und diese Figur sollte so komplex gedacht haben?
Wer´s glaubt, zahlt einen Taler!
Rumpelstilzchen
Mein süßes Mädchen du! Ich finde, du siehst mir ähnlich. Oft sagt man, Mädchen sehen eher ihren Vätern ähnlich. Du nicht. Wenn du deinem Vater ähnlich sehen würdest, dann müsstest du dieses glatte blonde Haar haben und seine königlich geschwungenen Augenbrauen. Ja, ein König ist er, dein Vater, und ich bin eine Königin.
Eigentlich bin ich eine Müllerstochter. Aber ich könnte schon die eigenartigsten Geschichten erzählen, wie man eine Königin wird. Genaugenommen dürfte ich meinen Mann ja gar nicht lieben, und genauso wenig meinen Vater. Aber was ist schon die Liebe? Als junges Mädchen glaubte ich, einen Burschen aus unserem Dorf - sein Vater war Schneider - wirklich zu lieben. Doch außer ein paar verstohlenen Küssen hinter einer Scheune, einigen Scherzen beim Dorftanz und einem ständig schlechten Gewissen wegen dieser unschuldigen Vergnügungen war nichts dahinter. In Gedanken schrieb ich ihm heiße Liebesbriefe, in denen ich ihn bat, mit mir auf und davon zu ziehen, aber ich dachte diese Briefe nur und kam mir dabei schrecklich verrucht vor. Mein sogenannter Geliebter küsste ja doch jede hinter irgendeiner Scheune, und Liebe, die richtige Liebe kam nur in den Büchern vor, die ich mir manchmal aus unserer Schulbibliothek holte.
Deinen Vater und meinen Vater, kann ich die beiden lieben? Nachdem sie mich in ihrem Spiel um Ruhm und Reichtum nur benützt haben? Wie einen Mensch-ärgere-dich-nicht-Stein, den man hin und her schiebt und hinauswirft, wenn er im Wege steht, haben sie mich verwendet; meinem Vater war in seiner Gier nach Ansehen und Berühmtheit selbst eine Lüge, mit der er seine Tochter in höchste Gefahr brachte, nicht zu viel. Stroh zu Gold spinnen könne ich angeblich, so ein Unsinn! Das glaubst ja nicht einmal du, mein Pumpelchen. O du, dich habe ich lieb. Ja, du siehst mir ähnlich, du hast meinen Mund und mein dunkles festes Haar, du liebes Pilzköpfchen du.
Und sei ehrlich, Pumpelchen, kann ich einen Ehemann lieben, der sich, als ich mit Hilfe dieses komischen hässlichen Mannes tatsächlich Gold erzeugen konnte, als immer noch gieriger erwies und der mich letzten Endes nur heiratete, weil er in mir eine Quelle unerschöpflichen Reichtums erblickte? Nein, sei ehrlich, so einen Mann kann ich nicht lieben. Aber jetzt habe ich ja dich, mein kleines Pilzchen. Für dich allein ist es wert, eine Königin zu sein und dir einmal all das bieten zu können, wovon ich nur in den Büchern lesen konnte.
Jetzt aber muss ich um dich kämpfen! Denn auch der hässliche Mann, dieser seltsame nächtliche Besucher, der das unmögliche Kunststück fertigbrachte, hat Bedingungen gestellt. Gibt es niemanden mehr auf der Welt, der jemandem etwas Gutes tut, ohne dafür immer mehr und mehr zu fordern? In der ersten Nacht das Halskettchen von meiner Mutter, in der zweiten mein zartes goldenes Ringlein, und in der dritten, als der König bereits seine Heirat mit mir in Aussicht gestellt hatte, mein erstes Kind, also dich. Was sollte ich denn in meiner Verzweiflung tun? Der König hatte mir ja den Tod angedroht, falls ich kein Gold spinnen konnte. Den Tod! Stell dir das vor, mein Pilzpumpelchen! Ich hätte sterben müssen oder seine Frau werden! Und jetzt soll ich diesen Mann lieben? Zugegeben, er hat sich seit unserer Hochzeit bemüht, ein liebevoller und zärtlicher Gatte zu sein, aber, ehrlich gesagt, es gelingt ihm nicht. Schon als er in der Hochzeitsnacht zu mir in das Bett kam, benahm er sich, als ginge es wieder darum, ihn zufriedenzustellen oder zu sterben. Da war ja mehr Gefühl in den rasch hingeschmatzten Küssen meines Schneiderburschen hinter der Scheune gewesen. Aber es war nicht zu ändern.
So wurdest du gezeugt. Und seither, in all den Monaten meiner Schwangerschaft, lebte ich stets in der Hoffnung, der hässliche Mann könnte seine Forderung vergessen haben, und gleichzeitig in der Angst, er werde sich noch erinnern. Dann gebar ich dich, und in der ganzen Freude und Aufregung konnte ich meinen unheimlichen Helfer doch tatsächlich vergessen. Bis gestern!