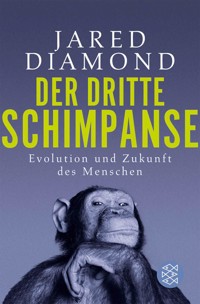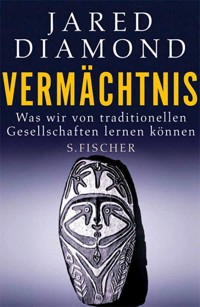
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Noch heute leben zahlreiche Stämme als Jäger und Sammler in unzugänglichen Teilen der Welt. Jared Diamond, Professor für Geographie und international erfolgreicher Bestsellerautor, kennt sie aus vielen Expeditionen, die er in den letzten Jahrzehnten geleitet hat. In seinem neuen Buch entfaltet er den ganzen Reichtum ihrer verblüffend anderen Lebensweise und zeigt anschaulich, was wir heute von ihnen lernen können. Eine überraschende und unterhaltsame Lektion über die Vielfalt der Kulturen – und eine Kritik unseres modernen Selbstverständnisses. »Jared Diamond schreibt mit Witz, Esprit und großem Sachverstand.« Die Welt »Die Zivilisation hat uns reich, satt und bequem gemacht, aber nicht rundum zufrieden. Jared Diamond hilft uns zu erkennen, woran das liegt. Und nicht nur das: Er sagt uns auch, was wir besser machen können. Vorbilder gibt es genug, von Afrika bis Neuguinea.« Stern »Eine Fundgrube und ein Gedankenanreger ohnegleichen.« Financial Times Deutschland »Auf Diamond passt das überstrapazierte Wort vom Universalgelehrten genau, dazu gehört auch, dass er Autodidakt geblieben ist, um Wissenslücken bald zu schließen, wenn die sich neu öffneten. Er ist die Lernfähigkeit selbst.« Die Zeit »Wichtige Einsichten in unser traditionelles wie modernes Menschsein.« Der Tagesspiegel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 957
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Jared Diamond
Vermächtnis
Was wir von traditionellen Gesellschaften lernen können
Über dieses Buch
Seit Jahrzehnten unternimmt Jared Diamond Expeditionen zu Stämmen, die noch traditionell als Jäger und Sammler leben, und beobachtet fasziniert ihre Lebensformen. In seinem neuen Buch entfaltet er lebendig und unterhaltsam die phantastische Bandbreite dieser Kulturen. Er führt plastisch vor Augen, wie grundverschieden Menschen mit dem Leben von Geburt bis Tod umgehen und wie verblüffend anders sie ihr Zusammenleben organisieren. Seine These: Wir können heute von diesen Kulturen viel lernen und so unsere aktuellen privaten und gesellschaftlichen Probleme lösen. Von Problemen der Kindererziehung über staatliche Konflikte bis zum Umgang mit Alter und Tod. Ein faszinierender Blick auf die Vielfalt der menschlichen Kulturen und eine überraschende Perspektive auf unser modernes Selbstverständnis.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jared Diamond, 1937 in Boston geboren, ist Professor für Physiologie an der Universität von Kalifornien in Los Angeles. Sein Hauptforschungsgebiet ist die Evolutionsbiologie. In den letzten 25 Jahren hat er rund ein Dutzend Expeditionen in entlegene Gebiete von Neuguinea geleitet. Für seine Arbeit auf den Gebieten der Anthropologie und Genetik ist er mehrfach ausgezeichnet worden, u.a. mit dem Pulitzer-Preis. Nach ›Der dritte Schimpanse‹ und ›Arm und Reich‹ hat er zuletzt bei S. Fischer den Bestseller ›Kollaps. Warum Gesellschaften überleben oder untergehen‹ veröffentlicht.
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: picture alliance/Artcolor
Die amerikanische Originalausgabe erscheint 2013 unter dem Titel
»The World Until Yesterday. What can we learn from traditional societies?«
im Verlag Viking, Penguin Group, New York
© 2012/2013 by Jared Diamond
Für die deutsche Ausgabe:
© 2012 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Karte 1 und Graphik 1: © Peter Palm, Berlin
Bildnachweis: www.jareddiamondbooks.com
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402014-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Prolog Auf dem Flughafen
Eine Szene am Flughafen
Warum untersucht man traditionelle Gesellschaften?
Staaten
Typen traditioneller Gesellschaften
Methoden und Quellen
Ein kleines Buch über ein großes Thema
Die Gliederung des Buches
Teil I Wegbereitung durch Raumaufteilung
Kapitel 1 Freunde, Feinde, Fremde und Kaufleute
Eine Grenze
Einander ausschließende Territorien
Nichtexklusive Landnutzung
Freunde, Feinde, Fremde
Erste Kontakte
Handel und Händler
Marktwirtschaften
Traditionelle Formen des Handels
Traditionelle Handelswaren
Wer handelt womit?
Winzige Nationen
Teil II Frieden und Krieg
Kapitel 2 Schadenersatz für den Tod eines Kindes
Ein Unfall
Eine Zeremonie
Was wäre, wenn …?
Was hat der Staat getan?
Schadenersatz in Neuguinea
Lebenslange Beziehungen
Andere nichtstaatliche Gesellschaften
Staatsgewalt
Staatliche Ziviljustiz
Schwächen der staatlichen Ziviljustiz
Staatliche Strafjustiz
Wiederherstellende Justiz
Vorteile und ihr Preis
Kapitel 3 Ein kurzes Kapitel über einen winzigen Krieg
Der Krieg der Dani
Der Ablauf des Krieges
Zahl der Kriegsopfer
Kapitel 4 Ein längeres Kapitel über viele Kriege
Definitionen für Krieg
Informationsquellen
Formen traditioneller Kriege
Sterblichkeit
Ähnlichkeiten und Unterschiede
Beendigung von Kriegen
Auswirkungen des Kontakts mit Europäern
Kriegslüsterne Tiere, friedliche Völker
Motiv für traditionelle Kriege
Letzte Gründe
Gegen wen kämpfen die Menschen?
Vergesst Pearl Harbor
Teil III Jung und Alt
Kapitel 5 Wie Kinder großgezogen werden
Kindererziehung im Vergleich
Geburt
Säuglingsmord
Entwöhnung und Abstände zwischen den Geburten
Versorgung nach Bedarf
Kontakt zwischen Säuglingen und Erwachsenen
Väter und Ersatzeltern
Umgang mit schreienden Säuglingen
Körperliche Züchtigung
Selbständigkeit von Kindern
Altersgemischte Spielgruppen
Kinderspiel und Ausbildung
Ihre Kinder und unsere Kinder
Kapitel 6 Umgang mit alten Menschen: lieben, aussetzen oder töten?
Die Alten
Erwartungen im Zusammenhang mit der Versorgung Älterer
Warum aussetzen oder töten?
Nützlichkeit älterer Menschen
Gesellschaftliche Werte
Gesellschaftliche Regeln
Ist es heute besser oder schlechter?
Was macht man mit älteren Menschen?
Teil IV Gefahr und Reaktion
Kapitel 7 Konstruktive Paranoia
Einstellungen zur Gefahr
Nächtlicher Besuch
Ein Bootsunglück
Nur ein Stock in der Erde
Risiken eingehen
Risiken und Redseligkeit
Kapitel 8 Löwen und andere Gefahren
Gefahren der traditionellen Lebensweise
Unfälle
Wachsamkeit
Gewalt unter Menschen
Krankheiten
Umgang mit Krankheiten
Hunger
Unvorhersehbare Nahrungsknappheit
Landverteilung
Jahreszeiten und Lebensmittelknappheit
Erweiterung des Speisezettels
Verdichtung und Verteilung
Umgang mit Gefahren
Teil V Religion, Sprache und Gesundheit
Kapitel 9 Was wir von Zitteraalen über die Evolution der Religion lernen können
Fragen nach der Religion
Definitionen für Religion
Funktionen und Zitteraale
Die Suche nach kausalen Begründungen
Glaube an Übernatürliches
Die Erklärungsfunktion der Religion
Entschärfung von Angst
Trost
Organisation und Gehorsam
Regeln für das Verhalten gegenüber Fremden
Rechtfertigung von Kriegen
Abzeichen des Engagements
Religiöse Erfolgsmaßstäbe
Veränderungen der Funktion von Religionen
Kapitel 10 In vielen Sprachen sprechen
Mehrsprachigkeit
Alle Sprachen der Welt
Evolution von Sprachen
Geographie der Sprachenvielfalt
Traditionelle Mehrsprachigkei
Nutzen der Zweisprachigkeit
Die Alzheimer-Krankheit
Sterbende Sprachen
Wie Sprachen verschwinden
Sind Minderheitensprachen schädlich?
Warum soll man Sprachen erhalten?
Wie können wir Sprachen schützen?
Kapitel 11 Salz, Zucker, Fett und Faulheit
Nicht übertragbare Krankheiten
Unser Salzkonsum
Salz und Blutdruck
Ursachen des Bluthochdrucks
Salz in der Nahrung
Diabetes
Formen des Diabetes
Gene, Umwelt und Diabetes
Die Pima-Indianer und die Bewohner der Insel Nauru
Diabetes in Indien
Nutzen von Genen für Diabetes
Warum ist Diabetes bei Europäern selten?
Die Zukunft der nicht übertragbaren Krankheiten
Epilog Auf einem anderen Flughafen
Vom Dschungel auf den Freeway 405
Vorteile der modernen Welt
Vorteile der traditionellen Welt
Was können wir lernen?
Weiterführende Literatur
Literaturangaben mit Gültigkeit für das ganze Buch
Literaturangaben zum Prolog: Auf dem Flughafen
Quellen für Informationen über traditionelle Gesellschaften
Danksagung
Abbildungsnachweise
[Tafelteil 1]
[Tafelteil 2]
Für Meg Taylor, mit Dank für Deine jahrzehntelange Freundschaft und dafür, dass Du mich an Deinen Einblicken in unser beider Welten teilhaben lässt.
PrologAuf dem Flughafen
Eine Szene am Flughafen
30. April 2006, sieben Uhr morgens. Ich stehe in der Abflughalle eines Flughafens, habe den Griff meines Gepäckwagens gepackt und werde von einer Menge anderer Menschen, die ebenfalls für die ersten Flüge des Tages einchecken wollen, hin und her geschubst. Es ist eine vertraute Szene: Hunderte von Reisenden mit Koffern, Kisten, Rucksäcken und Babys stehen in parallelen Schlangen vor einer langen Reihe mit Schaltern, und dahinter arbeiten uniformierte Mitarbeiterinnen der Fluggesellschaften an ihren Computern. Andere Uniformierte verteilen sich in der Menge: Piloten und Stewardessen, Gepäckprüfer und zwei Polizisten, die zwischen den Menschen stehen und nichts anderes zu tun haben, als sichtbar zu sein. Die Prüfer röntgen die Gepäckstücke, die Mitarbeiterinnen der Fluggesellschaften hängen Etiketten an die Koffer, und Gepäckträger heben die Koffer auf ein Förderband, das sie fortbringt, damit sie hoffentlich in die richtigen Flugzeuge geladen werden. An der Wand gegenüber den Check-in-Schaltern sind Läden, die Zeitungen und Fastfood verkaufen. Weitere Gegenstände in meiner Umgebung sind die üblichen Wanduhren, Telefone, Geldautomaten, Rolltreppen zur oberen Etage und natürlich die Flugzeuge, die man durch die Fenster des Terminals sehen kann.
Die Schaltermitarbeiterinnen der Fluggesellschaft bewegen ihre Finger über Computertastaturen, blicken auf Bildschirme und drucken zwischendurch an den Kreditkartenterminals die Zahlungsbelege aus. In der Menschenmenge herrscht die übliche Mischung aus Humor, Geduld, Empörung, respektvollem Anstehen und der Begrüßung von Bekannten. Als ich in meiner Schlange ganz vorn stehe, zeige ich ein Stück Papier (meinen Buchungsbeleg) einem Menschen, den ich noch nie gesehen habe und vermutlich nie wieder sehen werde (der Check-in-Mitarbeiterin). Im Gegenzug drückt sie mir ein Stück Papier in die Hand, das mich berechtigt, über Hunderte von Kilometern an einen Ort zu fliegen, an dem ich nie zuvor gewesen bin und dessen Bewohner mich nicht kennen, meine Ankunft aber dennoch hinnehmen.
Reisenden aus den USA, Europa oder Asien würde an dieser ansonsten vertrauten Szene zuerst eine Besonderheit auffallen: Bei allen Menschen in der Halle außer mir und einigen anderen Touristen handelt es sich um Neuguineer. Als weiterer Unterschied würde dem Reisenden aus Übersee auffallen, dass als Nationalflagge die schwarzrotgoldene Flagge des Staates Papua-Neuguinea über dem Schalter hängt, die einen Paradiesvogel und das Kreuz des Südens – ein Sternbild – zeigt; auf den Schildern über den Schaltern steht nicht »American Airlines« oder »British Airways«, sondern »Air Niugini«; und die Namen der Flugziele auf den Monitoren klingen exotisch: Wapenamanda, Goroka, Kikori, Kundiawa und Wewak.
Der Flughafen, auf dem ich an jenem Morgen eincheckte, liegt in Port Moresby, der Hauptstadt von Papua-Neuguinea. Für jemanden mit einem Gespür für die Geschichte Neuguineas – auch für mich, der ich 1964 zum ersten Mal in das Land kam, das damals noch unter australischer Verwaltung stand – war die Szene vertraut, erstaunlich und bewegend zugleich. Im Geist verglich ich sie mit den Fotos der ersten Australier, die 1931 in das Hochland Neuguineas vorgedrungen waren und es »entdeckt« hatten, eine Region, in der eine Million Dorfbewohner noch Steinwerkzeuge benutzten. Auf den Fotos starren die Hochlandbewohner, die seit Jahrtausenden relativ abgeschieden gelebt hatten und nur begrenzte Kenntnisse über die Außenwelt besaßen, voller Entsetzen auf die ersten Europäer, die ihnen begegneten (Abb. 30, 31). Als ich 2006 auf dem Flughafen von Port Moresby in die Gesichter der neuguineischen Passagiere, Schaltermitarbeiterinnen und Piloten blickte, sah ich in ihnen die Gesichter der Neuguineer, die man 1931 fotografiert hatte. Die Menschen, die auf dem Flughafen um mich herumstanden, waren natürlich nicht dieselben wie auf den Fotos von 1931, aber ihre Gesichter waren ähnlich, und manche von ihnen könnten die Kinder oder Enkel der Hochlandbewohner von damals gewesen sein.
Zwischen der Szene vom Check-in 2006, die sich in mein Gedächtnis eingebrannt hat, und den Fotos vom »Erstkontakt« aus dem Jahr 1931 besteht natürlich ein besonders augenfälliger Unterschied: Die Hochlandbewohner von 1931 waren nur spärlich mit Grasröcken bekleidet, trugen Netzbeutel auf den Schultern und hatten einen Kopfschmuck aus Vogelfedern; 2006 trugen sie die internationale Einheitskluft aus Hemden, Hosen, Röcken, Shorts und Baseballkappen. Innerhalb von ein bis zwei Generationen und innerhalb der Lebenszeit vieler einzelner Menschen in der Abflughalle hatten die Hochlandbewohner Neuguineas gelernt, zu schreiben, Computer zu bedienen und Flugzeuge zu steuern. Manche Menschen in der Halle waren vielleicht die ersten aus ihrem Stamm, die Lesen und Schreiben gelernt hatten. Ein Symbol für die Kluft zwischen den Generationen war für mich das Bild zweier Männer in der Menschenmenge: Der Jüngere, in Pilotenuniform, ging vor dem Älteren her und erklärte mir, er bringe seinen Großvater zu seiner ersten Flugreise; und der grauhaarige Großvater sah fast ebenso verwirrt und überwältigt aus wie die Menschen auf den alten Fotos.
Ein Beobachter, der sich in der Geschichte Neuguineas auskennt, hätte aber neben der Tatsache, dass die Menschen damals Grasröcke und 2006 westliche Kleidung trugen, noch größere Unterschiede zwischen den Szenen von 1931 und 2006 erkannt. Der Hochlandgesellschaft von 1931 fehlte nicht nur fabrikmäßig hergestellte Kleidung, sondern auch moderne Technologie in jeglicher Form, von Uhren, Telefonen und Kreditkarten bis zu Computern, Rolltreppen und Flugzeugen. Und auch grundlegende Dinge wie Schrift, Metall, Geld, Schulen und eine Zentralregierung gab es im Hochland Neuguineas 1931 nicht. Hätten wir nicht die Realität der neueren Geschichte hinter uns, so müssten wir uns fragen: Kann eine des Lesens und Schreibens unkundige Gesellschaft einen solchen Wandel wirklich innerhalb einer Generation bewältigen?
Mit ein wenig Aufmerksamkeit und Kenntnissen über die Geschichte Neuguineas hätte man in der Szene von 2006 noch weitere Aspekte entdeckt, die ähnlich auch auf anderen Flughäfen zu sehen wären, aber ganz anders waren als in den Szenen von 1931 auf den Fotos aus dem Hochland. In der Szene von 2006 kommt ein größerer Anteil grauhaariger alter Menschen vor, von denen in der traditionellen Gesellschaft im Hochland nur relativ wenige überlebten. Die Menschenmenge auf dem Flughafen kommt einem Besucher aus dem Westen, der noch keine Erfahrung mit Neuguinea hat, vielleicht »einheitlich« vor – alle Menschen ähneln sich mit ihrer dunklen Haut und den krausen Haaren (Abb. 13, 26, 30, 31, 32) –, in anderen Aspekten ihres Erscheinungsbildes ist sie jedoch heterogen: große Flachlandbewohner von der Südküste mit spärlichem Bart und schmalem Gesicht; kleinere Bartträger aus dem Hochland mit breitem Gesicht; und Bewohner der Inseln und des Flachlandes an der Nordküste, deren Gesichtszüge ein wenig asiatisch wirken. Im Jahr 1931 wäre es völlig unmöglich gewesen, Hochlandbewohnern sowie Flachlandbewohnern von der Süd- und Nordküste gleichzeitig zu begegnen; jede Menschenansammlung wäre in Neuguinea weitaus homogener gewesen als die Menschenmenge auf dem Flughafen im Jahr 2006. Ein Sprachforscher, der den Menschen zuhörte, hätte Dutzende von Sprachen unterscheiden können, die zu ganz unterschiedlichen Gruppen gehören: tonale Sprachen, deren Wörter sich wie im Chinesischen durch die Tonhöhe unterscheiden, austronesische Sprachen mit relativ einfachen Silben und Konsonanten, und die nichttonalen Papua-Sprachen. Auch 1931 hätte man zwar Menschen, die sich unterschiedlicher Sprachen bedienten, gemeinsam begegnen können, aber eine Versammlung, in der Dutzende von Sprachen gesprochen werden, hätte es nicht gegeben. An den Check-in-Schaltern und auch in vielen Unterhaltungen zwischen den Passagieren wurden 2006 zwei weit verbreitete Sprachen gesprochen, nämlich Englisch und Tok Pisin (auch Neomelanesisch oder Pidgin-Englisch genannt), 1931 dagegen hätten alle Gespräche im Hochland Neuguineas in lokalen Sprachen stattgefunden, die jeweils auf ein kleines Gebiet beschränkt waren.
Ein anderer kleiner Unterschied zwischen den Szenen von 1931 und 2006 bestand darin, dass zur Menschenmenge von 2006 auch einige Neuguineer mit einem unglückselig-verbreiteten amerikanischen Körperbau gehörten: übergewichtige Menschen, bei denen der »Bierbauch« über den Gürtel hing. Die Fotos aus der Zeit vor 75 Jahren zeigen nicht einen einzigen übergewichtigen Neuguineer: Alle waren schlank und muskulös (Abb. 30). Hätte man die Ärzte der Passagiere am Flughafen befragt, so hätte man (was man auch aus den modernen Gesundheitsstatistiken Neuguineas ablesen kann) von einer Vermehrung der Diabetesfälle erfahren, die mit dem Übergewicht gekoppelt sind, außerdem von Bluthochdruck, Herzkrankheiten, Schlaganfällen und Krebserkrankungen, die noch vor einer Generation unbekannt waren.
Ein weiterer Unterschied betrifft ein Merkmal, das wir in der modernen Welt für selbstverständlich halten: Die meisten Menschen, die in der Flughafenhalle zusammengedrängt waren, hatten einander nie zuvor gesehen; sie waren Fremde, und dennoch gab es zwischen ihnen keine Kämpfe. Auch das wäre 1931 unvorstellbar gewesen: Begegnungen mit Fremden waren damals selten, gefährlich und arteten sehr häufig in Gewalt aus. Da waren zwar die beiden Polizisten in der Flughafenhalle, die angeblich für Ordnung sorgen sollten, in Wirklichkeit sorgte die Menge aber selbst für Ordnung, einfach weil die Passagiere wussten, dass kein anderer auf sie losgehen würde und dass in der Gesellschaft, in der sie lebten, noch mehr Polizisten und Soldaten bereitstanden, falls ein Konflikt aus dem Ruder lief. Im Jahr 1931 gab es weder Polizei noch staatliche Autorität. Die Passagiere in der Flughafenhalle erfreuten sich des Rechts, nach Wapenamanda oder jedem anderen Ort in Papua-Neuguinea zu fliegen oder mit anderen Verkehrsmitteln dorthin zu reisen, ohne dass sie eine Erlaubnis brauchten. In der modernen westlichen Welt ist die Reisefreiheit für uns zu einer Selbstverständlichkeit geworden, früher jedoch war sie die Ausnahme. Im Jahr 1931 hatte noch kein Neuguineer, der in Goroka geboren war, das nur rund 170 Kilometer weiter westlich gelegene Wapenamanda besucht; von Goroka nach Wapenamanda zu reisen, ohne als unbekannter Fremder schon auf den ersten 15 Kilometern getötet zu werden, wäre undenkbar gewesen. Ich dagegen war gerade mehr als 11000 Kilometer von Los Angeles nach Port Moresby gereist, eine Entfernung, die viele Hundert Mal größer war als alle Strecken, die ein traditioneller Hochlandbewohner Neuguineas während seines gesamten Lebens von seinem Geburtsort aus zurückgelegt hätte.
Alle diese Unterschiede zwischen den Menschenmengen von 2006 und 1931 lassen sich kurz zusammenfassen: Die Bevölkerung des Hochlandes von Neuguinea hat in den letzten 75 Jahren im Eiltempo einen Wandel durchgemacht, der in großen Teilen der übrigen Welt Jahrtausende in Anspruch nahm. Für den einzelnen Hochlandbewohner spielten sich die Veränderungen sogar noch schneller ab: Einige meiner Freunde aus Neuguinea haben mir erzählt, sie hätten ungefähr zehn Jahre, bevor ich sie kennenlernte, die letzten Steinäxte hergestellt und an den letzten traditionellen Stammeskämpfen teilgenommen. Für Bürger der Industriestaaten sind die erwähnten Aspekte der Szene von 2006 eine Selbstverständlichkeit: Metalle, Schrift, Maschinen, Flugzeuge, Polizei und Staat, übergewichtige Menschen, angstfreies Zusammentreffen mit Fremden, eine heterogene Bevölkerung, und so weiter. Aber alle diese Aspekte einer modernen Gesellschaft sind in der Menschheitsgeschichte relativ neu. Während des größten Teils der rund 6 Millionen Jahre, seit sich die Evolutionslinien von Menschen- und Schimpansenvorfahren trennten, gab es in sämtlichen menschlichen Gesellschaften weder Metalle noch all die anderen erwähnten Dinge. Diese modernen Merkmale erschienen erst während der letzten 11000 Jahre auf der Bildfläche, und auch das nur in bestimmten Regionen der Erde.
Deshalb ist Neuguinea[1] in mancherlei Hinsicht ein Fenster zu der Welt der Menschen, wie sie praktisch bis gestern aussah, jedenfalls wenn man es an den 6 Millionen Jahren der Menschenevolution misst. (Ich betone »in mancherlei Hinsicht« – natürlich war das Hochland Neuguineas im Jahr 1931 nicht die unveränderte Welt von gestern.) Alle Veränderungen, die sich im Hochland während der letzten 75 Jahre abgespielt haben, sind auch in anderen Gesellschaften auf der Welt abgelaufen, aber im größten Teil der übrigen Welt setzte der Wandel früher und viel allmählicher ein als in Neuguinea. Aber auch »allmählich« ist relativ: Selbst in Gesellschaften, in denen die Veränderungen zuerst auftauchten, ist der zeitliche Abstand von noch nicht einmal 11000 Jahren winzig klein im Vergleich zu 6 Millionen Jahren. Grundsätzlich haben unsere menschlichen Gesellschaften erst vor sehr kurzer Zeit und sehr schnell tiefgreifende Veränderungen durchgemacht.
Fußnoten
[1]
Für Neuguinea wurde eine verwirrende Terminologie verwendet. In diesem Buch meine ich mit »Neuguinea« die gesamte Insel dieses Namens; sie ist nach Grönland die zweitgrößte Insel der Welt und liegt in der Nähe des Äquators nördlich von Australien (Abb. 26). Die verschiedenen indigenen Völker der Insel nenne ich »Neuguineer«. Wegen der Zufälle in der Kolonialgeschichte des 19. Jahrhunderts ist die Insel heute politisch zwischen zwei Staaten aufgeteilt. Die Osthälfte bildet zusammen mit vielen nahe gelegenen kleineren Inseln den unabhängigen Staat Papua-Neuguinea, der aus einer früheren deutschen Kolonie im Nordosten und einer früheren britischen Kolonie im Südosten entstanden ist und bis zur Unabhängigkeit 1975 von Australien verwaltet wurde. Die Australier bezeichneten den früheren deutschen Teil als Neuguinea und den britischen Teil als Papua. Die Westhälfte der Insel gehörte früher zu Niederländisch-Ostindien und ist seit 1969 eine Provinz (früher Irian Jaya, heute umbenannt in Papua) des Staates Indonesien. Meine eigenen Freilandarbeiten verteilen sich fast zu gleichen Teilen auf die beiden politischen Hälften der Insel.
Warum untersucht man traditionelle Gesellschaften?
Warum finden wir »traditionelle« Gesellschaften so faszinierend?[1]
Zum Teil liegt es an einem rein menschlichen Interesse: Es ist faszinierend, Menschen kennenzulernen, die uns so ähnlich und in mancherlei Hinsicht so verständlich erscheinen und uns doch andererseits unähnlich vorkommen und kaum zu verstehen sind. Als ich 1964 mit 26 Jahren zum ersten Mal nach Neuguinea kam, war ich verblüfft darüber, wie exotisch die Bewohner des Landes waren: Sie sehen anders aus als Amerikaner, sprechen andere Sprachen, kleiden sich anders und verhalten sich anders. Als ich aber vielen Teilen Neuguineas und den benachbarten Inseln in den nachfolgenden Jahrzehnten Dutzende von Besuchen abstattete, die zwischen einem und fünf Monaten dauerten, und als ich dabei einzelne Neuguineer kennenlernte, machte der beherrschende Eindruck des Exotischen dem Gefühl von Gemeinsamkeiten Platz: Wir führen lange Gespräche, lachen über die gleichen Witze, haben gemeinsames Interesse an Kindern, Sex, Essen und Sport, und sind gemeinsam wütend, ängstlich, traurig, erleichtert oder überschwänglich. Selbst ihre Sprachen sind Variationen alt vertrauter, weltweit verbreiteter linguistischer Themen: Die erste neuguineische Sprache, die ich lernte (das Fore), ist zwar mit den indoeuropäischen Sprachen nicht verwandt und hat deshalb einen Wortschatz, der mir völlig unbekannt war, aber im Fore werden Verben ebenso raffiniert konjugiert wie im Deutschen, und es hat doppelte Pronomen wie das Slowenische, Postpositionen wie das Finnische und drei Adverbien des Ortes (»hier«, »dort in der Nähe« und »dort weit weg«) wie das Lateinische.
Alle diese Ähnlichkeiten verleiteten mich nach dem ersten Eindruck der Exotik Neuguineas zu dem irrtümlichen Gedanken, Menschen seien »im Grundsatz überall gleich«. Am Ende wurde mir aber klar, dass wir in einigen grundlegenden Aspekten nicht alle gleich sind: Viele meiner neuguineischen Bekannten zählen anders (nämlich nicht mit abstrakten Zahlen, sondern durch visuelle Kartierung), wählen ihre Ehepartner anders aus, behandeln Eltern und Kinder anders und haben sowohl eine andere Einstellung zu Gefahren als auch einen anderen Begriff von Freundschaft. Diese verwirrende Mischung von Ähnlichkeiten und Unterschieden ist einer der Gründe, warum traditionelle Gesellschaften für Außenstehende so faszinierend sind.
Darüber hinaus gibt es aber noch einen anderen Grund, warum traditionelle Gesellschaften interessant und wichtig sind: In ihnen finden wir noch Hinweise darauf, wie alle unsere Vorfahren über Zehntausende von Jahren hinweg und praktisch bis gestern gelebt haben. Die traditionelle Lebensweise hat uns geprägt und dafür gesorgt, dass wir heute so und nicht anders sind. Der Übergang vom Jagen und Sammeln zur Landwirtschaft begann erst vor ungefähr 11000 Jahren; die ersten Metallwerkzeuge wurden vor 7000 Jahren hergestellt; und die ersten Staatsregierungen sowie die erste Schrift entstanden vor nicht mehr als 5400 Jahren. »Moderne« Verhältnisse herrschten nur während eines winzigen Bruchteils der Menschheitsgeschichte, und auch das nur lokal; alle menschlichen Gesellschaften waren weitaus länger traditionell, als unsere heutige Gesellschaft modern ist. Für die Leser dieses Buches ist es selbstverständlich, im Laden landwirtschaftlich erzeugte Lebensmittel zu kaufen, statt jeden Tag in freier Wildbahn zu jagen und zu sammeln; wir verwenden Metallwerkzeuge statt solchen aus Stein, Holz und Knochen, haben Staatsregierungen einschließlich der damit verbundenen Justiz, Polizei und Armee, und wir können lesen und schreiben. Aber alle diese scheinbaren Notwendigkeiten sind relativ neu, und Milliarden Menschen auf der ganzen Welt leben auch heute noch teilweise auf traditionelle Weise.
Selbst in die moderne Industriegesellschaft sind Bereiche eingebettet, in denen nach wie vor traditionelle Mechanismen am Werk sind. In vielen ländlichen Gebieten der Ersten Welt, beispielsweise in dem Tal in Montana, wo ich jedes Jahr mit meiner Frau und meinen Kindern die Sommerferien verbringe, zieht man bei Meinungsverschiedenheiten auch heute noch vielfach nicht vor Gericht, sondern man legt sie mit traditionellen, informellen Mechanismen bei. Jugendbanden in großen Städten rufen nicht die Polizei, wenn sie Konflikte austragen wollen, sondern sie bedienen sich der traditionellen Methoden der Verhandlung, Gegenleistung, Einschüchterung und Kriegsführung. Einige meiner Bekannten aus Europa, die in den 1950er Jahren in kleinen europäischen Dörfern aufwuchsen, beschreiben eine ganz ähnliche Kindheit wie in einem traditionellen Dorf in Neuguinea: Jeder kannte im Dorf jeden, jeder wusste, was jeder andere tat, und äußerte seine Meinung darüber, die Menschen heirateten Partner, die nur wenige Kilometer entfernt geboren waren, und sie verbrachten mit Ausnahme der jungen Männer, die während der Weltkriegsjahre abwesend waren, ihr ganzes Leben im Dorf oder in seiner Nähe; Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Dorfes mussten so beigelegt werden, dass Beziehungen wieder hergestellt oder erträglich gemacht wurden, denn man musste für sein ganzes weiteres Leben in der Nähe der betreffenden Person wohnen. Mit anderen Worten: Die Welt von gestern wurde nicht ausgelöscht und durch die neue, moderne Welt ersetzt, sondern vieles von gestern ist uns bis heute erhalten geblieben. Das ist ein weiterer Grund, warum wir die Welt von gestern verstehen wollen.
Wie wir in den Kapiteln des vorliegenden Buches noch genauer erfahren werden, sind traditionelle Gesellschaften in vielen ihrer kulturellen Gebräuche weitaus vielgestaltiger als moderne Industriegesellschaften. Im Spektrum dieser Vielfalt haben sich zahlreiche kulturelle Normen für moderne Staatsgesellschaften weit von den traditionellen Normen entfernt und liegen an den äußersten Enden der hergebrachten Bandbreite. So behandeln beispielsweise manche traditionellen Gesellschaften ältere Menschen im Vergleich zu jeder modernen Industriegesellschaft viel grausamer, während andere ihren Alten ein weitaus befriedigenderes Leben ermöglichen; die modernen Industriegesellschaften stehen aber dem ersten Extrem näher als dem zweiten. Dennoch stützen Psychologen sich mit ihren allgemeinen Aussagen über das Wesen des Menschen meist auf Untersuchungen in unserem eigenen schmalen, atypischen Teil der menschlichen Vielfalt. Unter den Versuchspersonen, die in einer Stichprobe von Fachartikeln aus den führenden psychologischen Fachzeitschriften im Jahr 2008 untersucht wurden, stammten 96 Prozent aus westlichen Industriestaaten (Nordamerika, Europa, Australien, Neuseeland und Israel); insbesondere kamen 68 Prozent aus den Vereinigten Staaten, und bis zu 80 Prozent waren College-Studienanfänger, die sich für psychologische Studiengänge eingeschrieben hatten, das heißt, sie waren nicht einmal für die Gesellschaft ihrer eigenen Staaten typisch. Die Sozialwissenschaftler Joseph Henrich, Steven Heine und Ara Norenzayan drücken es so aus: Unsere Kenntnisse über die Psychologie des Menschen wurden zum größten Teil an Versuchspersonen gewonnen, die man mit der Abkürzung WEIRD (white, educated, industrialized, rich, democratic), was im Englischen »sonderbar« bedeutet, beschreiben kann: Menschen aus westlichen, gebildeten, industrialisierten, reichen, demokratischen Gesellschaften. Die meisten Versuchspersonen sind anscheinend auch nach den Maßstäben der weltweiten kulturellen Bandbreite buchstäblich sonderbar – in vielen Untersuchungen an kulturellen Phänomenen, in denen die weltweite Vielfalt umfassender eingefangen wurde, erweisen sie sich als Exoten. Zu diesen untersuchten Phänomenen gehören visuelle Wahrnehmung, Fairness, Kooperation, Bestrafung, biologisches Denken, räumliche Orientierung, analytisches und ganzheitliches Denken, moralische Überlegungen, Motivation zur Anpassung, Entscheidungsfindung und der Begriff des Ich. Wenn wir also allgemeine Aussagen über das Wesen des Menschen machen wollen, müssen wir unsere untersuchte Stichprobe von den üblichen WEIRD-Versuchspersonen (vorwiegend amerikanische Studienanfänger in Psychologie) auf das gesamte Spektrum der traditionellen Gesellschaften erweitern.
Sozialwissenschaftler können also aus Studien an traditionellen Gesellschaften mit Sicherheit Schlussfolgerungen von akademischem Interesse ziehen, wir anderen sollten aber auch praktische Dinge lernen können. Traditionelle Gesellschaften stellen eigentlich Tausende von natürlichen Experimenten zum Aufbau einer Gesellschaft dar. Sie haben Tausende von Lösungen für die Probleme der Menschen gefunden, und diese Lösungen sind anders als jene, die unsere modernen WEIRD-Gesellschaften sich zu eigen gemacht haben. Wie wir noch genauer erfahren werden, scheinen manche dieser Lösungen – beispielsweise manche Methoden, nach denen traditionelle Gesellschaften ihre Kinder großziehen, ältere Menschen behandeln, gesund bleiben, sich unterhalten, ihre Freizeit verbringen und Konflikte beilegen – mir und sicher auch vielen Lesern im Vergleich zu den normalen Vorgehensweisen in der Ersten Welt überlegen zu sein. Vielleicht können wir davon profitieren, wenn wir gezielt einige dieser traditionellen Verfahren übernehmen. Manche von uns tun das bereits, und dies ist nachgewiesenermaßen nützlich für Gesundheit und Glück. In mancherlei Hinsicht sind wir modernen Menschen eigentlich Sonderlinge; unser Körper und unsere Handlungsweisen haben es heute mit Bedingungen zu tun, die ganz anders sind als jene, unter denen ihre Evolution stattgefunden hat und an die sie sich angepasst haben.
Wir sollten aber auch nicht in das andere Extrem verfallen, die Vergangenheit romantisch zu verklären und uns nach einfacheren Zeiten zu sehnen. Viele traditionelle Praktiken sind so, dass wir uns glücklich schätzen können, sie aufgegeben zu haben – dazu gehören Säuglingsmord, die Aussetzung oder Tötung älterer Menschen, immer wiederkehrende Hungersgefahr, ein erhöhtes Risiko für Umweltgefahren und Infektionskrankheiten, aber auch die Aussicht, die eigenen Kinder sterben zu sehen und in ständiger Angst vor Angriffen zu leben. Traditionelle Gesellschaften legen nicht nur einige bessere Aspekte der Lebensweise nahe, sondern sie können uns auch helfen, manche Vorteile unserer eigenen Gesellschaft schätzen zu lernen, die wir für selbstverständlich halten.
Fußnoten
[1]
Mit den in diesem Buch verwendeten Begriffen »traditionelle« Gesellschaften oder »Kleingesellschaften« meine ich Gesellschaften aus Vergangenheit und Gegenwart mit geringer Bevölkerungsdichte und kleinen Gruppen, die aus einigen Dutzend bis wenigen tausend Menschen bestehen. Sie leben vom Jagen und Sammeln oder von Ackerbau oder Viehzucht und haben sich nur in begrenztem Umfang durch den Kontakt mit großen, vom Westen beeinflussten Industriegesellschaften gewandelt. In Wirklichkeit haben sich alle vorwiegend traditionellen Gesellschaften, die es heute noch gibt, zumindest teilweise durch den Kontakt verändert, und man könnte sie statt als »traditionelle Gesellschaften« auch als »Übergangsgesellschaften« bezeichnen. Ich stelle die traditionellen Kleingesellschaften den »verwestlichten« Gesellschaften gegenüber – damit meine ich die großen modernen Industriegesellschaften, die von Staatsregierungen geleitet werden und den Lesern dieses Buches als beherrschendes gesellschaftliches Umfeld bekannt sind. Als »verwestlicht« bezeichne ich sie, weil wichtige Merkmale dieser Gesellschaften (so die industrielle Revolution und das öffentliche Gesundheitswesen) erstmals im 18. und 19. Jahrhundert in Westeuropa entstanden und sich von dort auf viele andere Länder der übrigen Kontinente verbreitet haben.
Staaten
Traditionelle Gesellschaften sind in ihrer Organisation vielgestaltiger als Gesellschaften mit Staatsregierungen. Um jene Merkmale traditioneller Gesellschaften zu verstehen, die uns weniger vertraut sind, wollen wir uns zunächst einmal an die allgemein bekannten Eigenschaften der Nationalstaaten erinnern, in denen wir heute leben.
Die meisten modernen Staaten haben eine Bevölkerung von Hunderten von Tausenden oder Millionen von Menschen; das Spektrum reicht bis zu jeweils über eine Milliarde Menschen in Indien und China, den beiden bevölkerungsreichsten Staaten unserer Zeit. Selbst die kleinsten modernen Einzelstaaten, die Inselstaaten Nauru und Tuvalu im Pazifik, haben jeweils über 10000 Einwohner. (Der Vatikan mit seiner Bevölkerung von nur 1000 Menschen gilt ebenfalls als Staat, stellt aber eine Ausnahme dar: Er ist eine winzige Enklave in der Großstadt Rom, aus der er alles Notwendige bezieht.) Auch früher hatten Staaten eine Bevölkerung im Bereich von einigen zehntausend bis einigen Millionen Menschen. Schon aus dieser großen Bevölkerungszahl können wir ablesen, wie Staaten sich ernähren müssen, welche Organisationsformen sie brauchen und warum sie überhaupt existieren. Alle Staaten ernähren ihre Bürger nicht durch Jagen und Sammeln, sondern durch Lebensmittelproduktion (Landwirtschaft und Viehzucht). Wenn man auf Garten-, Acker- oder Weideland von einigen hundert Quadratmetern Nutzpflanzen anbaut oder Vieh hält und sie auf diese Weise mit den Pflanzen- und Tierarten besetzt, die für uns am nützlichsten sind, kann man weitaus mehr Lebensmittel ernten als wenn man wilde Tiere jagt oder die Pflanzenarten (die meisten davon ungenießbar) sammelt, die zufällig auf einigen hundert Quadratmetern Waldland gedeihen. Allein aus diesem Grund konnte keine Gesellschaft von Jägern und Sammlern jemals eine so dichte Bevölkerung ernähren, dass daraus eine Staatsregierung hervorgehen konnte. In jedem Staat erzeugt nur ein gewisser Anteil der Bevölkerung – in modernen Gesellschaften mit stark mechanisierter Landwirtschaft oftmals nur zwei Prozent – die Nahrung. Die übrigen Bewohner sind mit anderen Dingen beschäftigt, beispielsweise mit Verwaltung, Produktion oder Handel; sie erzeugen ihre Lebensmittel nicht selbst, sondern leben von den Überschüssen, die von den Bauern produziert werden.
Wegen der großen Bevölkerung ist auch gewährleistet, dass die meisten Menschen innerhalb eines Staates sich gegenseitig nicht kennen: Selbst ein Bürger des winzigen Tuvalu kann nicht mit allen seinen 10000 Mitbürgern bekannt sein, und bei den 1,4 Milliarden chinesischen Bürgern wäre diese Herausforderung noch weniger zu bewältigen. Deshalb brauchen Staaten ihre Polizei, Gesetze und Moralvorschriften, die dafür sorgen, dass die ständigen, unvermeidlichen Begegnungen zwischen Fremden nicht immer wieder in Konflikte ausarten. Dieser Bedarf für Polizei, Gesetze und das moralische Gebot, freundlich zu Fremden zu sein, ergibt sich in winzigen Gesellschaften, in denen jeder jeden kennt, nicht.
Und schließlich ist es in einer Gesellschaft von mehr als 10000 Menschen nicht möglich, Entscheidungen zu fällen, auszuführen und durchzusetzen, indem alle Bürger sich zu einer persönlichen Diskussion zusammensetzen und ihre Meinung sagen. Eine große Bevölkerung funktioniert nicht ohne Führungspersonen, die Entscheidungen treffen, und ebenso braucht sie ausführende Organe, welche die Entscheidungen umsetzen, und Bürokraten, die Entscheidungen und Gesetze verwalten. Pech für alle Leser, die Anarchisten sind und von einem Leben ohne Staatsregierung träumen: Das sind die Gründe, warum ihr Traum unrealistisch ist. Sie müssten einen winzigen Clan oder Stamm finden, der sie aufnimmt, denn nur dort ist niemand ein Fremder, und Könige, Präsidenten oder Bürokraten werden nicht gebraucht.
Wie wir in Kürze genauer erfahren werden, war die Bevölkerung auch in manchen traditionellen Gesellschaften so groß, dass Allzweck-Bürokraten gebraucht wurden. Staaten sind aber noch bevölkerungsreicher und benötigen einen spezialisierten, vertikal und horizontal differenzierten Beamtenapparat. Wir Staatsbürger finden alle diese Bürokraten meist entsetzlich, aber noch einmal: Leider sind sie notwendig. Ein Staat hat so viele Gesetze und Bürger, dass Bürokraten eines einzigen Typs nicht alle Gesetze des Königs anwenden können: Es muss eine Trennung zwischen Finanzbeamten, Auto-Sicherheitsprüfern, Polizisten, Richtern, Inspektoren für die Sauberkeit in Restaurants und so weiter geben. Und auch innerhalb einer Behörde, in der nur eine solche Gruppe von Beamten tätig ist, sind wir daran gewöhnt, dass es viele Beamte gibt, zwischen denen eine hierarchische Ordnung mit mehreren Ebenen besteht: Im Finanzamt gibt es den Sachbearbeiter, der die eigentliche Steuererklärung bearbeitet; bei seinem Vorgesetzten können wir uns beschweren, wenn wir mit dem Steuerbescheid des Sachbearbeiters nicht einverstanden sind, und dieser Vorgesetzte ist seinerseits unter einem Amtsleiter tätig, der einem Kreis- oder Landesbeamten unterstellt ist, der dem Finanzminister des gesamten Staates unterstellt ist. (In Wirklichkeit ist die Sache noch komplizierter: Aus Gründen der Übersichtlichkeit habe ich mehrere weitere Hierarchieebenen weggelassen.) Eine imaginäre Bürokratie dieses Typs beschreibt Franz Kafka in seinem Roman Das Schloss; die Anregung dazu bezog er aus der tatsächlichen Bürokratie des Habsburgerreiches, dessen Bürger er war. Wenn ich Kafkas Bericht über die Frustrationen, die sein Protagonist im Umgang mit der imaginären Bürokratie des Schlosses erlebt, vor dem Zubettgehen lese, sind Albträume in der folgenden Nacht garantiert, aber auch jeder Leser hat sicher im Umgang mit der realen Bürokratie bereits seine eigenen Albträume und Frustrationen erlebt. Es ist der Preis, den wir für das Leben unter einer staatlichen Regierung bezahlen: Kein Utopist hat jemals herausgefunden, wie man einen Staat verwalten kann, ohne dass es zumindest einige Bürokraten gibt.
Und schließlich bleibt noch ein nur allzu vertrautes Merkmal der Staaten: Selbst in den skandinavischen Demokratien mit ihrer großen Gleichberechtigung sind die Bürger politisch, wirtschaftlich und sozial nicht gleich. In jedem Staat gibt es zwangsläufig einige Führungsgestalten, die Anordnungen erteilen und Gesetze machen, und viele gewöhnliche Bürger, die den Anordnungen gehorchen und die Gesetze befolgen. Staatsbürger haben unterschiedliche wirtschaftliche Positionen (als Bauern, Hausmeister, Anwälte, Politiker, Verkäufer usw.) inne, und manche dieser Positionen bringen höhere Gehälter ein als andere. Manche Bürger erfreuen sich eines höheren gesellschaftlichen Status als andere. Alle idealistischen Bemühungen, die Ungleichheit in den Staaten so gering wie möglich zu halten – zum Beispiel Karl Marx’ Formulierung des kommunistischen Ideals »jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen« –, sind gescheitert.
Staaten konnte es nicht geben, solange es keine Lebensmittelproduktion gab (die ungefähr 9000 v.Chr. begann), und auch danach konnten Staaten erst dann existieren, als die Lebensmittelproduktion über Jahrtausende hinweg funktionierte und die Entwicklung einer Bevölkerungsdichte ermöglichte, die eine Staatsregierung erforderte. Der erste Staat entstand um 3400 v.Chr. im Fruchtbaren Halbmond, andere entwickelten sich in den folgenden Jahrtausenden in China, Mexiko, den Anden, Madagaskar und anderen Regionen; heute zeigt die Weltkarte, dass sämtliche Landflächen unseres Planeten mit Ausnahme der Antarktis in Staaten aufgeteilt sind. Und selbst die Antarktis ist Gegenstand einander teilweise überschneidender Territorialansprüche von sieben Staaten.
Methoden und Quellen
Im vorherigen Abschnitt ging es um allgemeine Aussagen über Unterschiede zwischen traditionellen Gesellschaften, das heißt über Unterschiede, die systematisch mit unterschiedlicher Bevölkerungszahl und Bevölkerungsdichte, den Mitteln der Nahrungsbeschaffung und der Umwelt zu tun haben. Die allgemeinen Trends, von denen dort die Rede war, gibt es zwar, aber die Vorstellung, man könne alles in einer Gesellschaft aufgrund dieser materiellen Bedingungen voraussagen, wäre absurd. Man denke beispielsweise nur an die kulturellen und politischen Unterschiede zwischen Franzosen und Deutschen, die in keinem offenkundigen Zusammenhang mit dem Unterschied zwischen der Umwelt in Frankreich und Deutschland stehen – diese Unterschiede sind nach den Maßstäben der weltweiten Variationsbreite bestenfalls gering.
In der Wissenschaft verfolgt man mehrere Ansätze, um die Unterschiede zwischen Gesellschaften zu verstehen. Jeder davon ist nützlich, um Aufschlüsse über einige Unterschiede zwischen manchen Gesellschaften zu gewinnen, eignet sich aber zum Verständnis anderer Phänomene nicht. Einen auf die Evolution gestützten Ansatz habe ich im vorherigen Abschnitt bereits erörtert: Man sucht nach allgemeinen Merkmalen, in denen sich Gesellschaften unterschiedlicher Bevölkerungszahl und -dichte unterscheiden, während sie bei Gesellschaften mit vergleichbarer Bevölkerungszahl und -dichte ähnlich sind; außerdem zieht man Rückschlüsse auf Veränderungen, die sich mit dem Wachsen oder Schrumpfen einer Bevölkerung einstellen, oder beobachtet sie manchmal auch unmittelbar. Im Zusammenhang mit der evolutionären Methode steht ein Ansatz, den man als anpassungsorientiert bezeichnen könnte: Danach dienen manche Merkmale einer Gesellschaft der Anpassung, und sie versetzen die Gesellschaft in die Lage, vor dem Hintergrund ihrer materiellen Bedingungen, ihrer physikalischen und sozialen Umstände sowie ihrer Größe und Dichte effizient zu funktionieren. Beispiele sind die Tatsache, dass alle Gesellschaften von mehr als einigen tausend Menschen Führungsgestalten brauchen, und das Potential solcher großen Gesellschaften, die notwendigen Lebensmittelüberschüsse für die Ernährung solcher Anführer zu produzieren. Dieser Ansatz führt dazu, dass man allgemeine Aussagen formuliert und den Wandel einer Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt der Umstände und Umweltbedingungen interpretiert, in denen sie lebt.
Den Gegenpol zu diesem ersten Ansatz bildet der zweite: Danach betrachtet man jede Gesellschaft aufgrund ihrer besonderen Geschichte als einzigartig und interpretiert kulturelle Merkmale als unabhängige Variablen, die nicht von materiellen Voraussetzungen abhängen. Unter der praktisch unendlichen Zahl von Beispielen möchte ich einen Extremfall aus einem der in diesem Buch beschriebenen Völker erwähnen, weil er besonders dramatisch ist und definitiv nichts mit materiellen Bedingungen zu tun hat. Die Kaulong, eine von mehreren Dutzend kleinen Bevölkerungsgruppen südlich der Wasserscheide auf der Insel Neubritannien östlich von Neuguinea, praktizierten früher das rituelle Erdrosseln von Witwen. Wenn ein Mann starb, suchte die Witwe ihre Brüder auf, damit diese sie erwürgten. Sie wurde nicht wie bei einem Mord gegen ihren Willen erdrosselt, und andere Mitglieder der Gesellschaft übten auch keinen Druck auf sie auf, diese ritualisierte Form des Selbstmordes zu begehen. Sie war vielmehr mit der Sitte aufgewachsen und befolgte sie auch selbst, wenn sie Witwe wurde; dabei drängte sie ihre Brüder (oder, wenn sie keine Brüder hatte, ihren Sohn) energisch, die erhabene Verpflichtung zu erfüllen und sie trotz ihres natürlichen Widerwillens zu erdrosseln; wenn es dann geschah, fügte sie sich völlig.
Kein Wissenschaftler hat jemals behauptet, die Witwentötung bei den Kaulong habe für die Gesellschaft dieses Volkes einen Nutzen oder diene den langfristigen (posthumen) genetischen Interessen der erdrosselten Witwe oder ihrer Verwandten. Kein Umweltforscher konnte irgendein Merkmal in der Umwelt der Kaulong benennen, das die Sitte nützlicher oder verständlicher machen würde als nördlich der Wasserscheide von Neubritannien oder weiter östlich oder westlich im Süden der Insel. Ich kenne mit Ausnahme des verwandten Volkes der Sengseng, die Nachbarn der Kaulong sind, weder in Neubritannien noch in Neuguinea irgendeine andere Gesellschaft, die das rituelle Erdrosseln von Witwen praktiziert. Offenbar muss man die Sitte also als unabhängiges kulturelles Merkmal betrachten, das sich aus unbekannten Gründen gerade in dieser Region Neubritanniens entwickelt hat und irgendwann vielleicht durch die natürliche Selektion unter den Gesellschaften (das heißt dadurch, dass andere Gesellschaften in Neubritannien, die das Erdrosseln von Witwen nicht praktizieren, deshalb einen Vorteil gegenüber den Kaulong haben) ausgemerzt worden wäre, sich aber über einen beträchtlichen Zeitraum hinweg erhalten hatte, bis es durch äußeren Druck und Kontakt mit Fremden ungefähr 1957 abgeschafft wurde. Jedem, der mit irgendeiner anderen Gesellschaft vertraut ist, werden auch weniger extreme charakteristische Merkmale einfallen, die keinen erkennbaren Nutzen für die jeweilige Gesellschaft haben oder sogar schädlich zu sein scheinen und eindeutig keine Folge der örtlichen materiellen Bedingungen sind.
Ein weiterer Ansatz zum Verständnis der Unterschiede zwischen Gesellschaften schließlich besteht darin, dass man kulturelle Überzeugungen und Praktiken erkennt, die regional weit verbreitet sind und sich historisch in der fraglichen Region ausgebreitet haben, ohne dass ein eindeutiger Zusammenhang mit den lokalen materiellen Bedingungen besteht. Bekannte Beispiele sind die nahezu allgemein verbreiteten monotheistischen Religionen und die nichttonalen Sprachen in Europa, die in krassem Gegensatz zur Häufigkeit nichtmonotheistischer Religionen und tonaler Sprachen in China und den angrenzenden Teilen Südostasiens stehen. Über die Ursprünge und die historische Ausbreitung der jeweiligen Formen von Religion und Sprache in den einzelnen Regionen wissen wir eine Menge. Mir wäre aber nicht bekannt, dass es überzeugende Gründe dafür gäbe, warum tonale Sprachen in einer europäischen Umwelt ihren Zweck weniger gut erfüllen sollten oder warum monotheistische Religionen sich von ihrem Wesen her vielleicht nicht für die Umwelt in China und Südostasien eignen. Religionen, Sprachen und andere Überzeugungen und Praktiken können sich auf zweierlei Weise ausbreiten. Zum einen können sich die Menschen verbreiten und ihre Kultur mitnehmen, wie es die europäischen Auswanderer in Amerika und Australien taten, wo sie europäische Sprachen und Gesellschaften nach europäischem Vorbild installierten. Die zweite besteht darin, dass Menschen die Überzeugungen und Praktiken anderer Kulturen übernehmen: Die modernen Japaner übernahmen beispielsweise den westlichen Kleidungsstil, und moderne Amerikaner essen heute Sushi, ohne dass westliche Emigranten Japan oder japanische Emigranten die Vereinigten Staaten überrollt hätten.
Ein anderer Aspekt, der in meinen Erläuterungen in diesem Buch immer wieder auftauchen wird, ist die Unterscheidung zwischen unmittelbaren und letzten Erklärungen. Um diesen Unterschied zu verstehen, können wir uns vorstellen, wie ein Paar nach zwanzigjähriger Ehe zum Psychotherapeuten kommt, weil es sich scheiden lassen will. Auf die Frage des Therapeuten »Was führt Sie nach zwanzig Jahren plötzlich zu mir, und warum streben Sie die Scheidung an?« erwidert der Mann: »Sie hat mich mit einer schweren Glasflasche ins Gesicht geschlagen. Mit so einer Frau kann ich nicht leben.« Die Frau räumt ein, sie habe ihn tatsächlich mit der Flasche geschlagen, und das sei der »Grund« (das heißt die unmittelbare Ursache) für das Zerwürfnis. Der Therapeut weiß aber, dass Schläge mit Flaschen in einer glücklichen Ehe nur selten vorkommen, und erkundigt sich nach den eigentlichen Gründen. Die Frau sagt: »Ich konnte seine vielen Affären mit anderen Frauen nicht mehr ertragen, deshalb habe ich ihn geschlagen. Eigentlich sind die Affären der Grund, warum wir uns getrennt haben.« Darauf räumt der Mann die Affären ein, aber nun fragt sich der Therapeut, warum dieser Mann im Gegensatz zu den meisten glücklich verheirateten Männern Affären hat. Darauf antwortet der Mann: »Meine Frau ist ein kalter, egoistischer Mensch, und ich wollte eine Liebesbeziehung zu einem normalen Menschen; die habe ich in den Affären gesucht, und das ist die tiefere Ursache für unsere Trennung.«