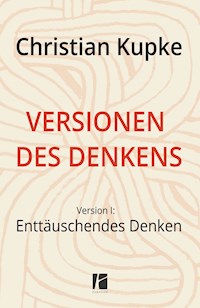
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: heptagon
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Versionen des Denkens stellt ein dreiteiliges Buchprojekt des Berliner Philosophen Christian Kupke dar, das Versionen des Denkens einerseits im Sinne unterschiedlicher Arten des Denkens und andererseits im Sinne von Wendungen des (eigenen) Denkens in den Blick nimmt. Der erste Band kreist um das Thema Enttäuschung („Enttäuschendes Denken“), die beiden Folgebände werden sich den Themen Widerstand („Widerständiges Denken“) und Hoffnung („Utopisches Denken“) widmen. Im ersten Band werden die Enttäuschungen des Denkens im Denken selbst vorgestellt: z.B. als Enttäuschung darüber, dass es nicht Gegebenes gibt: verlorene Freunde, vergangene Zeiten oder verpasste Gelegenheiten; dass es keinen Sinn in der Geschichte gibt, aber dass das Ende der Geschichte auch kein Ende findet; dass das letzte Wort im Denken nicht das Denken selber hat, sondern das Sein, nicht die Kultur, sondern die Natur, nicht die Dauer, sondern das Vergehen, nicht die lebendige Welt, sondern die Dingwelt, nicht das Leben, sondern der Tod. Anders als in der akademischen Philosophie üblich geht es also nicht um eine Meta-Analyse enttäuschenden Denkens, sondern um text- und sprachpraktische Formen solchen Denkens selbst, und zwar in unterschiedlichen Textarten und Sprachstilen, die oft überraschende Wendungen nehmen. Da stehen persönliche biographische Skizzen neben kulturtheoretischen Reflexionen, der Bericht von einer Reise neben existenzphilosophischen Betrachtungen, Aphorismen neben essayistischen Versuchen und literarische Entwürfe neben dialektischen Analysen. So verknüpfen sich verschiedene Ebenen der Enttäuschung – etwa die alltäglich-psychologische, die kognitive, die existenzielle und metaphysische – zu einem Netz von Bezügen, dessen Zentrum Kupkes überraschend einfache, aber grundlegende These bildet: „Philosophen, die nicht auch von sich selbst sprechen, sind keine.“ In der Vielsprachigkeit seiner Enttäuschungen reflektiert sich die Vielsprachigkeit des Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Enttäuschendes Denken
Christian Kupke
Versionen des Denkens
Version I: Enttäuschendes Denken
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.ddb.de abrufbar. © Parodos Verlag, Berlin 2021Alle Rechte vorbehalten Umschlag: Twosuns Studios – Berlin Umschlagmotiv: Paul Klee, Gespenster-Schwur (Ausschnitt), © Bilddatei: akg-images (Berlin) ISBN 978-3-938880-99-9 Lektorat: Thorsten Tynior https://parodos.de
Als E-Book veröffentlicht im heptagon Verlag, Berlin 2021 ISBN 978-3-96024-030-2 https://heptagon.de
»Ich müsste mich sehr täuschen – aber ich glaube,
ich habe ein nutzloses Buch geschrieben.«
(Verschreibung eines Satzes von Joaquim Maria Machado de Assis,
Die nachträglichen Memoiren des Bras Cubas, Kapitel CXXXVI)
μέγα βιβλίον μέγα κακόν (Kallimachos, Fragmente)
Vorwort
Das Buch, das der Leser in seinen Händen hält, ist der erste Band eines auf drei Bände angelegten Buchprojekts, an dem ich in den letzten acht Jahren, mal mit mehr, mal mit weniger Intensität, gearbeitet habe. Meine mich immer wieder fordernde, oft aufreibende Tätigkeit als Dozent an einer Berliner Berufsfachschule zwang mich gelegentlich, die Arbeit zu unterbrechen; aber sie zwang mich auch – aus einem z. T. als belastend empfundenen Ungleichgewicht zwischen Rede und Schrift, Theorie und Praxis –, nicht von ihr zu lassen. Die Form des Buches, eine Menagerie unterschiedlicher Texte statt einer linearen Textur, ist auch diesem Umstand geschuldet.
In den Jahren vor meiner Tätigkeit als Berufsschuldozent, in der ich als jemand unterwegs war, den man heute als »Freelancer« bezeichnen würde, hatte ich immer wieder lange Phasen verpflichtungsfreier Zeiten, in denen ich an einer Vielzahl von Vorträgen und Aufsätzen arbeitete, auf die ich im vorliegenden Band gelegentlich verweise. Der Charakter dieser Texte war jedoch ein völlig anderer als der der in diesem Buch präsentierten. Meine früheren Texte waren, trotz einer auch schon in ihnen gelegentlich geäußerten Kritik an der akademischen Philosophie, noch getragen vom Glauben an den Sinn von Philosophie als einer Textwissenschaft.
Diesen Glauben an Philosophie als Meta-Text, an das, was gelegentlich als »hermeneutisches Gespräch« bezeichnet wird, habe ich unterdessen verloren. Einige Gründe für diesen Verlust finden sich, auch wenn deren Artikulation nicht im Zentrum meiner letzten Schreibbemühungen steht, in diesem Buch wieder (z. B. in Kap. 1, 11 und 18 sowie 19). Was in einem solchen angeblichen »Gespräch« den Beteiligten, Autoren wie Lesern, geboten wird, ist nicht Philosophie, sondern Philologie: die philologische Zweit-, Dritt- oder auch Viertverwertung philosophischer Texte zugunsten einer endlosen historischen Reflexion, deren Ziel und Zweck mir mittlerweile nicht mehr erklärlich ist.
*
Was also kann der Leser von einem Buch erwarten, das sich diesem »hermeneutischen Gespräch« entzieht? Er kann erwarten, dass ihm eine Alternative geboten wird. Ob mein Buch eine solche Alternative ist, kann nur er selbst entscheiden; aber um mich einer solchen zu nähern, habe ich mich bemüht, so konkret, aktuell und lebensnah wie möglich zu argumentieren, ohne den in der populären Philosophie mittlerweile üblichen pädagogisch-didaktischen Ton anzuschlagen. Es mag, angesichts meiner langjährigen Tätigkeit als Dozent paradox erscheinen; aber in der Philosophie haben Pädagogik und Didaktik keinen angebbaren Ort. In ihr fungiert die Sprache nicht als Vermittlungs- oder Übersetzungsmedium, sondern als Medium des Denkens selbst, als Schrift.
Die Schrift aber ist keineswegs auf die Beschäftigung mit Texten beschränkt, und insbesondere nicht die philosophische. Deren Themen sind nicht oder doch nicht nur Texte, sondern auch und vor allem Erfahrungen. Das philosophische Denken hat, trotz seiner zweifellos in Texten überlieferten Geschichte, die die Philosophiewissenschaft zum Gegenstand hat, den gesamten Erfahrungsreichtum des Lebens zum Thema, in dem Enttäuschung, Widerstand und Hoffnung drei – ich möchte fast sagen anthropologische – Zentren der Erfahrung dieses Denkens sind. Und entsprechend vielfältig sind die Textformen, in denen sich diese Erfahrung artikuliert.
Der Leser wird daher in diesem Buch ein Patchwork unterschiedlicher Textarten und Sprachstile vorfinden: Textinterpretationen stehen in ihm neben biographischen Reminiszenzen, essayistische Versuche neben Reiseberichten, dialektische Analysen neben Aphorismen usw. Und je nachdem, welche Enttäuschungen, welche Erfahrungen den Leser gerade interessieren, kann er sich verschiedene Schneisen durch den Text schlagen, verschiedene Lesemodelle präferieren: Er kann den kulturtheoretischen Aspekten meiner Darstellung folgen (Kap. 2, 3, 6 und 22), den existenzphilosophischen (Kap. 5, 7, 13, 21), den philosophietheoretischen (Kap. 4, 8, 16, 18, 20) oder denjenigen, begriffsphilosophischen Aspekten, die noch am ehesten Anschluss finden dürften an den gegenwärtigen akademischen Diskurs (Kap. 12, 14, 15 und 23).
*
Womit der Leser daher rechnen muss – aber auch rechnen kann –, ist ein gewisser experimenteller Grundzug, sowohl in der Verkettung der Texte als auch in ihrem Aufbau. Viele Kapitel sind, obwohl sie später oft mehrfach überarbeitet wurden, spontan entstanden und zeigen noch die Spuren der Veränderung ihrer Thematik und Gedankenrichtung im Zuge ihrer Verfertigung (z. B. Kap. 14 u. 18). Andere sind über mehrere Monate entstanden und weisen eine gewisse Manieriertheit auf (z. B. Teile von Kap. 1 sowie Kap. 15 u. 23). Wieder andere, unter Einschluss meiner Abbreviaturen (Kap. 9, 17 u. 25), sind eher verspielt oder esoterisch und nähern sich literarischen Versuchen (z. B. Kap. 10 u. 24).
Aber ich hoffe, die Dringlichkeit meines Anliegens: die Rehabilitation der (ontologischen) Enttäuschung als einer Erfahrung philosophischen Denkens rechtfertigt ein derartiges Experiment. Wenn es richtig ist, was ich annehme: dass Philosophie, ebenso wie Kunst und Religion, der menschlichen Idee, genauer: der Idee des Menschlichen, zum Ausdruck zu verhelfen sucht, oder anders gesagt: dass wir Menschen nicht nicht philosophieren können, dann stellen Teile der zeitgenössischen akademischen Philosophie eine fundamentale Verirrung des Diskurses dar.
Aufgabe eines professionellen philosophischen Diskurses wäre es nämlich, dem gegenwärtigen Hang und Zwang zur universitären Arbeitsteilung und zur elitären, expertokratischen Unverständlichkeit entgegenzuwirken, statt solche Tendenzen noch zu verstärken. Zwar sollte sich nicht jeder Mensch, der ein wenig philosophiert, sogleich zum Philosophen deklarieren (vgl. hierzu Kap. 8). Aber aus der Notwendigkeit, nicht nicht philosophieren zu können, erwächst vielleicht auch eine Pflicht für jeden, der es versucht: den eigenen Diskurs nicht am ausgestreckten Arm einer sich auf Text-Fragen beschränkenden Wissenschaft langsam, aber sicher verhungern zu lassen.
Berlin, 1. Januar 2021
1. Enttäuschendes Denken
1.1. Enttäuschung, Widerstand, Hoffnung
Enttäuschung, Widerstand, Hoffnung – diese drei Begriffe bezeichnen die Denkzentren eines philosophischen Buchprojekts Versionen des Denkens, dessen ersten Band mit dem Titel Version I: Enttäuschendes Denken der Leser in seinen Händen hält. Jeder der drei Bände wird sich primär, explizit oder implizit auf einen dieser drei Begriffe beziehen bzw. sich in einem dieser drei Denkzentren bewegen: der erste Band in dem der Enttäuschung, der zweite in dem des Widerstandes, der dritte in dem der Hoffnung.
Der Bezug jeweils auf einen der drei Begriffe wird primär, nicht ausschließlich sein, denn in keinem dieser drei Zentren ist ein Denken des einen Begriffs möglich ohne ein Denken der jeweils anderen: Wie wären auf der einen Seite des Denkens – ich werde sie die passive nennen (sie ist Gegenstand des ersten Bandes) – Enttäuschungen ohne Widerstand und Hoffnung denkbar? Und wie wären auf der anderen Seite – ich werde sie die aktive nennen (sie ist Gegenstand des zweiten Bandes) – Widerstände ohne Enttäuschung und Hoffnung denkbar?
Mündet nicht jede Enttäuschung in einen Widerstand, der der Wahrheit der Hoffnung, die ihr zugrunde liegt, entspricht? Und ist nicht deshalb auch jeder Widerstand ohne eine ihn antreibende, aber auch wieder enttäuschbare Hoffnung undenkbar? Enttäuschung, Widerstand und Hoffnung bilden einen Kreis, der, ausgehend von der Enttäuschung, über den Widerstand zur Hoffnung (E-W-H), aber auch umgekehrt, ausgehend von der Hoffnung, über die Enttäuschung zum Widerstand führt (H-E-W).
So schließt sich auf der einen, der aktiven Seite des Denkens der Kreis zwischen Widerstand und Enttäuschung: Allen Widerständen, die sich – philosophisch – aus der Hoffnung nähren, liegt ein Moment von Enttäuschung zugrunde (E-W-H). Und es schließt sich auf der anderen, der passiven Seite des Denkens der Kreis zwischen Enttäuschung und Hoffnung: Allen Enttäuschungen geht – philosophisch – eine Hoffnung voraus, die in den Widerstand mündet (H-E-W).
In jedem der drei Begriffe »spiegeln sich« also – um mich einer bei Philosophen beliebten optischen Metapher zu bedienen – die beiden anderen »wider«. Jeder »reflektiert« sich in den jeweils anderen, ist ein »Reflex« der anderen. Sie bilden, wie es in der Dialektik heißt, eine Einheit, eine dialektische Einheit: Ist die Enttäuschung die These, so ist in ihr die Hoffnung, die Synthese, schon abstrakt vorweggenommen. Aber erfüllt werden kann die Hoffnung nur durch die Antithese zur Enttäuschung, in der, als Vermittlung der beiden, der Widerstand besteht.
Oder ist nicht vielmehr, umgekehrt, die Hoffnung die These, die Enttäuschung die Antithese und beider Synthese der Widerstand? Kann am Ende der Widerstand stehen? Das wirft die Frage auf: Was soll der Widerstand, wenn er denn am Ende steht, erreichen? Können wir uns mit der Hoffnung oder gar mit dem Widerstand als Synthese zufriedengeben? Wozu sind Widerstand und Hoffnung da? Der vorliegende Band, der primär der Enttäuschung gewidmet ist, kann darauf keine Antwort geben. Nur Eines sei an dieser Stelle gesagt:
Enttäuschung, Widerstand und Hoffnung werden hier als philosophische Denk-Versionen verstanden, die – das ist durchaus kritisch gemeint – im Bereich der Theorie verbleiben (in ihr »stecken bleiben«). Jeder Widerstand und alle Hoffnung muss am Ende in eine Handlung münden, die – realiter – das verändert, gegen das der Widerstand sich richtet. Das ist nicht mehr Sache der Philosophie, kann nicht mehr Sache nur von Theorie sein. Das ist Sache des Handelns, das heißt immer auch eine Sache der Praxis.
*
Aber der Ausdruck Wendung kann auch buchstäblich verstanden werden, so dass es sich bei jeder Wendung des jeweiligen – enttäuschenden, widerständigen und hoffenden– Denkens um eine (Bewegungs-)Umkehr, um ein Sich-Umwenden des jeweiligen Denkens handelt. So ist etwa das enttäuschende Denken in dem Sinne ein sich umwendendes Denken, dass es sich von der es tragenden Hoffnung, der es stützenden »Täuschung« ab- und den es zur Umwendung zwingenden, passivierenden Realitäten zuwendet.
Die Umwendung der Enttäuschung setzt sich also, analytisch gesehen, aus zwei Teilbewegungen zusammen, aus einer negativen und einer positiven Bewegung: aus der – negativen – Abwendung von, nämlich Zurückweisung der erhofften oder erwarteten Realität, die sich in der Enttäuschung als Täuschung erweist (die Enttäuschung ist Ent-Täuschung), und der – positiven – Zuwendung zu, nämlich Anerkennung derjenigen Realität, die der erhofften oder erwarteten nicht entspricht, ihr zuwiderläuft.
In ähnlicher Weise, als eine Form des Denkens, kann auch die aktive Bewegungsumkehr des Widerstandes verstanden werden. Sie besteht darin, sich im Namen jener erhofften Realität, von der sich die Enttäuschung abwendet, gegen diejenige Realität zu wenden, der sich die Enttäuschung – gezwungenermaßen, also als passive – zuwendet. Insofern findet zwischen Enttäuschung und Widerstand selbst eine Bewegungsumkehr statt, sind beide einander entgegengesetzte Formen der Umkehr:
Das widerständige Denken wendet sich von der Realität der Enttäuschung, die eine enttäuschende Realität ist, ab; es weist diese – negativ – zurück und wendet sich – positiv – einer neuen, im Widerstand selbst womöglich noch nicht thematischen Realität zu. Es nimmt die Erfahrung der Enttäuschung: dass das ursprünglich positiv Gedachte das eigentliche Negative ist, in sich auf und bringt sich, um willen eines noch nicht verwirklichten Positiven, als Negation dieses Negativen in Stellung. Was in der Enttäuschung das Positive ist, ist daher im Widerstand das Negative und umgekehrt.
Wie ist dann aber die Hoffnung zu verstehen? Ist sie, wie ich soeben behauptet habe, die Synthese aus Enttäuschung und Widerstand, so lässt sie sich ebenfalls als eine Bewegungsumkehr verstehen, aber, anders als Enttäuschung und Widerstand, als eine in sich gedoppelte, »synthetisierte«: Sie nimmt die Erfahrung der Enttäuschung insofern in sich auf, als sie sich, wie jede Enttäuschung, dem Negativen des Bestehenden zwar zuwendet, sich ihm stellt, aber nur, um in ihm nach Spuren des Neuen zu suchen.
Darin aber ist sie widerständig. Denn da das, was ist, noch nicht das ist, was sein soll, und das, was sein soll, noch nicht das ist, was ist, kann sie sich mit der Spurensuche, dem Suchen allein nicht begnügen. Sie kann sich nicht darauf verlassen, Ansätze im Realen dafür zu finden, was im Sinne dessen, was einmal sein soll, noch immer nicht ist; sie muss es auch entwerfen. Die Hoffnung ist daher mehr als die Summe aus Aktivität (Widerstand) und Passivität (Enttäuschung): sie ist Kreativität.
*
Enttäuschung, Widerstand und Hoffnung sind also nicht nur psychische Zustände, sondern unterschiedliche, wenn auch strukturell vergleichbare Denkbewegungen. Zwar lassen sie sich von den psychischen Zuständen, die sie stets auch bezeichnen: Frustration, Abwehr und positive Zukunftserwartung, kaum sinnvoll ablösen – keine Denkbewegung ist ohne psychische Regung möglich –, aber philosophisch verstanden gehen diese Zustände aus den soeben beschriebenen Wendungen erst hervor.
Daher sind Enttäuschung, Widerstand und Hoffnung keine bloßen Befindlichkeiten, die aus Widerfahrnissen des Lebens, subjektiven Entscheidungen und/oder charakterlichen Dispositionen eines Einzelnen resultieren. Sie stellen keine nur temporären, wieder vorübergehenden, manchmal auch persistierenden Lebensmomente dar. Sie meinen zwar das einzelne Leben, aber mehr als das. Sie zielen – in einem reflexiven Akt – vom Einzelnen aufs Ganze des Menschseins. Genau darin aber, in dieser Verklammerung von Einzelnem und Allgemeinem, liegt ihr philosophischer Anspruch.
Wenn ich etwa in einem der Kapitel dieses Buches, anlässlich meiner Auseinandersetzung mit einigen Texten des polnischen Philosophen Leszek Kolakowski, von der enttäuschenden Einsicht in die Sinnlosigkeit der Geschichte spreche1, so ist das eine Einsicht, die – wenn sie denn wirkliche, existenziell bezeugbare Einsicht ist – dauerhaft bestehen bleibt und die, anders als irgendeine vorübergehende Frustration im Leben eines einzelnen Menschen, im Vollzug der Existenz nicht mehr zurückgenommen werden kann2. Sie ist ein Allgemeines dieses Einzelnen.
Oder wenn ich mich im weiteren Verlauf meines Textes insbesondere mit der metaphysischen Enttäuschung auseinandersetze, derjenigen, die darin besteht, dass Sein, Tod und Natur dem Denken, dem Leben und der Kultur nicht nur nicht zuvorkommen, sondern sie noch stets überholen werden3, so ist das keine nurmehr subjektive, sondern bereits objektive Enttäuschung, eine Enttäuschung, die durch keinen Widerstand und keine Hoffnung jemals revidiert werden kann, sondern diesen auf Dauer zugrunde liegt.
Der Widerstand, der aus solcher Enttäuschung resultiert, bleibt daher existenziell ebenfalls auf das Ganze des Menschseins bezogen. Zwar arbeitet er sich, wie ich vor allem im zweiten Band des geplanten Buchprojektes kenntlich machen werde, stets an konkreten, subjektiven Enttäuschungen ab – denn das Leben ist, recht verstanden, stets konkret und niemals abstrakt –, aber er will dabei in letzter Rücksicht auf etwas hinaus, das sich auch der objektiven Enttäuschung widersetzt.
Insbesondere in den Blick kommen werden in diesem Zusammenhang theoretische Entwürfe, die das Drama des Menschseins zu trivialisieren, es in seine epistemologisch-anthropologischen Grenzen einzuschließen versuchen (»Was interessiert uns das Ende der Menschheit? Ändert das etwas an unseren philosophischen Einsichten hier und heute?«4) oder die gar, wie im Transhumanismus, danach trachten, es durch die biologische Unsterblichkeit von Menschen entdramatisieren zu können5.
Auf diese Weise wird daher der Widerstand, als Widerstand des Denkens, zum Widerstand gegen ein Denken, das, um es in einfachen Worten zu sagen, philosophisch »zu kurz greift«: gegen jede Form des philosophischen Feuilletonismus oder – enttäuschender noch – der Philosophiewissenschaft6. In diesem Sinne ist der Band, den der Leser in Händen hält, auch schon die Frucht eines bestimmten Widerstands: des Widerstands gegen den anti-philosophischen, anti-existenziellen Affekt einer sich wissenschaftlich gebärdenden Philosophie, wie wir sie heute an den Universitäten fast stets vorfinden.
*
Dennoch ist an diesem »zu kurz greifenden« Denken, an der Kritik an Metaphysik, an ihrem abstrakten Objektivismus, ein Wahrheitsmoment festzuhalten. Es gibt keine objektive Enttäuschung, keinen verallgemeinerten Widerstand, keine utopische Hoffnung ohne individuelle Betroffenheit, genauer: ohne existenzielle Verankerung. Was an sich das Spätere ist: die existenzielle Situierung als Folge der philosophischen Denkbewegung, ist für uns das Frühere. Und dieses Frühere, in Form von biographischen und selbstreflexiven Skizzen8, ist hier in diesem Buch deshalb ebenso zentrales Thema.
Das heißt, um es mit einem einfachen, aber grundlegenden philosophischen Satz des laufenden Buchprojektes zu formulieren: Philosophen, die nicht auch von sich selbst sprechen, sind keine.7 Ein Nachdenken über Probleme der Philosophie, das nicht zunächst dem individuellen Lebenskontext entstammt und an diesen Kontext stets wieder rückgebunden werden kann, »greift« – ebenfalls – »zu kurz«. Existenzielle, individuelle und objektive, metaphysische Enttäuschung bilden eben einen existenziellen, keinen objektiven, einen individuellen, keinen metaphysischen Zusammenhang.
Denn zunächst einmal muss Enttäuschung, nicht das objektive Faktum selbst, das sie meint, sondern die Enttäuschung über dieses Faktum, wahrgenommen, genauer: als wahr genommen werden. Darin liegt vielleicht der größte Unterschied, aber auch der enge Zusammenhang von Ontologie und Existenzphilosophie, der in diesem Buch hergestellt wird: Eine ontologische Einsicht kann trivial, aber auch gravial aufgefasst werden. Aber ob sie gravial aufgefasst und damit als wahr (oder unwahr) genommen wird, hängt vom jeweiligen – historisch und gesellschaftlich situierten – Individuum ab, das solche Einsicht hat.
Auch hier bestätigt sich also der Kreislauf von Enttäuschung, Widerstand und Hoffnung (E-W-H), genauer noch: von Hoffnung, Enttäuschung und Widerstand (H-E-W). Denn es ließen sich, gleichsam außerhalb dieses Kreises, Menschen, ja möglicherweise – in naher Zukunft – eine Menschheit denken, die für die Enttäuschungen, die ihr das philosophische Denken bereitet, nicht mehr empfänglich ist, der es gleichgültig geworden ist, bestimmte Fragen auch nur zu stellen, geschweige denn sie zu beantworten.
Was sind diese bestimmten Fragen des philosophischen, sich je in Enttäuschung, Widerstand und Hoffnung umwendenden Denkens? – Ich nenne, einigermaßen ungeordnet, erstens: Was ist ein gutes Leben?Was verstehen wir unter dem Guten? Zweitens: Was ist das Wahre? Drittens: Was ist das Schöne? Viertens: Worin besteht der Sinn des Lebens?Istein solcher überhaupt formulierbar? Fünftens: Ist alles vergänglich, auch die Zeit?Und wenn ja, was ist der Grund von Sein und Zeit: Ist es die Ewigkeit, das Göttliche, Gott? Und wenn nicht, ist dann nicht alles vergeblich? usw. usf.
In den Verbalismen der universitären Philosophie kommen diese und ähnliche Fragen und der fundamentale, ebenso historische wie existenzielle Sachverhalt, dass sie keine Antworten gefunden haben – und vielleicht auch niemals finden werden – heute immer seltener vor. Obwohl es jeder weiß und jeder es täglich erfahren kann, dass es diese Fragen sind, die das philosophische Denken überhaupt erst motivieren, stellt sich ihnen die universitäre Philosophie nicht, nicht mehr oder kaum noch. Sie hält sie, aus verschiedenen Gründen, die ich gleich noch darstellen werde, für unbeantwortbar.
Enttäuschenderweise ist ihr also die Enttäuschung, die genau darin liegt, keine reflexive Anstrengung mehr wert. Sie überlässt das Feld, erstaunlich genug, dem Unbewussten unserer Kultur: den Religionen, weil sie sich, als ein dem positiven Wissen der Wissenschaften verhafteter Diskurs, zur Negativität der menschlichen Existenz, die in der Unbeantwortbarkeit der genannten Fragen ihren Grund hat, wenn überhaupt, nur negativ verhalten kann. Diese abstrakte Negation der Negation aber muss misslingen. Religionen, vielleicht sogar fundamentalistische Religionen, besetzen ihr Feld.
1.2. Die Enttäuschungen der Philosophie
Es gibt mehrere Gründe, warum es nicht möglich ist, Antworten auf die soeben genannten Fragen zu finden, auf Fragen, die sich wohl jedem aufdrängen dürften, dem das eigene Sein nicht gänzlich gleichgültig geworden ist. Die universitäre Philosophie beschäftigt sich mit diesen Fragen, wie ich sagte, nicht, nicht mehr oder kaum noch, weil sie sie entweder für unsinnig erklärt, z. B. weil sie unbeantwortbar seien (das ist die sprachanalytische »Antwort« bzw. Enttäuschung in der Folge Wittgensteins). Oder sie erklärt sie nicht für unsinnig, aber für derart unspezifisch und allgemein, dass sie glaubt, einen gewaltigen, historischen und philologischen Umweg gehen zu müssen, um auch nur auf die Spur einer Möglichkeit zu stoßen, sie zu beantworten (das ist die hermeneutische »Antwort« bzw. Enttäuschung in der Folge Gadamers).
»Die Bedingungen«, heißt es dann sinngemäß, »unter denen wir heute Philosophie treiben, sind nicht mehr die, unter denen noch die alten Philosophen, z. B. Platon oder Aristoteles, ihre grundlegenden Fragen formuliert haben. Die Welt ist derart komplex geworden, dass schon die Fragen Was ist ein gutes Leben?Was verstehen wir unter dem Guten? oder Worin besteht der Sinn des Lebens? so nicht mehr gestellt werden können. Denn das, was mit diesen Fragen unterstellt wird: die Möglichkeit einer Antwort, die allgemeinverbindlich, d. h. für alle Menschen gültig ist, kann in einer von individueller Freiheit und Gleichheit, Toleranz und Demokratie gekennzeichneten Welt nicht mehr aufrechterhalten werden.«
So richtig diese Überlegungen zumindest für die Teile der Welt sind, in denen tatsächlich individuelle Freiheit, Gleichheit, Toleranz und Demokratie verwirklicht sind – es sind, das sollte man nicht vergessen, die wenigsten –, so spürt man doch ein doppeltes Unbehagen. Erstens: War und ist nicht die Philosophie diejenige Diskursform, die sich nicht darauf beschränken kann und darf, ihre Fragen nur in partikulären Kontexten bzw. nur für solche Kontexte zu formulieren, sondern die einen universalen Anspruch geltend macht? Und zweitens: Warum sollten in einer komplexen und, wie gelegentlich behauptet wird, sogar überkomplexen Welt die Antworten auf grundlegende Fragen ebenfalls komplex oder überkomplex ausfallen? Liegt darin nicht eine gewisse »Gefahr«, nämlich die, »den Fortschritt der Erkenntnis mit der wachsenden Komplexität der Geisteskonstruktionen zu verwechseln«?9
Müssen wir hier also zwingend von einer Entsprechung ausgehen? Müsste man nicht umgekehrt sagen: In einer komplexen Welt sollten die grundlegenden Fragen zunächst einmal beantwortet sein, bevor die Komplexion ins Unermessliche steigt und am Ende die Mehrheit der Menschen einer Welt, die von individueller Freiheit und Gleichheit, Toleranz und Demokratie gekennzeichnet sein sollte, den Rücken zukehrt? Zeigt nicht das erstarkende Bedürfnis nach Religion und Spiritualität, dass Menschen gerade in einer ökonomisch deregulierten und zweckrational verwalteten Welt nach Antworten suchen, die diese Welt ihnen nicht zu geben vermag? Und sollte sich die Philosophie in diesem schwierigen Konflikt zwischen Immanenz und Transzendenz einfach auf die Seite der Wissenschaften, also auf die der Immanenz, schlagen?
Wissenschaftler, insbesondere Naturwissenschaftler, welche heute behaupten, Menschen, die ein metaphysisches oder manifest religiöses Bedürfnis verspürten, seien einem hoffnungslos anachronistischen Diskurs verfallen, sind offenbar in einer Hinsicht ihrerseits Anachronisten. Sie wollen nicht wahrhaben, dass sich der Fortschritt der Moderne, in dem ihre eigene Reputation gründet, selbst einem metaphysischen Versprechen verdankt: dem einer von Mühsal und Elend, Leid und Schmerz befreiten Menschheit. Ob man nun meint, die Annahme eines allmächtigen Gottes sei wahnhaft oder nicht, man wird das metaphysische Bedürfnis der Menschen sicherlich nicht dadurch stillen oder stillstellen können, dass man es für nicht mehr zeitgemäß erklärt oder gar, wie Richard Dawkins es tut10, verteufelt.
*
Eine Alternative zur sprachanalytisch und hermeneutisch begründeten Erklärung, warum es nicht oder kaum mehr möglich ist, Antworten auf grundlegende philosophische Fragen zu finden, ist jedoch historisch noch bedeutsamer geworden, da sie überraschenderweise positiv argumentiert. Diejenigen, die diese Fragen für unsinnig erklären, und diejenigen, die, noch weitaus radikaler, von einem hoffnungslosen Veralten, ja sogar vom Ende der Philosophie sprechen, gehen nämlich implizit davon aus, dass diese Fragen prinzipiell, d. h. ihrer Form nach längst beantwortet seien (das ist die transzendentale »Antwort« bzw. Enttäuschung in der Folge Kants). Das lässt sich an den im engeren Sinne metaphysischen Fragen: Ist alles vergänglich, auch die Zeit? Und wenn ja, was ist der Grund des Seins: die Ewigkeit, das Göttliche, Gott? Und wenn nicht, ist dann nicht alles vergeblich? am besten verdeutlichen.
Solche Fragen, könnte man sagen, sind bereits in der erkenntniskritischen Konzeption Kants hinreichend reflektiert worden: Raum und Zeit sind dieser Konzeption zufolge reine Anschauungsformen unseres Denkens, die es uns konstitutiv verunmöglichen, eine Realität jenseits von Raum und Zeit zu erkennen11. Nimmt man nun an, die Zeit sei selbst zeitlich, wie in der Frage Ist alles, auch die Zeit, vergänglich? unterstellt wird, erliegt man einem Kategorienfehler: Man macht die Form der Anschauung selbst zum Inhalt einer Anschauung und erzeugt dadurch das, was Kant einen transzendentalen Schein nennt12. Die Frage Ist alles vergänglich? ist insofern zwar nicht unsinnig, denn sie kann gestellt werden. Aber je nachdem, wie man hier »alles« versteht, ist sie entweder sinnlos oder einfach mit Ja zu beantworten.
Aber auch die existenziellen Fragen, insbesondere die nach dem Sinn und dem Guten: Worin besteht der Sinn des Lebens? und Was ist ein gutes Leben?, sind, könnte man sagen, durch die Philosophie Immanuel Kants bereits beantwortet worden. Seit Kant gehen wir nämlich davon aus, dass der Grund alles ethisch Guten und Sinnvollen stets die Autonomie des Subjekts und daher diese gewissermaßen selbst das Gute ist13. Das hat im modernen Liberalismus dazu geführt, jedem Einzelnen das Recht zuzuerkennen, seiner eigenen Vorstellung vom Guten zu folgen: Es ist gut bzw. das Gute, so die liberalistische These, dass jeder, d. h. je der Einzelne selbst entscheidet, was gut bzw. das Gute ist. Die angebliche Unmöglichkeit einer allgemeinverbindlichen Antwort wird also selbst zum Guten erklärt und damit tatsächlich eine allgemeinverbindliche Antwort auf die Frage nach dem Guten gegeben.
Das heißt jedoch: Die Frage nach dem Guten wird im modernen und vor allem im postmodernen Denken philosophisch nur noch formal beantwortet und inhaltlich im Sinne einer Theorie radikaler Pluralität an den je Einzelnen delegiert. Das ist zwar, von einem sich auf Kant berufenden Liberalismus ausgehend, theoretisch konsequent, bringt aber eine Reihe vonProblemen mit sich. Denn kein Liberalismus ist je in Reinform realisiert worden und kann als solcher auch nicht realisiert werden, weil die mit ihm unterstellte individuelle Freiheit: jeder könne selbst entscheiden, was gut sei, so nicht gegeben bzw. je schon vermittelt ist mit der Freiheit der anderen, also einer, sit venia verbo, sozialen Freiheit. Insofern ist die individuelle Freiheit aber immer schon Unfreiheit, Illiberalität und daher der Liberalismus im Kern ideologisch.
Kurz, die allgemeinverbindliche Behauptung über das Gute, es könne keine allgemeinverbindliche Behauptung über das Gute geben, ist selbstwidersprüchlich und bereitet gerade dadurch der Philosophie erneut den ihr bereits entzogenen Boden. Mitnichten hat sich die mit einem universalen Anspruch verknüpfte philosophische Frage nach dem Guten erledigt, nur weil wir glauben, mit einem universalen Anspruch behaupten zu können, sie lasse sich nur individuell beantworten. Selbst die metaphysischen Fragen scheinen kraft dieses Selbstwiderspruchs noch nicht überholt zu sein. Denn auch die Behauptung von der Zeit als einer Anschauungsform, der angeblich jeder Inhalt unterliege, verkennt, dass für das Denken auch die Form lediglich ein Inhalt ist, der zum Gegenstand eines noch in der Form verbleibenden Denkens gemacht werden kann. Form und Inhalt sind also für das Denken keine Kategorien, keine ontologischen Schubladen, sondern Aspekte ein und derselben Realität.
*
Die für »unsere postmoderne Moderne«14 kennzeichnende sprachanalytische, hermeneutische und transzendentale Enttäuschung der in der Geschichte der Philosophie grundgelegten existenziellen und metaphysischen Fragen scheint also ihrerseits auf einer Täuschung zu beruhen: auf der einer bestimmten Sprach-, einer bestimmten Geschichts- und/oder einer bestimmten Denkkonzeption: erstens auf der Idee einer von spezifischen Regeln beherrschten Sprache, die diese willkürlich begrenzen; zweitens auf der Idee einer als Rezeptionsgeschichte begriffenen Tradition, die produktionsästhetische Aspekte vernachlässigt und daher geschichtlich wirkungslos gebliebene Entwürfe systematisch übergeht; und drittens auf der Idee eines konzeptuell gerahmten Denkens, das auch und gerade in seiner Selbstreflexion in diesem Rahmen, seiner »Konzeption« verbleibt.
Aber wer nun meint, diese bestimmten Regeln, Formen und Konzeptionen: der Sprache, der Tradition und des Denkens, einfach so hinter sich lassen zu können, wird nun seinerseits enttäuscht werden bzw. sich enttäuschen müssen. Denn diese Regeln, Formen und Konzeptionen – man könnte sie als »historisches Apriori«15 unserer Gegenwartskultur verstehen – lassen sich nicht einfach beiseite räumen. Man kann die Sprachregeln außer Kraft setzen. Aber welche Regeln treten an ihre Stelle, wenn eine Sprache (la langue) stets geregelt ist? Man kann dem Druck der Tradition seinen Widerstand entgegensetzen. Aber worauf, wenn nicht auf sie, bauen wir die Zukunft? Und man kann sich, wie es Foucault tat, der Anstrengung unterziehen, wissen zu wollen, wie und wie weit es möglich wäre, anders zu denken, als man denkt16. Aber welche Sicherheit hat man, damit dem Zirkel der Reflexion entronnen zu sein?17
Die Enttäuschung der sprachanalytischen, hermeneutischen und transzendentalen Enttäuschung muss sich – und uns, ihre Rezipienten – daher ihrerseits enttäuschen: Will Philosophie nicht hoffnungslos naiv erscheinen, will sie mit der historischen Realität Kontakt und Schritt halten, sollte sie einerseits der Überschreitung, dem Ausbruch aus der Immanenz, also der Transzendenz, wie auch immer negativ, die Treue halten – indem sie Abstand hält zur immanentistischen Reflexion: zu jeder Form von Szientismus, Pragmatismus und, im Bereich der Ethik, von Utilitarismus. Aber sie sollte andererseits auch bereit sein, der immanentistischen Reflexion zu folgen, um die Haltepunkte dieser Reflexion benennen und analysieren zu können: ihre ideologischen Hypostasierungen, ihre Halbwahrheiten, Widersprüche und Inkonsistenzen.
Das bedeutet erstens: Philosophie sollte ihre Distanz zur Wissenschaft aufrechterhalten, sollte Wissenschaftskritik leisten. Denn eine Gesellschaft wie die postmoderne, genauer: postmodern-moderne, die sich wissenschaftlich konstituiert, d. h. sich als Gesellschaft keinen einzigen Schritt erlaubt, der nicht wissenschaftlich konsolidiert ist: wir brauchen – angeblich – eine wissenschaftliche Pädagogik, eine wissenschaftliche Politik, eine wissenschaftliche Pflege etc. –, kennt am Ende kein nicht-szientifisches Außen mehr, von dem her die von der Verwissenschaftlichung ausgehende rational-funktionelle Technisierung unserer Lebenswelten noch analysiert, aber vor allem kritisiert werden kann; und zwar in einer Weise, die Kontakt hält mit einer diskursiven Tradition, etwa der Renaissance und der Aufklärung, aus der die Wissenschaften selber stammen.
Und es bedeutet zweitens: Philosophie sollte ihre Distanz zu sich selbst aufrechterhalten, sollte Selbst-, d. h. Philosophiekritik sein. Denn wenn sie sich auch wissenschaftskritisch gebärdet, so geht doch zumindest die Philosophiewissenschaft18 aus ihr hervor und bleibt, anders als im Verhältnis von Literatur und Literaturwissenschaft oder von Kunst und Kunstwissenschaft, ein Teil von ihr. Die Philosophiewissenschaft ist heute, wie man behaupten könnte, als Teil von Philosophie deren notwendige Propädeutik19. Die Literaturwissenschaft dagegen ist kein Teil von Literatur, und die Kunstwissenschaft kein Teil von Kunst. Eher schon ist das Gegenteil der Fall, wenn denn der Gegenstand einer Wissenschaft überhaupt ein Teil von ihr sein kann. Dass aber der Gegenstand einer Wissenschaft zur Kritik seiner eigenen Vergegenständlichung – und damit auch zur Selbstkritik – nötigt, ist eine Besonderheit, die der Philosophie eigen ist.
*
Was ist der Grund dieser Besonderheit? Während die transzendentale »Antwort« zu einer annähernd stabilen Abgrenzung von Philosophie und Wissenschaften führte: zunächst, im Transzendentalismus Kants, von Philosophie und Natur-, dann, im neukantianischen Transzendentalismus, auch von Philosophie und Geisteswissenschaften, führten die sprachanalytische und stärker noch die hermeneutische »Antwort« zu einer sich beschleunigenden internen Spaltung des philosophischen Diskurses selbst: zur Trennung einer v. a. textwissenschaftlich orientierten Philosophie, die sich als rezeptionsgeschichtliche Aufarbeitung einer ihrerseitsrezeptionsgeschichtlich begriffenen Tradition versteht, von einer emphatischen Form von Philosophie, die auch und gerade unter den Bedingungen ihrer eigenen reflexiven Modernisierung ihre Produktionsgeschichte fortzuschreiben versucht.
Die unter Philosophiewissenschaftlern verbreitete These, dass mit der modernen Ausdifferenzierung und Herauslösung der Einzelwissenschaften aus der Philosophie diese selbst zu einer Einzel- bzw. Fachwissenschaft, einer Disziplin unter anderen wurde20, ist daher grob einseitig, wenn nicht falsch. Die wissenschaftliche Reflexion der Philosophie als solche löst diese nicht auf, lässt nicht einfach nur Philosophiewissenschaft zurück. Vielmehr bleibt – genau das ist ein Kennzeichen reflexiver Modernisierung – der alte, ursprüngliche Diskurs (Philosophie) neben dem neuen, ihm entsprungenen, emergenten (Philosophiewissenschaft) bestehen. In beständiger, gegenseitiger Kritik trennen sich, im wörtlichen Sinn von Kritik, beide voneinander, indem der eine den anderen zum Gegenstand macht, während sich dieser seiner Vergegenständlichung immer wieder entzieht, sie »aufschiebt«.
Was macht diesen Entzug, diesen »Aufschub« aus? Was ist es, was die Texte Heideggers, Sartres, Merleau-Pontys, Levinas', Adornos, Ricoeurs, Derridas und vieler anderer, die heute zum Gegenstand philosophiewissenschaftlichen Forschens werden, von ihrer Vergegenständlichung trennt? Das ist mehr als nur eine Frage der Form und des Stils, mehr als nur ein gradueller Unterschied21, sondern ein Unterschied ums Ganze: Diese Texte machen die Enttäuschungen, die seit Kant, Wittgenstein und Gadamer zum zentralen Element von Philosophie geworden sind, zum konstitutiven Moment ihrer eigenen Erfahrung, während die Philosophiewissenschaft solche Erfahrung als Fremderfahrung lediglich analysiert und konstatiert. Zwischen der philosophiewissenschaftlichen Verifikation bzw. Falsifikation der Erfahrungs-Behauptung und der philosophischen Erfahrung selbst klafft eine Lücke, die nicht geschlossen werden kann.
Und dennoch fallen Philosophie und (Philosophie-)Wissenschaft nicht beziehungslos auseinander. Zwar kann Philosophie sich heute nicht mehr als eine das Ganze integrierende Universal- oder Metawissenschaft verstehen. Sie darf sich auch nicht, wie noch die klassische Philosophie bis Husserl es konnte, einbilden, für irgendeine Fachwissenschaft eine Grundlegung leisten zu können22. Aber sie bleibt doch Grundlagenreflexion, grundsätzliches Denken und deckt von daher immer wieder die für die Wissenschaften konstitutiven, aber ihnen oft verborgenen Abgründe des Denkens auf. Sie steht insofern zur (Philosophie-)Wissenschaft in keinem positiven, fundierenden, aber doch in einem deren Fundament befragenden, negativen Verhältnis. Sie steht dem Szientismus, der ein nicht-szientifisches Außen nicht kennt, skeptisch gegenüber und entzieht ihm, wo nötig, seine Legitimation.
Das heißt aber auch: Dem Rekurs auf die Wissenschaften kann sich die Philosophie nicht verweigern, insbesondere nicht dem auf die Philosophiewissenschaft. Diese ist und bleibt ein Teil von ihr. Wenn sie sich daher, wie dies in den folgenden Texten des Buches immer wieder geschieht, von ihr losmacht, von ihr dispensiert, bleibt das eine Form der Selbstkritik, auch wenn es gelegentlich so scheinen mag, als operierten beide in unterschiedlichen Sphären. Das ist aber einem kontingenten Umstand geschuldet: der sich gegenwärtig stark beschleunigenden ökonomischen Zurüstung der Hochschulen zu marktkonformen Wettbewerbsagenturen23, in deren Verlauf sich auch die Philosophiewissenschaft allmählich zu einer Disziplin von betriebsblinden Spezialisten verselbständigt hat, die über den Tellerrand ihres »Fachs Philosophie« weder mehr hinausschauen können noch wollen.
1.3. Résumé I
Ist Philosophie, so wie sie sich einmal verstand: als Suche nach einem dem menschlichen Leben immanenten, aber es auch transzendierenden Sinn, als Frage nach der Bedeutung von Sein und Zeit, aber auch nach der eines Jenseits von Sein und Zeit, – ist eine solche Philosophie nicht am Ende? Ist Philosophie nicht zu einer Spezialwissenschaft geworden, in der diese Themen und Fragen kaum noch oder allenfalls am Rande behandelt werden?
Die bisherige Analyse hat gezeigt: Philosophie, philosophisches Denken ist ein enttäuschendes Geschäft, und zwar auf allen Ebenen ihres Wirkens, historisch und systematisch, institutionell und außer-institutionell: historisch aufgrund ihres Zerfalls in einzelne Fachwissenschaften und der daraus folgenden Konstituierung als Philosophiewissenschaft; systematisch aufgrund der – angesichts des Fortbestands metaphysischer Bedürfnisse – unzureichenden Antworten, die sie anzubieten hat: der transzendentalen, der sprachanalytischen und der hermeneutischen »Antwort«. Es war, rückblickend betrachtet, eine Täuschung, anzunehmen, diese Antworten könnten eine endgültige, stabile Basis sein für ein weiteres, von interner Selbstkritik und Selbstzweifeln befreites philosophisches Denken, Lehren und Forschen. Im Gegenteil. Die Enttäuschungen der Philosophie wurden durch sie nur noch weiter vorangetrieben.
Das wiederum hat sowohl institutionelle als auch außerinstitutionelle Folgen. Über das »historische Apriori« einer wissenschaftlich reglementierten Sprache, einer rezeptionsgeschichtlich definierten Tradition und eines kategorial beschränkten Denkens kommen sowohl die institutionelle als auch außerinstitutionelle Philosophie vorerst nicht hinweg. Dieses Apriori wirkt wie ein Bündel der von Thomas Kuhn beschriebenen Paradigmen24: Ohne Bezug auf sie ist heute kein Philosophieren mehr möglich. Aber die sich als Philosophiewissenschaft verstehende, institutionelle Form philosophischen Denkens betrifft das stärker als dessen emphatische, außerinstitutionelle Form. Denn diese ist, da sie sich nicht als Wissenschaft versteht noch als solche geriert, an solche Paradigmen nur negativ, nicht positiv gebunden. Sie arbeitet sich an ihnen ab, während der Philosophiewissenschaftler auf sie aufbaut.
Philosophie ist also, so scheint es, zwar am Ende, aber doch noch nicht an einem endgültigen. Sie ist an einem Wendepunkt. Es gibt da nämlich, um nun einmal – und in diesem Buch immer wieder – von der apersonalen, in den Wissenschaften verbreiteten Artikulationsform des Man zur personalen Sprachform des Ich umzuschwenken, noch das eine oder andere Thema, das ich anzusprechen, noch die eine oder andere Frage, die ich zu stellen hätte – zum Beispiel im Zusammenhang mit einer biographischen Erinnerung:
1.4. Frühes Fragen, späte Antworten
Mitte der 80er Jahre fuhr ich für einige Wochen von Berlin nach Freiburg/Br. und besuchte dort meine alten Kommilitonen Peter P. und Elisabeth W. Einige Jahre zuvor war ich von Freiburg/Br. nach Berlin gezogen, weil ich glaubte, meine – am Anfang sicher noch übertrieben idealistische – Vorstellung davon, was Philosophie sein könnte, in Berlin besser realisieren zu können. Schon bald nach meiner Ankunft dort hatte ich angefangen, sprachspielerisch zu arbeiten und mit Texten zu experimentieren. Die ersten Entwürfe der von Robert Krokowski und mir herausgegebenen ZeitSchrift für TopoLogie und StrömungsKunde25 lagen vor (vgl. Abb. 1), und Peter und Elisabeth sprachen mich darauf an:
»Ist das nicht ein wenig verspielt, was Ihr, Du und Robert, da macht? Konkrete Poesie oder Begriffspoesie oder dergleichen?« Ich dachte, um der nur mühsam cachierten Kritik meiner Freunde gewappnet entgegentreten zu können, wäre es gut, etwas weiter auszuholen, und erläuterte: »Bei Wittgenstein habe ich mal gelesen: Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt26. Wenn ich also als Philosoph die Grenzen meiner Welt, vielleicht auch überhaupt der Welt, erweitern möchte, so muss ich doch wohl die Sprache erweitern, Spracharbeit betreiben, oder nicht?«
Und weil ich wusste, dass Peter Ingeborg Bachmann über alles schätzte – Elisabeth begann damals, sich für Derrida zu interessieren –, fügte ich noch hinzu: »Steht nicht auch irgendwo bei Bachmann: Keine neue Welt ohne neue Sprache27? Meint nicht auch Bachmann – so jedenfalls verstehe ich rückblickend ihre Dissertation über Heidegger und ihr Interesse an Wittgenstein und am Wiener Kreis28 –, dass wir, um neue Formen des Lebens leben zu können, eine neue Sprache brauchen? Und ist nicht Philosophie auch in diesem, existenziellen und explizit literarischen Sinne, Spracharbeit?«
Peter war verärgert: »Das ist purer Idealismus. Der Satz fordert doch nicht, gleichsam normativ, dazu auf, an der Sprache zu arbeiten, um die Welt zu verändern, sondern weist nur, rein deskriptiv, darauf hin, dass zwischen Welt und Sprache eine konstitutive, nicht nur eine kontingente Beziehung besteht. Das ist ein wechselseitiges, kein einseitiges Verhältnis. Im Übrigen ist das, was Bachmann da formuliert, ein ästhetisches Programm, das durchaus auch auf hermetische Texte zutreffen kann wie auf die von Celan, Kafka oder Beckett. Aber Ihr wollt doch, soweit ich es verstehe – und ich verstehe nur sehr wenig davon – Philosophie betreiben, nicht Dichtung. Oder?«
*
Meine alten Freunde aus Freiburger Zeiten hatten Recht. Ich war – negativ – einer Täuschung erlegen und hatte mich – positiv – der Illusion hingegeben, mit ein wenig Spracharbeit die Welt verändern zu können. Ich war vielleicht sogar, wie der von mir verehrte Hegel, zu einem unverbesserlichen Idealisten geworden: »Die theoretische Arbeit, überzeuge ich mich täglich mehr«, schreibt Hegel 1808 in einem Brief an Niethammer, »bringt mehr zustande in der Welt als die praktische; ist erst das Reich der Vorstellungen revolutioniert, so hält die Wirklichkeit nicht aus.«29 Als hätte es Feuerbach, Marx & Co. nicht gegeben – und auch nicht die Kritische Theorie, die Peter, Elisabeth und ich in Form der Dialektik der Aufklärung einige Jahre zuvor eingehend studiert hatten.
Ich war also ohne große Überlegung – Julia Kristevas La révolution du langage poétique stand dabei Pate für mich30 – an einem rebellischen Projekt beteiligt gewesen, das keines war, oder umgekehrt an einem revisionistischen, das ich für rebellisch hielt. Genau in dieser Umkehrung aber lag damals für mich das ganze Problem des so genannten linguistic turn: War er ein rebellischer oder ein revisionistischer turn? War ich also an einem rebellischen Projekt beteiligt gewesen oder nicht? Je nachdem, wie man den turn verstand, war ich ein Idealist / ein Kritizist oder auch – und die zweite Alternative lehnte ich damals kategorisch ab – ein Realist / ein Dogmatiker31.
Vor allem aber war mir ein Fehler unterlaufen, der mir immer wieder unterlief und über den ich mir erst in den letzten Jahren ausreichend Gewissheit verschaffen konnte. Bedingung und Grund waren zu unterscheiden: Die conditio sine qua non ist noch kein zureichender Grund. »Keine neue Welt[ist] ohne neue Sprache [möglich]« heißt ja nicht: »Eine neue Welt [ist nur] durch neue Sprache [möglich]«; denn das würde den Unterschied zwischen Bedingung und Grund verschleifen. Genau deshalb beharrten aber offenbar meine Freiburger Freunde darauf, dass es sich bei dem Satz Bachmanns nicht um einen normativen, sondern um einen deskriptiven Satz handelte32.
Aber auch wenn man ihn nicht als einen einseitigen, normativen Satz verstehen konnte, was besagte er dann? Wenn man z. B. annahm, dass es sich um ein wechselseitiges Verhältnis handelte, Sprache und Welt einander bedingten, war es dann nicht gleichgültig, wo man mit seiner Arbeit begann: ob man, z. B. als Philosoph, Schriftsteller oder Gelehrter, Spracharbeit, betrieb oder aber die Welt direkt zu verändern suchte, indem man, z. B. als Naturwissenschaftler, Techniker oder Ingenieur, ganz konkret, materiell das Antlitz der Welt umgestaltete? Und erwächst nicht der Pluralismus der Postmoderne genau aus dieser grundlegenden Einsicht: dass der Binarismus von Kultur und Natur, Denken und Sein, Differenz und Identität etc. keine Wertungen impliziert, dass die Bereiche gleich gültig sind?
*
Nur wenige Jahre nach meinem Gespräch in Freiburg – ich hatte keinen Kontakt mehr zu meinen alten Kommilitonen – beschäftigte ich mich mit Foucault und las im zweiten, 1986 in deutscher Übersetzung erschienenen Band von Sexualität und Wahrheit: »Es gibt im Leben Augenblicke, da die Frage, ob man anders denken kann, als man denkt, anders wahrnehmen kann, als man sieht, zum Weiterschauen oder Weiterdenken unentbehrlich ist. (…) Was ist die Philosophie heute – ich meine die philosophische Aktivität –, wenn nicht die kritische Arbeit des Denkens an sich selber? Und wenn sie nicht, statt zu rechtfertigen, was man schon weiß, in der Anstrengung liegt, zu wissen, wie und wie weit es möglich wäre, anders zu denken.«33
Als ich diese Passage las, musste ich zunächst an Wittgenstein und Bachmann denken. Aber Foucault geht, wie man sieht, noch einen Schritt weiter, nämlich zurück hinter das Verhältnis von Sprache und Welt. Ihn interessiert überhaupt die Möglichkeit einer neuen Sprache oder eines anderen Denkens, und zwar zunächst einmal unabhängig von einer möglichen Veränderung von Welt, wodurch im Kontext Wittgenstein – Bachmann – Foucault implizit deutlich wird, dass der Weltbegriff selbst unpräzise ist: Man könnte ebenso gut von der Welt des Denkens oder der Gedanken sprechen wie von der Welt des Wahrnehmens oder der Wahrnehmungen.
Was daher mit Welt gemeint sein kann, beschränkt sich bei Foucault auf den Seinsbegriff. Das geht aus einer Passage in einem Interview hervor, das Foucault 1980 mit Le Monde geführt hat. Er sagt dort: »Philosophie ist eine Bewegung, mit deren Hilfe man sich nicht ohne Anstrengung und Zögern, nicht ohne Träume und Illusionen von dem freimacht, was für wahr gilt, und nach anderen Spielregeln sucht. Philosophie ist jene Verschiebung und Transformation der Denkrahmen, die Modifizierung etablierter Werte und all der Arbeit, die gemacht wird, um anders zu denken, um anderes zu machen und anders zu werden, als man ist.«34
Denken und Sein sind hier derart eng miteinander verwoben: »anders denken« – »anders machen« – »anders werden«, dass die entscheidende Frage nicht mehr die nach deren Verhältnis ist, sondern, vergleichbar einer transzendentalen Fragestellung35, nach den Bedingungen der Möglichkeit einer Veränderung dieses Verhältnisses selbst bzw. innerhalb dieses Verhältnisses: Wie ist ein Anders-Denken und damit ein Anders-Werden, und umgekehrt, überhaupt möglich? Was muss geschehen, damit sich die eine Gestalt des Denkens bzw. des Seins in eine andere Gestalt transformiert, damit sich die »Welt« ändert? Wie können – mit dem späteren Wittgenstein gesprochen – die »Spielregeln« des Denkens / des Seins verändert werden?
*
Man könnte argumentieren, das sei überhaupt kein Problem: »Wir verändern uns alle Tage. Veränderung geht doch je schon vor sich, ob man es nun bemerkt oder nicht. Also verändert sich auch unsere Welt kontinuierlich, und mit ihr verändern wiederum wir uns usw. usf.«36 Das Verhältnis von Sprache und Welt, Sein und Denken sei eben – so das Argument, das schon meine alten Freiburger Kommilitonen vorgebracht hatten – ein wechselseitiges, und insofern sei es völlig gleichgültig/gleich gültig, an welcher Stelle die Veränderung beginne oder ende. Die Veränderung finde dauerhaft statt, und mit ihr verändere sich – ebenso dauerhaft – das gesamte Verhältnis.
Die ethische Frage der Veränderung, die Foucault in seinem Spätwerk anspricht, wird aber auf diese Weise, ontologisierend, eskamotiert und damit gleich ein weiteres Problem beiseitegeschafft, das an die ethische Frage rührt: das Problem des Verhältnisses von Theorie und Praxis. Wenn ich nämlich eine Veränderung will, die sich nicht und vielleicht auch niemals von allein einstellt, dann muss ich mich in ein theoretisches Verhältnis zu meiner mir vorgängigen Praxis setzen, die ich verändern will. Und wenn die Praxis, die ich verändern will, mein eigenes Denken / meine eigene Sprache ist, bin ich, anders als im üblichen Theorie-Praxis-Verhältnis, mit einem besonderen Problem konfrontiert:
Ich muss mich, so scheint es, um eine willentliche Veränderung meines eigenen Denkens und Sprechens herbeiführen zu können, in meinem Denken und Sprechen auf mich selbst beziehen, oder anders gesagt: Mein Denken und Sprechen müssen sich verdoppeln. Auf der einen Seite steht dann ein Denken, das als Subjekt sich selbst reflektiert: das reflektierende Denken, und auf der anderen ein Denken, das der Gegenstand, das Objekt, dieses reflektierenden Denkens ist: das reflektierte Denken. Aber wie sollte ich allein durch diesen formalen Unterschied von reflektierendem und reflektiertem Denken jemals eine inhaltliche Differenz bewirken können? Durch die Vergegenständlichung meiner selbst bzw. meines Denkens ist offenbar noch wenig gewonnen.
Es scheint daher, dass eine reine Reflexion des Denkens, ein Denken des Denkens, zumindest mit der Absicht, das Denken verändern zu wollen, unmöglich ist. Zwar kann ich – das ist der Kern des linguistic turn – nach den Kategorien und Spielregeln fragen, nach denen mein Denken oder mein Sprechen »funktionieren«; und ich kann es durchaus in der Absicht tun, diese Kategorien und Spielregeln zu verändern, um eine neue Sprache, ein anderes Denken zu konstituieren. Aber es gibt keine Gewähr dafür, dass die Reflexion meines Denkens nicht denselben Kategorien und Spielregeln – im Wortsinn von subiectum – unterworfen ist wie das von mir reflektierte Denken. Aus dem Zirkel der Reflexion gibt es daher ohne ein Anderes ihrer selbst kein Entkommen. Die reine Reflexion bleibt das, was sie ist, das heißt, sie ist als solche zu keiner Veränderung fähig.
1.5. Exkurs zu Fichte und Adorno
Dieser Zirkel der Reflexion ist in der Geschichte der Philosophie in unterschiedlicher Weise dargestellt worden. Ich nenne hier zwei: zum einen den Zirkel des Selbstbewusstseins bzw. der subjektivierenden Reflexion im Verhältnis von Denken und Sein und zum anderen den Zirkel des Identitätsdenkens bzw. der verobjektivierenden Reflexion im Verhältnis von Subjekt und Objekt. Der erste Zirkel kann verdeutlicht werden anhand von Dieter Henrichs Darstellung der Kritik Fichtes an der so genannten Reflexionstheorie des Ichs. Der zweite Zirkel kann verdeutlicht werden anhand Theodor W. Adornos Darstellung des von ihm so genannten Vorrangs des Objekts.
Dieter Henrich zufolge hat sich Fichte gegen die Reflexionstheorie des Ichs gewandt, weil er einsah, dass das Wissen dieses Ichs kein vermitteltes, sondern nur ein unmittelbares Wissen sein konnte. Das heißt zum einen, das Wissen des Ichs von sich kann durch den expliziten Rekurs auf sich, also durch die Vermittlung seiner selbst überhaupt nicht zustande kommen, es muss bereits vorausgesetzt werden. Denn wenn das Ich etwas anderes als Wissen von sich wäre, dann würde der Selbstbezug ihm etwas Neues hinzufügen. Das Ich, das sich versteht, und das, wovon es Verständnis hätte, wären nicht identisch37.
Zum anderen kann sich das Ich durch die Reflexion, den expliziten Rekurs auf sich nicht selbst in der Weise durchsichtig werden, dass es verstehen könnte, wie oder woraus es entsteht bzw. entstanden ist. Es hat eine Grundlage oder einen Grund, von dem es kein Wissen haben kann38. Nimmt man dabei an, dass es wesentlich Denken und darin stets auch Denken seines Denkens ist, so gilt die These der Undurchsichtigkeit auch für seinen eigenen Denkprozess und die in ihm erzeugten Gedanken. Das hat Julia Kristeva einmal in den Worten ausgedrückt: »La production de la pensée est exclue de la pensée.« / »Die Erzeugung des Gedankens bleibt aus dem Gedanken selbst ausgeschlossen.«39
Das Sein des Denkens ist also aus der Perspektive des Denkens, im Denken des Denkens immer schon vorausgesetzt, es kann nicht causa sui sein, d. h. nicht durch sich selbst, durch das Denken des Denkens gesetzt, nicht »geschlossen in sich (…) und wesentlich ganz nur Bewusstsein seiner selbst« sein40. Oder anders gesagt, das Ich kann sich nicht aus sich selbst heraus explizieren, sondern bedarf zu seiner Explikation stets eines Anderen. Seine Reflexion ist nichts ohne das von dieser Reflektierte: nichts ohne ihr Sein oder, gleichwie, das Sein. Es gilt, könnte man, Adorno variierend, sagen, die These vom Vorrang des Seins, die sich als Asymmetrie fassen und in verkürzter Form folgendermaßen formulieren lässt: Kein Denken [ist] ohne Sein [möglich], aber Sein [ist] ohne Denken [möglich].
*
Adorno selbst hat nicht vom Vorrang des Seins gegenüber dem Denken, sondern vom Vorrang des Objekts gegenüber dem Subjekt gesprochen: »Vermöge der Ungleichheit im Begriff der Vermittlung«, heißt es in der Negativen Dialektik – Vermittlung meint hier sowohl den Prozess begrifflicher Vermittlung als auch dessen Resultat, das Vermitteltsein des Unmittelbaren –, »fällt das Subjekt ganz anders ins Objekt als dieses in jenes. Objekt kann nur durch Subjekt gedacht werden, erhält sich aber diesem gegenüber immer als Anderes; Subjekt jedoch ist der eigenen Beschaffenheit nach vorweg auch Objekt. Vom Subjekt ist Objekt nicht einmal als Idee wegzudenken, aber vom Objekt Subjekt.«41
Die Intuition, die hinter dieser Erkenntnis steht, ist zunächst einfach, fast schon trivial: Auch der Mensch ist, obwohl er darauf nicht reduziert werden kann, ein materiell-stoffliches, dingliches Etwas in der Welt; er ist, wie Adorno schreibt, der eigenen Beschaffenheit nach auch Objekt. Das wissen wir, weil wir jeden anderen Menschen und insofern immer auch uns selbst als ein Ding bei und unter den Dingen der Welt schlicht vorfinden, ohne diese Vorfindlichkeit jemals auf Subjektivität selbst zurückführen zu können. »Der [Heidegger’sche] Ausdruck Dasein, synonym mit Subjekt, spielt auf solche Sachverhalte an.«42 Man kann hier von einem ontologischen Vorrang von Objektivität sprechen.
In einem zweiten, erkenntnistheoretischen Schritt heißt das aber, dass das Denken – und es ist immer das Denken eines Subjekts – auf ein Objekt zwar nicht als seinen Grund (s. o.), aber als seine epistemologische Bedingung angewiesen ist: »Das nicht Gedankliche«, heißt es in der Negativen Dialektik, »ist logisch-immanente Bedingung des Gedankens«43 Das ist gemeint, wenn Adorno im obigen Zitat vom »Ungleichgewicht im Begriff der Vermittlung« spricht: Die Vermittlung ist der Prozess der Vermittlung, aber sie könnte nicht auch deren Resultat sein, wenn ihr nicht ein Unmittelbares vorgeordnet wäre, das sie vermittelt: »In Unmittelbarkeit liegt nicht ebenso deren Vermitteltsein wie in der Vermittlung ein Unmittelbares, welches vermittelt würde.«44
So wie die Reflexion in Fichtes Theorie des Selbstbewusstseins nichts ist ohne das von ihr Reflektierte, so ist also auch hier das Subjekt nichts ohne sein Anderes, das Objekt. Man könnte insofern auch hier sagen, es handele sich um eine ontologischeAsymmetrie: Kein Subjekt [ist] ohne Objekt [möglich], aber Objekt [ist] ohne Subjekt [möglich]. Zwar ist der epistemologische Einwand berechtigt, dass das Objekt vom Subjekt konstituiert werde, dass das Vermittelte das, was es ist, durch die Vermittlung sei. Aber zöge man gleichsam vom Objekt das Subjekt ab, bliebe doch immer noch Objektives zurück: »Nicht ist (…) obiectum subiectum; wohl jedoch subiectum obiectum.«45
1.6. Unfreiheit als Fundament
In einem Kalender mit dem Titel »Ich bin Ich. Gedanken berühmter Frauen« findet sich auf dem Blatt für die 17. Woche des Jahres 2019 ein Zitat der früheren First Lady, Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin der USA Hillary Clinton. Es lautet: »Jeder von uns steht im Leben vor schweren Entscheidungen. Wie wir mit ihnen umgehen, das macht uns zu den Menschen, die wir sind.«46 Wenn wir also einmal eine Reihe von Entscheidungen, politischer oder anderer Art, getroffen haben – vielleicht aber auch eine philosophische wie die durch dieses Zitat verdeutlichte –, dann, so Clinton, wird das unsere Persönlichkeit nachhaltig prägen. Wir konstruieren uns, könnte man sagen, durch unsere Entscheidungen selbst.
Aber ist das richtig? Ist das ein Votum für eine politische und/oder philosophische Welthaltung, die den Realitäten – und nicht irgendwelchen Potentialitäten und Wünschen, wie es sein könnte oder sein sollte – gerecht wird? Als ich mir diese Frage stellte, musste ich an den Satz des bekannten Philosophen Johann Gottlieb Fichte denken, den ich Jahre zuvor gelesen hatte und der das genaue Gegenteil behauptete. Der Satz lautet: »Was für eine Philosophie man wähle, hängt (…) davon ab, was man für ein Mensch ist: denn ein philosophisches System ist nicht ein toter Hausrat, den man ablegen oder annehmen könnte, wie es uns beliebte, sondern es ist beseelt durch die Seele des Menschen, der es hat.«47
Machen uns, wie Clinton vermutet, unsere Entscheidungen erst zu denjenigen Menschen, die wir sind? Geht unsere Individualität aus unseren Entscheidungen hervor? Oder liegt unseren Entscheidungen, wie Fichte vermutet, unsere Individualität bereits zugrunde? Oder ist das überhaupt nicht die Frage? Muss man nicht auch hier, wie es meine Freiburger Kommilitonen taten, annehmen, dass das Verhältnis von Denken und Sein ein wechselseitiges Verhältnis ist und dass es insofern völlig gleichgültig / gleich gültig ist, an welcher Stelle die Veränderung beginnt oder endet? Findet nicht auch hier eine kontinuierliche Veränderung statt, die man von beiden Seiten beeinflussen kann?
Sobald wir diese – angeblich dialektische – Antwort geben, kann von einer philosophischen Positionierung, einer, um es mit Hegel zu formulieren, »Stellung des Gedankens zur Objektivität«48, nicht mehr die Rede sein. Denn dann sind nicht nur Subjektivität und Objektivität, Denken und Sein austauschbar, sondern jede Veränderung ist auch kontingent. Wenn ich nämlich daran glaube, dass mich meine Entscheidungen erst zu dem machen, was ich bin, aber umgekehrt das, was ich bin, erst zu denjenigen Entscheidungen führt, die mich zu dem machen, was ich bin, drehe ich mich offenbar im Kreis, und nichts wäre gewonnen. An keiner Stelle könnte es irgendeine willentliche Veränderung geben.
*
Wo liegt hier also der Fehler? Liegt er bei Clinton: Unsere Individualität sei das Resultat unserer Entscheidungen? Oder liegt er bei Fichte: Unsere Entscheidungen seien das Resultat unserer Individualität? Er liegt zunächst bei jeder dieser beiden Auffassungen selbst. Sie sind beide inkonsistent. Aber wenn man ihre Inkonsistenz beseitigen will, ohne beim jeweils entgegensetzten Satz Anleihen machen zu wollen, werden die Sätze in sich widersprüchlich. Also kann die nächste Konsequenz nur sein, dass beide Sätze zugleich wahr sein müssen. Aber genau diese Konsequenz führt uns, wie gezeigt, in einen Zirkel, der dem schon angesprochenen Zirkel der Reflexion auf verblüffende Weise ähnelt.
Clintons Satz ist inkonsistent, weil sie mit ihm, wenn sie ihn streng verstehen würde – was ich hier voraussetze –, nicht erklären kann, wie überhaupt Entscheidungen zustande kommen. Entscheidungen entstehen ja nicht aus dem Nichts. Selbst als willkürliche Entscheidungen müssen sie noch in einem bestimmten Kontext und von einer bestimmten Person gefällt werden. Legt man nun aber diese Bedingungen des Kontextes und der Person einer jeweiligen Entscheidung zugrunde, wird die Behauptung, unsere Individualität sei das Resultat unserer Entscheidungen, in sich widersprüchlich. Sie kann nicht mehr aufrechterhalten werden und zwingt uns dazu, Fichtes Satz: unsere Entscheidungen seien das Resultat unserer Individualität, in Erwägung zu ziehen.
Aber auch Fichtes Satz ist inkonsistent, weil er mit ihm, wenn er ihn ebenfalls streng verstehen würde – was ich hier voraussetze –, nicht nur seine Theorie absoluter Freiheit aufgeben müsste (die er tatsächlich vertreten hat), sondern auch nicht mehr erklären kann, wie Freiheit überhaupt möglich ist. Sind nämlich Entscheidungen das Resultat unserer Individualität, so sind sie offenbar von der jeweiligen Individualität der Person, die sie fällt, bedingt. Und wenn sie nicht nur nicht ohne (oÙk ¢noi), sondern auch durch (di£) eine individuelle Person gefällt werden sollen, so sind sie sogar vollständig durch die Individualität dieser Person bestimmt. Freiheit wäre als solche und im Ganzen unmöglich.
Die Frage, die hier gestellt wurde, war aber die nach den willentlichen Veränderungen sowohl des Denkens als auch des Seins, also nach solchen, in denen Freiheit eine konstitutive Rolle spielt. Das heißt, die Frage nach dem Verhältnis von Denken und Sein, Sprache und Welt, Subjekt und Objekt, Dezision und Individuation war von Anfang an als Frage nach dem Verhältnis von Freiheit und Unfreiheit konzipiert worden. Und die einzige Alternative, die uns am Ende, im Orientierungsrahmen all dieser binären Verhältnisbestimmungen, blieb, war dann die, anzunehmen, dass sich Freiheit und Unfreiheit in diesem Rahmen nicht ausschließen, sondern gegenseitig bedingen.
*
Auf der einen Seite haben nämlich unsere eigenen Lebensentscheidungen und ihre Folgen tatsächlich prägenden Einfluss auf unsere Persönlichkeit; wir sind also frei. Aber andererseits hat auch wiederum unsere Persönlichkeit mit all ihren Facetten wesentlichen Einfluss auf unsere Entscheidungen; wir sind also auch unfrei. Was bedeutet es dann aber, dass wir in den oben genannten Zirkel geraten? Sobald man mit Foucault danach fragt, wie willentliche, nicht kontingente Veränderungen im Denken oder im Sein möglich sind (kontingente sind immer möglich), erkennt man, dass der Fehler nicht in der These der Wechselseitigkeit liegt (diese ist durchaus angemessen), sondern in der mangelnden Präzision dieser These.
Die Annahme der Wechselseitigkeit führt nämlich zu einer Täuschung des Denkens. Sie verführt das Denken dazu anzunehmen, Freiheit und Unfreiheit seien insofern das Gleiche, als sie in einem symmetrischen Verhältnis zueinander stünden: Freiheit sei die Negation von Unfreiheit und umgekehrt; das eine sei also gewissermaßen, nur mit umgekehrtem Vorzeichen, das andere. Tatsächlich handelt es sich aber um eine radikale Ungleichheit, um eine Asymmetrie: Denn Freiheit ist nur unter der Voraussetzung möglich, dass es bereits bestimmte Kontexte und eine gewachsene Persönlichkeit gibt, die selbst nicht durch sie konstituiert sind, so dass, umgekehrt, Freiheit keine notwendige Voraussetzung von Unfreiheit sein kann. Vielmehr ist Unfreiheit eine notwendige Voraussetzung von Freiheit.
Anders gesagt, Unfreiheit lässt sich ohne eine ihr ontologisch inhärierende Freiheit denken, nicht jedoch Freiheit ohne Unfreiheit. Denn weil der Mensch immer auch Teil der materiell-stofflichen Welt ist, d. h. stets mit einem ontologischen Vorrang von Objektivität konfrontiert ist (s. o.), unterliegt er, wie jedes andere Ding und Lebewesen auch, den Kontingenzen und Kausalitäten, die in einer solchen Welt herrschen und von denen er sich immer nur bedingt frei machen kann. Freiheit ist also, wenn sie realisiert wird, immer nur bedingte Freiheit, solche, die der vorherrschenden Unfreiheit abgerungen wird; sie ist immer auch – und zunächst – negative Freiheit und kann deshalb niemals nur positive, unbedingte Freiheit sein. Aber unbedingte Unfreiheit ist als solche durchaus möglich.
Weil also Unfreiheit aus den angegebenen Gründen eine conditio sine qua non von Freiheit ist (Entscheidungen müssen stets in einem bestimmten, natürlichen, aber auch sozialen Kontext und von einer bestimmten, natürlichen, aber auch sozialen Person gefällt werden), geht Freiheit aus Unfreiheit hervor; sie ist, wie ich in vager Anknüpfung an Emergenz-Theorien behaupten möchte, ein Emergent von Unfreiheit. Aber umgekehrt geht Unfreiheit nicht aus Freiheit hervor. Sie ist, weil Freiheit für sie keine conditio sine qua non ist, ein Implement von Freiheit. Oder anders gesagt: Keine Freiheit [ist] ohne Unfreiheit [möglich], aber Unfreiheit ohne Freiheit.
*
Nimmt man an, das Menschheitsprojekt einer universalen Realisierung unbedingter Freiheit laufe darauf hinaus, den Menschen von allen natürlichen (Zwangs-)Verhältnissen zu befreien, in denen er jahrtausendelang gelebt hat, so könnte man behaupten, es ginge hier am Ende darum, alle Unfreiheit in Freiheit zu verwandeln, d. h. gesellschaftliche Verhältnisse zu schaffen, in denen überhaupt kein Zwang mehr herrscht. Dann wäre Freiheit ohne jede Unfreiheit nicht nur möglich gewesen, sondern auch real geworden. Der Grundsatz »Keine Freiheit ohne Unfreiheit, aber Unfreiheit ohne Freiheit« wäre widerlegt.
Aber darin liegt erneut eine Täuschung. Die erste Täuschung bestand in der Annahme einer Symmetrie von Freiheit und Unfreiheit; die zweite, hier vorliegende besteht darin, konkrete Unfreiheit könne durch freies Handeln vollständig in konkrete, materielle Freiheit verwandelt werden. Aber das ist abwegig: Alle Verhältnisse, in die Einzelne hineingeboren werden, sind, ob sie nun gesellschaftliche oder natürliche Verhältnisse sind, zunächst für jeden dieser Einzelnen Zwangsverhältnisse. Er muss sich ihnen stellen und sich an ihnen abarbeiten, ob er will oder nicht. Und er muss auch die Freiheit haben, sich gegen sie zu stellen, wenn er sie in sein eigenes Verständnis von Freiheit nicht einbauen kann.
Die Realisierung allgemeiner Freiheit ohne Unfreiheit ist also unmöglich. Der Versuch dazu würde – paradox – in einem Totalitarismus der Freiheit enden, Freiheit also in Unfreiheit umschlagen. Tatsächlich ist der Einzelne zur Akzeptanz von Verhältnissen gezwungen, die zwar, wenn die Voraussetzung stimmt, aus Freiheit, z. B. auf demokratischer Grundlage geschaffen wurden, aber weder eine inhaltliche Garantie für Freiheit bieten noch auch formal garantieren können, dass nachfolgende Generationen sich mit ihnen arrangieren. Denn was Freiheit ist und wie sie gesichert werden kann, ist und muss, gerade um willen der Freiheit, historisch offenbleiben, d. h. kann immer nur negativ formuliert werden.
1.7. Freiheit als Widerstand
»Keine neue Welt ohne neue Sprache« heißt also nicht – wie man den linguistic turn auch verstehen könnte (und viele haben ihn damals so verstanden) –, dass die Logik der Sprache fundamental ist, dass die symbolische Ordnung die einzige und die letzte Ordnung ist, dass Alles auf Eines und Eines auf Alles zurückgeführt werden kann. Im Gegenteil: Mit einem zurückführenden Denken können wir heute, im Denken, genauer im Denken des Denkens, immer weniger operieren. Die Fäden der Welt sind nicht monofaktoriell, sondern multifaktoriell gespannt, das heißt, die Metapher, die in solcher Redeweise mitschwingt: die Sprache sei ein Faden- oder Netzwerk – und insofern hatte der linguistic turn durchaus seine Berechtigung – ist, in der Tat, nur eine Metapher.





























