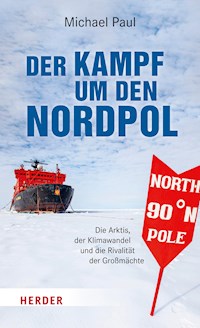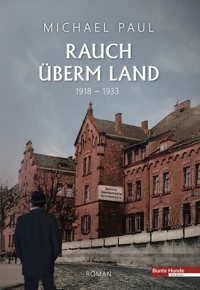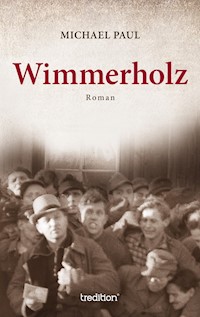7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Schwarzwald im Winter 1944 – Marie Heumann ahnt nicht, dass sie in Lebensgefahr gerät, als ihr im Lebensborn-Heim der SS in Nordrach die sechsjährige Alma anvertraut wird. Zur gleichen Zeit hat der von Maries elterlichem Hof geflohene Zwangsarbeiter Pawel nur ein Ziel: Reichsführer SS Heinrich Himmler, der sich mit seinem Sonderzug in Triberg versteckt. Den Polen treibt der Hass zu einem teuflischen Plan. Als Maries und Pawels Weg sich auf dramatische Weise kreuzen, hängt ihr beider Leben an einem seidenen Faden.
Nach »Wimmerholz« und »Das Haus der Bücher« spielt Michael Pauls neuer, spannender Roman diesmal im Schwarzwald. Wieder basiert der Roman auf wahren, oft nicht bekannten Begebenheiten.
»Mit jedem seiner historisch unterfütterten Romane meistert Paul versiert den Spagat zwischen spannender Unterhaltung und anspruchsvoller Wissensvermittlung. In lebendiger Sprache versteht er, die Ergebnisse aufwendiger Recherchen in spannungsgeladene und dramatische Geschichten zu verpacken.« - Lahrer Zeitung -
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Versteckt im Schwarzwald
BookRix GmbH & Co. KG81371 München1
Ihre Verzweiflung hallte ein weiteres Mal den langen, hohen Gang des Heims entlang. Nur eine Frau konnte trotz vollkommener Erschöpfung aus tiefstem Inneren so kräftig und schmerzvoll zugleich schreien. Dabei waren diese Schreie an sich im Heim ›Schwarzwald‹ nichts Ungewöhnliches.
Dafür war das Lebensborn-Heim in Nordrach von der SS eingerichtet worden: um Kinder zur Welt zu bringen. Heime des SS-Lebensborn-Vereins im ganzen Reich, von Österreich bis Norwegen, kümmerten sich darum, dass deutsche Frauen uneheliche Kinder arischen Blutes zur Welt bringen konnten, statt sie heimlich abzutreiben. Oder aber dass Kinder aus dem Osten, die wenigstens arisch aussahen, ihren Eltern entrissen und umerzogen, »arisiert« wurden. Die Herrenrasse brauchte mehr Nachwuchs! Dafür war jedes Mittel recht. Und manche Mutter war froh, in einem Heim fern der Heimat Hilfe zu bekommen, um möglichst unentdeckt entbinden zu können. So war es auch in diesem Fall.
Doch diese Geburt verlief nicht reibungslos wie sonst bisher alle Geburten in dem Heim. Selbst Gertrud Dörflinger, die Hebamme, die schon unzähligen Kindern auf die Welt geholfen hatte, war überrascht worden. Natürlich hatte sie die komplizierte Steißlage schon vor Wochen festgestellt, war aber überzeugt gewesen, dass sich das Kind mit ihrer Hilfe noch drehen lassen würde. Doch dann hatten bei Irene Hartwig plötzlich die Wehen eingesetzt und die Fruchtblase war geplatzt, viel zu früh, zur falschen Zeit. Sonst wäre Dr. Feger, der Bereitschaftsarzt aus Zell, an diesem Nachmittag im Oktober 1944 sicher im Heim geblieben. Er war der Einzige, der im Ernstfall das Leben von Mutter und Kind mit einem Kaiserschnitt retten konnte. Seine Diagnose hatte die Einschätzung der erfahrenen Geburtshelferin bestätigt, dass bis zur Geburt noch gut zwei oder drei Wochen Zeit waren. Angesichts der gefährlichen Lage des Fötus kam auch eine sonst angezeigte Zangengeburt nicht infrage. Die Hebamme drückte nach dem Nachlassen der letzten Wehe das Hörrohr auf den Bauch der Frau.
Marie Heumann, die junge Krankenschwester, die Irene Hartwig die letzten Wochen betreut hatte, saß am Kopfende der Liege und tupfte mit einem kühlen, feuchten Tuch den Schweiß von Irenes rot angelaufenem Gesicht ab. Durch den Druck waren sämtliche Äderchen in den Augen geplatzt und ihre Augäpfel blutrot. Marie hob Irenes Oberkörper sanft an und zog das Kissen zurecht. Dann ließ sie sie langsam zurück auf die Liege sinken. Nur mit Mühe konnte die völlig erschöpfte Frau unter den zitternden Lidern die Augen offenhalten. Auch ihr Kreislauf hielt der Anstrengung kaum noch stand.
»Du weißt, was du mir versprochen hast, Marie?«, flüsterte Irene schwach zwischen zwei mörderischen Wehen.
Marie nickte ihr zu und warf dann der Hebamme einen fragenden Blick zu. Gertrud Dörflinger legte das Hörrohr weg und schüttelte unmerklich den Kopf. Dann signalisierte sie Marie, Irene gut festzuhalten. Friedgard Lotz, die Oberschwester, trat hinzu und beugte sich zu Irene herunter. Sie war erst vor wenigen Minuten hinzugekommen und hatte das Geschehen zunächst nur beobachtet. Mit einem leisen, aber klaren »Festhalten!« gab sie jetzt das Kommando. Marie und sie hielten jeweils die Schulter und Hand der Frau auf einer Seite fest. Im gleichen Moment versuchte die Hebamme, mit einem kräftigen Druck auf den Bauch den Fötus zu drehen. Irenes Körper bäumte sich auf, sie stieß einen entsetzlichen Schrei aus und Marie und die Oberschwester mussten alle Kraft einsetzen, um Irene festhalten zu können. Dann löste sich plötzlich die Spannung und Irene sackte zusammen. Marie sah Oberschwester Lotz ernst an. Sie erkannte Panik in ihrem Blick, denn Irene Hartwig war nicht irgendeine Schwangere.
»Wo verdammt noch mal bleibt dieser Dr. Feger?« Der Ton der Oberschwester ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie keine besondere Wertschätzung für den »Dorfgynäkologen« empfand, wie sie den Arzt despektierlich nannte. Für sie war klar, dass ihr mit ihrer über dreißigjährigen Erfahrung kein Arzt etwas vormachen konnte. Jeden Kaiserschnitt würde sie besser machen, wenn man es ihr nur erlauben würde. Aber sie war Oberschwester, keine Ärztin. Ein Makel, den sie ihr Leben lang wohl nicht mehr verwinden würde und deshalb jeden Arzt spüren ließ.
»Ich habe den Hausmeister geschickt, ihn in Zell zu suchen und schleunigst herzubringen«, sagte die Hebamme. Rund einhundertachtzig Mütter hatten bisher ihre Kinder unter ihrer Verantwortung zur Welt gebracht und fast alle kerngesund. Ernsthafte Komplikationen hatte es selten gegeben. Zumal die medizinische Versorgung im Vergleich zu den in den Dörfern oft noch üblichen Hausgeburten deutlich besser war. Bei zu erwartenden Problemen war stets der Arzt anwesend gewesen, doch kriegsbedingt gab es keinen festen Heimarzt mehr, sondern nur noch einen Bereitschaftsarzt, der das Heim zusätzlich zu seiner eigenen Praxis betreute. Die medizinische Versorgung war daher nicht mehr so, wie Friedgard Lotz das für die Erfüllung ihrer Pflicht eigentlich erwartete. Die regelmäßigen Beschwerden des Heimverwalters über diesen Zustand in der Zentrale des Lebensborns in München waren allesamt ohne Erfolg geblieben. Der Krieg, mittlerweile im sechsten Jahr, hatte überall im Reich längst zu einer dramatischen medizinischen Unterversorgung geführt. Eine weitere Not der Menschen neben Hunger, Kälte, Armut und einem Leben in ständiger Angst. Sie mussten froh sein, dass sie überhaupt einen Arzt im Heim hatten.
In aller Eile war der Hausmeister des Heims, Ludwig Nickel, wenige Minuten zuvor mit seinem Lieferwagen die Einfahrt hinuntergerast. Zum Glück lag trotz der Kälte der Oktobernächte kaum Schnee auf der Straße. Der zu erwartende Winter, hart und schneereich, kündigte sich gerade erst an. In weitläufigen Kurven schlängelte sich die schmale Straße rund acht Kilometer das Tal entlang bis nach Zell. Dort traf es mit dem Harmersbachtal zusammen und mündete bei Biberach in das breite Kinzigtal. In Zell hatte Dr. Feger seine eigene Praxis und wohnte in einer kleinen Wohnung direkt darüber. »Nickelchen«, wie die Lernschwestern und jungen Vorschülerinnen den Hausmeister liebevoll nannten, schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass er Dr. Feger zu Hause oder in der Praxis antreffen würde. Er würde ihn ins Heim fahren und das schnell, sehr schnell!
Irene Hartwig war erst vier Wochen zuvor unter äußerst ungewöhnlichen Umständen in dem Heim in Nordrach angekommen. Nickel hatte an diesem Tag damals ein Fräulein Biermann aus Hannover am Bahnhof in Biberach abholen sollen, die das uneheliche Kind eines Gauleiters in sich trug. Doch diese war nicht im angekündigten Zug gewesen. Das Reisen mit der Eisenbahn war schon lange nicht mehr so zuverlässig, wie es noch vor dem Krieg gewesen war. Stattdessen hatte der Schaffner einen Notfall und einer anderen schwangeren Frau aus dem Zug geholfen, die sich offenbar unter Schmerzen im Bauch krümmte. Der Hausmeister war dem Schaffner zu Hilfe geeilt und hatte die Frau gestützt. Diese hatte sich zwischen zwei Wehen als Irene Hartwig aus Berlin vorgestellt, während noch ein kleines Mädchen in einem geblümten blauen Kleid mit einem braunen Koffer in der Hand aus dem Zug kletterte. Kaum hatte Nickel das Kind entdeckt, das die Hand der stöhnenden Frau ergriff, ertönte bereits ein lauter Pfiff, der Bahnbeamte sprang in den Zug und dieser setzte sich in Bewegung.
»Tut mir leid! Wir haben Verspätung! Kümmern Sie sich um die Frau!«, hatte er Nickel noch zugerufen, bevor der Zug den Bahnhof verlassen hatte. Nachdem außer ihnen nur noch drei ältere Männer und eine Bäuerin mit einer Gemüsekiste in Händen auf dem kleinen Bahnsteig zurückblieben, hatte Nickel den Entschluss gefasst, die Frau mit dem Kind schnellstens ins Heim zu fahren. Wo, wenn nicht da, konnte ihr geholfen werden. Zumal der Heimarzt Dr. Feger zu dem Zeitpunkt im Heim war und nicht in seiner Praxis in Zell.
»Dort vorne ist das Lebensborn-Heim«, hatte Nickel während der Fahrt gesagt und geradeaus durch die Windschutzscheibe gezeigt. Frau Hartwigs Schmerzen waren in dem Moment offenbar gerade erträglicher und sie für eine Ablenkung dankbar. Alma hatte sich auf der Rücksitzbank ducken müssen, um etwas sehen zu können. Herrschaftlich erhob sich das dreigeschossige Gebäude wie ein kleines Schloss über den Ort. Ein mit vielen Gauben versehenes, hohes Dach zierte das beeindruckende, im Stil des Historismus errichtete Haus. Alma rutschte vor Aufregung auf der Bank hin und her, als sie das »Märchenschloss« erblickte. Im Zug hatte sie lange geschlafen, doch jetzt war sie hellwach. Schon der Schreck im Zug, als Irene Hartwig nach dem Umsteigen in Offenburg plötzlich so starke Schmerzen bekommen hatte, hatte sie in Aufregung versetzt. Rot leuchtete der Buntsandstein des Erdgeschosses, der kleinen Pilaster und der Fenstereinfassungen des Hauses in der nachmittäglichen Sonne. Bei den Wandfassaden der oberen Stockwerke hatte sich der Bauherr Anfang des Jahrhunderts für gelben Greppiner Ziegel entschieden, der in dieser Region eher ungewöhnlich war. Irene Hartwig erkannte diese Steine aus Hunderten, denn sie waren auch an der Fassade des Anhalter Bahnhofs in Berlin verbaut und hatten ihr dort immer schon gut gefallen. Manchmal blitzte in ihr noch ein Funke ihrer Begeisterung für Architektur auf. Wenn sie sich nicht anders hätte entscheiden müssen, hätte sie zweifelsfrei Architektur studiert. Aber letztlich hatte sie ihre Entscheidung für einen anderen Weg nie bereut.
Der Eingang des Hauses war integriert in den Treppenhausturm mit einem hohen und breiten Dach. Über den hohen Fenstern des Treppenhauses hatte das oberste Dachgeschoss des Turms einen kleinen Balkon. Der erhabene Standort des großen Hauses oberhalb der Kirche und des Friedhofs auf der anderen Seite der Dorfstraße und sein rau-romantisches Erscheinungsbild dominierten den Anblick des Ortes.
Nickel spürte, dass etwas Ablenkung der Frau half und erzählte mehr zu dem Haus. Das ›Juden-Sanatorium‹ oder das ›Rothschild‹ nannten es die Nordracher, obwohl die SS das Gebäude schon seit November 1942 als ›Lebensborn-Heim Schwarzwald‹ nutzte. Das Haus war bis zum »Einzug« durch die Nationalsozialisten, wie der Fahrer sich ausdrückte, das jüdisch-orthodoxe Rothschild-Lungensanatorium gewesen. Ununterbrochen hatte er die ganze Fahrt geredet, ihnen erzählt, dass er oft Leute am Bahnhof abhole und dass man doch nur nach Nordrach käme, wenn man dort lebte oder arbeitete. Ansonsten wäre man Patient oder Kurgast in einer der über die Landesgrenzen hinaus bekannten Tuberkulose- und Lungenheilanstalten. Seit Beginn des Jahrhunderts boten die Kliniken vielen Leuten Arbeit. Die Patienten und Kurgäste, so hatte er berichtet, kämen meist mit der Schwarzwaldbahn, die in Offenburg die Fahrgäste von der badischen Hauptbahnstrecke übernahm und in Biberach wieder absetzte. Meist nähme er seine Fahrgäste und deren Gepäck dann dort in Empfang. Er hatte über die Schulter zu dem kleinen Mädchen geschaut, während er von der Schwarzwaldbahn geschwärmt hatte, wohl in der Annahme, dass es das Kind besonders interessieren würde.
»Die Bahn fährt von hier über Hornberg und Triberg in siebenunddreißig Tunneln den Schwarzwald hinauf!«
Doch längst hatte Irene Hartwig wieder aufgehört, seinem Vortrag zu folgen und mit schmerzverzerrtem Gesicht aus dem Fenster gesehen. Durch die etwas versteckte Lage war das Tal von Krieg und Fliegerangriffen bisher offensichtlich verschont geblieben.
»Nur ab und zu fliegt eine feindliche Bomberformationen in größerer Höhe über das Tal hinweg«, erklärte der Chauffeur, als sie von der Straße abbogen. »Die fliegen andere Ziele an, interessantere, Offenburg, Straßburg und so.«
»Na Gott sei Dank«, bemerkte Irene Hartwig, als ein nächster schwerer Krampf sie aufstöhnen und das Bewusstsein fast verlieren ließ.
Vorsichtig steuerte Nickel den Wagen die Auffahrt hinauf, hielt vor dem Eingang, riss die Tür auf und rannte nach Hilfe rufend ins Haus.
Zwei Stunden nach der Ankunft und der medizinischen Erstversorgung der unbekannten Schwangeren war Marie zu Steiner bestellt worden. Wie immer, wenn sie das Büro des SS-Oberscharführers betreten musste, hatte sie einen Kloß im Hals gehabt. Es bedeutete selten etwas Gutes für jemanden des Pflegepersonals, wenn man zum Verwalter gerufen wurde. Mit zweiunddreißig Jahren war Steiner für einen Heimleiter noch erstaunlich jung. Umso strenger führte er jedoch »sein Regiment«, wie er sich ausdrückte, wenn er vom Heim sprach. Nordrach sollte für ihn das Karrieresprungbrett in der SS sein. Heinrich Himmler würde irgendwann von dem von ihm geführten Vorzeigeheim erfahren, davon war er überzeugt. Die Schwestern vermuteten, dass in höheren SS-Etagen jemand saß, der Steiner protegierte, was sie generell dazu veranlasste, möglichst einen großen Bogen um diesen Mann in seiner schwarzen Uniform zu machen.
Zu Maries Überraschung erwartete sie im Büro Steiners auch Oberschwester Lotz mit ernstem Gesicht. Ein Gespräch alleine mit Wilhelm Steiner war an sich schon immer unangenehm. Doch wenn auch noch die Oberschwester dabeisaß, musste sie schon einen großen Fehler begangen oder gegen die strenge disziplinarische Ordnung verstoßen haben. In diesem Fall erwartete sie sicher eine heftige Standpauke oder eine ausführliche Belehrung und am Ende hatte man sich für die ausgesprochene Strafe zu bedanken. Marie ging in Windeseile die letzten zwei, drei Tage durch, die Geburten, die anderen ihr übertragenen Aufgaben. Beschwerden und besondere Vorkommnisse hatte es aber eigentlich nicht gegeben. Alles war ganz normal und unauffällig gewesen. Vielleicht die zickige Mutter aus Zimmer 212 mit ihrem rheinischen Dialekt? Sie hatte sich beschwert, weil ihr der Hagebuttentee nicht geschmeckt hatte, er erst zu heiß und dann zu kalt gewesen sei. Typische Stimmungsschwankungen der werdenden Mütter, mit denen sie in der Regel gelassen und freundlich umgehen konnte. Aber das war auch schon alles, was ihr einfiel. So holte sie einmal tief Luft und versuchte, sich damit ein wenig zu beruhigen. Sie war sich nun sicher, dass es einen anderen Anlass für das Gespräch geben musste. Obwohl man sich als Schwester natürlich nie sicher sein konnte. Vielleicht hatte sich ein Kindsvater beschwert? Über die Väter erfuhren die Schwestern in der Regel nichts. Es konnte ein hochrangiger Offizier der SS sein, ein einflussreicher Amtmann, ein Universitätsprofessor oder ein Fabrikdirektor. Einmal war der uneheliche Vater sogar ein Olympiasieger von 1936 gewesen. Meist kannte sie im Heim aber nur die Mütter. Mit einem unguten Gefühl im Magen ging sie auf den Schreibtisch zu.
»Bitte nehmen Sie Platz, Schwester Marie!«, sagte die Oberschwester und deutete auf den Stuhl neben sich. Marie setzte sich, während Steiner noch in Papieren blätterte, die vor ihm auf dem großen Schreibtisch lagen.
»Schwester Marie«, begann er mit ernstem Ton. »Wie Sie ja wissen, hatten wir heute einen unerwarteten Neuzugang.«
»Ja, das Fräulein Bierbaum, oder?« Marie sah ihn fragend an.
»Nein, die Dame ist beim Umsteigen vor Frankfurt nicht weitergekommen. Wir erwarten sie morgen oder übermorgen hier.« Er machte eine kurze Pause. »Es handelt sich um eine Dame aus Berlin. Herr Nickel hat sie vom Bahnhof mitgebracht. Sie haben sie ja bei der Ankunft schon gesehen. Sie hatte Vorwehen, ist aber jetzt wieder zur Ruhe gekommen und schläft. Ihr Name ist Irene Hartwig. Wohin sie ursprünglich reisen wollte, wissen wir noch nicht. Sie wird auf jeden Fall bis zu ihrer Geburt nun hierbleiben müssen. Eine weitere Reise ist für sie viel zu gefährlich. Und wir wollen ja nicht, dass sie ihr Kind noch verliert!«
Marie nickte. Dann fuhr Steiner fort.
»Es bedarf in diesem Fall einer, sagen wir, besonderen persönlichen Betreuung. Oberschwester Lotz und ich glauben, dass Sie die Richtige dafür sind.« Er machte eine kurze Pause und sah Marie streng an. Dann fuhr er fort. »Es gibt eine Besonderheit, denn diese Dame, Frau Hartwig ...«
»Fräulein!«, korrigierte ihn die Oberschwester.
»Natürlich!« Er räusperte sich. »Fräulein Hartwig hat ein kleines Mädchen mitgebracht, um das Sie sich bitte ebenso kümmern werden. Ein Kind in dem Alter bringt nur Unruhe. Zumal wir noch nicht genau wissen, wen uns da Nickel ins Haus gebracht hat. Ich will hier Ordnung im Haus haben! Fräulein Hartwig bekommt mit dem Mädchen das Zimmer 307. Wenn die Frau mit ihrem Kind das Zimmer verlässt, sind Sie bitte immer dabei. Das gilt für den Speisesaal oder wenn sie im Park spazieren gehen. Das Gelände wird die Frau mit dem Kind in der Zeit ihres Aufenthaltes nicht verlassen.« Steiner senkte das Kinn und sah Marie ernst an. »Haben Sie das verstanden?«
Marie nickte, überrascht von der ungewöhnlichen Aufgabe. Sie wusste nur zu gut, dass Steiner alles hasste, was den normalen Ablauf stören konnte.
»Wenn Fräulein Hartwig sich ausruhen will oder bei der Hebamme oder Dr. Feger ist, kümmern Sie sich derweil um das Kind. Solange Fräulein Hartwig bei uns weilt, sind Sie soweit dafür notwendig von allen anderen Aufgaben entbunden. Brauchen Sie Hilfe, wenden Sie sich ausschließlich an die Oberschwester oder mich! Habe ich mich klar ausgedrückt?« Sein Ton war eindringlich und die Frage rhetorischer Art.
Marie sah ihn an und nickte erneut. »Jawohl, Herr Steiner.«
Steiner fuhr fort: »Das Mädchen heißt Alma und ist sechs Jahre alt. Mehr weiß ich auch nicht. Und ich erwarte Diskretion. Wer weiß, wer das ist. Dass mir da keine Klagen kommen!«
Marie nickte. Die ungewöhnlich strengen Anweisungen des Verwalters irritierten sie. Die Aufnahme neuer Mütter war ansonsten ein reiner Routinevorgang. Vielleicht, so dachte sie, war dieses Fräulein Hartwig ja in Wirklichkeit eine Prominente. Oder aber die heimliche Geliebte eines besonders reichen oder wichtigen Herren. Was sie erwartete, wenn ihr ein Fehler unterlaufen sollte, wollte sie sich lieber nicht vorstellen.
»Dann können Sie an die Arbeit gehen. Danke!«, sagte Steiner bestimmt.
»Vielen Dank, Herr Steiner«, sagte Marie, stand auf, nickte der Oberschwester zu und ging zur Tür.
»Ach, Schwester Marie!«, sagte diese und stand auf.
Marie drehte sich um. »Bis zur Abreise der Dame gilt für Sie ab sofort ein striktes Ausgangsverbot. Sie sind rund um die Uhr für die beiden da. Bitte holen Sie ihre persönlichen Sachen aus ihrer Kammer. Sie werden gleich in das kleine Zimmer neben 307 umziehen. Herr Nickel installiert dort gerade eine Klingel.«
»Aber meine Mutter sollte ...«
Friedgard Lotz nickte. »Wir werden sie darüber informieren, dass Sie die nächsten Wochen im Heim unabkömmlich sind.«
Natürlich waren die Umstände ungewöhnlich und die persönlichen Einschränkungen streng, doch gleichzeitig fühlte Marie sich auch etwas geehrt, dass Steiner und Lotz ausgerechnet sie für diese wichtige Aufgabe ausgewählt hatten. Nun war Marie neugierig auf die beiden, die ihr da anvertraut wurden.
»Ich bin Alma«, begrüßte sie das Mädchen flüsternd, als Marie das Zimmer das erste Mal betrat. Das Kind streckte Marie die Hand hin.
»Hallo, Alma«, sagte Marie und ergriff ihre Hand »Ich bin Marie.«
In dem Moment öffnete Irene Hartwig im Bett ihre Augen.
»Sie kümmern sich um uns?«, fragte sie, noch etwas schwach.
»Ja, dafür bin ich da«, antwortete Marie. »Nennen Sie mich bitte Marie!« Marie sah der Frau in die Augen und spürte, dass diese Frau aus Berlin keine gewöhnliche Schwangere war, dass etwas anders war, als sie es schon so viele Male bei neuankommenden Schwangeren erlebt hatte. Es war nur ein erstes unklares Gefühl. Und tatsächlich sollte sich zwischen den Frauen bis zu der schwierigen Geburt eine außergewöhnlich freundschaftliche, ganz vertraute Beziehung entwickeln. Was auch für Alma galt, die Marie schnell in ihr Herz geschlossen hatte.
Ein weiterer, alles durchdringender Schrei hallte durch den Kreißsaal. Marie sah die Hebamme hilfesuchend an, während diese zwischen den Schenkeln der Gebärenden hantierte. Deren sorgenvoller Blick bestätigte Maries schlimmste Befürchtungen. Sie hielt Irenes Hand, während diese sie mit weit aufgerissenen Augen flehend anstarrte. Marie strich ihr die auf ihrer Stirn klebenden Haare zur Seite, als die nächste Presswehe ihr die letzten Kräfte raubte. Jetzt fühlte Marie schmerzlich, dass sie zugelassen hatte, dass zwischen ihr und Irene in den vorangegangenen Wochen ein engerer persönlicher Kontakt entstehen konnte, als es für Krankenschwestern gut war. Bei der nächsten Wehe versagte Irene Hartwig das Herz und die Verkrampfung löste sich. Marie spürte, wie der Händedruck schlagartig nachließ. Irenes Körper verlor mit einem tiefen letzten Seufzer die Spannung. Marie ließ ihre Hand los, während ihr dicke Tränen über die Wangen liefen. Für einen Moment war es still im Kreißsaal, totenstill. Alle starrten die Tote vor sich an. Entsetzt sah Marie zu der Hebamme auf.
»Und das Baby?«
Doch die Hebamme schüttelte nur stumm den Kopf. Marie schrie vor Schmerz und Trauer laut auf.
»Schwester Marie! Das ist doch nicht Ihre erste Geburt!«, raunzte die Oberschwester sie an, die sich scheinbar als erste im Raum wieder gefangen hatte. Doch auch Friedgard Lotz hatte ein Zittern in der Stimme. Sie räumte fahrig verschiedene Utensilien auf.
Was würde der Tod der Frau für das Heim bedeuten, welche Folgen würde er haben? Und was würde mit dem Mädchen geschehen, das ahnungslos oben in seinem Zimmer saß? Die Oberschwester konnte die Situation zum ersten Mal in ihrem Berufsleben nicht erfassen, aber Schwäche oder Verunsicherung zeigte eine Oberschwester nicht, niemals, schon gar nicht gegenüber »ihren Mädchen«, wie sie die Schwestern nannte! Marie wischte sich die Tränen vom Gesicht, während die Hebamme mit der Hand über das Gesicht der Toten strich und ihr die Augen schloss.
»Schwester Marie, gehen Sie hoch und kümmern Sie sich um das Mädchen. Aber kein Wort darüber zu ihr! Ich komme später zu Ihnen.«
Marie nickte und strich der Toten noch einmal übers Haar. Dann verließ sie den Kreißsaal. Im Flur kam ihr Dr. Feger entgegengeeilt und blieb stehen, als er ihren traurigen Blick sah.
»Zu spät?«, fragte er. Marie lief wortlos an ihm vorbei.
2
Auf der Pritsche des die Talstraße entlangfahrenden Lastwagens saßen sechs zusammengekauerte Figuren in verdreckten, alten Jacken und mit gesenkten Köpfen. Die Hände hatten sie unter die Achseln oder in die löchrigen Jackentaschen gesteckt, um die Finger wenigstens etwas warm zu halten. Die Blicke der meisten Männer waren leer, wirkten apathisch und sie schauten auf den Pritschenboden vor sich. Ihre Gesichter waren so verdreckt wie ihre Hände und zeugten von Monaten harter Arbeit und wenig Essen. Wer sie sah, konnte nur erahnen, was diese Männer mit ihren schmalen Gesichtern und dunklen Augenringen für Strapazen hinter sich hatten und welch gutaussehende junge Kerle sie einmal in ihrer Heimat gewesen waren. Unter der Plane war es eiskalt und der Fahrtwind pfiff durch alle Ritzen. Zwei SS-Männer mit Gewehren saßen zur Bewachung bei ihnen. Sie rauchten eine Zigarette nach der anderen und bliesen den Qualm ab und zu höhnisch den Gefangenen ins Gesicht. Eine ernsthafte Gefahr, dass einer der erschöpften Polen oder Russen ausbrechen würde, bestand sowieso nicht, denn die Männer hatten eine dreitägige Fahrt in einem kalten Güterwaggon hinter sich, ohne ausreichend zu essen und zu trinken. Die Kälte ließ sie ruhig und wehrlos dasitzen.
»Wohin?«, fragte einer der Gefangenen mit östlichem Akzent. Er bekam keine Antwort.
Paweł Kulik, einer der Polen, hob den Kopf und drückte ihn gegen die kalte Plane. Er versuchte, durch einen Riss in der Plane etwas von der Landschaft zu erkennen.
Er war einmal ein fröhlicher, gut aussehender junger Mann gewesen. Hart und fleißig hatte er den kleinen Hof in Boborka bewirtschaftet, auf dem gemeinsam mit ihm seine alten Eltern und seine Schwester mit ihrem Kind gelebt hatten. Das kleine Bauernhaus bot der Familie nur drei bescheidene Stuben. Das Leben spielte sich in der Küche ab, dem einzigen Raum, in dem mit dem alten Holzherd geheizt werden konnte. Eine Stube mit großem Bett bewohnten seine Eltern, eine weitere Milena, seine Schwester, mit ihrer Tochter Anna. Er schlief in einer Kammer unter dem Dach. Arbeiten von morgens bis spät abends, das hatte ihm nie etwas ausgemacht. Bei Tagesbeginn früh raus, um sich um die Tiere zu kümmern, die Kühe, Schweine, Ziegen und Hühner, den Stall ausmisten, hatte zum festen Tagesablauf gehört. Dank eines kleinen Kartoffel- und Steckrübenackers sowie des Gemüsegartens hatten sie immer noch genug zu essen auf dem Tisch gehabt. Damit war es ihnen vergleichbar gut gegangen, denn die meisten Polen litten unter der Besatzung der Deutschen Hunger. Bis die Deutschen gekommen waren, war es ein armes, arbeitsreiches, aber auch gutes Leben gewesen. Er hatte an Gott geglaubt und ging mit der Familie jeden Sonntag in die Kirche. Sie waren arm gewesen, der Hof hatte wenig, aber doch etwas mehr abgeworfen, als sie selbst gebraucht hatten. Was übrig geblieben war, hatten sie auf dem kleinen Markt in Kraków, das die Deutschen jetzt Krakau nannten, am Ufer der Wisla, die sie jetzt Weichsel nannten, verkauft. Er liebte seine Familie, seine Heimat, den Hof, das Dorf und seine Freunde. Trotz der mörderischen, unberechenbaren Restriktionen der Deutschen war er dankbar gewesen. Die mörderischen Besatzer hatten zunächst ihrem Hof aus Gründen, die sich Paweł selbst heute nicht erklären konnte, nur selten einen räuberischen Besuch abgestattet und sich dabei noch gesittet benommen, zumindest bestand nie Lebensgefahr, wenn sie abgegeben hatten, was verlangt wurde.
Er hatte seine Eltern und seine Schwester gehabt und er war dem Herrn dafür dankbar gewesen, dass er ihn hatte zusehen lassen, wie seine kleine Nichte Anna von Tag zu Tag größer geworden war. Dieses liebe und lebensfrohe Mädchen war sein ganzer Stolz gewesen. Doch das alles existierte nicht mehr, war nur noch Erinnerung, grausame Erinnerung, unerträgliche Erinnerung. Er war noch keine dreißig Jahre alt und alles, einfach alles, war zu Ende.
Erneut blickte er durch den Riss in der Plane und der Wind schnitt ihm eisig ins Gesicht. Er sah neben der Straße die vorbeiziehenden, gefrorenen Felder, am Waldrand mit Schnee belegte, hohe Tannen, ab und zu einen Bauernhof am Hang. Diese sahen anders aus als in seiner Heimat, doch er kannte diese Hausform.
Die Bauernhäuser hier waren groß und hatten riesige, mit Holzschindeln belegte Dächer. An der Frontseite zum Tal hin zeigten kleine Fenster in dunklem Fachwerk den Wohnbereich. Im gemauerten Sockel waren die Türen mit rötlichen Steinrundbögen eingefasst. Eine führte offensichtlich zum Stall, denn eine Bäuerin zog gerade eine Kuh an einem Seil hindurch. Meist gab es ein, zwei kleinere Gebäude in unmittelbarer Nähe.
Er ahnte, wohin man sie brachte. Daheim hatte seine Mutter ein Bild von einem solchen Bauernhof vor einem Tannenwald in der Stube hängen. Es zeigte sie als junges Kind mit ihrer Mutter vor so einem über vierhundert Jahre alten Hof. Auf dem Bild lächelte sie vergnügt in die Kamera.
»Wir sind im Schwarzwald«, flüsterte Paweł seinem Freund Stanko zu, der neben ihm saß. Unvermittelt traf ihn ein Gewehrkolben in die Magengrube und Paweł krümmte sich vor Schmerz.
»Schnauze!«, blaffte ihn der Soldat an.
Nachdem der Hof, auf dem sie bisher hatten arbeiten müssen, nach einem Blitzeinschlag abgebrannt war, hatten sie ihn zusammen mit Stanimir und Kamil abgeholt und in ein Lager gebracht. Drei Tage später waren sie in den Zug verfrachtet worden.
Stanimir Banowski und Paweł kamen aus dem gleichen Dorf, aus Boborka. Sie waren zusammen zur Schule gegangen und während Paweł auf dem elterlichen Hof gearbeitet hatte, war »Stanko«, wie alle den lustigen, lebensfrohen Kerl nannten, Waldarbeiter geworden. Jeder im Dorf kannte seine schiefe Hakennase, die er sich bei einem Boxkampf im Streit um ein Mädchen mit einem rüden Kerl aus dem Nachbardorf zugezogen hatte. Stanko war meist froh gelaunt gewesen und hatte in allem das Gute gesehen. Wohl auch deshalb hatte er immer die schönsten Mädchen um sich, wenn sie einmal in der Woche abends in dem kleinen Wirtshaus von Boborka gegenüber Kirche und Friedhof zu einem Bier zusammengesessen waren. Neben dem sonntäglichen Gottesdienst und dem Kirchfest war die verqualmte Gaststube die einzige Abwechslung, die das Dorf zu bieten hatte. Stanko hatte ein Zimmer in einem alten Haus in einer Seitenstraße vom Dorfplatz bewohnt, gleich neben der Brücke über den Bach. Seine Eltern waren einige Jahre zuvor gestorben und so hatte er sich als Tagelöhner durchs Leben geschlagen. Er arbeitete im Wald, half bei der Ernte, reparierte geschickt Maschinen oder schleppte Möbel. Manchmal aber hatte er auch nur im Gras am Ufer des Dorfbachs gelegen, unter der alten Trauerweide, auf einem Grashalm gekaut und sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen.
Der Wagen hielt an und drei der Männer mussten aussteigen. Als der Lastwagen seine Fahrt wieder aufnahm, blieben auf der Pritsche nur noch Paweł, Stanko und Kamil und die beiden Wachmänner zurück.
Kamil Gurski war erst auf dem letzten Hof zu ihnen gestoßen. Er war Mitte vierzig, ein ruhiger und meist in sich gekehrter Charakter mit schmächtigem Oberkörper und dünnen Armen, der kaum richtig anpacken konnte. Er redete nur, wenn er musste und selbst dann waren es nur wenige Worte. Er war wie Stanko Waldarbeiter, was man sich bei seiner schmalen Statur gar nicht vorstellen konnte. Kamil war mit der polnischen Armee bei Danzig stationiert gewesen und hatte sich dort schon an einem der ersten Tage des deutschen Überfalls eine Kugel eingefangen. Diese hatte sein Fußgelenk durchbohrt und derart zertrümmert, dass es steif geblieben war und er seitdem hinkte. Und das hatte er nur dem Zufall und dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass ein Stabsarzt in dem Moment genug Zeit und Muße hatte, seinen Fuß zu richten, statt ihn abzusägen.
Mehr wussten Paweł und Stanko nicht über Kamil. Doch es tat gut, jemanden um sich zu haben, der aus der Heimat kam, dieselbe Sprache sprach und auf den man sich im Zweifelsfall verlassen konnte. In dieser Zeit war das alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Den Russen und Ukrainern trauten sie genauso wenig wie diese ihnen. Und die Franzosen, mit denen sie auf dem letzten Hof gewesen waren, waren ihnen ein Rätsel geblieben. Sie waren anders, fremdartig, benahmen sich in ihren Augen stets merkwürdig, hielten sich für etwas Besseres und waren nicht zu verstehen. Deshalb redeten die Polen oft nur mit ihresgleichen.
Stanko und Kamil verstanden gerade so viel Deutsch, wie es ein Zwangsarbeiter verstehen musste, während Paweł gut Deutsch sprach, denn seine Großmutter mütterlicherseits war deutscher Abstammung gewesen und nach dem Krieg 1918 aus dem Elsass mit dem Großvater nach Polen gekommen. Sie hatte mit Milena und ihm immer Deutsch gesprochen, weil sie meinte, dass dies Familientradition sei. Längst schickte Paweł ihr dafür regelmäßig ein Dankesgebet gen Himmel.
Der dumpfe Schmerz durch den Hieb mit dem Gewehrkolben holte Paweł aus den quälenden Erinnerungen an die Heimat, seine Familie und an das Bild in der Stube zurück. Er zog den Kragen der Jacke etwas höher, steckte seine steifgefrorenen Finger wieder in die Jackentaschen und sah Stanko an, der ihm einen gequälten Blick zuwarf. Seit sie als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt worden waren, hatte Stanko seine lebensfrohe Art verloren. Längst ging es jeden Tag und jede Stunde nur noch ums Überleben. Im Gegensatz zu Paweł aber spornte die Erinnerung an die Heimat und seine Familie Stanko an, dem Tod zu trotzen. Anfänglich hatte er noch Witze gemacht und seinen Kameraden erklärt, dass er auch lachen könne, obwohl der Krieg so furchtbar sei. Schließlich würde sich an dem Krieg auch nichts ändern, wenn er nicht lachen würde.
Auch Paweł wollte mit aller Macht weiterleben. Aber im Gegensatz zu Stanko spornte ihn nicht der Wunsch nach Rückkehr in die alte Heimat an. Sein Antrieb war Hass, abgrundtiefer Hass, der ihn innerlich immer mehr zerfraß. Nur der unbändige Drang nach Rache ließ ihn alles ertragen und hielt ihn davon ab, aufzugeben.
Der Lastwagen holperte über die unebene Straße, überquerte eine schmale Brücke und wurde etwas langsamer. Paweł und Stanko sahen sich an. Sie rochen frisches Holz und hörten das rhythmische Stampfen einer Gattersäge, wie sie in Sägemühlen benutzt wurden. Im Hintergrund rauschte das Wasser eines Bachs in einem Mühlrad. Der Motor des Wagens heulte auf und der Fahrer fluchte, als er mit Gewalt und Zwischengas das grobe Getriebe in den kleineren Gang zwang. Dann fuhr er einen steilen Hang hinauf. Die Männer auf der Pritsche wurden durchgeschüttelt und hielten sich am Gestänge unter der Plane fest. Bald darauf erreichte der Lastwagen das Ende der Steigung und hielt an. Die Deutschen öffneten die Plane und die Ladebordwand und sprangen hinunter.
»Los, aussteigen!«, rief einer der Wachmänner den drei Polen zu.
»Da in Reihe aufstellen und warten!«
»Scheiße, ist das kalt«, fluchte der andere Soldat, der mit dem Lauf des Gewehrs den drei Polen zeigte, wo sie anzutreten hatten. Eine eiskalte Windböe wehte über die Anhöhe, auf der der Bauernhof stand. Paweł entdeckte unter dem Dach des Hauses ein geschnitztes Schild: »Heumannhof«. Der Hof war noch mächtiger und schöner als die anderen, die er unterwegs gesehen hatte. Etwas unterhalb des Haupthauses, nur einige Schritte entfernt, stand eine kleine Scheune. Auf der anderen Seite, den Hang ein Stück hinauf, sah er eine kleine Kapelle. Paweł hoffte, dass sie diesmal bei frommen Leuten arbeiten konnten. Vielleicht hatten sie ja etwas mehr Glück. Er drehte den Kopf und sah den Hang hinunter. In der Talsohle am Ende des steilen, steinigen Wegs, den sich der Lastwagen heraufgequält hatte, stand eine Sägemühle direkt an einem Bach. Auf einem Holzplatz neben der Säge lagen Baumstämme und in einem offenen Schuppen lagerten gestapelte Bretter. Leise wurde das Stampfen der Säge vom Wind bis zu ihnen hinaufgetragen.
»Sie kommen spät!«, schimpfte ein älterer, großer, kräftiger Mann, der in dunkler Arbeiterkluft die Treppe vom Haus herunterkam. An seiner Hose klebten Sägespäne und in der Hand hielt er einen Stock. »Das sind also die Neuen, die mir Repple schickt?«, fragte er den Soldaten, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. »Ja, ein Bauer und zwei Waldarbeiter!«, antwortete dieser.
Karl Heumann begutachtete die neuen Arbeiter skeptisch, ging auf Paweł zu und sah ihm direkt ins Gesicht. Sein Blick war kalt und wirkte bedrohlich, aber trotzdem blieb Paweł regungslos stehen. Er fror und zitterte am ganzen Körper, doch er versuchte, sich das nicht anmerken zu lassen.
»Ein junger Bursche, gut«, sagte der Bauer, trat einen Schritt zurück und musterte Paweł von oben bis unten.
»Wie heißt du?«, fragte er herrisch.
»Paweł, Paweł Kulik.«
»Paweł?« Der Blick von Karl Heumann verfinsterte sich plötzlich weiter. »Wo kommst du her?«
»Boborka, Polen.«
»Polen?«, schrie Heumann plötzlich und wirbelte zu dem Soldaten herum. Der hatte eigentlich damit gerechnet, dass sich Heumann für die prompte Lieferung neuer Arbeiter mit gewünschter Qualifikation bedanken würde und war sichtlich überrascht. Schließlich hatte Erwin Repple von der örtlichen Landwacht die vier Russen, die vorher bei Heumann gearbeitet hatten, letzte Woche abholen lassen, nachdem sie vollkommen betrunken vom Hof abgehauen waren. Arbeitsfähige Männer waren rar in Kriegszeiten. Ohne Zwangsarbeiter aus dem Osten oder aus Frankreich funktionierten kein Betrieb und kein Hof mehr, der auf Arbeitskräfte angewiesen war. Die vier Russen von Karl Heumann hatte die SS ins Lager »Sportplatz« in Haslach gebracht, ein nur knapp fünfzehn Kilometer von Nordrach entferntes Außenlager des KZ Natzweiler-Struthof. Dort wurden die Insassen seit Kurzem gezwungen, die unterirdischen Stollen des ehemaligen Amphibolit-Bergwerks »Vulkan« für die Rüstungsindustrie auszubauen. Nach der Zerstörung des Daimler-Benz-Werkes in Gaggenau durch britische Bomber hatte man für die Fertigung von Panzerteilen händeringend sichere Produktionsstätten unter der Erde gesucht. Das bedeutete für sie schwere, mörderische Arbeit bei unzureichender Versorgung, einfachster Unterbringung und übelster Behandlung. Wie unmenschlich die SS-Wachmannschaften die Zwangsarbeiter im Lager behandelten, hatte sich bis Nordrach herumgesprochen.
Da waren diese drei Arbeiter für den Landwirt eigentlich ein Glücksfall, fand der SS-Mann. Doch Heumann sah das völlig anders.
»Polen? Ausgerechnet verdammte Polen!« Sein von tiefen Falten durchzogenes Gesicht errötete vor Zorn, seine kleinen, zusammengekniffenen Augen funkelten.
»Alle drei sind Polen?«
»Pawel Kulik, Stanimir Banowski und Kamil Gurski«, las der Soldat die Namen von dem Überstellungsbefehl in seiner Hand ab. »Beide gute Waldarbeiter, alle sprechen etwas Deutsch, dieser hier sogar sehr gut.« Er zeigte auf Paweł.
Heumann machte einen Schritt auf Stanko zu. Er blieb dicht vor ihm stehen, schnaubte und blies Stanko seinen nach Tabak stinkenden Atem direkt ins Gesicht. Dann ging er weiter zu Kamil Gurski. Dieser musste husten.
»Was ist mit dem?«, fragte Heumann.
»Er hat einen steifen Fuß, hat aber Erfahrung mit der Arbeit in einer Säge. Den bekommen sie so dazu. Eigentlich waren ja nur zwei Männer für Sie eingeplant«, sagte der Soldat und hielt Heumann die Arbeitsbücher der drei Männer hin.
»Hier sind die Überstellungspapiere. Bitte händigen Sie die der örtlichen Landwacht aus.« Er hielt Heumann ein Formular hin, das dieser ihm achtlos aus der Hand riss.
»Landwacht! Repple!«, brummte er. »Der hat mir doch die Russen absichtlich genommen. Die konnten wenigstens anpacken. Aber was soll ich mit dem faulen Pack hier? Da brauchst du Arbeiter und sie schicken dir zweieinhalb Polen«, fluchte er und schien zu überlegen, ob er die Polen lieber wieder wegschicken sollte. Doch er wusste, dass er dringend Arbeiter brauchte.
»Hauen Sie schon ab!«, winkte er dem Soldaten gestikulierend zu.
Dieser hob den rechten Arm und grüßte mit einem zackigen »Heil Hitler!«, das Heumann mit einem unwirschen »Ja, ja«, quittierte. Die beiden Männer bestiegen den Lastwagen und fuhren mit laut aufheulendem Motor den steilen Weg wieder hinunter ins Tal.
»So, nun zu euch!« Verächtlich betrachtete Heumann die Männer, die ihm die SS auf den Hof gebracht hatte. Er hasste Zwangsarbeiter. Aber der Krieg hatte ihm seine zwei Knechte vom Hof und die vier Arbeiter aus der Sägemühle geholt. Nur er und Franz Huber, sein alter Vorarbeiter, waren noch da. Den Rest hatten seither die vier Russen erledigt. Und nun Polen!
»Ausgerechnet Polen«, schimpfte er erneut, schwang dabei den Stock in die Höhe und baute sich vor den drei frierenden Männern auf.
»Damit eins klar ist: Wer nicht arbeitet oder Dummheiten macht, den gebe ich der Landwehr. Die Russen vor euch haben ihr Saufgelage mit dem Leben bezahlt. Schade um den Schnaps«, lachte er hämisch. »Für mich gehört ihr an den nächsten Baum geknüpft.« Er spie Paweł direkt vor die Füße.
Aus dem Haus kam eine ältere Frau. Über ihre blaugeblümte Kittelschürze hatte sie einen warmen, dicken Mantel geworfen.
»Elisabeth, schau nur, was sie uns gebracht haben! Polacken. Dazu ist einer davon auch noch ein Krüppel!«
Die Bäuerin runzelte die Stirn. So wurden die Falten, die die harte Arbeit auf dem Hof in ihrem freundlichen Gesicht schon geschaffen hatte, noch einige mehr. Neugierig und ihren Mann nicht beachtend kam sie näher und betrachtete die verschüchterten Neuankömmlinge. Kamil zitterte mittlerweile am ganzen Körper, denn seine dünne Jacke konnte die Eiseskälte nicht abhalten.
»Schau, der da kann nicht einmal richtig laufen!«, empörte sich Heumann und schlug zu. Der Stock schwirrte mit einem Pfeifen herab und landete auf Kamils Schulter knapp neben seinem Ohr.
»Können Sie mich verstehen?«, fragte die Bäuerin. Kamil schüttelte den Kopf. Sie sah zu Stanko.
»Ich spreche deutsch«, sagte Paweł, und Elisabeth Heumann ging erleichtert zu ihm hinüber.
»Das ist gut. Wenigstens einer von euch. Das hört sich sogar ziemlich akzentfrei an. Wie kommt das?«
»Meine Großmutter stammte aus einem kleinen Ort bei Hannover. Sie sprach mit uns immer Deutsch, Frau ...?«
»Heumann. Das ist der Heumannhof und das da unten ist unsere Säge«, erklärte sie und zeigte hinunter auf den Betrieb im Tal.
»Ich bin Paweł, Paweł Kulik, das ist Stanko Banowski, und er hier heißt Kamil Gurski.« Paweł zeigte auf seine beiden Freunde. »Sie sind Waldarbeiter, ich bin Bauer. Also, ich war Bauer.« Er spürte, dass die Bäuerin im Gegensatz zu ihrem Mann nicht denselben Groll gegen sie hegte. Elisabeth Heumann drehte sich zu ihrem Mann um.
»Karl, bring die Leute in die Scheune. Wir wollen keinen Ärger mit Repple. Du weißt, dass sie die Vorschriften nochmal verschärft haben und der Kerl nur darauf wartet, etwas zu finden, um die Männer umzubringen.«
»Bei den Polacken das einzig Richtige«, brummte Karl Heumann.
»Karl!«, ermahnte sie ihren Mann. »Willst du die Arbeit dann alleine machen? Du elender Sturkopf! Sperr sie in den Stall, ich bringe ihnen nachher noch etwas zum Anziehen und zum Essen. Die Männer brauchen Kraft.«
»Pah«, brummte Karl Heumann verächtlich, zeigte aber mit dem Stock auf die kleine Scheune. Auch sie hatte ein gemauertes Untergeschoss, darüber Fachwerk und ein mit Holzschindeln belegtes Dach. Die drei Polen gingen an einem Brunnen vorbei hinunter zu dem kleinen Haus. Ein Weg zwischen der Hauswand und einer Mauer, die das ansteigende Gelände abstützte, führte zu einer stabilen Holztür im hinteren Teil der Scheune. Neben der zweigeteilten Stalltür war auf der Außenseite, fast auf Bodenhöhe, ein kleines mit Eisenstäben vergittertes Fenster zu erkennen. Karl Heumann zog die drei stabilen Eisenriegel auf und öffnete die Tür zu dem Raum, in dem schon die Russen untergebracht gewesen waren. Paweł und seine beiden Freunde duckten sich durch die niedrige Öffnung und betraten den feuchtkalten Raum. Hinter ihnen fiel die Tür krachend ins Schloss. Sie hörten, wie Heumann die Riegel zuschob. Durch das Fenster sahen sie ihn zum Haupthaus hinauflaufen. So gut es im Halbdunkel ging, schauten sie sich um. Der Boden war mit alten Holzdielen ausgelegt. Es roch nach Ziege, womit geklärt war, wer die eigentlichen Bewohner des Stalls gewesen waren, bevor Zwangsarbeiter auf den Hof gekommen waren. Entlang der Wände waren mit Decken und Strohsäcken Schlafmöglichkeit geschaffen worden. In der Mitte der Kammer stand ein alter, rostiger Kanonenofen, dessen Ofenrohr senkrecht nach oben durch die Decke führte. Er war offensichtlich extra für diese Zelle eingebaut worden, jetzt aber kalt und ohne Feuer. In einer schmalen Nische im hinteren Teil des Raums stand ein verbeulter Blecheimer mit Deckel und daneben lagen ein paar alte Zeitungen. Ein alter Holztisch und drei Stühle boten fast schon so etwas wie ein wohnliches Gefühl. Über dem Tisch hing eine alte Petroleumlampe an einer Kette, die nicht angezündet war.
»Kein Licht und ein kalter Ofen ohne Holz«, sagte Kamil enttäuscht. »Will der uns hier erfrieren lassen?« Er ging zur Tür und rüttelte daran, doch sie klapperte nur unnachgiebig im Schloss.
»Dafür riecht es nach Ziege!«, sagte Stanko und lachte gequält.
»Nun, Freunde, Tisch und Stühle hatten wir zuletzt auch nicht. Und du musst nicht auf dem Boden schlafen«, ergänzte Paweł.
»Ein warmes, weiches Bett wäre mir trotzdem lieber«, maulte Kamil und setzte sich an den Tisch. Wolken zogen auf und die Dämmerung raubte dem Tag das Licht. Die Feuchtigkeit zog durch den Ziegenstall, als sich das schaukelnde Licht einer Laterne näherte und die Tür geöffnet wurde. Elisabeth Heumann brachte den Männern in einer Milchkanne Wasser aus dem Brunnen. Dann zog sie einen Laib Brot aus dem Korb und brach ihn in drei gleiche Teile. Gierig griffen die ausgehungerten Männer danach. In einem Blechnapf war Suppe mit Kartoffelstückchen und Paweł ließ ihn reihum gehen, damit jeder daraus trinken konnte. Warmes Essen, noch dazu mit Kartoffeln, die man beißen konnte, das hatten sie schon lange nicht mehr bekommen.
»Esst! Ihr werdet eure Kraft brauchen. Morgen früh bringe ich euch noch etwas für den Tag. Der geht früh los, also legt euch besser jetzt hin.«
Dankbar sahen die drei Männer sie an. In der Tür drehte sich Elisabeth Heumann noch einmal um. »Nehmt euch vor meinem Mann in Acht! Mit ihm ist nicht gut Kirschen essen«, sagte sie mit eindringlichem Blick. Sie sah Paweł an. »Du bist der Landarbeiter, oder?«
Paweł nickte.
»Dann wirst du hier oben auf dem Hof bleiben und mir helfen. Die beiden anderen werden in der Säge unten arbeiten und im Wald Holz machen.« Sie zeigte auf den Ofen. »Morgen gibt es auch Holz und Zündhölzer für den da.« Dann verließ sie den Ziegenstall, schloss die Tür und schob die Riegel vor. Die drei Männer sahen sich an. Die Warnung der Bäuerin nahm ihnen wieder die kleine Hoffnung, die sie beim Anblick der Kapelle bei ihrer Ankunft für einen Moment geschöpft hatten. Sie legten sich auf die Strohsäcke, zogen die Filzdecken bis zu den Ohren hoch und waren froh, nach den letzten Tagen im Güterwaggon wenigstens wieder etwas weicher liegen zu können.
3
Als Alma am nächsten Morgen die Augen aufschlug, blickte sie in Maries Gesicht.
Alma war für ihre sechs Jahre ein außergewöhnlich aufgewecktes, selbstbewusstes Mädchen. Wenn sie Dinge oder Zusammenhänge nicht verstand, hakte sie nach. Sie konnte einem rücksichtslos Löcher in den Bauch fragen, wie es Marie einmal genannt hatte, als das fortlaufende »Warum?« kein Ende nehmen wollte. Alma hatte vor Lachen Bauchweh bekommen und einen Tag später Frau Hartwig gefragt, ob sie einmal ihren Bauch ansehen dürfe. Diese hatte ihr den Gefallen gerne erfüllt, doch Alma hatte spielerisch entrüstet reagiert: »Marie hat gelogen! Da sind ja gar keine Löcher drin!«
Irene hatte sie fragend angesehen und im ersten Moment gar nicht begriffen, was das Mädchen damit gemeint hatte.
»Dann kann ich ja weiter fragen!«, hatte Alma lachend festgestellt.
Noch wusste das Kind nichts vom Tod Irene Hartwigs und dem ungeborenen Baby. Am Abend hatte Marie sich um eine Antwort auf die Frage, wo denn Frau Hartwig sei, gedrückt und gesagt, dass sie noch unten im Geburtssaal sei und über Nacht dortbleiben müsse. Damit hatte sie zwar nicht gelogen, aber die Wahrheit würde sie schnell einholen, das war ihr klar.
Nach dem Zusammentreffen mit Dr. Feger im Flur war Marie zunächst durch die Küche und die enge Wendeltreppe hinab zum Hinterausgang und dann weiter in den Garten hinaus gerannt.
»Verdammt! Verdammt! Verdammt!«, hatte sie unter Tränen geschrien und mit den Fäusten gegen den Stamm der großen Tanne geschlagen, die hinter dem Haus stand. Erschrocken über sich selbst hatte sie sich umgeschaut, doch glücklicherweise hatte sie niemand gesehen. Erleichtert hatte sie sich die Tränen aus dem Gesicht gewischt, tief Luft geholt und sich auf eine der Parkbänke gesetzt. In dem Moment schwor sie sich zum wiederholten Male, nie wieder die emotionale Distanz zu einer Mutter zu verlieren, wie es ihr jetzt bei Irene Hartwig geschehen war. Als Krankenschwester durfte sie kein Mitgefühl mit den Müttern oder Kindern entwickeln. So oft hatte sie sich das geschworen. Immer wieder hörte sie die warnenden Worte der Oberschwester: »Wenn Sie im Dienst sind, sind Patienten nur Patienten, keine Menschen!« Doch es gelang ihr nicht, das zu trennen, nicht bei Irene Hartwig und schon gar nicht bei Alma. Schließlich war das eine außergewöhnliche Situation und sie waren in den letzten Wochen ständig zusammen gewesen.
Marie hatte erlebt, wie Irene Hartwig Alma unterrichtet hatte bis zu dem Tag, an dem überraschend die Wehen eingesetzt hatten. Lesen, Schreiben, Rechnen. Sie hatte ihrem Schützling vorgelesen und anschließend über die gehörten Geschichten gesprochen. Marie erinnerte sich daran, wie Irene erklärt hatte, dass es ungehörig sei, dass Max und Moritz die Brücke ansägten. Alma hatte trotzdem über den Streich gelacht und Marie hatte mitlachen müssen, was Irene Hartwig mit einem ernsten Blick gestraft hatte. Ihr Unterricht war streng gewesen und sie hatte von dem Mädchen absolute Konzentration und Disziplin erwartet. Dass Alma ihr ohne besondere Strenge gehorchte und eifrig lernte, hatte aber nicht, wie die Gouvernante dachte, an ihr und ihrer Lehrmethode gelegen, sondern viel mehr an der ungeheuren Wissbegierde des Kindes. Sie hatten so viel Zeit miteinander verbracht und mit der Zeit hatte es sich wie eine Freundschaft zwischen ihr und Irene angefühlt.
Wohl kaum sonst hätte Irene ausgerechnet Marie einen Tag vor ihrem Tod so ins Vertrauen gezogen. Bei einem Spaziergang im Park, Alma war auf dem Zimmer geblieben und wollte lieber spielen, hatte sie ihr offenbart, dass das Kind in ihrem Bauch ebenso wie Alma das Ergebnis einer Vergewaltigung waren. Ihr Dienstherr in Berlin missbrauchte sie seit Jahren regelmäßig und nun war sie schwanger geworden.
»Er ist ein Schwein, ein Teufel,« hatte sie gesagt, »ein sehr, sehr hohes Tier bei der Partei und er hat enorme Macht und Kontakte, bis ganz nach oben«, hatte sie Marie mit stockender Stimme erzählt. »Er ist verheiratet, aber seine Frau kann keine Kinder bekommen und ist krank. Kein Rock ist vor ihm sicher. Nicht einmal Kinder! Zu mir kam er regelmäßig, manchmal mehrere Abende hintereinander.«
Marie hatte sie entsetzt angeschaut und ihre Hände gegriffen, als Irene die Tränen über das Gesicht liefen.
»Ich habe mich nie wehren können. Verstehst du, Marie!«
»Aber warum?«, hatte Marie gefragt, immer noch geschockt von dem, was Irene ihr erzählt hatte.
Irene drehte sich um und schaute hinauf zum Fenster ihres Zimmers. »Er konnte furchtbar böse und zornig werden, sehr brutal. Wenn ich mich wehren oder zu jemand etwas sagen würde, würde er mich töten, hat er gesagt. Und wenn ich weglaufen würde, würden seine Männer mich finden und mich ins KZ bringen lassen.«
»Oh mein Gott!«, rief Marie aus und spürte, wie Irene ihre Hand noch stärker drückte.
»Nur so konnte ich ihn bisher auch von Alma fernhalten. Sie ist noch etwas zu jung für ihn. Aber das wird ihn nicht abhalten. Verstehst du?«
»Willst du mir sagen, dass Alma auch ...« Sie wagte es nicht auszusprechen.
»Bisher nicht. Sie weiß nichts davon. Sie haben sie mir weggenommen. Alma weiß nicht, dass ich ihre Mutter bin. Sie denkt, dass ich nur ihr Kindermädchen und Angestellte ihrer Pflegeeltern bin. Und dass ihre wahren Eltern tot sind.« Wortlos gingen sie ein paar Schritte zwischen den Rosenbüschen entlang. Marie versuchte, ihre Gedanken zu sortieren.
»Und jetzt? Du bist doch geflohen, oder? Darum warst du im Zug. Wo wolltest du hin?«
Irene blieb stehen.
»Sie haben einen Adoptionsantrag gestellt. Damit würde ich endgültig Alma verlieren und er mich hinterher loswerden wollen. Wenn ich nicht geflohen wäre, würde er Alma auch bald nur noch quälen. Wer weiß, was er mit ihr anstellen würde. Alma ist ein wunderbares süßes kleines Mädchen! Mein Mädchen!«
Marie sah, wie Irene die Fäuste ballte. »Ich will zu einer Freundin in die Schweiz. Dort bin ich sicher.«
»Aber die Grenze ist zu. Sie lassen niemand mehr ins Land,« sagte Marie besorgt. »Und mit einem Neugeborenen? Wie stellst du dir das vor?«
»Irgendwo wird es über die grüne Grenze noch einen Weg geben. Es soll noch einige mutige Helfer geben, die einem helfen. In Deutschland kann ich auf keinen Fall bleiben. Früher oder später wird er mich finden. Und dann bin ich tot. Offiziell bin ich schließlich die Entführerin seiner Tochter.«
Marie begriff, wie gefährlich die Situation war. Irene hatte bei der Ankunft keine Chance gehabt, sich unter falschem Namen anzumelden, weil sie keine gefälschten Papiere hatte. Die Oberschwester hatte Irenes Ausweispapiere in der Manteltasche gefunden und Alma ausgefragt. Und Steiner, da war sich Marie sicher, hatte Irene ordnungsgemäß als Neuzugang an die Lebensbornzentrale in München gemeldet. Schließlich war ja auch die Kostenübernahme zu melden. Die Fragen nach dem Kindsvater hatte sie stets mit »unbekannt« beantwortet und ein ausgebombtes Haus in Berlin als Adresse angegeben.
Doch die Aufregung tat ihr nicht gut, sie hielt sich den Bauch und Marie begleitete sie zu einer Bank, damit sie sich setzen und kurz erholen konnte.
»Marie, du musst mir etwas versprechen!«
Marie sah sie an und griff nach ihrer Hand.
»Wenn mir hier etwas passiert, musst du dich um Alma kümmern, hörst du! Sie darf nicht mehr in die Hände dieses Kerls geraten, ohne dass ich auf sie aufpassen kann!«
Marie war überrascht.
»Marie, versprich es mir! Schwöre es!«, flehte Irene sie an.
»Ja. Ja, natürlich«, antwortete Marie, noch immer geschockt von dem, was Irene ihr berichtet hatte. Sie hatte fest Irenes Hand gedrückt. »Du kannst dich auf mich verlassen! Aber dir wird nichts passieren. Alles wird gut gehen.«
Schmerzlich erinnerte sich Marie jetzt an diese Worte. Nach dem Frühstück kam die Oberschwester und sagte Alma, was passiert war. Marie war froh gewesen, dass dieser Kelch an ihr vorübergegangen war und das erste Mal war sie der Oberschwester richtig dankbar. Almas lauter Entsetzensschrei und ihre Tränen lösten bei den beiden Frauen körperlichen Schmerz aus.
Das arme Kind!, dachte Marie. Die Gedanken drehten sich in ihrem Kopf. Sie musste an das denken, was Irene ihr am Tag zuvor gesagt hatte. Und was sie versprochen hatte. Sanft nahm sie das Mädchen in den Arm und tröstete sie. Und fast fand Marie es etwas tröstend, dass für Alma »nur« ihre Gouvernante gestorben war. Die nächsten zwei Tage waren traurige Tage. Die Nachricht vom Tod Irenes hatte im Heim schnell die Runde gemacht. Alle versuchten, Alma zu trösten und sie aufzumuntern. Und nach wenigen Tagen schien sich Alma tatsächlich wieder zu fangen, wurde wieder fröhlicher. Vielleicht hatte dazu beigetragen, dass Marie ihr gesagt hatte, dass sie erst einmal bei ihr bleiben würde. Steiner hatte beschlossen, die Zentrale nicht sofort zu informieren. Schließlich wusste er noch immer nicht genau, wer Irene Hartwig wirklich gewesen war. Und er befürchtete als Vater ein hohes Tier in Partei oder Wehrmacht oder SS. Offensichtlich hatte dieser »Störfall« im Betriebsablauf bei ihm Ängste ausgelöst, dass seine Karrierepläne durch Irenes Tod einen Dämpfer erhalten würden. Und die kleine Alma konnte ihm nun plötzlich gefährlich werden.
Marie ging hinunter in die Küche und holte für Alma und sich das Frühstück. Unterwegs traf sie Luise und Minna. Die beiden waren zusammen mit Erna und Marie zu einer festen »Viererbande« geworden, wie sie sich nannten. Erna Wawerka kam aus Duisburg, während Luise und Minna aus der Nähe von Stuttgart stammten. Sie waren zuvor in einem Lebensbornheim in Bayern eingesetzt gewesen und nach ihrer Versetzung nach Nordrach schnell zu Maries Freundinnen geworden. Zumindest im Heim, wenn sie abends keinen Dienst hatten, saßen sie gerne in einer der Kammern unter dem Dach zusammen.
Luise stürzte auf Marie zu. »Hallo Marie! Wie geht es der Kleinen? Ach je, das ist so traurig.«
»Es geht schon wieder etwas besser«, antwortete Marie.
Wie sie die gemütlichen, lustigen Stunden mit den Freundinnen vermisste! Seit Irene mit Alma ins Heim gekommen war, hatte sie keine Zeit mehr gehabt. Oft hatte sie in den letzten Wochen abends nach dem normalen Dienstschluss am Fenster gestanden und ihren Freundinnen zugewunken, wie sie durch das Tor gehuscht und über die Wiese den Hang hinauf zum Waldweg gelaufen waren. Bis zu ihrem Spezialauftrag hatten sie zu viert öfter den Ausflug gemacht und in Gedanken ging Marie mit ihren Freundinnen mit. Sie liefen hinter dem Heim den Berg hinauf und sangen beim halbstündigen Aufstieg Lieder. Oben angekommen, genossen sie den Ausblick über die Höhen der Ortenau und tratschten befreit über dies und das, vergaßen für zwei Stunden den Alltag und den Krieg. Manchmal kehrten sie sogar in dem Gasthaus »Vogt zum Mühlstein« oben auf dem Berg ein und hatten bei ein oder zwei badischen Weinschorlen Spaß. Ihre Ausflüge machten die vier Frauen heimlich, denn die Oberschwester sah das nicht gerne, auch wenn sie es nicht ausdrücklich verboten hatte. Aber Nickelchen ließ sie dann durchs Tor hinaus. Wenn sie von ihrem Ausflug zurückkamen, erwartete er sie wieder am Tor, immer geduldig und ein Pfeifchen rauchend. Er freute sich, wenn er danach beruhigt das Tor für die Nacht schließen konnte.
Bevor ihre beiden Freundinnen Marie sie weiter nach Alma fragen konnten, kam Oberschwester Lotz um die Ecke des Flurs und erblickte die beiden. Ihre Zurechtweisung folgte auf dem Fuße: »Schwester Luise, Schwester Minna, haben Sie nichts zu tun?«
»Doch, doch«, antwortete Luise Haberstroh und die beiden trollten sich auf die Wöchnerinnenstation.
Marie war als Schwester, die im Ort wohnte, eher eine seltene Ausnahme, denn die SS vermied es meist, Schwestern aus dem gleichen Ort des Heims einzusetzen. Das führte nur zu Geschwätz im Dorf. Doch Steiner hatte die begabte Schwester damals unbedingt im Heim haben wollen und sie angefordert. So konnte Marie, bis Irene Hartwig und Alma gekommen waren, öfter auf dem heimischen Hof schlafen und hatte im Heim nur eine winzige Kammer. Die Schwestern und andere Mitarbeiter verließen das Heim normalerweise nur, um eine persönliche Besorgung zu machen, oder wenn sie nicht im Heim wohnten, sondern im Dorf privat untergebracht waren. Einige der Schwestern hatten schlechte Erfahrung mit den Dorfbewohnern gemacht, die das SS-Heim und die jungen Mütter oft mit Skepsis und die Mitarbeiterinnen mit Neid beäugten. Denn während im Dorf Mangel und Versorgungsnöte herrschten, sorgte die SS dafür, dass es im Lebensborn immer genug zu essen gab. Den werdenden Müttern sollte es an nichts fehlen, schließlich wollte Heinrich Himmler die deutschen Frauen ausdrücklich animieren, dem Führer viele arische Kinder zu schenken. Es kursierte sogar hartnäckig das Gerücht, das Heim sei eine Art Bordell oder gar Zuchtstation der SS. Obwohl jeder, der es wollte, sehen konnte, dass kaum fremde SS-Männer das Heim besuchten. So mussten manchmal auch die jungen Mütter verächtliche Blicke ertragen, wenn sie das Heim zu einem Spaziergang verließen.
Marie stand am Fenster und betrachtete die Frauen, die im Park spazieren gingen. Oft schon hatte sie sich gefragt, ob sie hinter dem stehen konnte, wofür die Lebensborn-Idee stand. Natürlich wollte sie den Müttern helfen und die Kinder gesund zur Welt bringen. Sie war Krankenschwester! Doch mit vielen Dingen, mit denen sie weniger Berührung hatte, tat sie sich schwer. Und jetzt? Jetzt hatte sie ein viel größeres Problem. Sie hatte Irene versprochen, Alma zu beschützen. Zu verhindern, dass sie das Mädchen zurück nach Berlin bringen würden, in die Fänge dieses grausamen Kerls und seiner Frau. Das konnte sie nicht zulassen! Das hatte sie Irene geschworen! Doch wie sollte sie das anstellen? Schließlich war er ja sogar ihr biologischer Vater. Eine Vergewaltigung war ihm nicht mehr nachzuweisen. Der Gedanken widerte Marie in dem Moment an, als sie ihn dachte. Nein, dieser Kerl hat keine Vaterrechte! Niemals. Sie blickte hinunter in den Garten und dachte nach, was sie tun konnte. Mit dem Kind fliehen? Sie würde nicht weit kommen, das war aussichtslos. Verzweifelt schlug sie mit der Hand gegen den Fensterrahmen.
»Marie, ist was?«, fragte Alma.
»Nein, mein Mädchen, alles ist gut!«
Bereits bei ihrer Ankunft im Lebensborn mussten die Frauen, die ihr Kind nach der Geburt nicht mitnehmen wollten oder konnten, unterschreiben, dass sie das Kind zur Adoption freigaben. In manchen dieser Fälle übernahm der Reichsführer SS Heinrich Himmler dann sogar persönlich die Vormundschaft. Viele Frauen sahen in dem Moment gar keinen anderen Ausweg, denn oft konnten sie ein uneheliches Kind unmöglich wieder mitnehmen. Manche kamen aus feinerem Hause und trugen die Konsequenzen einer einzigen leidenschaftlichen Nacht aus. Ein gesellschaftlicher Skandal oder die Ächtung der Frau als Dirne waren oft die Folge. Spätestens, wenn sich die Schwangerschaft unter einem Kleid nicht mehr verbergen ließ, konnten sie in einen Lebensborn fern der Heimat gehen und waren froh, sich dadurch gleichzeitig eine mittlerweile bei strenger Strafe verbotene Abtreibung zu ersparen. Offiziell waren sie dann zu einer längeren Kur im bayrischen Wald gewesen oder an der See.
Väter gab es oft nicht. Natürlich hatte jedes Kind einen Vater, besser einen Erzeuger, aber dieser wollte oft nicht genannt werden. Nur die Lebensbornzentrale kannte ihre Identität und teilte sie nicht einmal den Heimen mit. Allerdings sorgte der Verein dafür, dass die Väter, zumindest wenn sie in der SS waren, Alimente an den Lebensborn bezahlten. Selbstverständlich wurden die Zahlungen so getarnt, dass niemand auf die Idee kam, ein Herr Obersturmbannführer bezahle hier regelmäßig für ein Kind von einem Seitensprung, einer nicht erfüllten Verlobung oder dem Abenteuer einer Nacht. Himmler wachte oft persönlich über die Auswahl der Frauen seiner SS-Männer, genehmigte oder verbot die Heirat. Die Kinderanzahl der Ehe war Karrierekriterium und weitere uneheliche Kinder waren vom Reichsführer SS gerne gesehen. Selbst später als Erwachsene sollten die Lebensborn-Kinder nichts über ihre leiblichen Eltern erfahren.
Marie war klar, dass Alma nicht mehr nach Berlin zurück durfte. Das konnte sie auf keinen Fall zulassen. Mit einer Adoption konnte sich Irenes Peiniger auch noch als Wohltäter präsentieren und die Erwartungen des Reichsführers SS von kinderreichen Ehen seiner SS-Männer erfüllen. Jetzt erst fiel ihr auf, dass Alma noch gar nicht gefragt hatte, wann man sie zurück nach Berlin bringen würde. Heimweh hatte das Kind ganz offensichtlich nicht. Marie nahm sich vor, bei passender Gelegenheit Alma einmal vorsichtig nach ihren Eltern in Berlin zu fragen. Vielleicht kommt es anders, bis dahin ist hoffentlich noch etwas Zeit, dachte Marie. Woher sie diese Hoffnung nahm, wusste sie nicht.
Alma hatte im Nachthemd gespielt und gefrühstückt. Sie saß plantschend in der Wanne und sang Lieder.
»Weil es im Bad so schön klingt wie in einer Kirche«, fand sie.
In Gedanken versunken wusch Marie mit einem Waschlappen den Rücken des Mädchens ab. Das Singen des Kindes war wunderschön und ihr zudem viel lieber als eine endlose »Warum?«-Fragenkette. Sie tauchte den Waschlappen erneut ins warme Wasser und strich damit vorsichtig über den Rücken des Kindes.
»Frau Hartwig meint ja, ich bekomme mal furchtbar krumme X-Beine, weil ich immer so rumhampel.« Alma stand auf. »Marie, findest du, dass meine Beine wie ein X aussehen?« Mit einem prüfenden Blick schaute sie an sich herunter.
»Ach was«, antwortete Marie. »Du hast ganz normale, schöne Beine! Nun ja, hm ... Deine Füße sehen vielleicht bald so aus wie bei einer Ente«, spottete sie. »Wenn wir dich jetzt nicht aus dem Wasser holen, wachsen dir bestimmt noch Schwimmhäute zwischen den Zehen!«
Alma ließ sich lachend zurück ins Wasser plumpsen und spritzte Marie nass. Marie lachte spontan mit und war dankbar für die kurze Ablenkung.
Später saßen sie am Tisch und bürsteten Almas Haare, als es plötzlich an der Tür klopfte. Vor Schreck hätte Marie fast die Haarbürste fallen lassen. Oberschwester Lotz streckte den Kopf zur Tür herein, ohne auf eine Aufforderung zu warten.
»Guten Morgen!« Sie ließ einen prüfenden Blick durch das große Zimmer schweifen. Die Betten waren noch nicht gemacht, am Boden lag Spielzeug herum. Man sah ihr ihren Unmut über die Unordnung deutlich an.
»Schwester Marie, Obersturmführer Steiner erwartet sie in dreißig Minuten in seinem Büro.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, hatte sie die Tür schon wieder geschlossen. Würde sie jetzt erfahren, wie es mit dem Mädchen weitergehen sollte? Wohl eher, wann Alma abgeholt würde. In Marie stieg Panik auf. Wenn es den Moment für eine gute Idee, einen guten Plan gab, dann war es dieser jetzt! Die Zeit lief ihr davon. Wie sollte sie nur ihr Versprechen einlösen, das sie Irene gegeben hatte?