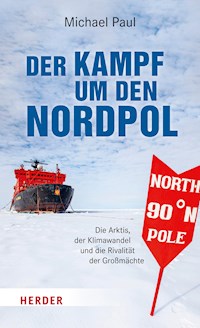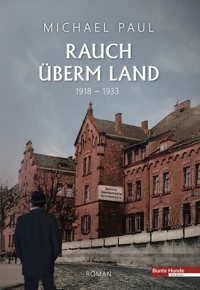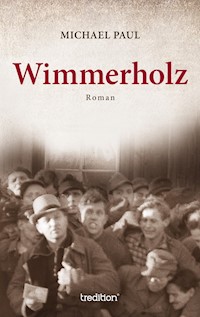5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gustav Siebenpfeiffer wird von seiner Enkelin für eine Nacht in das seit Jahren leerstehende Schwarzwälder Luxushotel „entführt“, in dem er fast 50 Jahre als Concierge gearbeitet hat. Jeder Saal, jedes Zimmer, jeder Gegenstand lösen bei ihm intensive Erinnerungen aus. Die Nacht wird zu einer aufregenden emotionalen Reise für Großvater und Enkelin Vivi zugleich.
Dieser außergewöhnliche Patchwork-Roman erzählt in einer liebevollen Rahmengeschichte um Großvater und Enkelin vierzehn unterhaltsame und auch tiefgründige Kurzgeschichten rund um Tugend und Sünde. Er entstand im Rahmen einer Freizeit-Autorengruppe rund um den Lahrer Schriftsteller Michael Paul.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Paternoster
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenPaternoster
Paternoster
Michael Paul Gertrud Göhringer
Claudia Krappitz
Michael Ständer
Marietta Bohrer
Linda Florek
Ralf Prost
© 2023 Bunte Hunde Verlag, Lahr/Schw.
Lektorat: Susanne Hülsenbeck, Lichtblick Text
Korrektorat und Textsatz: Dr. Katrin Scheiding
Titelbild und Umschlaggestaltung: Marlon Spitz
Symbole: Anastasia Reich
Verlag: Bunte Hunde
ISBN: 978-3-947081-14-1
www.bunte-hunde.de
»There ain‘t no sin and there ain‘t no virtue. There‘s just stuff people do.«
»Es gibt keine Sünde und keine Tugend. Es gibt nur Sachen, die Leute machen.«
John Steinbeck
US-Schriftsteller
(1902–1968)
Prolog
»Opa Guuuuuuuuuu?«, hallte es durch den Hof. Vivien, von allen nur Vivi gerufen, war eine waschechte sechzehnjährige Berliner Göre. Seit ihr Vater vor sechs Jahren ein attraktives Jobangebot bekommen hatte und sie vom Schwarzwald nach Berlin umgezogen waren, besuchte sie ihren Großvater nur noch ab und zu in den Schulferien. Opa Gu hieß eigentlich Gustav, Gustav Siebenpfeifer, aber seit die kleine Vivi mit dem Reden angefangen hatte, war das »Opa Gu«, und das war auch so geblieben.
»Ich bin hier vorne!«, rief der alte Mann.
»Hier hast du also dein ganzes Leben gearbeitet, in diesem alten Schuppen?«, fragte Vivi, als sie ihren Opa wieder vor dem Eingang des Hotels traf.
»Ja, eigentlich war es mein Leben, solange ich denken kann. So wie mit deiner Oma, solange sie gelebt hat.«
Vivi hörte den leicht traurigen Unterton. Seit Omas Tod vor sechs Jahren, ein Jahr nachdem er offiziell in den Ruhestand gegangen war, war ihr Großvater ruhiger geworden, oft in sich gekehrter.
»Du vermisst Oma sehr, nicht?«
»Ja, sie fehlt mir«, sagte der alte Mann und griff nach Vivis Hand. »Immer wenn ich sehr an sie denken muss, gehe ich hierher, zu meinem Hotel.«
»Aber das Hotel ist doch schon lange geschlossen«, erwiderte Vivi.
»Ich werde nie vergessen, wie mir der Herr Direktor mit Tränen in den Augen anvertraute, dass das Hotel von einem Investor aus dem Osten gekauft wurde und niemand wüsste, wie es weitergehen würde. Drei Monate, nachdem ich im Ruhestand war, wurde ihnen allen gekündigt, und das Hotel schläft seither den Dornröschenschlaf. Niemand weiß warum. Der Investor hat zwar das Geld für den Kauf bezahlt, aber ab diesem Zeitpunkt ist nichts mehr von ihm zu sehen gewesen. Niemand versteht es. Es ist so traurig.« Vivi spürte ein leichtes Zittern in seiner Hand und drückte sich an ihn.
Während sie in Berlin gerne die Sau rausließ, keine Party verpasste und ihren Eltern sorgenvolle Abende bereitete, bis sie wieder nach Hause kam, oder ihnen gar ältere Jungs vorstellte, wenn diese ihre Tochter immerhin nach Hause brachten, war sie in den wenigen Wochen im Jahr bei ihrem Opa ein komplett anderer Mensch. Da erkannte sie sich selbst nicht mehr wieder. Es war jedes Mal wie eine Kur für sie, raus aus der stürmischen Welt der Metropole, weg von den vielen Freunden, den Partys, dem Abtanzen, Trinken, Feiern und den Jungs. Viel mehr war es eine Zeit der Ruhe, der schlauen Gespräche und weisen Gedanken, die sie mit ihrem Opa austauschte. Nur bei ihrem Opa schaffte sie es, nicht alle zwei Minuten auf ihr Smartphone zu glotzen, Messenger zu checken, irgendwelches Zeug zu posten und zu chatten. Hier und nur hier schaffte sie es, ihr Handy sogar auszuschalten. Und tatsächlich genoss sie es nach anfänglich schmerzhafter Nervosität, für all die wichtigen Dinge nicht erreichbar zu sein und alles in der Welt zu verpassen. In jeder Woche bei Opa Gu im Schwarzwald las sie sogar Bücher. Zwei oder drei, die ihr Großvater jedes Mal extra für sie vor ihrer Ankunft besorgt hatte. Und gegen ersten Widerstand las sie dann sogar mal einen Klassiker, einen, den sie in der Schule im Deutschunterricht so gehasst hatte. Aber ihr Großvater erklärte ihr das Buch, während Dr. Kleist, der »Kleist ohne von, nicht verwandt, nicht verschwägert«-Kleist in ihrer Schule nur die Lektüre als Grundlage für die nächste fiese Klausur hernahm, weil es so im Lehrplan stand. Bei ihrem Großvater im Schwarzwald wurde sogar »Die Leiden des jungen Werther« zu einem Pageturner. Für sie. »Jugend ohne Gott« hatte er ihr diesmal als erste Ferienlektüre auf den Nachttisch gelegt. Und nach erster Skepsis hatte sie die halbe Nacht gelesen.
»Hallo, Sie!«, erklang eine tiefe, ernste Stimme mit östlichem Akzent hinter ihnen. »Was machen Sie hier? Können Sie nicht lesen, das ist Privatgelände!« Opa Gu und Vivi drehten sich um, und vor ihnen baute sich ein großer Kerl auf, breit wie ein Schrank und mit schwarzer Lederjacke und einem Schlagstock am Gürtel. Auf seiner Brusttasche prangte ein »Security«-Schriftzug.
»Oh, entschuldigen Sie«, stotterte Opa Gu los. »Es tut mir leid. Ich habe hier früher gearbeitet und wollte das Hotel meiner Enkelin einmal zeigen.«
»So, so, sehr interessant«, spottete der Mann und stemmte seine Hände in die Hüfte. »Das Hotel ist geschlossen! Verlassen Sie umgehend das Grundstück!«
»Aber …«, wollte Opa Gu erwidern, doch mit einem barschen »Kein Aber!« ließ der Kerl sie stehen, ging an ihnen vorbei und schloss die Tür zum Eingang auf, um offensichtlich seinen Rundgang im Hotel zu machen.
Enttäuscht drehte sich der alte Mann weg. »Komm, Vivi, wir wollen doch keinen Ärger.« Wieder spürte Vivi das Zittern in seiner Hand und hörte den jetzt noch etwas traurigeren Unterton.
»Hey, Moment mal!«, rief sie plötzlich und ging auf den Sicherheitsmann zu. Nur aus der Entfernung beobachtete ihr Großvater, wie sie erst energisch und dann wieder ganz ruhig auf den Wachmann einredete. Verstehen konnte er sie über die Entfernung nicht. Zwischendurch zeigte Vivi immer wieder auf ihren Großvater. Dann plötzlich winkte sie ihm.
»Komm, Opa Gu, wir dürfen ins Hotel!« Triumphierend lächelnd sah sie in das verdatterte Gesicht ihres Großvaters.
»Wirklich?«
»Ja, wirklich«, brummte der Wachmann.
»Und wie lange?«, fragte Opa Gu.
»Komm einfach, Opa. Ich habe das geklärt!«, knuffte ihn Vivi in die Seite und zog ihren etwas verdattert dreinschauenden Großvater am Ärmel seiner Jacke in die Eingangshalle des ehemaligen Grandhotels »Adlerhöhe« hinein.
In der Mitte der kreisrunden, über alle drei Stockwerke nach oben zu einer Glaskuppel reichenden Lobby blieb er stehen. Über ihm schwebte der riesige Kronleuchter, der an einer goldenen, mit Efeu verzierten Kette vom höchsten Punkt der Kuppel herunterhing. Er drehte sich und sah nach oben, zuckte zusammen, als der Kronleuchter plötzlich erstrahlte, zumindest was die noch funktionierende Hälfte der verstaubten Glühbirnen an Licht noch abgab.
»Sogar der Strom geht noch«, sagte Opa Gu erstaunt. Vivi sah förmlich, wie ihr Großvater in Erinnerung vor seinem geistigen Auge das Hotel erstrahlen sah. Wie er sich wieder in seiner blauen Concierge-Uniform mit den goldenen Knöpfen dastehen sah, den Doorman Franz, von dem er Vivi schon einmal erzählt hatte, weil er mit Franz über viele Jahre lang einmal die Woche abends Schach gespielt hatte. Und den Betrieb vorfahrender Luxuslimousinen, die Berge großer, edler Koffer, den Empfangschef Herr Baumgartner und drei seiner »Damen«, wie dieser sie nannte, die die Gäste auf zuvorkommendste Art in Empfang nahmen. Und Peter und Ferdinand, die beiden Pagen, die mit goldenen Wagen das Gepäck der Gäste durch die Lobby schoben und auf die Suiten und Zimmer brachten. Seine Augen wurden feucht.
»Sind Sie sicher?«, fragte der Securitymann. Damit riss er den Großvater aus seinem Wachtraum. Er zuckte vor Schreck zusammen und drehte sich um.
»Ja, ganz sicher!«, erwiderte Vivi.
»Sicher?«
»Ja doch!«, entgegnete Vivi leicht genervt.
Opa Gu sah seine Enkelin fragend an. »Was meint er?«
»Gleich, Opa, gleich. Eine Überraschung!«
»Also gut, aber ich will keine böse Überraschung erleben. Lassen Sie alles so, wie es ist. Klar?«, fragte er und sah Vivi ernst an.
»Klar, Chef!« Vivi salutierte wie ein Soldat und grinste.
Bevor ihr Großvater noch etwas sagen konnte, verließ der große Mann in Schwarz die Lobby und schloss die Eingangstür hinter sich ab.
»Aber … aber … Vivi, er schließt uns hier ein! Halt! Stopp!«, rief der Großvater und machte ein paar Schritte auf die Eingangstür zu, so als wolle er den Mann draußen aufhalten, der unbeirrt in seinen schwarzen Wagen stieg und davonfuhr.
Der Großvater drehte sich um und sah seine Enkelin an.
»Was ist denn hier los?«, fragte er.
»Opa Gu, was ist heute für ein Tag?«
Er überlegte.
»Der 31. Juli, glaube ich. Oder?«
»Genau. Und was ist das für ein Tag?«
Ihr Großvater sah sie unsicher an, dann plötzlich weiteten sich seine Augen.
»Natürlich! Heute vor fünf Jahren war mein letzter Tag hier im Hotel.«
»Geeeenau, Opa Gu!«, freute sich Vivi, dass ihre Überraschung gelungen war.
»Aber er hat uns eingeschlossen!«
»Ja, und zwar bis morgen Mittag.«
»Was? Bist du verrückt?«
»Aber nein. Du sagst doch immer, wenn wir in die tolle Buchhandlung unten in der Stadt gehen, dass du da mal eine ganze Nacht eingeschlossen werden wolltest, um in allen Büchern stöbern zu können. Und genau das machen wir jetzt. Du kannst mir dein Hotel zeigen und mir die Geschichten erzählen, die dieses Haus zu erzählen hat.«
»Aber die ganze Nacht?«
»Wir haben Strom im ganzen Haus und in Zimmer 21 ist sogar ein Bett hergerichtet, falls du müde wirst. Und zu essen haben wir auch was.« Sie deutete auf eine Kühltasche, die am Rande des Empfangstresens stand.
»Du bist verrückt, Vivi! Vollkommen verrückt!«, schluchzte Opa Gu und ihm liefen Tränen über die Wangen. »Du hast das alles eingefädelt und geplant?«
»Jep, Opa!«, antwortete Vivi triumphierend.
»Die Überraschung ist dir gelungen.« Er nahm Vivis Kopf in beide Hände und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn.
»Los, komm, Opa Gu, wo fangen wir an? Was zeigst du mir zuerst?«
Eine Weile stand ihr Großvater still, bewegt und gerührt einfach nur da.
»Auf den Schreck muss ich mich erst einmal setzen. Du bist wirklich vollkommen verrückt. Aber die Überraschung ist dir gelungen.« Er ging zu einer der beiden großen Sitzgruppen, die jeweils aus Sesseln und zwei Sofas bestanden, in Beige mit großem floralem Muster. Als er sich in den Sessel fallen ließ, umgab ihn eine gewaltige Staubwolke und er musste kurz husten.
»Hier müsste mal wieder abgestaubt werden«, lachte er.
Vivi setzte sich ihrem Großvater gegenüber und sah ihn an, ließ ihm, obwohl sie so aufgeregt und ungeduldig war, die Zeit, die er brauchte. Nur erahnen konnte sie, wie sich ihr Großvater gerade fühlte. Sie hatten Zeit, einen Abend und die ganze Nacht. Nur sie zwei, hier in diesem Hotel, diesem Lost Place, der nur für sie da war.
»Wie hast du das gemacht?«, fragte er plötzlich.
»Ach, nicht so wichtig, Opa Gu. Hauptsache, wir sind jetzt hier, oder?«
»Ja, das stimmt«, sagte er und ließ sich in die plüschige Lehne des Sessels zurückfallen, was dieser mit einer weiteren kleinen Staubwolke quittierte.
Sie saßen einige Minuten nur da, hörten der absoluten Stille des leeren, großen Hotels zu, das in einem üppigen, von einer hohen Mauer umgebenen Parkgelände abseits der Schwarzwaldhochstraße lag. Zur Westseite hin offerierte das Haus seinen Gästen durch die raumhohen Sprossenfenster einen beeindruckenden Ausblick über das gesamte Rheintal bis hinüber zu den Vogesen. Bei klarerem Wetter konnte man im Süden den Turm des Straßburger Münsters erkennen, im Norden am Fuße der Berge Baden-Baden.
So waren sie in dem Haus weit weg von allem, was Lärm verursachen konnte. Ab und zu knackte irgendwo etwas, Holz, vielleicht ein Balken, vielleicht eine Tür.
»Wie fühlst du dich, Opa Gu?«
»Gut, mein Kind, sehr gut. Etwas aufgeregt. Ich hatte nicht damit gerechnet, das jemals wiederzusehen. Und etwas traurig, weil es so leer, so leblos ist.«
Er holte tief Luft. »Und Demut. Demut für all das, was ich hier erleben durfte. Die vielen Menschen, die vielen Erlebnisse, die Dramen, die Feiern, die Reichen und die Adligen. Könige waren hier und Regierende, Industriemagnate, Nobelpreisträger, Künstler und Neureiche mit ihren eingebildeten Vorzeigefrauen. Und alle waren sie mir recht, alle gleich.«
»Bip« – »bip« – »bip« … Wenn Maria jemals auch nur einen Hauch breit aus den tiefsten Tiefen ihres Dämmerschlafes auftauchen würde, wäre dies wohl das Erste und Einzige, was sie von ihrer Umgebung wahrnehmen würde: diesen hohen, beinahe schon schrillen Ton, der fast jede Sekunde wiederkehrt.
Sie würde in diesen Momenten mit Sicherheit nicht erahnen, dass sie selbst die Quelle des getakteten Signals ist, zeigt doch jedes einzelne »Bip« an, dass ihr Herz noch schlägt.
Sie sähe auch nicht und merkte wohl auch nicht, dass dieser Monitor, der ihren Herzschlag wiedergibt, keineswegs das einzige Gerät ist, das über sie wacht und sie versorgt.
Die ganze hochtechnische Palette intensivmedizinischer Maschinen erhebt sich am Kopfende ihres Patientenbettes in zwei vertikalen Reihen: Perfusoren, Infusoren, Sensoren …
Nein, davon, das zu erahnen, ist sie meilenweit entfernt.
Ein klebriger, zäher Nebel hat sich derart um ihr Bewusstsein gelegt, dass sie noch nicht einmal diese Tatsache erfassen würde.
Das geht nun schon tagelang so, bis es zuweilen langsam an ihr zupft, innerlich: Etwas regt sich … Fetzen von erschrockenem Gewahrwerden eines Gefangenseins in einer trägen Substanz, die die Sinne vernebelt.
Noch reicht dieses Zupfen nicht aus, einen halbwegs klaren Gedanken zu greifen. Immer noch schwappt diese unheilvolle träge Suppe jedes Rationale weg.
So kann sie auch nicht erkennen, dass hin und wieder jemand neben ihr am Bett sitzt, schweigend, sie betrachtend, voll von einfühlsamem Verständnis.
Statt eines klaren Gedankens tauchen in wahlloser Reihenfolge und wechselnder Dichte Bilder auf. Bilder, in denen sie vorkommt, ohne dass sie dies zu Anfang auch selbst so wahrnimmt. In einigen Szenen steht sie als kleines Mädchen am Bett einer alten Frau, die dort offensichtlich schon länger liegt. Schwach, in sich eingefallen, die Augen nur hin und wieder öffnend. Auf diese Frau gilt es aufzupassen, ihr gelegentlich den Mund zu wischen und die Stirn abzutupfen, bei Bedarf einen Schluck Wasser zu reichen oder ein Stückchen rindenloses Brot mit etwas Belag in den Mund zu schieben.
Dann wieder, in anderen Szenen, sieht sie sich, ohne sich zunächst selbst zu erkennen, als junge Frau in einer fast gleichen Situation: am Bett einer anderen alten Frau sitzend oder stehend. Auch hier gilt es, die Versorgung zu sichern, und sogar noch weitergehend: körperliche Hinterlassenschaften zu entsorgen, den gebrechlichen ausgemergelten Körper zu waschen, zu frottieren, umzulagern, Medikamente zu verabreichen.
In wahlloser Folge tauchen diese Bilder auf, anfangs nur selten, dann immer öfter und dringlicher. Dazwischen mischen sich Szenen, in denen sie sich als kleines Mädchen nicht an der Seite einer Bettlägerigen wiederfindet, sondern in Begleitung einer anderen Frau. Diese Frau erscheint nicht sehr freundlich, sondern fordernd, ja, fast schon übergriffig, Erwartungen anmeldend, Vorhaltungen machend. Das kleine Mädchen fühlt dabei eine Ohnmacht, die sich nicht überwinden lassen will; nur ein Sich-Fügen scheint angemessen.
Ähnlich ergeht es ihr in der Rolle als junger Frau aus den vergleichbaren Szenen, auch hier erscheint statt einer pflegebedürftigen Alten jemand, der über sie bestimmen will, der ihr vorschreiben will, was sie zu tun und zu lassen hat. Und zwar in einem Ton, der keinen Widerspruch duldet, mehr noch, es als etwas Gottgegebenes hinstellt. Etwas, dem unbedingt um des Seelenfriedens zu folgen ist – in aller Demut.
Das Auftauchen dieses Begriffes sticht schmerzend in ihr immer noch dumpf dahintreibendes Bewusstsein, welches sich wehren will. Der Stich lässt sich jedoch nicht so leicht verdrängen, er bleibt mehr oder weniger intensiv. Er will wahrgenommen werden. Er will, dass man sich um ihn kümmert.
Doch dann, plötzlich und schockierend zugleich, setzt sich ein Erkennen durch, spontan und unwiderruflich.
Jetzt erst wird ihr bewusst, dass sie selbst das Mädchen ist, die kleine Maria etwa im Alter von elf Jahren.
Was man vielleicht als einen Durchbruch bezeichnen könnte, ist gefühlt eher ein Rückschlag, ein Zurückgestoßensein in ihre damaligen Empfindungen.
Dann die nächste Stufe der Erkenntnis: Die Bettlägerige ist ihre eigene Großmutter, die endlos lange Jahre im Halbschlaf vor sich hindämmerte. Es war die Aufgabe der kleinen Maria, sich um diese gebrechliche Person zu kümmern. Es war ihre Pflicht, kein Auge von der Kranken zu lassen – zumindest, wenn die Schule vorbei war. Es war die eigene Mutter, die darauf bestand, dass Maria nachmittags und abends die Wache und Pflege übernahm: ausnahmslos und voller Demut! Schließlich war die alte Frau dort im Bett diejenige, die zuerst der Mutter und dann – indirekt – auch ihr das Leben geschenkt hatte.
So eine Verpflichtung überwiegt alles andere. Sie stellt alles in den Schatten. Diese Erkenntnis trifft Maria hart, und das immer noch getrübte Bewusstsein wünscht sich in solchen wenigen klaren Augenblicken sehnlichst, wieder abzutauchen.
Aber nein: Kaum sind die Bilder um das kleine Mädchen entschlüsselt und halbwegs akzeptiert, setzt ein neuer Schub des Bewusstwerdens ein.
Auch die zweiten Szenen einer jungen Frau in gleicher Lage erhellen sich schmerzlich und erschreckend. Auch hier ist sie es selbst, die eine weitere bettlägerige Person zu betreuen hat, noch schockierender: Es ist ihre eigene Mutter, die diesmal im Pflegebett liegt und versorgt werden muss. Und es ist die eigene Stimme im Kopf, die ihr dies aufzwingt, als gottgegeben und unwiderruflich.
»Bip« – »bip« – »bip« … Der monotone, hohe Glockenklang ist Markus vertraut; der gleichmäßige Rhythmus gibt ihm ein beruhigendes Gefühl. Er kann die Signale deuten und auch die vielen Kurven interpretieren, die am Kopfende des Intensivbetts mehr oder weniger lebhaft darüber Auskunft geben, ob und wie der Körper der darin liegenden Patientin funktioniert.
Seit Tagen schon verbringt er seine Freizeit hier in dieser für ihn ach so gewohnten Umgebung. Denn das ist sein Beruf und sein Metier, in dem er sich auskennt: die medizinische Überwachung und Versorgung intensiv zu betreuender Patientinnen und Patienten.
Allerdings ist dies hier nicht sein eigentlicher Arbeitsplatz; seine Klinik liegt in einem anderen Stadtteil.
Warum er auch noch in seiner dienstfreien Zeit den Drang verspürt, in einem fremden Haus auf eine ihm eigentlich unbekannte Person zu achten? Er kann es selbst nicht so genau sagen. Etwas an dieser Frau hat ihn in seinen Bann gezogen. Dabei kennt er sie noch nicht einmal wirklich.
Sie war …? Sie ist …? … eine Nachbarin …? Er wohnt in einem Hochhaus mit über zwanzig Etagen, jeweils bis zu acht Wohnungen auf jedem Stockwerk. Kann man da von einer Nachbarin sprechen?
Bis zu jenem besonderen Tag wusste er noch nicht einmal von ihr, auch nicht, dass sie auf der gleichen Etage, sogar ihm gegenüber wohnt. So unregelmäßig seine Arbeitszeiten sind und so intensiv er für seinen Beruf lebt, desto weniger kümmerte er sich bisher um sein privates Umfeld. Nicht, dass er etwas vermisste oder dass er sich unglücklich oder zu kurz gekommen fühlte. Er hat sich bewusst in seinem privaten Kokon fast wie ein Eremit eingenistet.
Nur wenige zweckmäßige Möbel hat er als Einrichtung gewählt. Sein einziger Luxus sind schwere Vorhänge vor den Türen, um möglichst viele Geräusche zu dämmen, und eine außergewöhnliche Musikanlage, die ihm einen unbeschreiblichen Klanggenuss gewährt. Er liebt ruhige, melodische, entspannende Musik, auch Naturklänge voller Nuancen, die ihn beinahe in eine Art Trance zu versetzen vermögen. Und er liebt den weiten Blick aus seinem großen Wohnzimmer- und Balkonfenster auf die bewaldete Hügellandschaft, die sich im Osten erhebt.
Nein, er ist kein Yogi, kein Meditierer – es ist einfach seine Art, mit sich im Reinen zu sein. Er liebt seinen Beruf mit Hingabe, und in gleicher Weise liebt er sein zurückgezogenes Dasein in Harmonie mit sich selbst.
Jener besondere Tag allerdings gab seinem Alltagsgeschehen eine unerwartete Wendung. Auf dem Rückweg von der Frühschicht registrierte er sehr wohl vor dem Wohnblock einen Rettungs- sowie den Notarztwagen. Nichts wirklich Ungewöhnliches bei einem so großen Wohnblock und den vielen Einwohnern, sollte man meinen. Ohne dieser Beobachtung viel Aufmerksamkeit zu schenken, stellte er seinen Wagen in der Tiefgarage ab und nahm den Aufzug zu seiner Etage.
Vor seiner eigenen Wohnung angekommen, bekam er durch die offen stehende gegenüberliegende Wohnungstür den geschäftigen Wortwechsel seiner Kollegen mit, deren Einsatz nicht zu übersehen und zu überhören war.
Eher aus einem für ihn ungewöhnlichen Impuls der Neugier heraus statt aus professionellem Antrieb näherte er sich der ihm fremden Wohnung. Er trat langsam ein und sah eine Frau im mittleren Alter bewusstlos auf dem Boden liegen. Sanitäter und Notarzt agierten höchst konzentriert und professionell und versorgten die leblose Patientin mit den nötigen Medikamenten und Geräten, sodass es eigentlich keinen Grund für ihn gab hierzubleiben.
Auch schien niemand von ihm Notiz zu nehmen, und so ging er ein paar Schritte weiter und warf einen genaueren Blick in die Wohnung, die ähnlich geschnitten war wie die seine: ein großes kombiniertes Wohn-Schlaf-Esszimmer mit offener Küchenzeile. Der Blick aus dem großen Wohnzimmerfenster ging nach Westen über das quirlige Stadtzentrum.
Ungewöhnlich war jedoch ein Pflegebett, das sich inmitten des Raumes befand, umgeben von medizinischen Utensilien und Materialien, die auf einen Langzeit-Pflegeplatz hindeuteten. Im Pflegebett – er musste zweimal hinsehen – lag eine … Tote? Eine eingefallene, abgemagerte, leblose ältere Frau lag dort, fast schon aufgebahrt: zugedeckt, die Hände auf der Bettdecke gefaltet, die Augenlider geschlossen, die Haare sorgfältig gebürstet.
Noch während er versuchte, sich einen Reim auf die Szenerie zu machen, betraten zwei Polizeibeamte den Raum. Offenbar waren sie vom medizinischen Einsatzpersonal benachrichtigt worden. Zunächst ließen sich die Beamten vom Notarzt über die Situation informieren und wandten sich dann an Markus. Wer er sei, ob er verwandt oder sonst wie mit den Personen in Beziehung stünde. Da dies nicht der Fall war, baten die Uniformierten ihn, die Wohnung sofort zu verlassen. Kurz konnte er seine ihm nicht weiter bekannten Kollegen noch fragen, wie es um die Notversorgte stünde und wohin sie die zu Behandelnde bringen würden.
Er schloss seine Wohnung auf, legte seine Sachen ab und trat langsam an sein eigenes großes Fenster. Welches Geheimnis mochte sich auf seiner Etage direkt gegenüber verborgen haben? Welche Schicksale mochten sich dort abgespielt haben, ohne dass er vermutlich je etwas davon erfahren hätte?
Etwas begann, an seinem Selbstverständnis zu nagen. War er seiner Umgebung gegenüber so ignorant? Bisher jedenfalls, so fand er, habe er sich mit vollem Einsatz den ihm anvertrauten Patientinnen und Patienten gewidmet.
»In Demut«, wie er meinte und es auch so empfand: ohne Ansehen der Person, ohne ihre eventuellen persönlichen Einstellungen, ohne ein mögliches Selbstverschulden an ihrer Krankheit oder andere Eigenschaften.
Und so hatte er – zu Recht, so dachte er bisher – sein privates Leben in Ruhe und Zurückgezogenheit gelebt. Reichte das als »gutes Leben«, um als »guter Mensch« eines Tages das Hier und Jetzt zu verlassen?
An jenem Tag kamen ihm Zweifel. Natürlich konnte er nicht die ganze Welt retten! Das war ihm schon klar. Aber vielleicht doch ein wenig mehr die Augen offen halten, besser noch, mit allen Sinnen auch seine unmittelbare Umgebung wahrnehmen, statt sich völlig zurückzuziehen. Nein, das würde ihn sicher nicht überfordern, ein wenig mehr Offenheit und Vernetzung mit seinem unmittelbaren Umfeld würde ihm sicher nicht schaden.
Und so beschloss er an diesem Tag, sich zunächst erst einmal der Geschichte seiner Nachbarin zu widmen. Das wäre ein erster Schritt aus seiner Komfortzone, in der er es sich ach so gemütlich gemacht hat.
Dabei fiel ihm das hübsche Wortspiel ein: Komfortzone – Komm-vor-Zone.
»…« – »…« – »…« … Tonlos, aber mit einem Aufblinken registriert ein Kompaktmonitor jeden Herzschlag von Maria. Sie liegt nun in einem einfacheren Zimmer halb aufgerichtet in ihrem Krankenbett. Lediglich über einen Zugang an ihrem Handrücken wird sie mit den noch benötigten Medikamenten versorgt, und das kleine Gerät überwacht ihren Puls und ihre Sauerstoffsättigung.
Meist hat sie die Augen geschlossen und dämmert vor sich hin. Die verstörende Bilderflut hat nicht nachgelassen, aber sie lässt sie regungslos über sich ergehen. Auf Ansprachen der Pflegekräfte reagiert sie nur ungern, öffnet vielleicht hin und wieder die Augen und den Mund, wenn sie darum gebeten wird. So hat sie bisher auch nur am Rande registriert, dass ab und zu jemand etwas länger in ihrem Zimmer schweigend Platz nimmt.
Es ist Markus, der nach wie vor so gut wie täglich Zeit neben Marias Bett verbringt. Seine Kollegen haben akzeptiert, dass er ihre Patientin ohne Rücksicht auf die Tageszeiten besucht. Auskunft geben dürfen sie ihm eigentlich nicht – man versteht: der Datenschutz. Aber er ist ja einer von ihnen und kann die jeweilige Situation auch ohne direkte Erklärung interpretieren. Was immer das Pflegepersonal mit der Patientin durchführt, Markus schweigt dazu. Nein, er überlässt das in diesem Fall den Zuständigen, auch wenn er vielleicht den einen oder anderen Handgriff anders durchgeführt, die eine oder andere Situation anders eingeschätzt, die eine oder andere Medikamentengabe differenziert vorgenommen hätte.
Für ihn zählt in diesem Fall nur das Hiersein, die schweigende Anteilnahme, auch ohne etwas von Maria oder seinen Kollegen zu erwarten. Nach wie vor kennt er Marias Geschichte nicht. Nach wie vor weiß er nicht, was in der Wohnung gegenüber der seinen vorgefallen ist oder sich dort vielleicht sogar schon über Jahre hinweg abgespielt hat.
Seines Wissens war nur ein einziges Mal ein Kriminalbeamter am Krankenbett. Das gibt ihm das sichere Gefühl, dass nichts Verbotenes oder gar ein Verbrechen auf seiner Etage stattgefunden hat. Nach wie vor geht ihm zwar das Bild der toten alten Frau nicht aus dem Sinn, aber mehr rührt ihn das Schicksal Marias, auch wenn er nicht sagen könnte weshalb.
Bei Maria nimmt der Bilderstrom langsam einen ruhigeren Fluss an. Sie fühlt sich nicht mehr so sehr von ihm mitgerissen, gar untergetaucht. Stattdessen eher getragen wie ein toter Baumstamm, der langsam mit der Fließgeschwindigkeit des Wassers dahintreibt. Es ist ein leicht entspannendes Gefühl, sich nun treiben lassen zu können, ohne etwas zu müssen, ohne zu kämpfen, ohne nach Luft zu schnappen.
Markus interpretiert den ruhigeren Puls und die etwas gestiegene Sauerstoffsättigung in gleicher Weise als ein gutes Zeichen. Bisher saß er nur neben dem jeweiligen Pflegebett, ohne sich groß eine Vorstellung über eine erste wirkliche Kontaktaufnahme mit der Kranken zu machen. Doch als er registriert, dass die Patientin – wohlgemerkt, nicht seine Patientin – entspannter wirkt und mit ihrem baldigen vollständigen Wachwerden zu rechnen ist, fällt ihm auf, dass er sich bisher über den Erstkontakt noch überhaupt keine Gedanken gemacht hat.
Was sollte er sagen? Was hätte er zu sagen? Will er denn überhaupt etwas sagen? Wie sollte er sie anreden? Er weiß, dass sie Maria heißt; dürfte er Du sagen? Und was wird sie sagen, wie wird sie seine Anwesenheit auffassen? Wird sie überhaupt wollen, dass er hier ist? Kennt sie ihn etwa? Weiß sie, dass er ihr Nachbar ist? Was hätte er ahnen oder wissen müssen über das Leben gegenüber seiner eigenen Wohnung?
Kurz überfluten ihn die vielen Fragen, aber durch seinen Beruf ist er gewohnt, mit plötzlichen Situationswechseln umzugehen. Er atmet ein paarmal tief ein und aus und lässt die Fragen und Gedanken passieren. Wenn es Zeit dazu ist, wird die richtige Antwort auf jede der Fragen eintreffen. So wie immer – mit Ausnahme der Frage, warum er überhaupt hier sitzt; aber auch die Antwort, so ist er sicher, wird sich eines Tages ergeben.
Es vergehen noch ein oder vielleicht zwei Tage, bis Maria bereit ist, die Augen wirklich zu öffnen und ihre Umgebung zu erfassen. Sie ist nicht erschrocken, sie hat auch mit geschlossenen Augen und in entspannter Dämmerung wahrgenommen, dass sie versorgt wird, und sich ihre Situation ausmalen können.
Worauf sie nicht gefasst war, ist, dass ein männliches Wesen ohne Arzt- oder Pflegerkittel neben ihrem Bett sitzt, ihr schweigend einen Blick zuwirft und dann ruhig und entspannt einfach nur da ist. Wer ist das?
Markus hat sich inzwischen auf diesen Moment vorbereitet, und zwar derart, dass er es Maria überlassen wird, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Seine Rolle ist, da zu sein, abzuwarten, es fließen, es geschehen zu lassen.
Es dauert noch eine Weile, bis Maria ihn noch einmal anschaut. Verdutzt, wie es scheint, überrascht. Aus ihrer so lange schweigsamen Kehle kommt nur ein kurzatmiges, kratzendes »Was?«
Und aus seinem Mund fließt ohne lange Vorüberlegung die Antwort: »Nichts. Nur … Ich weiß: Du heißt Maria. Ich bin Markus, ich wohne dir gegenüber.« Mehr fürs Erste nicht.
Maria wendet den Blick ab und schließt die Augen. Er sei ein Nachbar? Nicht, dass sie sich an ihn oder sein Gesicht erinnern würde. Ja, sie hat die Wohnung auch nur selten verlassen, für Einkäufe oder Besuche in der Apotheke. Nie hat sie irgendwen bewusst wahrgenommen. Sie will noch einmal hinsehen, aber da öffnet sich die Zimmertür.
Ein Arzt und eine Krankenschwester treten ein. »Herr Kollege?«, wird Markus aufgefordert, das Zimmer für eine Visite zu verlassen. Er kommt der Bitte nach, tritt vor die Tür und sammelt sich: War das ein guter Anfang eines Gesprächs? Das weiß man immer erst hinterher. Nach etwa fünf Minuten darf er wieder zurück auf seinen Platz am Bett.
»Kollege?«, kommt es aus Marias rauer Kehle, den Blick fragend auf ihn gerichtet.
»Na ja … nicht in dieser Klinik. Ja, ich bin Krankenpfleger. Ich habe zufällig den Einsatz in deiner Wohnung mitbekommen. Ich war gerade von meiner Schicht heimgekommen.«
Maria wendet den Blick und schließt die Augen. Jemand hat sie also in ihrem schwächsten Moment gesehen? Jemand, den sie nicht kennt und der jetzt hier sitzt. Was will er?
Wieder bringt sie nur ein »Was?« heraus.
Markus beginnt langsam und ehrlich: »Ich weiß es nicht … Ich hatte, nein, ich habe das Gefühl, es ist richtig, was ich hier tue … Einfach nur da sein.«
Maria hält den Blick abgewandt und die Augen geschlossen, antwortet nicht, bleibt aber ruhig.
Er fährt fort: »Ich bin Pfleger, und ich tue alles, was ich kann, für meine Patienten. Das war für mich immer genug. Ich fand, ich hätte mich damit genug in die Welt eingebracht. Ich habe das in aller Demut gemacht. Ich dachte, das sei genug.«
Wieder eine Pause. Dann: »Ich habe nicht wirklich wahrgenommen, dass es auch außerhalb der Intensivstation Leben gibt … na ja … Schicksale, Menschen, mit allem, was das Leben zu bieten hat … Dann habe ich nur ganz kurz in deine Wohnung, auf dein Leben blicken können. Und ich war mehr über mich erschrocken … Ich habe mit mir ausgemacht, mir mehr Zeit zu nehmen, genauer hinzuschauen – zumindest hier.«
War es das, was er sagen wollte? Hat sie ihn verstanden? Hat er sich selbst verstanden? Maria hat die Augen geschlossen, scheint aber wach – zumindest sagt das der Monitor. Da auch nach einer Viertelstunde keine Antwort und kein Blick kommen, beschließt Markus, es für heute genug sein zu lassen.
Als er am nächsten Tag wiederkehrt, diesmal spät, hat er den Eindruck, dass er schon erwartet würde – eine ganz neue Situation und überraschend für ihn.
Maria begrüßt ihn mit einem schwachen Kopfnicken und blickt ihn fragend an, sodass ihm ein »Was?« statt einer Begrüßung herausrutscht. Maria räuspert sich und beginnt mit rauer, belegter Stimme: »Komisch, dass du Demut erwähnt hast.«
Es folgt eine Pause, auf die Markus nachdenklich antwortet: »Ja … Das ist für mich die Antwort auf die Frage: ›Was kann ich eigentlich? Was soll ich eigentlich?‹ Die Antwort: ›Ich möchte mich, meine Talente, dienend in die Welt einbringen.‹ Also, das klingt vielleicht jetzt schwülstig, aber das ist das, was ich unter Demut verstehe … Und gleichzeitig darf ich mich um mich kümmern, ich darf Zeit für mich haben, ich darf …«
Noch einmal macht er eine Pause. »Ich darf … dabei aber nicht ganz die Augen verschließen vor dem, was unmittelbar um mich herum passiert, auch außerhalb der Intensivstation.«
Und nach einer weiteren Pause ergänzt er: »Deshalb bin ich einfach hier, als Anfang, die Augen aufzumachen.«
Wieder nach einer Weile dann: »Ich hoffe, ich bin dir damit nicht zu nahe getreten … Ich kann auch gehen und wegbleiben, wenn das für dich besser ist … Ich habe wieder mal nur an mich gedacht, fürchte ich.«
Sie schaut ihn kurz an, dann wendet sie den Blick wieder ab und schließt die Augen. Nach einem Moment des Schweigens flüstert sie: »Nein, danke, schon gut.«
Es dauert noch ein paar Tage, bis Maria etwas flüssiger sprechen kann. Sie erzählt von ihrem Leben als unfreiwillige Pflegerin. Erst war es ihre Großmutter, die pflegebedürftig war. Und da ihre alleinerziehende Mutter damit beschäftigt war, den Lebensunterhalt für drei zu verdienen, war die Versorgung der Bettlägerigen zu Marias Aufgabe geworden.
Kaum war die Großmutter nach über zehn Jahren gestorben, hat sich – so fasst es Markus auf – die Mutter selbst ins Bett gelegt und zur zu pflegenden Person erklärt. Wieder war es an Maria, die Versorgungsaufgabe zu übernehmen. Ihr ganzes Leben bestand also darin, jeweils für eine alte Frau zu sorgen, die im Bett lag. Es war ihr so aufgegeben und ausweglos erschienen.
Dann war ihre Mutter friedlich eingeschlafen, und Maria hatte ihre Aufgabe erfüllt, so sah sie das. Aber: Was dann? In einer Kurzschlussreaktion muss es wohl gewesen sein, dass sie sich eine Überdosis von Mutters Medikamenten hinunterwürgte. Als sie dann schon die Wirkung spürte, musste sie wohl über sich selbst erschrocken sein. Voller Scham und Reue setzte sie einen Notruf ab, konnte gerade noch die Wohnungstür öffnen, bevor sie zusammenbrach.
Was Markus am meisten zu denken gibt: Die gleiche Lebensaufgabe, die er für sich gestellt sieht und angenommen hat, war Maria mehr oder weniger aufgezwungen worden.
Beide hatten die Annahme der Aufgaben als »Demut« verstanden. Offensichtlich ist Demut ein schwer zu fassender Begriff: In der offiziellen Definition des Dudens wird er beschrieben als eine »Ergebenheit, die sich herleitet aus der Einsicht in die Notwendigkeit und im Willen zum Hinnehmen der Gegebenheiten«.
Markus empfand es als eine Pflicht, der er sich gestellt sah. Für Maria war es ein Zwang, der ihr auferlegt worden war.
»Demut«
von Michael Ständer
1
Vivi juchzte über ihre gelungene Überraschung.
»Komm, Opa Gu! Zeig mir den alten Kasten!« Sie sprang los auf die große geschwungene Treppe zu.
»Langsam, Vivi. Ein alter Mann ist doch kein D-Zug!«
»Was ist denn ein D-Zug?«, fragte Vivi. »So was wie ein ICE, nur in alt?« Sie lachte, denn sie liebte die veralteten Sprüche und Beispiele ihres Großvaters. Erst kürzlich hatte er ihr erklären müssen, was ein Videorekorder war.
»Dann lass uns aber hier unten anfangen«, sagte Opa Gu und ging hinüber zu der breiten Empfangstheke. Vivi sprang an seine Seite. Als sie mit dem Arm über den Tresen wischte, stieg Staub auf. Sie hüstelte gekünstelt.
»Ja, alles etwas angestaubt. Du kannst dir nur ein bisschen vorstellen, welchen Zauber dieses Haus hatte, als es in Betrieb war. Hier am Empfang, unser Empfangschef Herr Müller. Der war wunderbar zu den Gästen, hat sie sich hier sofort besonders aufgenommen fühlen lassen. Und die Pagen hatten mächtig Respekt vor ihm. Mein lieber Scholli, konnte der einen Pagen in den Senkel stellen, wenn ihm ein Koffer vom Wagen rutschte.«
»Puh, das kann ich mir vorstellen«, sagte Vivi, ging um den Tresen herum und setzte ein strenges Gesicht auf.
»Oh, Herr Siebenpfeifer! Wie schön, Sie wieder in unserem Hause begrüßen zu dürfen!« Sie äffte den Empfangschef mit tiefer Stimme nach. »Selbstverständlich haben wir wieder die große Suite für Sie reserviert. Eine Flasche Champagner steht gekühlt schon bereit, natürlich die beste Marke.« Sie drehte sich um zur Wand, an der tatsächlich noch die Schlüssel mit dunkel angelaufenen Messinganhängern hingen. »Suite 21, bitte schön, Herr Siebenpfeifer.« Sie reichte ihm theatralisch einen Schlüssel.
»Nummer 30 ist unsere schönste Suite«, flüsterte er ihr mit vorgehaltener Hand zu.
»Oh, natürlich, Herr Siebenpfeifer, entschuldigen Sie.«
»Fräulein Bauernfeind, haben Sie wieder die Schlüssel vertauscht! Da sprechen wir noch drüber!«, spielte Vivi den Empfangschef.
Sie reichte ihrem Großvater den Schlüssel mit der Nummer 30 drauf.
»Vielen Dank, Herr Müller. Es wird mir wieder ein Vergnügen sein.«
»Ihren gewohnten Tisch mit dem herrlichen Ausblick für das Abendessen habe ich bereits für Sie reserviert. Neunzehn Uhr wie immer, ja?«
»Ja, sehr gerne«, spielte der Großvater mit.
Mit ins Genick gekipptem Kopf schnippte Vivi mit den Fingern und winkte virtuell den Pagen herbei. »Bitte begleite Herrn Siebenpfeifer auf seine Suite. Seine sechs Koffer mit seinen Büchern stehen noch draußen. Bitte schnell. Hopp, hopp, sonst gibt’s mal wieder eine Heiligabend-Nachtschicht!«
Der Großvater lachte. »Ja, so ungefähr war Herr Müller.«
Vivi stützte sich auf ihre Arme und schwang sich auf den Tresen. »Der Empfang ist doch sicher der interessanteste Bereich im Hotel, oder? Da lernt man alle Gäste kennen. Für mich wäre das nichts. Immer den Leuten dienen, immer höflich und nett sein, selbst zu den eingebildetsten Tanten und arrogantesten Herren.«
»Dienstleistung«, sagte der Großvater. »Dienst leisten. Das muss man wollen, das kann man nicht lernen. Etwas für andere tun, damit sie sich besser fühlen, damit alles zu ihrem Wohle getan wird. Und dabei milde sein, freundlich bleiben, immer verbindlich, aber höflich. Das ist das Geheimnis. Dann bringt dir das selbst so viel Wertvolles. Das war immer mein höchster Lohn für meine Arbeit, und vielleicht habe ich diesen Beruf deshalb so geliebt.«
Charlotte
Florians Brief hatte einige Tage ungelesen auf Charlottes Schreibtisch gelegen, bis sie den Mut fand, ihn zu beantworten. Sie wusste, dass es eine besondere Bewandtnis haben musste, wenn er zur Feder griff. Denn schon bald nach ihren ersten Treffen flogen seine Worte pfeilschnell durch den Äther hin und her und landeten auf dem kalt leuchtenden Monitor ihres PC. Charlotte fand das sehr schade, denn sie liebte seine gleichmäßige Schrift, liebte seine Worte, die er für sie fand. Er lachte nur, wenn sie sagte, seine Worte verlören an Intimität, wenn sie nicht in einem Liebesbrief standen. »Intimität mit dir ist mir lieber«, sagte er damals schmunzelnd.
Und sie hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, ihm nach jedem Sommertreffen in glühenden Worten ihre Empfindungen und Gefühle im Zusammensein mit ihm zu schildern. Die Briefe sandte sie stets an eine Geschäftsadresse in Frankfurt, wie er es verlangte. In gewisser Weise war es ihr gleichgültig gewesen, dass Flori sie gebeten hatte ihre Verbindung geheim zu halten. Er war ein nicht unbekannter Forscher und wollte kein Gerede.
Ach, Frankfurt, nie hätte sie erwartet, hier in dieser geschäftigen Metropole des Geldes und der Wissenschaft ihre große Liebe zu finden. Und Florian hatte nie einen Zweifel daran gelassen, dass er ebenso empfand. Und nun hatte er angedeutet, dass sich eine Änderung anbahnte.
»Mein geliebter Flori,
Ich weiß, es ist Sommer, schriebst du mir in deinem letzten Brief, und sooft ich die Worte lese, höre ich deutlich einen entschuldigenden Klang in deiner Stimme. Dabei hatte ich dich dieses Mal gar nicht daran erinnert, dass ich Sehnsucht nach ›unserem‹ Sommer habe, denn unser Sommer findet ja gänzlich unabhängig von der Jahreszeit statt. Darüber bin ich immer mehr als glücklich, ein paar Tage deiner kostbaren Zeit mit dir zu genießen. Du bist für mich alles, was ein Sommer an Überschwang bereithält, mein Liebster.
Ja aber, höre ich dich einwenden, unser erster heißer Sommer fand in der richtigen Jahreszeit statt, und da kann ich dir ja nicht widersprechen. Fünf Jahre sind wir nun zusammen und ich bin nach wie vor von dir erfüllt an Leib und Seele. Wir mussten uns finden, wir waren uns seit langen Generationen vorherbestimmt, mein über alles geliebter Flori.
Ich vermisse dich in jeder Minute, die wir nicht zusammen sind. So viele Liebesworte, so viele Fotos hast du mir geschickt, die mich und manchmal auch dich in unseren glücklichen Sommerzeiten zeigen und für immer festhalten. Beim Rodeln in den Bergen, im sommerheißen Garten, am lodernden Kaminfeuer, am großen Fluss im Schwarzwald, in Island im Frühling als Eismalerin, ja, wir waren der Sommer selbst.
Doch nun will mich eine dunkle Ahnung beschleichen, als würden unsere Sommer nicht mehr zur gleichen Zeit stattfinden.
Bist du der sommerlichen Erscheinungen müde geworden?
Der zitternden Hitze vor dem erschauernden Guss?
Des schnellen Atems, der wie ein löschender Trank die heißen Lippen berührt?
Der glühenden Haut, gekühlt von fächelnder Zärtlichkeit?
Der wortlosen Laute, wenn Blitze die Glieder durchzucken?
Der Liebe Duft, der uns zusammenführte?
Sag mir, mein Hirte, mein Hüter der wilden Gedankenmeute, wenn du das alles bedenkst, willst du dann wirklich unsere Sommer zu Ende gehen lassen?
Du schreibst, ich weiß, es ist Sommer, aber weißt du es wirklich? Sage es mir, schreibe es nicht! Sage mir, was du schon weißt, was schon in dir ist, was mich jetzt im Innern erzittern lässt.
Sage es mir, warum unser Sommer vorbei ist. Sage mir, was dir die Lust und die Kraft nimmt, unsere Sommer in einen lieblichen Herbst umzuwandeln. Du weißt doch, alle Lust will Ewigkeit.
In großer Liebe
Deine Flotti«
In einer kurzen Mailnachricht bestätigte Florian nach drei Tagen den Erhalt des Briefes und bat sie um ein Treffen in einem Restaurant, das sie öfter besucht hatten.
Charlotte war fassungslos, als er ihr eröffnete, dass er für ein Jahr nach Amerika ginge, um die Bauten der Pueblo-Indianer und den Verbleib ihrer Nachfolger, der Navajos, zu erforschen und fotografisch zu dokumentieren für sein neues Buch. Als er ihr dann noch mitteilte, dass das Institut schon eine komplette Crew zusammengestellt hatte und auch die Stelle einer Fotografin und Texterin schon besetzt war, konnte sie nur noch einen Satz denken: »Er will mich nicht dabeihaben.«
Schon seit Tagen hatte sie einen dumpfen Druck auf der Brust gespürt, wenn sie an das heutige Treffen gedacht hatte. Und wie in einem rosigen Nebel verschwamm nun das Gesicht ihres Gegenübers. Sie sträubte sich gegen die aufkommende Gewissheit, dass dies ein Abschied von Florian war, von ihrer großen Liebe in ihrem Leben.
»Ist meine Vermutung richtig, dass du Constanze Perl vom Perl-Verlag als Fotografin engagiert hast?«
Florian nickte kaum merklich. »Flotti, ich bin verpflichtet.« Charlotte hob abwehrend die Hände, doch er hielt sie mit sanfter Kraft in den seinen. »Ich bin verpflichtet, sie mitzunehmen. Ihr Verlag wird in Zukunft meine Bücher herausbringen und übernimmt fünfundsiebzig Prozent der Reise- und Forschungskosten für ein Jahr. Und wir, das Institut und ich auch, wir sind auf das Geld angewiesen.«
»Oh, ich verstehe, Geld ist ein starkes Argument, sie mitzunehmen.« Charlotte entzog ihm ihre Hände und umfasste ihre Oberarme. »Was weiß diese Frau Perl über uns, weiß sie, dass wir zusammen sind? Und was bedeutet die ganze Situation für mich, für uns?«
»Flotti«, sagte Florian eindringlich, »ich möchte nicht, dass du auf mich wartest, du bist zehn Jahre jünger als ich, du bist beruflich nicht festgelegt, hast großes Schreibtalent für Reiseberichte und wirst vielleicht auch nicht hier in Frankfurt bleiben wollen. Ich weiß nicht, ob Constanze etwas von uns weiß.«
Charlotte saß ganz still, starrte ihn mit großen Augen an, die sich jetzt mit Tränen füllten. »Du hast für mich den Kosenamen Flotti erfunden, aus Flori-Lotti Flotti gemacht. Ja, es geht nun flott zu Ende mit unserer Liebesgeschichte«, sagte sie leise und bitter. Wieder wollte Florian ihre Hände halten, doch sie wies ihn ab.
»Was ist mit meinen Briefen und den Fotos, die ich dir überlassen habe?« Hart und kurz kamen jetzt die Worte aus ihrem Mund.
»Ich möchte alles behalten, was du mir geschrieben und geschenkt hast. Auch jene Geschenke, die man nicht sehen, sondern ich nur fühlen konnte, werde ich niemals vergessen«, erwiderte er eindringlich.
Charlotte schwieg. Dann sagte sie ruhig: »Ich möchte dich bitten, mir in Zukunft weder Mails noch andere Nachrichten zu schicken, auch keine über deine Arbeiten. Wann wirst du fliegen? Was ist mit deinen Sachen in meiner Wohnung?«
»Nächste Woche, es ist alles vorbereitet. Bitte sende die Sachen an meine Geschäftsadresse. Ich wollte und konnte dich nicht früher informieren, ich bin nicht erfreut über diese Art von Abschied.«
»Dann möchte ich jetzt gehen«, erhob sich Charlotte, ihre Hände umkrampften die Griffe ihrer Tasche.
»Lass mich dich nach Hause bringen«, drängte Florian, sich ebenfalls erhebend, »warte bitte, bis ich die Rechnung beglichen habe.«
»Ich habe einen eigenen Wagen. Und wieso denkst du, dass ich nach Hause will? Jetzt habe ich Zeit und alle Freiheiten, mich umzusehen und zu amüsieren. Fünf Jahre, Florian, fünf Jahre, in denen ich nur für dich lebte, einfach abzuhaken, dazu bedarf es einiger Hilfsmittel.«
»Was meinst du mit Hilfsmitteln?«, stieß er hervor.
»Nun, das überlasse ich deiner Fantasie, du warst ein erfahrener Liebhaber und hast mich ja einiges gelehrt.« Damit drehte sie sich um und verließ das Restaurant.
»Flotti, Charlotte«, sagte Florian leise und starrte wie hypnotisiert zur Tür, die sich langsam und von selbst hinter ihr schloss.
Dreißig Jahre später
Gewohnheitsmäßig wie jeden Tag, wenn sie nach Hause kam, schob Charlotte ihre Hand in den großen Briefkastenschlitz und forschte nach ihrer Post. Noch im Treppenhaus blätterte sie die Briefe hastig durch und seufzte, als sie die vielen Anfragen ihrer Redaktion sah.
Nachdem sich Florian damals von ihr getrennt hatte, war sie recht bald in eine neue Wohnung gezogen, weit weg vom Perl-Verlag und leider auch von ihrer Redaktion. Dies war eines der Hilfsmittel, mit dem sie ihren großen namenlosen Schmerz in eine neue Umgebung zwang, wo keinerlei Erinnerungen an Florian in den Wänden und Vorhängen saßen, um sie nächtelang zu quälen.
Mit verbissenem Eifer widmete sie sich ihrem beruflichen Fortkommen, indem sie ihre Reiseberichte verschiedenen Journalen und Reisebüros anbot. Sie begann, sich für Japan und seine Kultur zu interessieren, und belegte ein Seminar, um Japanisch zu lernen.
Sie gestattete keinem Mann mehr, sich in ihr Herz oder gar in ihr Bett zu schleichen. Lange Zeit, eigentlich über Jahre, verbot sie sich, die Briefe, die sie damals als Mail von Florian erhalten und eifrig ausgedruckt hatte, noch die Fotos anzusehen. Doch sie war nicht verbittert oder hart geworden, dies lag nicht in ihrem überaus femininen Wesen. Mit den Jahren fühlte sie sogar fast ein wenig Verständnis für ihn. Und wenn Berichte über seine Arbeiten in der Presse zu finden waren, las sie alle mit Interesse.
Einer plötzlichen Eingebung folgend, hatte sie sich vor längerer Zeit ihrer Verwandtschaft besonnen und zu ihrer Nichte Luise Bremer Kontakt aufgenommen, die in Freiburg lebte. Einige Male besuchten sie sich gegenseitig, und Luise bewunderte Charlotte ob ihrer kreativen Fähigkeiten. Als sie Kenntnis bekam von Charlottes Affinität zu Japan, hatte sie ihre Tante eingeladen, mit ihr die große Chrysanthemen-Schau in Lahr zu besuchen. Günstig an der Bahnstrecke gelegen, trafen sie sich an einem Freitag zu einem Bummel und hatten das Glück, sich einer Führung anschließen zu können.
Zurück in Frankfurt erzählte sie einem ebenfalls in ihrem Hause wohnenden Japaner, Herrn Oku-sai, von dieser Schau. Doch selbstverständlich war er bestens informiert, hatte er sich doch vor einigen Jahren selbst als Akteur für Kalligrafie dort eingebracht. Charlotte mochte diesen Nachbarn sehr, er besaß ein feines Gespür für die schönen Dinge des Lebens. Herr Oku-sai war ihr behilflich, als sie den Wunsch äußerte, ihr Schlafzimmer im japanischen Stil einzurichten. Es lag gegen Osten und spiegelte durch die zarten Farbtöne die ganze Herrlichkeit eines beginnenden Tages wider. Nur das Bett war auf eine bequeme Art europäisch, darauf hatte sie bestanden. Als er von einer Japanreise zurückkehrte, brachte er ihr einen Kimono mit, dessen Seide mit wundervollen langschwänzigen Vögeln durchwebt war. Herr Oku-sai lud Charlotte zur Übergabe des Geschenks zur Teezeremonie ein und Charlotte nahm gerne an. Sie fühlte die Verehrung, die Herr Oku-sai ihr entgegenbrachte, und genoss sie ohne Hintergedanken.
Er unterrichtete sie in Kalligrafie und lehrte sie deren tiefere Bedeutung im Umgang mit den Materialien. Als sie für eine Frauenzeitschrift eine mehrwöchige Reise nach Japan plante, sagte er ihr jegliche Unterstützung zu.
Charlotte schloss ihre Wohnungstür auf, entledigte sich rasch der Schuhe und wusch sich gründlich die Hände. Sie öffnete das große Fenster und atmete tief die herbe Luft ein, die der Wind vom Nussbaum hereinblies.
Dann aber hielt sie ihrer Neugier nicht mehr stand. Sie öffnete den weißen DIN-A4-Umschlag mit ihrer vollständigen Namensadresse und las den Absender eines Anwaltsbüros Gregor Kromer. Kurz überlegte sie sogar, ob sie sich wohl einer Straftat schuldig gemacht habe.
In all den vielen Jahren, nachdem Florian sie verlassen hatte, hat Charlotte aus einer Nähe, die aber gefühlt ferner nicht sein konnte, das öffentliche Leben von ihm mitverfolgt. Seine Erfolge als Forscher der amerikanischen Ethnien bewundert, seine Bücher gekauft, seine Worte gelesen, ja, sie an ihr Herz gedrückt. Und sie hat seine Hochzeitsanzeigen mit Constanze in den Buchgeschäften gelesen. Florian hatte also schon im selben Jahr, da er sie verließ, in Amerika Constanze Perl geheiratet. Wie um sich zu bestrafen, dass sie ihn nicht vergessen konnte und doch grausam darunter litt, hatte sie damals einfach eine solche Anzeige an sich genommen.
Und nun saß sie da und las wiederum eine Anzeige. Constanze Perl, Florians Frau, sie hatte ihren Mädchennamen behalten, war nach einer Krankheit plötzlich verstorben. Charlottes Herz tat einen harten Schlag, und sie legte die Anzeige zur Seite. Constanze war also nie Frau Spranger gewesen, dachte sie mit einer kleinen Genugtuung. Sie stand auf und holte sich in der Küche ein Getränk, setzte sich bequemer hin und begann, den Brief des Anwalts zu lesen.
»Sehr geehrte Frau Bremer,
im Auftrag meiner verstorbenen Klientin Constanze Perl wende ich mich heute mit folgender Bitte an Sie. Herr Spranger wird schon seit vielen Jahren von mir anwaltlich beraten, und ich durfte in seinem Sinne Ihre Briefe an ihn und weitere Dinge für ihn aufbewahren. Mit dem Tode von Constanze Perl ergibt sich mir der Auftrag, mich bei Ihnen zu melden und Sie um einen Besuch in meiner Kanzlei zu bitten. Bei diesem Gespräch werden ich als gesetzlicher Vertreter und Frau Anke Berg als Pflegerin von Herrn Florian Spranger anwesend sein.
Herr Spranger wird an diesem Gespräch nicht teilnehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Gregor Kromer
Anwalt«