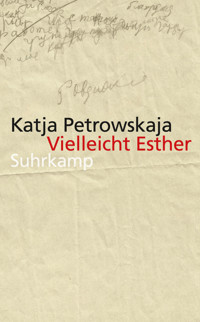
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hieß sie wirklich Esther, die Großmutter des Vaters, die 1941 im besetzten Kiew allein in der Wohnung der geflohenen Familie zurückblieb? Die jiddischen Worte, die sie vertrauensvoll an die deutschen Soldaten auf der Straße richtete – wer hat sie gehört? Und als die Soldaten die Babuschka erschossen, »mit nachlässiger Routine« – wer hat am Fenster gestanden und zugeschaut? In Kiew und Mauthausen, Warschau und Wien legt Katja Petrowskaja Fragmente eines zerbrochenen Familienmosaiks frei – Stoff für einen Epochenroman, erzählt in lapidaren Geschichten. Die Autorin schreibt von ihren Reisen zu den Schauplätzen, reflektiert über ein zersplittertes, traumatisiertes Jahrhundert und rückt Figuren ins Bild, deren Gesichter nicht mehr erkennbar sind. Ungläubigkeit, Skrupel und ein Sinn für Komik wirken in jedem Satz dieses eindringlichen Buches.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Hieß sie wirklich Esther, die Großmutter des Vaters, die 1941 im besetzten Kiew allein zurückblieb? Wer hat ihr, die nicht mehr laufen konnte, die Treppe hinuntergeholfen? Die jiddischen Worte, die sie vertrauensvoll an die deutschen Soldaten auf der Straße richtete – wer hat sie gehört? Und als die Soldaten die Babuschka erschossen, »mit nachlässiger Routine« – wer hat am Fenster gestanden und zugeschaut?
Katja Petrowskaja geht den Menschen nach, die durch ihr unzuverlässiges Gedächtnis geistern: dem Studenten Judas Stern, einem Großonkel, der 1932 ein Attentat auf den deutschen Botschaftsrat in Moskau verübte; Sterns Bruder, Revolutionär aus Odessa, der sich den Untergrundnamen Petrowskij gab; oder »Simon, dem Hörenden«, der im Warschau des 19. Jahrhunderts ein Waisenhaus für taubstumme jüdische Kinder gründete.
Wer zeugt für die Wahrheit unserer Geschichte? Wie erzählt man, was man nicht weiß – auf Deutsch, in der Sprache der Stummen, wie sie auf Russisch heißt? In Episoden, die sich zu sieben Kapiteln fügen, schreibt Katja Petrowskaja von ihren Reisen zu den Schauplätzen, bringt Erinnerungsfragmente in Sicherheit und rückt Figuren ins Bild, deren Gesichter nicht mehr erkennbar sind. Ungläubigkeit, Skrupel und ein Sinn für Komik durchwirken jeden Satz ihres eindringlichen Buches.
Katja Petrowskaja, 1970 in Kiew geboren, studierte Literaturwissenschaft in Tartu (Estland) und promovierte in Moskau. Seit 1999 lebt sie in Berlin und arbeitet als Journalistin für russische und deutsche Print- und Netzmedien. Seit 2011 ist sie Kolumnistin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Für ihre Erzählung Vielleicht Esther erhielt sie den Ingeborg-Bachmann-Preis 2013.
Katja Petrowskaja
Vielleicht Esther
Geschichten
eBook Surhkamp Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2014.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-73584-8
Vielleicht Esther
Google sei Dank
Es wäre mir lieber, ich müsste meine Reisen nicht hier beginnen, in der Ödnis um den Bahnhof, die immer noch von der Verwüstung dieser Stadt zeugt, einer Stadt, die im Lauf siegreicher Schlachten zerbombt und ruiniert worden war, als Vergeltung, so schien es mir, denn von dieser Stadt aus war der Krieg gesteuert worden, der tausendfach Verwüstung verursacht hatte, weit und breit, ein endloser Blitzkrieg auf eisernen Rädern, mit eisernen Flügeln. Das ist nun so lange her, dass diese Stadt zu einer der friedlichsten Städte der Welt geworden ist und diesen Frieden fast aggressiv betreibt, als eine Form der Erinnerung an den Krieg.
Der Bahnhof wurde vor kurzem in die Mitte dieser Stadt gebaut, und trotz des Friedens war der Bahnhof unwirtlich, es war, als verkörpere er all die Verluste, die mit keinem Zug einzuholen sind, einer der unwirtlichsten Orte in unserem kreuz und quer vereinigten und doch sehr begrenzten Europa, ein Ort, an dem es immer zieht und wo sich der Blick auf eine Ödnis öffnet, ohne dass sich ihm Gelegenheit bieten würde, in einem städtischen Dickicht hängenzubleiben, auf etwas zu ruhen, bevor man wegfährt von hier, aus dieser Leere inmitten der Stadt, die keine Regierung füllen kann, mit keinen großzügigen Bauten und keinen guten Absichten.
Es zog auch dieses Mal, als ich am Bahnsteig stand und wieder die Großbuchstaben Bombardier Willkommen in Berlin unter dem Bogen des geschwungenen Daches mit dem Blick abtastete, die Umrisse befühlte, gelangweilt, aber doch wieder erstaunt über das Gnadenlose dieses Willkommens. Es zog, als ein älterer Herr sich mir näherte und mich nach Bombardier fragte.
Man denke sofort an Bomben, sagte er, an Artillerie, an diesen schrecklichen, unbegreiflichen Krieg, und warum gerade Berlin so grüßen solle, diese schöne, friedliche, zerbombte Stadt, die sich all dessen bewusst sei, es könne doch nicht wahr sein, dass Berlin Ankommende wie ihn mit diesem Wort in Großbuchstaben sozusagen bombardiere, und was heißt hier Willkommen, wer genau soll hier bombardiert werden und womit. Er suche dringend nach einer Erklärung, denn er fahre gleich ab. Ich antwortete, etwas erstaunt darüber, dass meine innere Stimme sich in Gestalt eines alten Mannes mit schwarzen Augen und amerikanischem Akzent an mich wandte, atemlos und immer aufgeregter, fast ungezügelt mit Fragen mich bewarf, die ich selbst schon hundertmal durchgespielt hatte, play it again, dachte ich, immer weiter in diese Fragen versinkend, in diese Ferne der Fragen auf dem Bahnsteig, und ich antwortete, dass auch ich sofort an Krieg denke, keine Altersfrage also, ich denke sowieso immer an den Krieg, besonders hier in diesem Durchgangsbahnhof, der für keinen Zug Endstation ist, keine Sorge, man fährt immer weiter, dachte ich, und dass er nicht der erste sei, der sich das frage und auch mich. Ich bin zu oft hier, dachte ich kurz, vielleicht bin ich стрелочник, strelotschnik, ein Weichensteller, und immer ist der Weichensteller schuld, aber nur auf Russisch, dachte ich, als der alte Mann sagte, my name is Samuel, Sam.
Und dann erzählte ich ihm, dass Bombardier ein französisches Musical sei, das in Berlin erfolgreich laufe, viele Menschen kommen deshalb in diese Stadt, stellen Sie sich vor, nur wegen Bombardier, die Pariser Kommune oder so von damals, zwei Nächte im Hotel plus Musical alles inklusive von heute, und dass es schon Probleme gegeben habe, weil im Hauptbahnhof für Bombardier geworben wird, nur mit diesem einen Wort, kommentarlos, es stand schon in der Zeitung, sagte ich, ich erinnere mich, sagte ich, dort stand, das Wort wecke falsche Assoziationen, sogar einen Gerichtsfall hat es gegeben im Streit der Stadt mit dem Musical, es wurden Linguisten beigezogen, stellen Sie sich vor, die das Wort auf sein Gewaltpotential hin überprüften, und das Gericht hat das Urteil zu Gunsten der freien Werbung ausgesprochen. Ich glaubte immer mehr an meine Worte, obwohl ich keine Ahnung hatte, was dieses Bombardier am Dachbogen des Bahnhofs bedeutete und woher es kam, aber das, was ich so begeistert und fahrlässig erzählte und was ich auf keinen Fall als Lüge bezeichnen würde, beflügelte mich, und ich schweifte immer weiter ab, ohne die geringste Angst abzustürzen, ich drehte mich immer weiter in den Kurven dieses niemals gesprochenen Urteils, denn wer nicht lügt, kann nicht fliegen.
Wohin fahren Sie?, fragte mich der alte Mann, und ich erzählte ihm alles, ohne eine Sekunde zu zögern, mit dem gleichen Schwung, als würde ich das nächste Musical verurteilen, ich erzählte von der polnischen Stadt, aus der meine Verwandten vor hundert Jahren nach Warschau und dann weiter nach Osten gezogen waren, vielleicht nur, um mir die russische Sprache zu vererben, die ich nun so großzügig niemandem weiterverschenke, dead end also und Halt, deswegen muss ich fahren, erzählte ich, dorthin, in eine der ältesten Städte Polens, wo sie, die Ahnen, von denen man nichts weiß, wirklich, keine Ahnung, wo sie zwei, drei oder auch vier Jahrhunderte gelebt haben, vielleicht seit dem fünfzehnten Jahrhundert, als die Juden in dieser kleinen polnischen Stadt die Garantien bekommen hatten und zu Nachbarn wurden und zu den anderen. And you?, fragte Sam, und ich sagte, ich bin eher zufällig jüdisch.
Wir warten auch auf diesen Zug, sagte Sam nach einer kurzen Pause, auch wir fahren mit dem Warszawa-Express. Mit diesem Zug, der wie ein Vollblutpferd aussieht, wie er nun aus dem Nebel auftaucht, ein Expresszug, der sich zwar gemäß dem Fahrplan, jedoch gegen die Zeit bewegt, in die Zeit von Bombardier, for us only, dachte ich, und der alte Mann fuhr fort, seine Frau suche dasselbe, die Welt ihrer Großmutter nämlich, die aus einem kleinen weißrussischen Dorf bei Biała Podlaska in die USA gekommen sei, und doch sei es nicht seine Heimat und nicht die seiner Frau, hundert Jahre sei es her und viele Generationen, und auch die Sprache kenne von ihnen keiner mehr, aber Biała Podlaska klinge für ihn wie ein forgotten lullaby, gottweisswarum, ein Schlüssel zum Herzen, sagte er, und das Dorf heißt Janów Podlaski, und dort hätten damals fast nur Juden gewohnt und jetzt nur die anderen, und sie beide würden dorthin fahren, um sich das anzuschauen, und, er sagte tatsächlich wieder und wieder und, als stolpere er über ein Hindernis, dort sei natürlich nichts geblieben, er sagte natürlich und nichts, um die Sinnlosigkeit seiner Reise zu betonen, ich sage auch oft natürlich oder sogar naturgemäß, als ob dieses Verschwinden oder dieses Nichts natürlich oder auch selbstverständlich sei. Die Landschaft jedoch, die Namen der Orte und ein Gestüt für Araberpferde, das seit Anfang des neunzehnten Jahrhunderts existiert, gegründet nach dem Napoleonischen Krieg und in Fachkreisen die erste Adresse, das alles sei noch da, erzählten sie mir, das hätten sie alles gegoogelt. Ein Pferd könne dort gut eine Million Dollar kosten, Mick Jagger habe bei einer Auktion schon Pferde aus diesem Gestüt angeschaut, sein Drummer habe drei gekauft, und nun würden sie dorthin fahren, fünf Kilometer von der weißrussischen Grenze entfernt, Google sei Dank. Sogar einen Pferdefriedhof gebe es dort, nein, der jüdische Friedhof sei nicht erhalten geblieben, auch das stehe im Internet.
I'm a Jew from Teheran, sagte der alte Mann, als wir noch am Bahnsteig standen, Samuel ist mein neuer Name. Ich bin aus Teheran nach New York gekommen, sagte Sam, er könne Aramäisch, habe vieles studiert und sei immer mit seiner Geige unterwegs. In den USA hätte er eigentlich Nuklearphysik studieren sollen, habe sich jedoch beim Konservatorium angemeldet, sei bei der Aufnahmeprüfung durchgefallen, und so sei er Banker geworden, und auch das sei er nicht mehr. Noch nach fünfzig Jahren, sagte seine Frau, als wir schon im Zug saßen und der metallene Regenbogen Bombardier Willkommen in Berlin nicht mehr auf unsere Köpfe drückte, da sagte seine Frau, egal ob er Brahms, Vivaldi oder Bach spielt, alles klingt iranisch. Und er sagte, es sei Schicksal, dass sie mich getroffen hätten, ich sähe aus wie die iranischen Frauen seiner Kindheit, er hatte iranische Mütter sagen wollen, vielleicht wollte er sogar wie meineMutter sagen, hielt sich aber zurück, und er fügte hinzu, es sei auch eine Schicksalsfügung, dass ich mich in der Familienforschung besser auskenne als sie und dass ich mit dem gleichen Ziel und dem gleichen Zug nach Polen fahre – falls man den Drang, nach Verschwundenem zu suchen, überhaupt als Ziel definieren dürfe, erwiderte ich. Und nein, es ist nicht Schicksal, sagte ich, denn Google wacht über uns wie Gott, und wenn wir etwas suchen, dann gibt er uns nur unsere Reime darauf, genauso wie sie einem, hat man im Internet einen Drucker gekauft, noch lange Zeit danach Drucker anbieten, und wenn man einen Schulranzen kauft, kriegt man noch jahrelang die Werbung dazu, von Partnersuche ganz zu schweigen, und wenn man sich selbst googelt, verschwinden irgendwann sogar die Namensvettern, und es bleibt only you, als würde, wenn man sich den Fuß verstaucht hat und hinkt, plötzlich die ganze Stadt hinken, aus Solidarität vielleicht, Millionen von Hinkenden, sie bilden eine Gruppe, beinahe die Mehrheit, wie soll Demokratie funktionieren, wenn man nur das kriegt, was man schon gesucht hat, und wenn man das ist, was man sucht, so dass man sich nie allein fühlt oder immer, denn man hat keine Chance, die anderen zu treffen, und so ist das mit der Suche, bei der man auf Gleichgesinnte stößt, Gott googelt unsere Wege, auf dass wir nicht herausfallen aus unseren Fugen, ich treffe ständig Menschen, die das Gleiche suchen wie ich, sagte ich, und deswegen haben auch wir uns hier getroffen, und der alte Mann sagte, genau das sei eben Schicksal. In der Exegese war er offensichtlich weiter als ich.
Auf einmal fiel mir das Musical ein, das tatsächlich vor Jahren hier Furore gemacht hatte, als man auf den Werbeflächen der Stadt die Worte Les Misérables sah, kommentarlos, anders als der gleichnamige Film, der die Elenden Gefangene des Schicksals nannte. Das Musical sprach jeden mit Les Misérables an, als ob man ständig getröstet werden müsste – Ach du Elende! – oder auch nur darauf hingewiesen, dass nicht nur einer, sondern wir alle uns im Elend wiederfinden, im Elend vereint, denn angesichts dieser riesigen Buchstaben, angesichts dieser Ödnis in der Mitte der Stadt sind wir alle Elende, nicht nur die anderen, sondern auch ich. Und so füllen die Buchstaben von Bombardier am Bogen des Bahnhofsdaches uns mit ihrem Hall, wie Orgelmusik die Kirche füllt, und niemand kann entkommen.
Und dann googelte ich wirklich: Bombardier war eine der größten Eisenbahn- und Flugzeugbaufirmen der Welt, und dieser Bombardier, der unsere Wege bestimmt, hatte vor kurzem die Kampagne Bombardier YourCity gestartet. Schnell und sicher. Und nun fuhren wir mit dem Warszawa-Express von Berlin nach Polen, mit dem Segen Bombardiers, umgeben von Vorhängen und Servietten, seinen Insignien mit dem Aufdruck WARS, einer Abkürzung so altmodisch und vergangen wie Star Wars und andere Kriege der Zukunft.
Kapitel 1Eine exemplarische Geschichte
Familienbaum
Ein Fichtenbaum steht einsam
Heinrich Heine
Am Anfang dachte ich, ein Stammbaum sei so etwas wie ein Tannenbaum, ein Baum mit Schmuck aus alten Kisten, manche Kugeln gehen kaputt, zerbrechlich wie sie sind, manche Engel sind hässlich und robust und überleben alle Umzüge. Jedenfalls war ein Tannenbaum der einzige Familienbaum, den wir hatten, er wurde jedes Jahr neu gekauft und dann weggeschmissen, einen Tag vor meinem Geburtstag.
Ich hatte gedacht, man braucht nur von diesen paar Menschen zu erzählen, die zufälligerweise meine Verwandten waren, und schon hat man das ganze zwanzigste Jahrhundert in der Tasche. Manche aus meiner Familie waren geboren, um ihren Berufungen nachzugehen in dem hellen, aber nie ausgesprochenen Glauben, sie würden die Welt reparieren. Andere waren wie vom Himmel gefallen, sie schlugen keine Wurzeln, sie liefen hin und her, kaum die Erde berührend, und blieben in der Luft wie eine Frage, wie ein Fallschirmspringer, der sich im Baum verfängt. In meiner Familie gab es alles, hatte ich überheblich gedacht, einen Bauern, viele Lehrer, einen Provokateur, einen Physiker und einen Lyriker, vor allem aber gab es Legenden.
Es gab
einen Revolutionär, der zu den Bolschewiken ging und im Untergrund seinen Namen änderte, den nun wir schon fast hundert Jahre tragen, ganz legal
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























