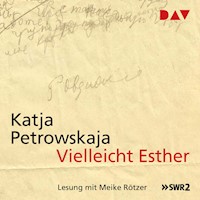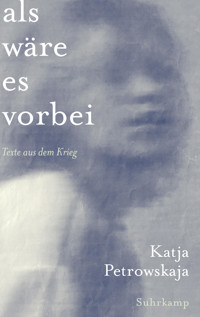
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wie verändert der Krieg die Bilder? Wie verändert er das Sehen? Wie verändert er diejenigen, die ihm standhalten oder die ihm zuschauen?
Mit ihren Fotokolumnen, die zwischen Februar 2022 und Herbst 2024 in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erschienen sind, hat Katja Petrowskaja absichtslos eine Chronik des Ukraine-Krieges geschrieben. Sie beginnt am Vorabend, mit einer Landschaft in Georgien, entlang der Großen Heerstraße. Tiere. Kriegsgefahr liegt in der Luft. Auf der nächsten Seite der Schrei: Mein Kiew! Die unfassbare Realität des Krieges, das Einbrechen des Ungeheuerlichen ins eigene Leben.
Der Krieg verunsichert den Blick. Man sieht Bilder lächelnder Menschen und fragt sich unwillkürlich, ob sie noch leben. Ein Mann steht in einem Loch, mitten auf einer Straße, »als probiere er den möglichen Tod an, als wäre der Tod seine neue Kleidung«. Ein bleiches, lachendes Mädchen, an eine ältere Frau geschmiegt. Aus der Geschichte hinter diesem Bild springt einen hinterrücks die Erkenntnis an, dass selbst das Unwahrscheinliche doch möglich ist – in dieser Zeit auch der Wunder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Katja Petrowskaja
Als wäre es vorbei
Texte aus dem Krieg
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der Originalausgabe, 2025.
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung, Layout und Satz: Nick Teplov
Umschlagfoto: Ausdruck eines Selfies von Angelina Goncharenko, © Angelina Goncharenko
eISBN 978-3-518-78328-3
Suhrkamp Verlag AG
Torstraße 44, 10119 Berlin
www.suhrkamp.de
Ein Sprung
13.02.2022
Das schwarze Schaf springt über den Bach, wie vom Schicksal dazu aufgefordert. Es ist unwirklich schwarz, unheimlich, wie ein Loch im Bild. Die anderen Schafe stehen am Wasser, trinken oder laufen durch die kleinen Strömungen. Wenn ich dieses Foto nicht selbst gemacht hätte und nicht ein weiteres Dutzend Bilder des schwarzen Schafes besitzen würde, hätte ich sie für Photoshop gehalten. Die Prise des Absurden in diesem Sprung, die Tatsache, dass es nur ein einziges schwarzes Schaf in dieser riesigen Herde gab, verdammt dazu, meine Aufmerksamkeit zu erregen, und auch die abgeschnittenen Berge, die den Blick einschränken – dies alles beunruhigt mich jetzt.
Es gibt Tage, an denen man so viel Schönes sieht, dass man die Erinnerung daran wie einen Vorrat benutzt, für später, für die Winterzeit, für die grauen und traurigen Tage. So war auch dieser Tag. Wir befanden uns in einer merkwürdig abstrakten Landschaft: mächtige Berge, Lavagestein, rotgefärbte brodelnde Mineralquellen, Ruinen von Festungen. Ich erinnere mich an den steinigen Weg, an einen Baum mit »wollenen« Knospen, an zwei düstere Nonnen, die aus dem Nichts auftauchten, und an diese Herde vor einem verlassenen Dorf.
Woher diese Herde kam und wohin sie zog, blieb unklar, auch der Hirte war nicht in Sicht. Ich erinnere mich an dieses grüne Gras und die weißen Berge und auch an jenes Schaf, das links zu sehen ist und das mein Fotografieren skeptisch beobachtete, während die anderen Schafe an mir vorüberzogen. Ich fotografierte mit einem Gefühl, als könnte sich all dies gleich in Luft auflösen.
Das Trusso-Tal liegt in Georgien, in der Nähe des Kasbek, der 240 Meter höher als der Mont Blanc ist. In dieses langgezogene Tal gelangt man über die Große Heerstraße, die direkt nach Norden führt, nach Russland, die Hauptstraße vieler Kriege. Bis zum Ende der Sowjetunion lebten im Trusso-Tal noch Hunderte Menschen in achtzehn Dörfern, vor allem Osseten, eine kaukasische Minderheit. Noch vor dem russisch-georgischen Krieg im August 2008, in der Krise der Neunzigerjahre, wurde es dann fast unmöglich, hier zu überleben. Nun sind die Nonnen die Einzigen, die noch da sind. Für mich nannte ich das Tal stets »Tal der Tränen«. Hier kommt alles zusammen – die Verlassenheit und der Krieg, die offenen Wege, die durch Schluchten und Grenzen versperrt sind, und das Wunder des Anfangs: Oben, aus dem Gletscher, entspringt der legendäre Fluss Terek, der durch Georgien fließt und dann nach Russland, durch Tschetschenien und Dagestan bis ins Kaspische Meer.
Auf unserem Bild ist die Grenze mit Russland zu sehen, in der Ferne, in der sich nur sehr vage Ruinen der Türme einer ossetischen Festung zeigen. Dort befindet sich der letzte georgische Grenzposten, und der war unser Ziel: Theona, die mich begleitet, bringt den Grenzsoldaten Pralinen – einer von ihnen ist ihr Verwandter. Wir besteigen die mittelalterliche Festung und können nicht aufhören, auf die Berge, in das Tal zu schauen: Hier könnte das Ende der Welt sein.
Am nächsten Tag fuhren wir weiter. Unser Blick öffnete sich auf einen Hügel, der komplett mit Blut übergossen war. Solch eine glatte, intensive rote Farbe, entstanden in der Natur, hatte ich niemals zuvor gesehen. Tote Schafe, ganz oder zerlegt, lagen herum, auf Lastwagen, in Haufen am Wegesrand. Es fand ein christlich-heidnisches Fest statt, überall gab es Tiere, die zum Opfern hergeführt wurden.
In diesen Tagen, in denen die Nachrichten über mein Land, die Ukraine, so absurd und fatal klingen und man über den Krieg diskutiert, als handelte es sich um ein Tischtennisspiel, als ging es in Wirklichkeit nicht um die Mengen von Panzern, um irgendwelche Truppenstärken und um Interessengebiete, kam dieses merkwürdige Bild wieder hoch: Es zeigt das Reale und das Mögliche, wirkt dabei aber surreal. Ich erlaube mir hier einen Gedankensprung, mit dem man im Nirgendwo landet, aber vielleicht darf man dadurch – so wie dieses Schaf– in der Luft bleiben.
Das Unvorstellbare
25.02.2022
Die Realität hat meine schlimmsten Albträume eingeholt. Meine Heimatstadt Kiew wird bombardiert. Wie merkwürdig einfach das klingt. Es gibt ein Lied darüber, aus dem Jahr 1941. Meine Mutter, Swetlana Petrowskaja, Jahrgang 1935, eine verehrte Geschichtslehrerin, die Generationen von Schülern unterrichtet hat, sitzt im Luftschutzkeller. Auf Wohnhäuser auf dem linken Ufer der Stadt Kiew, wo ich aufgewachsen bin, fallen Raketen. Hunderttausende Menschen haben diese Nacht in Kellern, Bunkern und U-Bahn-Stationen verbracht. Was wird bereits passiert sein, wenn dieser Text gedruckt ist? Wird meine Heimatstadt mit drei Millionen Einwohnern dann bereits erobert sein? Meine Mutter ist Kriegskind. Hat die Weltgeschichte einen Kreis gezogen – oder ist es ein Salto mortale? Wir wollten gestern Abend zoomen, aber dann rief sie mich nachmittags an, mit ihrer etwas kecken Art: »Grüß dich, ich bin im Luftschutzkeller, nett hier, hundert Menschen, ich habe alles: Wasser und mein Ladegerät«.
Ich bin empört. Seit zwanzig Jahren lebe ich in Berlin mit seiner wohltemperierten Erinnerungskultur, mit seinen Tausenden Gedenkstätten, doch diesen Krieg hat all das nicht verhindert, ich bin empört über die Jahre der Appeasement-Politik, ich bin empört über die Sozialdemokratie, mit ihren halbgaren Maßnahmen und Beschwichtigungen, um bloß Putin nicht zu beleidigen und zu provozieren, ich bin empört über die Demagogie der Linken, die die Schuld am Angriffskrieg dem Westen in die Schuhe schiebt, über all die Geschäfte mit Putin und Gazprom, über die gesponsorten Konzerte und Ausstellungen, über Russia Today, über die Münchner Philharmoniker mit Waleri Gergijew als Chefdirigent. Ich bin auch empört über die fünftausend deutschen Helme, die sicher viele Gräber schmücken können. Man muss keine Angst vor Putin haben, denn wir sind längst alle seine Feinde, egal was wir tun. Er möchte seine Herrschaft spüren, und wenn er dazu alles in die Luft sprengen muss. Er geilt sich auf an seiner nuklearen Potenz.
Tschetschenien, Georgien, Krim, Ostukraine, Syrien– die Eskalation der putinschen Kriegsverbrechen ist lupenreine Faktographie. Wenn nicht schon vor 15 Jahren, dann spätestens seit acht Jahren war es klar, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist und nicht aufhören wird. Nachdem er die Krim annektiert hatte, entschieden Politiker im Westen, dass ein größerer Krieg am besten dadurch verhindert wird, dass man der Ukraine die NATO-Mitgliedschaft bis auf Weiteres versagt und sie militärisch nicht in erforderlicher Weise unterstützt. Eine aberwitzige strategische Entscheidung! Europa trägt eine Mitverantwortung für das heutige Geschehen, dafür, dass Putin nicht früher aufgehalten wurde.
Die Ukraine braucht unsere gemeinsame Hilfe: Ich nehme mir das Recht, einen totalen Einfuhrstopp für Gas und Öl aus Russland zu fordern, selbst wenn das der deutschen Wirtschaft– welch Sakrileg! – schaden sollte. Deutschland muss aufhören, die russische Kriegsmaschine mit Milliarden für Erdöl und Erdgas zu subventionieren. Vielleicht retten wir dadurch noch Menschenleben! Außerdem braucht die Ukraine defensive Waffen, einen Luftschild und militärische Hilfe jeglicher Art, sonst wird übermorgen Putin auch Berlin »befreien«. Wir stehen an der Schwelle zu einem noch größeren Weltkrieg.
Vor wenigen Minuten habe ich meine Mutter im Luftschutzkeller erreicht, die Stimmung ist heute ganz anders, man hört Kinder weinen und sehr viele leise Stimmen. »Katja«, sagt sie, »ich bitte dich: Sag der NATO, sie muss unseren Himmel schließen!«
Tag fünf
28.02.2022
Es ist das erste Mal, dass ich mich freue, dass mein Vater nicht mehr lebt. Dass er all das nicht sehen und nicht hören muss. Ein unmöglicher, ein unvorstellbarer Krieg. Fliegeralarm in Kiew, Raketenangriffe, Straßengefechte, Millionen auf der Flucht, Kinder in Kellern. Eine Freundin schreibt mir in der Nacht nur: »Oh mein Gott!«, und antwortet nicht mehr. Was ist mit ihr passiert? Haben sie die Sophienkathedrale mit den ältesten Fresken der Stadt getroffen? Die Wohnbezirke? Ich wache auf: Ein radioaktives Lager ist beschädigt. Ein Erdölspeicher bei Kiew brennt. Das berühmte Kinderkrankenhaus Ochmatdit (»Schutz der Mutterschaft und des Kindes«), das auch mich einmal gerettet hat, wurde mit Raketen beschossen. Es gibt Tote und Verletzte. Meine Cousine, Querflötistin des Kiewer Symphonischen Orchesters, wohnt mit ihrer Familie direkt neben diesem Krankenhaus und ich kann sie viele Stunden nicht erreichen. Dann ruft sie an und fragt mich heiter, ob ich okay bin. Sehr verwirrend: Ich bin in Sicherheit, in Tiflis, sie ist im Keller des Hauses. »Alles ist gut, wir sind mit den Rättchen hier« – so nennt sie liebevoll ihre drei Dackel. Mehr erzählen möchte sie aber nicht. In der Nacht gab es Panik. Sie verschweigt Details und preist die Nachbarn. Den Schreck blendet man aus.
Tag vier. Sperrstunde bis Montag früh. Meine Mutter, die weit über achtzig ist, sitzt schon den dritten Tag im Luftschutzkeller, nichts Besonderes – die halbe Stadt sitzt in den Kellern oder in den U-Bahnhöfen. Fast 60 Jahre lang hat meine Mutter Geschichte unterrichtet und macht nun im Keller etwas ganz Ähnliches: Sie spricht mit den Menschen im Untergrund und gibt ihnen das Gefühl, hier und jetzt die wichtigsten Akteure der Geschichte zu sein und dass auch diese schreckliche Zeit einmal vorbeigehen wird. Am ersten Tag des Krieges hat sie es noch geschafft, zur Beerdigung eines guten Freundes zu gehen, der letzte Gigant der ukrainischen Literatur, Iwan Dzjuba. Welch symbolischer Akt. Sie wollte Kiew nicht verlassen. »Ich bleibe hier, mit allen Anderen«, sagte sie, »und es passiert mir das, was allen passiert.« Ich denke an unsere Mutter-Heimat-Statue aus Sowjetzeiten, 102 m hoch, auf dem Hügel oberhalb des Dnjepr, neben dem Lawra-Kloster, und ich denke an meine Mutter und verstehe plötzlich, dass sie beide von ähnlicher Statur sind. Sie bleiben, unverrückbar. Wenn ich sie anrufe, erzählt sie mir begeistert von den anderen Menschen im Keller, von Lena, Mykola und Odarka und von den Kindern im Zimmer nebenan. Sie hat ihre Rückenschmerzen komplett vergessen und spricht theatralisch mit mir, überzeugt davon, dass die ganze Welt sie hört, dass jemand nebenan sagt: »Sie sollten das in TikTok posten, Mütterchen, dann siegen wir.« Eine schwere Kolonne bewegt sich Richtung Kiew.
Heute ist der fünfte Tag des Kriegs. Eine weitere Nacht ist vorbei. Das kleine Haus mit Bildern von Maria Primatschenko, einer Ikone der ukrainischen Volkskunst, ist in Iwaniw verbrannt. Ich weine wieder. In Charkiw gibt es kaum noch Brot. Weitere Tote. Ein Bild von einem Mädchen. Alle lesen Nachrichten. Es gab Raketen auf die Kiewer Stadtbezirke, Obolon und Posniaki unter Beschuss, wieder Alarmsirenen. Im ganzen Land beginnt der Tag mit dem Morgenappell, das ist bereits zum Kriegsritual geworden: »Hallo, wie geht es Euch?« heißt es auf Facebook, Twitter und in den Telegram-Kanälen. Meine Freunde melden sich aus den Luftschutzkellern, aus verbarrikadierten Wohnungen, aus den U-Bahn-Stationen in verschiedenen Bezirken: »Hallo! Hallo! – Am Leben!« – »Bei uns war alles still.« – »Vögel, die Vögel singen!«– »Ich habe mich noch nie so über Sonnenlicht gefreut.« – »Bei uns miaut es und schnarcht es!« – »Meldung aus dem Nordosten: bei uns gibt es Tau. Das Wetter ist sonnig.« Wie kurze Funksprüche per Facebook. Manchmal posten Menschen nur ein Herz oder eine Umarmung. Alle versuchen einander aufzumuntern, zu scherzen – Berichte aus dem Hinterland. Die Solidarität unter den Menschen ist sagenhaft, wie in einem Epos. Niemals zuvor habe ich so viel Liebe, Zusammenhalt und Stärke gesehen. Millionen von Menschen helfen einander in allen existierenden Formen. Ich schaue auf die Facebook-Seite meines Bezirks– »Festung Rusanowka«, einer Halbinsel im Dnjepr, auf der einhunderttausend Menschen leben. Ein unendlicher Strom von Nachrichten. Da meldet sich eine Tierärztin: Sie geht von Keller zu Keller, um kostenlos Tiere zu versorgen. Ich freue mich, meine Stimmung schwankt die ganze Zeit, aber diese Menschen in Kiew muntern mich auf.
Durch die Ukraine zieht eine gesichtslose und namenlose Armee, die nicht einmal ihre eigenen Toten einsammelt, sondern am Straßenrand wie Müll zurücklässt. Das ist der Preis eines Menschenlebens im Imperium Putins. Ich rufe meine Freundin an, Olga, eine Flamenco-Tänzerin. Im vergangenen Jahr haben wir zusammen in Kiew getrauert: sie um ihren an Corona gestorbenen Mann, ich um meinen Vater. Durch das Telefon höre ich Sirenen. Heimat hat ein Gesicht, sagt Olga plötzlich, und das, was zerstört wird, hat auch ein Gesicht. Und in der Tat: In einem mehrstöckigen Wohnhaus, das in Kiew getroffen wurde, befand sich im Erdgeschoss ein modernes Therapiezentrum für behinderte Kinder, in dem früher meine Freundin Irina gearbeitet hat. Die große Eisenbahnbrücke über den Dnjepr, die ihr Vater Boris vor wenigen Jahren restauriert hatte, ist von der russischen Armee gesprengt worden, und die Enkelin des Architekten des Charkiwer Traktorenwerks, das nun auch brennt, sitzt mit meiner Olga in einem Keller. »Es ist unsere Heimat, wir wissen, wofür wir kämpfen.« Und ich glaube an das Wunder der gemeinsamen Mühe.
Mein Kiew!
06.03.2022
Jeden Tag denke ich, es kann alles nicht wahr sein, jeden Tag geht es weiter. Meine Heimatstadt ist unter Beschuss, und die Horde kommt und kommt, wie Heuschrecken, wie die Pest. Der Krieg nimmt eine mythische Dimension an. Es war noch nie so klar, was gut und was böse ist. Gegen diesen unbegreiflichen Krieg ist Russland nicht aufgestanden. Nur einzelne Stimmen. Oder noch nicht? Ich schreibe, und mir fehlt der Atem, ich weiß nicht, was von dem, was ich heute sehe, noch stehen wird. Noch leben wird.
Erst wollte ich hier das Foto meiner Mutter aus dem Keller publizieren. Wie sie da sitzt und auf uns schaut. Von einer Frau fotografiert, die vor fast acht Jahren aus der Donezker Region geflüchtet ist. Sie sitzt neben ihr im Keller. So etwas könnte sofort auf dem Cover von »Newsweek« landen. Ich konnte es nicht. Zu intim? Aus Respekt? Mutter sagte: »Ich habe mein Leben unter Bomben angefangen und beende mein Leben unter den Bomben.« So einfach, wie nebenbei, nur eine Feststellung. Sie ist ein Kriegskind, 1935 geboren. Sie ist Historikerin. Sie sitzt da und liest das Buch von Janusz Korczak, »König Mateusz«, ein Buch über die Kinderrechte in der Zeit hereinbrechender Finsternis. Man sagt, der Krieg habe kein weibliches Gesicht.
Was ist das Bild des Krieges? Ein zerstörter Platz der Freiheit in Charkiw? Oder eine Frau, die ihr Kind während eines Luftalarms im Keller entbunden hat? Obdachlose, die Molotowcocktails vorbereiten? Menschen, die Fenster mit Papierstreifen bekleben? Eine Rakete, die Babyn Jar trifft? Flüchtlinge an den Grenzen, zerstörte Häuser, halb leere Städte. Die ganze Welt engagiert sich. Meine Tochter sieht ein zerbombtes Haus in den Nachrichten und meint, es sehe genauso aus wie unser Haus in Berlin, in das nun die ersten Freunde einziehen, aus der Ukraine geflüchtet.
Ich halte dieses zufällige Bild aus meinem iPhone für eine Ikone, für ein Amulett gegen all die Zerstörung, ein Bestandteil des ukrainischen Widerstands. Ich sehe meine Stadt im dokumentarischen Schwarz-Weiß, ich kann das Geschehen nicht fokussieren. Alles in meinem Kopf ist genau festgehalten – und doch unfassbar in der Realität. Ich fotografiere die Lawra, das älteste Kloster Kiews, viel zu oft, wie verzaubert, wie in einem Ritual, jedes Mal, wenn ich in Kiew bin. Ein historisches Dokument meiner ungeschickten Liebe, die U-Bahn, mein Weg zur Schule.
Ich habe viele Schwarz-Weiß-Bilder von Kiew aus dem Zweiten Weltkrieg gesehen. Auch das mit einem deutschen Soldaten, der auf diesem Glockenturm steht und in die Ferne schaut. Mehr als eine Million Menschen fahren diesen Weg in die Stadt über die Metrobrücke jeden Tag und sehen das Kloster. Ich weigere mich, in der Vergangenheitsform zu sprechen. Ich weigere mich, mir die Stadt wie eine militärische Karte vorzustellen, obwohl ich genau weiß, wo die 30 Kilometer lange Kolonne russischer schwerer Technik steht und welche Freunde am nächsten wohnen. Ich halte dieses Bild vor mich wie ein Schild des flüchtigen Lebens in der ewigen Stadt. 800000 Menschen haben bereits das Land verlassen. Es ist nur ein Fünfzigstel der Bevölkerung. Viele meiner Freunde sind in Kiew geblieben und lassen keinen Gedanken daran zu, die Stadt zu verlassen. Es herrscht ein unausgesprochenes Einverständnis zwischen Fliehenden und Bleibenden. Als ich die schlechten militärischen Prognosen höre, rufe ich eine Freundin an, ich sage nur »Sasha«, und sie schaltet das Video an, zeigt mir ihre Jungs, zwei kleine Söhne, und alle lachen.
Sie kennen die Prognosen, aber es ist unanständig von mir, ihre Entscheidung infrage zu stellen. Sie sind die Festung, sie sind konzentriert und fröhlich (wobei ich nicht weiß, ob ich dieses Wort verwenden darf), sie arbeiten am Frieden und trösten uns, wenn unsere Kräfte und Hoffnungen brechen. Es wird fest daran geglaubt, dass, wenn sie nur dableiben, auch die Stadt bleiben wird. Niemand sagt das laut. Ich glaube auch daran, aber ich bin in Sicherheit.
Dann überfallen mich wieder Horrorvorstellungen. Ich kann nur kurze Sätze aussprechen. Ich kann kaum schreiben, mir scheint es viel sinnvoller, zurückzukehren zu meiner Menschenkette: zu Hunderttausenden anderen, die alles versuchen, dass möglichst vielen geholfen wird, dass möglichst wenige sterben. Schutzwesten, Medikamente, Feldbetten, Funkgeräte. Alle sind an der Arbeit, denn Frieden ist eine handgemachte Sache. Dann ruft mich meine sechsundachtzigjährige Mutter an. Sie hat eine Ansprache an die russischen Mütter aufgenommen. »Lasst eure Kinder nicht in diesen Krieg ziehen!«
Ein Vorort
03.04.2022
Ein Vorort von Kiew. Irpin. Eine Frau im Pelzmantel rennt eine gepflegte Straße entlang. Man sieht ihre Ohrringe. Hinter ihr brennt ein Haus. Es waren die ersten Raketen, die den Ort erreichten. Der erste Horror. Danach kamen Gostomel, Charkiw, Mariupol. Die Bomben fallen und fallen. Der Krieg tobt in der fünften Woche, und wir gewöhnen uns daran. In Irpin liegen ganze Straßen in Trümmern. Wir gewöhnen uns daran, als wäre die wachsende Opferzahl bereits zur Statistik für künftige Geschichtsbücher geworden. Auch unsere Ohnmacht wird zur Gewohnheit. Wir werden mit Bildern weiterer Zerstörung konfrontiert, wir schauen zu.
Ich denke an die Vororte meiner Heimatstadt Kiew, sie liegen dicht beieinander wie drei Finger, Butscha, Worsel und Irpin, und ich denke auch daran, dass dort vor Kurzem gute Straßen gebaut wurden. Es ist ganz nah bei Kiew, beinahe der westnördliche Teil der Stadt.
Zum ersten Mal in meinem Leben schaue ich mit dem Blick einer Militärexpertin auf die Karte. Das Sommergedicht von Boris Pasternak von 1930 steckt mir im Hals wie eine Gräte. Irpen (so auf Russisch) ist ein Zufluchtsort, ein Ort der Befreiung: »Irpen – Erinnerung an Sommer und Leute, an Freiheit und Flucht aus der Leibeigenschaft.« Was ist mit diesem Gedicht passiert? Mit dieser Sprache?
Viele von uns hatten eine Datscha dort in der Gegend, viele wohnten auch dort, wie einer meiner Freunde aus Uni-Zeiten. In Butscha haben wir im Sommer auf einer kleinen Insel gebadet, Plow gekocht, gesungen, eine riesige Gruppe von Freunden. Der Krieg hat alles zerstört, selbst die Vorstellung.
Letzten Sommer habe ich eine Freundin in Irpin besucht, eine Künstlerin, sie macht wunderschöne kleine Puppen. Seit die russische Armee die Ukraine angegriffen hat, schreibt sie jeden Tag kleine Notizen auf Facebook, mit dem Hashtag #umzuerinnern. Über ihre demente Mutter, über ihre Katze und wie sie zusammenhalten mit Witz und Liebe gegen die Barbarei, der sie ausgesetzt sind. Als direkte Angriffe kamen, flüchteten sie zu Fuß, suchten sich ihren Weg über die zerstörte Brücke, die Alten wurden getragen. Ihre Mutter ging im Durcheinander verloren, ein paar Stunden später ist sie wiederaufgetaucht, sie fanden sie über Onlinekanäle.