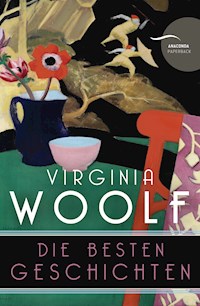
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit ihren avantgardistischen Romanen gehört Virginia Woolf neben Autoren wie Joyce und Proust zu den wichtigsten Figuren der literarischen Moderne. Doch nirgendwo zeigt sich Woolfs meisterhaft experimenteller Stil deutlicher als in ihren Kurzgeschichten, von denen dieser Band alle zu ihren Lebzeiten erschienenen versammelt. In Texten wie »Ein Geisterhaus« und »Montag oder Dienstag« sind konventionelle Erzählstrukturen aufgebrochen zugunsten eines fast traumartigen Bewusstseinsstroms. Wie mit einem Blitzstrahl leuchtet Woolf die Details der Szenen aus, deren Sog sich der Leser kaum entziehen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Virginia Woolf
Die besten Geschichten
Aus dem Englischen vonChristel Kröning
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt
und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte
Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung
durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung
oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in
elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und
zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so
übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns
diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand
zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2021 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen
der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotiv: Francis Campbell Boileau Cadell (1883–1937),
»Still Life with a Lacquer Screen«, The Fine Art Society,
London, Bridgeman Images
Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de
Satz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., Heiligenhaus
ISBN 978-3-641-28393-3V002
www.anacondaverlag.de
Inhalt
Inhalt
Der Fleck an der Wand
Kew Gardens
Feste Gegenstände
Ein ungeschriebener Roman
Ein Geisterhaus
Eine Gesellschaft
Montag oder Dienstag
Das Streichquartett
Blau & Grün
Das neue Kleid
Augenblicke des Daseins: »Slater’s-Nadeln haben keine Spitzen«
Die Dame im Spiegel: Eine Reflexion
Die Herzogin und der Juwelier
Die Jagdgesellschaft
Lappin und Lapinova
Editorische Notiz
Der Fleck an der Wand
Es wird so Mitte Januar dieses Jahres gewesen sein, als ich erstmals im Aufschauen den Fleck an der Wand bemerkte. Um sich an einen bestimmten Tag zu erinnern, muss man sich ins Gedächtnis rufen, was man gesehen hat. Ich denke also zurück an das Feuer. An den beständigen gelben Lichtschimmer auf meiner Buchseite. An die drei Chrysanthemen in der runden Glasvase auf dem Kaminsims. Ja, es muss Winter gewesen sein, kurz nach dem Tee, denn ich erinnere mich, eine Zigarette in der Hand gehalten zu haben, als ich das erste Mal im Aufschauen den Fleck an der Wand bemerkte. Ich blinzelte durch den Rauch meiner Zigarette und mein Blick verharrte für einen Moment auf den brennenden Kohlen, wobei mir jene alte Fantasie von der am Burgturm flatternden blutroten Fahne in den Sinn kam, und ich gedachte des Zugs roter Ritter, der den schwarzen Felshang hinanritt. Eher zu meiner Erleichterung unterbrach der Anblick des Flecks die Fantasie, denn es ist eine alte, vielleicht als Kind ersonnene, die mich stets unwillkürlich überkommt. Der Fleck war klein, rund, hob sich schwarz von der weißen Wand ab und lag etwa fünfzehn bis zwanzig Zentimeter über dem Kaminsims.
Wie bereitwillig sich unsere Gedanken auf etwas Neues stürzen, es erst eine Zeit lang, wie Ameisen einen Halm Stroh, übereifrig mit sich tragen, um es dann achtlos liegen zu lassen … Falls der Fleck von einem Nagel stammte, konnte der nicht für ein größeres Bild gewesen sein, sondern nur für eine Miniaturmalerei – die Miniatur einer Dame mit weiß gepuderten Locken, puderbestäubten Wangen und nelkenroten Lippen. Keine echte Antiquität natürlich, aber so hätten die Bewohner vor uns ihren Dekor nun einmal ausgesucht – ein altes Bild für ein altes Zimmer. Zu der Sorte von Leuten gehörten sie – hochinteressante Leute, an die ich sehr oft an sehr seltsamen Orten denke, weil niemand sie je wiedersehen wird, je wissen wird, was danach geschah. Sie verkauften das Haus, weil sie ihren Einrichtungsstil verändern wollten, so sagte er, und während er noch hinzufügte, dass seiner Meinung nach hinter Kunst Gedanken stehen sollten, wurde ich fort von ihm gerissen, so wie man fort von der alten Dame gerissen wird, die gerade Tee einschenkt, von dem jungen Mann, der gerade hinten im Stadtvillagarten den Tennisball schlägt, wenn man im Zug an ihnen vorbeirauscht.
Was jedoch den Fleck betrifft, so bin ich nicht sicher. Eigentlich glaube ich nicht, dass er von einem Nagel stammt. Dafür ist er zu groß und zu rund. Ich könnte aufstehen, aber zehn zu eins, dass ich, wenn ich aufstünde und ihn mir näher ansähe, auch nichts mit Sicherheit sagen könnte. Denn wenn etwas einmal geschehen ist, vermag niemand je zu erfahren, wie es passierte. Du meine Güte! Das Mysterium des Lebens! Die Fehlerhaftigkeit des Denkens! Das Unwissen der Menschheit! Um zu veranschaulichen, wie wenig Kontrolle wir über unsere Besitztümer haben, wie zufällig dieses Dasein trotz all unserer Zivilisiertheit immer noch ist, will ich nur einmal ein paar der in einem Menschenleben verlorenen Dinge aufzählen, angefangen mit, denn dieser Verlust erscheint mir stets als der mysteriöseste von allen – welche Katze fräße sie schließlich, welche Ratte zernagte sie? –, drei hellblauen Dosen mit Buchbindewerkzeugen. Dann die Vogelkäfige, die Bandeisen, die Schlittschuhe, der Kohleneimer aus der Queen-Anne-Ära, das Tivolispiel, der Leierkasten – alle fort, und erst die Schmuckstücke. Opale und Smaragde geraten auf einmal zwischen die Steckrüben. Das gibt ein fröhliches Wühlen und Scharren! Geradezu ein Wunder, dass mir noch Kleidung am Leib geblieben ist, dass ich hier noch von standhaften Möbeln umgeben bin. Nun ja, wenn man das Leben mit etwas vergleichen will, dann am ehesten damit, dass man mit achtzig Stundenkilometern durch den U-Bahn-Tunnel gepustet wird und am anderen Ende sämtliche Haarnadeln eingebüßt hat! Splitternackt ausgespuckt vor Gottes Füße! Kopfüber in die Moorlilienwiesen getaumelt wie eins dieser braunen Päckchen, die sie im Postamt die Rutsche hinunterkippen! Und die Haare wehen hinter einem drein wie ein Rennpferdschwanz. Ja, so scheint mir die Schnelligkeit des Lebens, das beständige Abhandenkommen und Flickschustern ganz gut veranschaulicht. Alles so zufällig, alles so willkürlich …
Nach dem Leben jedoch. Peu à peu dicke grüne Stängel zu sich herunterziehen, damit der Blütenkelch, sobald er sich neigt, einen mit violettem und rotem Licht übergießt. Warum sollte man schließlich dort anders geboren werden als hier – hilflos, sprachlos, mit unscharfem Blick, die Wurzeln des Grases betastend und die Zehen der Riesen? Unterscheiden, was Bäume sind und was Männer und Frauen, oder wissen, ob es sie überhaupt gibt, das könnte man erst nach grob fünfzig Jahren. Nichts als Flächen aus Hell und Dunkel, von dicken Stängeln durchschnitten, und ganz hoch oben vielleicht rosenförmige Kleckse unbestimmter Farbe – verschwommen rosa oder blau –, die im Lauf der Zeit deutlicher und … zu etwas werden, ich weiß nicht, wozu.
Und doch ist der Fleck an der Wand auf keinen Fall ein Loch. Er könnte eigentlich sogar von einem runden schwarzen Ding verursacht sein, wie einem kleinen Rosenblatt, das noch vom Sommer übrig ist, und ich, die ich meinen Haushalt nicht gerade mit Argusaugen führe – man sehe sich nur einmal den Staub auf dem Kaminsims an, den Staub, der, wie es heißt, Troja dreimal unter sich begrub, sodass dort wohl nur noch Geschirrscherben der Vergänglichkeit trotzen.
Der Baum vor dem Fenster klopft sacht an die Scheibe … Ich möchte in Ruhe nachdenken, besonnen, ausführlich, nie unterbrochen werden, nie von meinem Sessel aufstehen müssen, möchte geschmeidig vom einen ins andere gleiten, ohne Feindseligkeit oder Hemmnis. Tiefer und tiefer möchte ich sinken, fort von der Oberfläche mit ihren harten, zertrennten Tatsachen. Um mich ein wenig zu fangen, greife ich nach dem erstbesten vorbeitrudelnden Gedanken … Shakespeare … Na, der taugt dafür so gut wie jeder andere. Ein Mann, der seinerseits fest im Sessel saß und ins Feuer blickte, und … Ein Ideenregen fiel unablässig aus einem sehr hohen Himmel durch seinen Geist herab. Er stützte die Stirn auf die Hand, und Leute, die durch die offene Tür hereinsahen – denn diese Szene soll sich an einem Sommerabend abspielen … Oje, wie öde das ist! Derlei Historienschinken interessieren mich kein bisschen. Stieße ich doch auf einen wohltuenden Gedankengang, einen, der über Umwege ein gutes Licht auf mich wirft, denn das sind die wohltuendsten Gedanken, und sie kommen ja sogar den bescheidensten, mausgrauen, jedwedem Lob aus tiefster Seele abgeneigten Menschen ziemlich häufig in den Sinn. Solche Gedanken loben einen nicht direkt, das ist das Schöne an ihnen, es sind Gedanken in dieser Art:
»Und dann kam ich ins Zimmer. Das Gespräch drehte sich um Botanik. Ich erzählte, wie ich eine Blume entdeckt hatte, die unter dem Schutt eines alten Hauses auf der Kingsway hervorspross. Ihr Samen, sagte ich, muss unter der Herrschaft Karls des Ersten gesät worden sein. Welche Blumenarten blühten unter Karl dem Ersten?, so fragte ich (erinnere mich aber nicht mehr an die Antwort). Langstielige mit purpurnen Narbenfäden vielleicht. Und so geht es weiter. Währenddessen hübsche ich, liebevoll und verstohlen, mein Ich im Geiste auf, ohne es offen zu bewundern, denn sobald ich das täte, würde ich mich ertappen und aus Selbstschutz eilig zu einem Buch greifen. Tatsächlich ist es doch kurios, wie instinktiv man sein Selbstbild vor Vergötterung oder sonst einer Behandlung schützt, die es lächerlich oder der Vorlage zu unähnlich machen würde, um weiter an es zu glauben. Wobei, vielleicht ist dieser Reflex nur natürlich. Denn was gibt es Wichtigeres? Angenommen, der Spiegel zerbräche, das Bild verschwände und die romantische Gestalt inmitten der grünen Waldestiefe wäre für immer fort, ließe nur jene menschliche Hülle zurück, die die anderen Leute sehen – welch eine stickige, seichte, karge, grelle Welt da entstünde! Eine Welt, in der niemand leben wollte. Wenn wir einander in Bussen und U-Bahnen ansehen, schauen wir in den Spiegel. Daher auch das Verschwommene, der gläserne Schimmer in unseren Augen. Und denjenigen, die künftig Romane schreiben, wird die Bedeutsamkeit dieser Spiegelbilder immer bewusster werden, denn natürlich gibt es davon nicht nur eines, sondern nahezu unendlich viele. Diese Tiefen werden sie erforschen, diesen Phantomen nachjagen und in ihren Geschichten immer weniger die Wirklichkeit beschreiben, sondern das Wissen darum als gegeben voraussetzen, wie die Griechen es taten und Shakespeare vielleicht – doch derlei Generalisierung ist vollkommen wertlos. Man achte nur auf den militärischen Klang des Begriffs. Der erinnert an Leitartikel, an Kabinettsminister – an ganze Reihen von Dingen, die man als Kind für das Ding an sich gehalten hat, für den Standard, das Echte, von dem man sich nicht lösen konnte, ohne namenlose Verdammnis fürchten zu müssen. Auf unklare Weise bringt Generalisierung den Londoner Sonntag zurück, sonntägliche Nachmittagsspaziergänge, sonntägliche Essen und eine bestimmte Art, über die Toten zu reden, über Kleidungsstücke und Gewohnheiten – wie die Gewohnheit, bis zu einer bestimmten Uhrzeit gemeinsam in einem Zimmer zu sitzen, obwohl es niemandem gefiel. Für alles gab es eine Regel. Die Tischtuchregel zu jener Zeit besagte, dass diese kleinen gelben Rauten eingewebt sein mussten, wie man es vielleicht von den Fotografien der Flurteppiche in den königlichen Palästen her kennt. Alles andere war kein echtes Tischtuch. Welcher Schrecken und gleichzeitig welches Glück einen überkamen, als man entdeckte, dass all diese echten Dinge, Sonntagsessen, Sonntagsspaziergänge, Landhäuser, Tischtücher, gar nicht absolut echt waren, sondern eigentlich halb nur Phantome und dass die dem Ungläubigen drohende Verdammnis eigentlich nur verbotener Freiheitssinn war. Was nimmt nun den Platz dieser Dinge ein, frage ich mich, dieser echten Dinge, dieser Standards? Männer vielleicht, wenn man eine Frau ist. Der männliche Blickwinkel, der unsere Leben regiert, der den Standard setzt, der Whitakers Adelstabelle aufstellt, jene Rangordnung, die seit dem Krieg, wie ich glaube, für viele Männer und Frauen halb zum Phantom geworden ist und die bald, wie ich hoffe, in den Abfalleimer gelacht werden wird, worin die Phantome landen, die Mahagonianrichten und die Landseer-Drucke, die Götter und Teufel, die Hölle und so weiter, während wir alle in einem Rausch von verbotenem Freiheitssinn zurückbleiben – falls Freiheit existiert …
In einem bestimmten Licht wirkt es eher so, als würde der Fleck von der Wand abstehen. Und auch gar nicht ganz rund sein. Vielleicht irre ich mich, aber er scheint sogar einen Schatten zu werfen, ganz als würde mein Finger, wenn ich ihn die Wand hinabgleiten ließe, dort einen dieser kleinen, sanft auf- und abschwingenden Erdhügel überqueren, wie es sie in den South Downs gibt und die, so heißt es, entweder Grab- oder Wehrbauten waren. Von den beiden Möglichkeiten bevorzuge ich die Grabvariante, da ich mich wie die meisten in England nach Melancholie sehne und es nur natürlich finde, am Ende eines Spaziergangs an die unter der Grasnarbe ruhenden Knochen zu denken … Irgendwo muss es ein Buch darüber geben. Irgendein Altertumsforscher muss diese Knochen ausgegraben und ihnen einen Namen gegeben haben … Welche Sorte Mensch, frage ich mich, wird Altertumsforscher? Hauptsächlich Stabsoffiziere im Ruhestand, wage ich zu behaupten, die Gruppen betagter Arbeiter hier heraufführen, um Erd- und Steinklumpen zu untersuchen, und die in Korrespondenz mit dem benachbarten Pfarramt treten, worauf jenes, indem es zur Frühstückszeit öffnet, den älteren Herren ein Gefühl der Wichtigkeit schenkt, und natürlich erfordert das Vergleichen von Pfeilspitzen auch Reisen durchs Land zu den Kreisstädten – ein angenehmes Erfordernis sowohl für die älteren Herren als auch für ihre Ehefrauen, die Pflaumenmarmelade einkochen wollen oder im Arbeitszimmer einmal ordentlich durchwischen und daher guten Grund haben, die Spannung um die große Frage nach Grab- oder Wehrbau stetig zu schüren, während der Offizier selbst sich wohlig philosophisch fühlt, indem er Beweise für beide Möglichkeiten zusammenträgt. Doch letzten Endes tendiert er zur Wehrbauvariante und verfasst, als ihm widersprochen wird, eine Streitschrift, die er gerade beim Quartalstreffen des Ortsvereins vorlesen will, als ihn ein Schlaganfall niederstreckt, weshalb seine letzten bewussten Gedanken sich nicht um Frau oder Kind drehen, sondern um den Wehrbau und die dort gefundene Pfeilspitze, die jetzt hinter Glas im örtlichen Heimatmuseum liegt, zusammen mit dem Fuß einer chinesischen Mörderin, einer Handvoll elisabethanischer Nägel, einer großen Auswahl Tonpfeifen aus der Tudorzeit, einem Stück römischer Töpferware und einem Weinglas, aus dem einst Admiral Nelson trank und das somit … etwas beweist, ich weiß beim besten Willen nicht, was.
O nein, nichts ist bewiesen, nichts ist bekannt. Und wenn ich in genau diesem Moment aufstehen und feststellen würde, dass der Fleck an der Wand in Wirklichkeit ein – was nehmen wir? – riesiger alter Nagelkopf ist, der vor zweihundert Jahren dort hineingeschlagen wurde und der jetzt, wegen des durch ganze Generationen von Hausmädchen verursachten, geduldigen Abriebs, sein Haupt aus den Farbschichten streckt, um zum ersten Mal das moderne Leben in Gestalt eines weiß gestrichenen, kaminfeuerbeschienenen Zimmers zu erblicken, was sollte ich dadurch gewinnen? – Wissen? Material für weitere Spekulationen? Spekulieren kann ich ebenso gut, wenn ich sitzen bleibe. Und was ist schon Wissen? Was sind unsere Gelehrten anderes als die Nachfahren von Hexen und Einsiedlern, die sich in ihre Höhlen duckten, in den Wäldern Kräutertränke zusammenbrauten, Spitzmäuse befragten und die Sprache der Sterne notierten? Je weniger wir sie verehren, während gleichzeitig unser Aberglaube schwindet und unser Respekt für die Schönheit und Kraft des Geistes wächst … Ja, man könnte sich eine sehr angenehme Welt vorstellen. Eine ruhige, geräumige Welt mit sattroten und -blauen Blumen auf den weiten Feldern. Eine Welt ohne Professoren, Experten oder Haushälterinnen mit Polizistenprofil, eine Welt, die man mit seinen Gedanken teilen könnte, wie ein Fisch mit der Flosse das Wasser teilt, Seerosenstängel streift, über weißen Seeigelnestern schwebt … Wie friedlich es ist hier unten, wo man, verwurzelt im Herzen der Welt, emporblickt durch die grauen Wasser mit ihrem jähen Aufglitzern und ihren Spiegelungen – wäre da nicht Whitakers Almanach – wäre da nicht diese Adelstabelle!
Ich muss einfach aufspringen und nachsehen, was der Fleck an der Wand wirklich ist – ein Nagel, ein Rosenblatt, ein Spalt im Holz?
Hier spielt die Natur einmal wieder ihr altes Spiel namens Selbsterhaltung. Durch meinen Gedankengang, so merkt sie, droht die reinste Energieverschwendung, eine Kollision gar mit der Wirklichkeit, denn wer wäre je imstande, auch nur einen Finger gegen Whitakers Rangordnung zu erheben? Dem Erzbischof von Canterbury folgt der Hohe Lordkanzler, dem Hohen Lordkanzler folgt der Erzbischof von York. Jeder folgt jemandem, so Whitakers Philosophie. Und das Tolle daran ist zu wissen, wer wem folgt. Whitaker weiß es und wir sollen uns, so rät die Natur, davon nicht erzürnen, sondern trösten lassen. Und bevor man sich partout nicht trösten lassen kann, bevor man unbedingt diese Stunde des Friedens zerschlagen muss, denke man an den Fleck an der Wand.
Ich verstehe das Spiel der Natur – dass sie, um jeden Gedanken zu beenden, der womöglich begeistern oder gar wehtun könnte, zur Tätigkeit antreibt. Daher rührt, so scheint mir, auch unsere leichte Verachtung für Männer der Tat – Männer, die, wie wir vermuten, nicht denken. Trotzdem kann es nicht schaden, hinter unangenehme Gedanken einen Punkt zu setzen, indem man einen Fleck an der Wand betrachtet.
Tatsächlich fühle ich mich jetzt, da ich meinen Blick fest auf den Fleck gerichtet halte, als hätte ich mitten auf hoher See eine Planke zu fassen bekommen. Ich verspüre eine befriedigende Echtheit, die die zwei Erzbischöfe und den Hohen Lordkanzler im Handumdrehen in Schatten von Schatten verwandelt. Hier ist etwas Konkretes, etwas Echtes. Deswegen macht man auch, wenn man mitten in der Nacht aus einem Schreckenstraum hochfährt, hastig Licht, bleibt andächtig liegen und betet die Kommode an, die Festigkeit, die Wirklichkeit, die unpersönliche Welt, die beweist, dass es eine andere Existenz neben der unseren gibt. Dessen möchte man sicher sein … Es ist angenehm, über Holz nachzudenken. Holz kommt vom Baum. Bäume wachsen, ohne dass wir wissen, wie sie das tun. Jahr um Jahr wachsen sie, ohne sich um uns zu kümmern, auf Wiesen, in Wäldern und an Flussufern – etwas, an das man gern denkt. In ihrem Schatten schlagen die Kühe an heißen Nachmittagen mit dem Schwanz nach Fliegen. Sie malen die Flüsse so grün, dass man, wenn ein Sumpfhuhn hineintaucht, in der Erwartung stehen bleibt, es werde mit grün eingefärbtem Federkleid wieder auftauchen. Gern denke ich an die Fische, die sich in die Strömung stellen wie wehende Flaggen. Und an die Wasserkäfer, die bedächtig ihre Schlammkuppeln im Flussbett errichten. Ich denke gern an den Baum selbst: erst das dichte, trockene Gefühl des Holzseins, dann das Knirschen im Sturm, dann das langsame, köstliche Fließen der Säfte. Auch an den Baum, der in Winternächten auf kahlem Feld steht, mit eingerollten Blättern, ohne den Stahlgeschossen des Mondes etwas Zartes preiszugeben, denke ich gern, an diesen blanken Schiffsmast auf einer Erde, die die ganze Nacht hindurch taumelt und schwankt. Der Junigesang der Vögel muss unglaublich laut und fremdartig sein und das Trippeln der Insekten unglaublich kalt, wenn sie sich mühsam durch die Rindenfurchen emporarbeiten oder sich auf den zarten grünen Blattmarkisen sonnen und mit diamantgeschliffenen roten Augen reglos geradeaus starren … Eine Faser nach der anderen reißt unter dem lastenden kalten Erdendruck, bis schließlich der letzte Sturm kommt und selbst die höchsten Äste tief in den Boden zurückfallen. Und doch ist das Leben noch nicht vorbei. Auf der ganzen Welt erwarten den Baum noch Tausende Existenzen voller Geduld und Wachsamkeit, in Schlafstuben, auf Schiffen, auf Gehwegen, in Wohnzimmern, wo Männer und Frauen nach dem Tee eine Zigarette rauchen. So voll friedlicher, voll glücklicher Gedanken steckt dieser Baum, dass ich jeden einzelnen davon genießen möchte – doch etwas gerät mir in den Weg … Wo war ich? Worum ging es hier? Um einen Baum? Einen Fluss? Die Downs? Whitakers Almanach? Die Moorlilienwiesen? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Alles bewegt sich, fällt, entgleitet, verschwindet … Etwas Gewaltiges erhebt sich. Jemand beugt sich über mich und sagt:
»Ich geh eine Zeitung kaufen.«
»Ja?«
»Obwohl das eigentlich sinnlos ist … Es ändert sich eh nie etwas. Verflucht sei dieser Krieg, gottverdammt sei er! … Trotzdem weiß ich nicht, was eine Schnecke bei uns an der Wand zu suchen hat.«
Ah, der Fleck an der Wand! Er war eine Schnecke.
Kew Gardens
An die hundert Stängel streckten sich aus dem ovalen Blumenbeet empor, spreizten auf halbem Weg herz- oder zungenförmiges Blattgrün und öffneten an der Spitze erhaben betupfte rote, blaue oder gelbe Blütenblätter. Dieser roten, blauen oder gelben Glut der Kehle entsprang ein kerzengerader, dick goldbestäubter Griffel samt Blütennarbe. Die Blütenblätter waren groß genug, um sich in der leichten Sommerbrise zu regen, und wenn sie das taten, legten die roten, blauen und gelben Lichter sich übereinander, sodass auf dem Erdenbraun darunter ein unendlich vielschichtiger Farbfleck entstand. Das Licht fiel bald auf den glatten grauen Rücken eines Kiesels, bald auf ein braun geädertes Schneckenhaus oder erfüllte, wenn es in einem Regentropfen landete, die hauchdünne Wasserkuppel mit einem so satten Rot, Blau oder Gelb, dass man glaubte, sie würde davon zerspringen. Stattdessen jedoch blieb der Tropfen schon im nächsten Moment wieder silbergrau zurück, weil das Licht sich jetzt auf das Fleisch eines Blattes legte, die verzweigten Äderchen im Innern zum Vorschein brachte und gleich darauf weiterzog und seinen Schein unter dem weitläufigen Gewölbe des herz- und zungenförmigen Blattgrüns ausbreitete. Als dann die Brise etwas stärker ging, wurde das farbige Leuchten emporgesandt, in die Augen der Männer und Frauen, die im Juli durch die Kew Gardens spazieren.
In einem seltsam unsteten Gang, der dem Zickzack der gaukelnden weißen und blauen Schmetterlinge nicht unähnlich war, streiften die Männer- und Frauengestalten zwischen den Beeten umher. Der Mann schlenderte müßig eine Handbreit vorweg, während die Frau entschlossener vorwärtsstrebte und nur dann und wann den Kopf danach umdrehte, ob die Kinder noch in der Nähe waren. Absichtlich, wenn auch vielleicht unbewusst, hielt der Mann diesen Abstand zur Frau, denn er wollte seine Gedanken fortführen.
»Vor fünfzehn Jahren war ich mit Lily hier«, dachte er. »Wir saßen irgendwo dort an einem See und den ganzen heißen Nachmittag hindurch flehte ich sie an, mich zu heiraten. Wie ausdauernd uns die Libelle umkreiste. Wie deutlich ich das Tier noch sehe, und ihren Schuh mit der viereckigen silbernen Schnalle an der Spitze. Die ganze Zeit, während ich sprach, hatte ich diesen Schuh vor Augen, und als der ungeduldig wippte, wusste ich, ohne aufzusehen, was sie sagen würde – ihr ganzes Wesen schien in diesem Schuh zu stecken. Und meine Liebe, mein Sehnen steckten in der Libelle. Aus irgendeinem Grund glaubte ich, wenn das Tier sich auf dieses Blatt setzte, auf das breite dort mit der roten Blüte in der Mitte, wenn es sich auf das Blatt setzte, dann würde sie sofort ›Ja‹ sagen. Doch die Libelle flog nur immer im Kreis, setzte sich nirgendwo hin – natürlich nicht, zum Glück nicht, denn sonst spazierte ich ja jetzt nicht hier mit Eleanor und den Kindern. Sag, Eleanor, denkst du manchmal an früher?«
»Warum fragst du, Simon?«
»Weil ich an früher gedacht habe. An Lily, die Frau, die ich fast geheiratet hätte … Nun, warum sagst du nichts? Stört es dich, wenn ich an früher denke?«
»Warum sollte es, Simon? Denkt man nicht automatisch an früher in so einem Park, in dem Männer und Frauen unter Bäumen liegen? Sind sie nicht die eigene Vergangenheit, was davon übrig ist, diese Männer und Frauen, diese Geister unter den Bäumen … das eigene Glück, die eigene Wirklichkeit?«
»Für mich sind eine viereckige silberne Schuhschnalle und eine Libelle –«





























