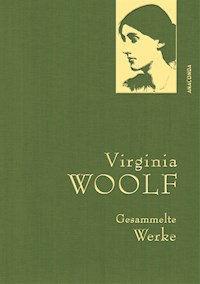
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Anaconda Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
Virginia Woolf zählt neben Autoren wie James Joyce und Marcel Proust zu den herausragendsten Schriftsteller*innen der Klassischen Moderne. Diese Werkausgabe versammelt ihre großen Romane »Orlando« und »Mrs Dalloway« sowie den Essay »Ein Zimmer für sich allein«, der in den 1970er-Jahren zu einem der zentralen Texte der Frauenbewegung avancierte. Ergänzt wird der Band durch bedeutende Erzählungen wie »Kew Gardens« und »Ein Geisterhaus«, in deren Kürze besonders deutlich wird, wie Woolf konventionelle Erzählstrukturen aufbricht zugunsten eines fast traumartigen Bewusstseinsstroms, der den Leser unwiderstehlich mitreißt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1071
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Virginia Woolf
Gesammelte Werke
Aus dem Englischen von Marion Herbert,Kai Kilian und Christel Kröning
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthälttechnische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernungdieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung,Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung,insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- undzivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, soübernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diesenicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunktder Erstveröffentlichung verweisen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind imInternet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2021 by Anaconda Verlag, einem Unternehmender Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenAlle Rechte vorbehalten.Umschlagmotiv: »Portrait of the British novelistVirginia Woolf (1882–1941)«Photo © Isadora / Bridgeman ImagesUmschlaggestaltung: Druckfrei. Dagmar Herrmann, Bad HonnefSatz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., HeiligenhausISBN 978-3-641-29231-7V002www.anacondaverlag.de
Inhalt
Erzählungen
Der Fleck an der Wand
Kew Gardens
Feste Gegenstände
Ein ungeschriebener Roman
Ein Geisterhaus
Eine Gesellschaft
Montag oder Dienstag
Das Streichquartett
Blau & Grün
Das neue Kleid
Augenblicke des Daseins: »Slater’s-Nadeln haben keine Spitzen«
Die Dame im Spiegel: Eine Reflexion
Die Herzogin und der Juwelier
Die Jagdgesellschaft
Lappin und Lapinova
Mrs Dalloway
Orlando. Eine Biografie
Ein Zimmer für sich allein
Editorische Notiz
Erzählungen
Der Fleck an der Wand
Es wird so Mitte Januar dieses Jahres gewesen sein, als ich erstmals im Aufschauen den Fleck an der Wand bemerkte. Um sich an einen bestimmten Tag zu erinnern, muss man sich ins Gedächtnis rufen, was man gesehen hat. Ich denke also zurück an das Feuer. An den beständigen gelben Lichtschimmer auf meiner Buchseite. An die drei Chrysanthemen in der runden Glasvase auf dem Kaminsims. Ja, es muss Winter gewesen sein, kurz nach dem Tee, denn ich erinnere mich, eine Zigarette in der Hand gehalten zu haben, als ich das erste Mal im Aufschauen den Fleck an der Wand bemerkte. Ich blinzelte durch den Rauch meiner Zigarette und mein Blick verharrte für einen Moment auf den brennenden Kohlen, wobei mir jene alte Fantasie von der am Burgturm flatternden blutroten Fahne in den Sinn kam, und ich gedachte des Zugs roter Ritter, der den schwarzen Felshang hinanritt. Eher zu meiner Erleichterung unterbrach der Anblick des Flecks die Fantasie, denn es ist eine alte, vielleicht als Kind ersonnene, die mich stets unwillkürlich überkommt. Der Fleck war klein, rund, hob sich schwarz von der weißen Wand ab und lag etwa fünfzehn bis zwanzig Zentimeter über dem Kaminsims.
Wie bereitwillig sich unsere Gedanken auf etwas Neues stürzen, es erst eine Zeit lang, wie Ameisen einen Halm Stroh, übereifrig mit sich tragen, um es dann achtlos liegen zu lassen … Falls der Fleck von einem Nagel stammte, konnte der nicht für ein größeres Bild gewesen sein, sondern nur für eine Miniaturmalerei – die Miniatur einer Dame mit weiß gepuderten Locken, puderbestäubten Wangen und nelkenroten Lippen. Keine echte Antiquität natürlich, aber so hätten die Bewohner vor uns ihren Dekor nun einmal ausgesucht – ein altes Bild für ein altes Zimmer. Zu der Sorte von Leuten gehörten sie – hochinteressante Leute, an die ich sehr oft an sehr seltsamen Orten denke, weil niemand sie je wiedersehen wird, je wissen wird, was danach geschah. Sie verkauften das Haus, weil sie ihren Einrichtungsstil verändern wollten, so sagte er, und während er noch hinzufügte, dass seiner Meinung nach hinter Kunst Gedanken stehen sollten, wurde ich fort von ihm gerissen, so wie man fort von der alten Dame gerissen wird, die gerade Tee einschenkt, von dem jungen Mann, der gerade hinten im Stadtvillagarten den Tennisball schlägt, wenn man im Zug an ihnen vorbeirauscht.
Was jedoch den Fleck betrifft, so bin ich nicht sicher. Eigentlich glaube ich nicht, dass er von einem Nagel stammt. Dafür ist er zu groß und zu rund. Ich könnte aufstehen, aber zehn zu eins, dass ich, wenn ich aufstünde und ihn mir näher ansähe, auch nichts mit Sicherheit sagen könnte. Denn wenn etwas einmal geschehen ist, vermag niemand je zu erfahren, wie es passierte. Du meine Güte! Das Mysterium des Lebens! Die Fehlerhaftigkeit des Denkens! Das Unwissen der Menschheit! Um zu veranschaulichen, wie wenig Kontrolle wir über unsere Besitztümer haben, wie zufällig dieses Dasein trotz all unserer Zivilisiertheit immer noch ist, will ich nur einmal ein paar der in einem Menschenleben verlorenen Dinge aufzählen, angefangen mit, denn dieser Verlust erscheint mir stets als der mysteriöseste von allen – welche Katze fräße sie schließlich, welche Ratte zernagte sie? –, drei hellblauen Dosen mit Buchbindewerkzeugen. Dann die Vogelkäfige, die Bandeisen, die Schlittschuhe, der Kohleneimer aus der Queen-Anne-Ära, das Tivolispiel, der Leierkasten – alle fort, und erst die Schmuckstücke. Opale und Smaragde geraten auf einmal zwischen die Steckrüben. Das gibt ein fröhliches Wühlen und Scharren! Geradezu ein Wunder, dass mir noch Kleidung am Leib geblieben ist, dass ich hier noch von standhaften Möbeln umgeben bin. Nun ja, wenn man das Leben mit etwas vergleichen will, dann am ehesten damit, dass man mit achtzig Stundenkilometern durch den U-Bahn-Tunnel gepustet wird und am anderen Ende sämtliche Haarnadeln eingebüßt hat! Splitternackt ausgespuckt vor Gottes Füße! Kopfüber in die Moorlilienwiesen getaumelt wie eins dieser braunen Päckchen, die sie im Postamt die Rutsche hinunterkippen! Und die Haare wehen hinter einem drein wie ein Rennpferdschwanz. Ja, so scheint mir die Schnelligkeit des Lebens, das beständige Abhandenkommen und Flickschustern ganz gut veranschaulicht. Alles so zufällig, alles so willkürlich …
Nach dem Leben jedoch. Peu à peu dicke grüne Stängel zu sich herunterziehen, damit der Blütenkelch, sobald er sich neigt, einen mit violettem und rotem Licht übergießt. Warum sollte man schließlich dort anders geboren werden als hier – hilflos, sprachlos, mit unscharfem Blick, die Wurzeln des Grases betastend und die Zehen der Riesen? Unterscheiden, was Bäume sind und was Männer und Frauen, oder wissen, ob es sie überhaupt gibt, das könnte man erst nach grob fünfzig Jahren. Nichts als Flächen aus Hell und Dunkel, von dicken Stängeln durchschnitten, und ganz hoch oben vielleicht rosenförmige Kleckse unbestimmter Farbe – verschwommen rosa oder blau –, die im Lauf der Zeit deutlicher und … zu etwas werden, ich weiß nicht, wozu.
Und doch ist der Fleck an der Wand auf keinen Fall ein Loch. Er könnte eigentlich sogar von einem runden schwarzen Ding verursacht sein, wie einem kleinen Rosenblatt, das noch vom Sommer übrig ist, und ich, die ich meinen Haushalt nicht gerade mit Argusaugen führe – man sehe sich nur einmal den Staub auf dem Kaminsims an, den Staub, der, wie es heißt, Troja dreimal unter sich begrub, sodass dort wohl nur noch Geschirrscherben der Vergänglichkeit trotzen.
Der Baum vor dem Fenster klopft sacht an die Scheibe … Ich möchte in Ruhe nachdenken, besonnen, ausführlich, nie unterbrochen werden, nie von meinem Sessel aufstehen müssen, möchte geschmeidig vom einen ins andere gleiten, ohne Feindseligkeit oder Hemmnis. Tiefer und tiefer möchte ich sinken, fort von der Oberfläche mit ihren harten, zertrennten Tatsachen. Um mich ein wenig zu fangen, greife ich nach dem erstbesten vorbeitrudelnden Gedanken … Shakespeare … Na, der taugt dafür so gut wie jeder andere. Ein Mann, der seinerseits fest im Sessel saß und ins Feuer blickte, und … Ein Ideenregen fiel unablässig aus einem sehr hohen Himmel durch seinen Geist herab. Er stützte die Stirn auf die Hand, und Leute, die durch die offene Tür hereinsahen – denn diese Szene soll sich an einem Sommerabend abspielen … Oje, wie öde das ist! Derlei Historienschinken interessieren mich kein bisschen. Stieße ich doch auf einen wohltuenden Gedankengang, einen, der über Umwege ein gutes Licht auf mich wirft, denn das sind die wohltuendsten Gedanken, und sie kommen ja sogar den bescheidensten, mausgrauen, jedwedem Lob aus tiefster Seele abgeneigten Menschen ziemlich häufig in den Sinn. Solche Gedanken loben einen nicht direkt, das ist das Schöne an ihnen, es sind Gedanken in dieser Art:
»Und dann kam ich ins Zimmer. Das Gespräch drehte sich um Botanik. Ich erzählte, wie ich eine Blume entdeckt hatte, die unter dem Schutt eines alten Hauses auf der Kingsway hervorspross. Ihr Samen, sagte ich, muss unter der Herrschaft Karls des Ersten gesät worden sein. Welche Blumenarten blühten unter Karl dem Ersten?, so fragte ich (erinnere mich aber nicht mehr an die Antwort). Langstielige mit purpurnen Narbenfäden vielleicht. Und so geht es weiter. Währenddessen hübsche ich, liebevoll und verstohlen, mein Ich im Geiste auf, ohne es offen zu bewundern, denn sobald ich das täte, würde ich mich ertappen und aus Selbstschutz eilig zu einem Buch greifen. Tatsächlich ist es doch kurios, wie instinktiv man sein Selbstbild vor Vergötterung oder sonst einer Behandlung schützt, die es lächerlich oder der Vorlage zu unähnlich machen würde, um weiter an es zu glauben. Wobei, vielleicht ist dieser Reflex nur natürlich. Denn was gibt es Wichtigeres? Angenommen, der Spiegel zerbräche, das Bild verschwände und die romantische Gestalt inmitten der grünen Waldestiefe wäre für immer fort, ließe nur jene menschliche Hülle zurück, die die anderen Leute sehen – welch eine stickige, seichte, karge, grelle Welt da entstünde! Eine Welt, in der niemand leben wollte. Wenn wir einander in Bussen und U-Bahnen ansehen, schauen wir in den Spiegel. Daher auch das Verschwommene, der gläserne Schimmer in unseren Augen. Und denjenigen, die künftig Romane schreiben, wird die Bedeutsamkeit dieser Spiegelbilder immer bewusster werden, denn natürlich gibt es davon nicht nur eines, sondern nahezu unendlich viele. Diese Tiefen werden sie erforschen, diesen Phantomen nachjagen und in ihren Geschichten immer weniger die Wirklichkeit beschreiben, sondern das Wissen darum als gegeben voraussetzen, wie die Griechen es taten und Shakespeare vielleicht – doch derlei Generalisierung ist vollkommen wertlos. Man achte nur auf den militärischen Klang des Begriffs. Der erinnert an Leitartikel, an Kabinettsminister – an ganze Reihen von Dingen, die man als Kind für das Ding an sich gehalten hat, für den Standard, das Echte, von dem man sich nicht lösen konnte, ohne namenlose Verdammnis fürchten zu müssen. Auf unklare Weise bringt Generalisierung den Londoner Sonntag zurück, sonntägliche Nachmittagsspaziergänge, sonntägliche Essen und eine bestimmte Art, über die Toten zu reden, über Kleidungsstücke und Gewohnheiten – wie die Gewohnheit, bis zu einer bestimmten Uhrzeit gemeinsam in einem Zimmer zu sitzen, obwohl es niemandem gefiel. Für alles gab es eine Regel. Die Tischtuchregel zu jener Zeit besagte, dass diese kleinen gelben Rauten eingewebt sein mussten, wie man es vielleicht von den Fotografien der Flurteppiche in den königlichen Palästen her kennt. Alles andere war kein echtes Tischtuch. Welcher Schrecken und gleichzeitig welches Glück einen überkamen, als man entdeckte, dass all diese echten Dinge, Sonntagsessen, Sonntagsspaziergänge, Landhäuser, Tischtücher, gar nicht absolut echt waren, sondern eigentlich halb nur Phantome und dass die dem Ungläubigen drohende Verdammnis eigentlich nur verbotener Freiheitssinn war. Was nimmt nun den Platz dieser Dinge ein, frage ich mich, dieser echten Dinge, dieser Standards? Männer vielleicht, wenn man eine Frau ist. Der männliche Blickwinkel, der unsere Leben regiert, der den Standard setzt, der Whitakers Adelstabelle aufstellt, jene Rangordnung, die seit dem Krieg, wie ich glaube, für viele Männer und Frauen halb zum Phantom geworden ist und die bald, wie ich hoffe, in den Abfalleimer gelacht werden wird, worin die Phantome landen, die Mahagonianrichten und die Landseer-Drucke, die Götter und Teufel, die Hölle und so weiter, während wir alle in einem Rausch von verbotenem Freiheitssinn zurückbleiben – falls Freiheit existiert …
In einem bestimmten Licht wirkt es eher so, als würde der Fleck von der Wand abstehen. Und auch gar nicht ganz rund sein. Vielleicht irre ich mich, aber er scheint sogar einen Schatten zu werfen, ganz als würde mein Finger, wenn ich ihn die Wand hinabgleiten ließe, dort einen dieser kleinen, sanft auf- und abschwingenden Erdhügel überqueren, wie es sie in den South Downs gibt und die, so heißt es, entweder Grab- oder Wehrbauten waren. Von den beiden Möglichkeiten bevorzuge ich die Grabvariante, da ich mich wie die meisten in England nach Melancholie sehne und es nur natürlich finde, am Ende eines Spaziergangs an die unter der Grasnarbe ruhenden Knochen zu denken … Irgendwo muss es ein Buch darüber geben. Irgendein Altertumsforscher muss diese Knochen ausgegraben und ihnen einen Namen gegeben haben … Welche Sorte Mensch, frage ich mich, wird Altertumsforscher? Hauptsächlich Stabsoffiziere im Ruhestand, wage ich zu behaupten, die Gruppen betagter Arbeiter hier heraufführen, um Erd- und Steinklumpen zu untersuchen, und die in Korrespondenz mit dem benachbarten Pfarramt treten, worauf jenes, indem es zur Frühstückszeit öffnet, den älteren Herren ein Gefühl der Wichtigkeit schenkt, und natürlich erfordert das Vergleichen von Pfeilspitzen auch Reisen durchs Land zu den Kreisstädten – ein angenehmes Erfordernis sowohl für die älteren Herren als auch für ihre Ehefrauen, die Pflaumenmarmelade einkochen wollen oder im Arbeitszimmer einmal ordentlich durchwischen und daher guten Grund haben, die Spannung um die große Frage nach Grab- oder Wehrbau stetig zu schüren, während der Offizier selbst sich wohlig philosophisch fühlt, indem er Beweise für beide Möglichkeiten zusammenträgt. Doch letzten Endes tendiert er zur Wehrbauvariante und verfasst, als ihm widersprochen wird, eine Streitschrift, die er gerade beim Quartalstreffen des Ortsvereins vorlesen will, als ihn ein Schlaganfall niederstreckt, weshalb seine letzten bewussten Gedanken sich nicht um Frau oder Kind drehen, sondern um den Wehrbau und die dort gefundene Pfeilspitze, die jetzt hinter Glas im örtlichen Heimatmuseum liegt, zusammen mit dem Fuß einer chinesischen Mörderin, einer Handvoll elisabethanischer Nägel, einer großen Auswahl Tonpfeifen aus der Tudorzeit, einem Stück römischer Töpferware und einem Weinglas, aus dem einst Admiral Nelson trank und das somit … etwas beweist, ich weiß beim besten Willen nicht, was.
O nein, nichts ist bewiesen, nichts ist bekannt. Und wenn ich in genau diesem Moment aufstehen und feststellen würde, dass der Fleck an der Wand in Wirklichkeit ein – was nehmen wir? – riesiger alter Nagelkopf ist, der vor zweihundert Jahren dort hineingeschlagen wurde und der jetzt, wegen des durch ganze Generationen von Hausmädchen verursachten, geduldigen Abriebs, sein Haupt aus den Farbschichten streckt, um zum ersten Mal das moderne Leben in Gestalt eines weiß gestrichenen, kaminfeuerbeschienenen Zimmers zu erblicken, was sollte ich dadurch gewinnen? – Wissen? Material für weitere Spekulationen? Spekulieren kann ich ebenso gut, wenn ich sitzen bleibe. Und was ist schon Wissen? Was sind unsere Gelehrten anderes als die Nachfahren von Hexen und Einsiedlern, die sich in ihre Höhlen duckten, in den Wäldern Kräutertränke zusammenbrauten, Spitzmäuse befragten und die Sprache der Sterne notierten? Je weniger wir sie verehren, während gleichzeitig unser Aberglaube schwindet und unser Respekt für die Schönheit und Kraft des Geistes wächst … Ja, man könnte sich eine sehr angenehme Welt vorstellen. Eine ruhige, geräumige Welt mit sattroten und -blauen Blumen auf den weiten Feldern. Eine Welt ohne Professoren, Experten oder Haushälterinnen mit Polizistenprofil, eine Welt, die man mit seinen Gedanken teilen könnte, wie ein Fisch mit der Flosse das Wasser teilt, Seerosenstängel streift, über weißen Seeigelnestern schwebt … Wie friedlich es ist hier unten, wo man, verwurzelt im Herzen der Welt, emporblickt durch die grauen Wasser mit ihrem jähen Aufglitzern und ihren Spiegelungen – wäre da nicht Whitakers Almanach – wäre da nicht diese Adelstabelle!
Ich muss einfach aufspringen und nachsehen, was der Fleck an der Wand wirklich ist – ein Nagel, ein Rosenblatt, ein Spalt im Holz?
Hier spielt die Natur einmal wieder ihr altes Spiel namens Selbsterhaltung. Durch meinen Gedankengang, so merkt sie, droht die reinste Energieverschwendung, eine Kollision gar mit der Wirklichkeit, denn wer wäre je imstande, auch nur einen Finger gegen Whitakers Rangordnung zu erheben? Dem Erzbischof von Canterbury folgt der Hohe Lordkanzler, dem Hohen Lordkanzler folgt der Erzbischof von York. Jeder folgt jemandem, so Whitakers Philosophie. Und das Tolle daran ist zu wissen, wer wem folgt. Whitaker weiß es und wir sollen uns, so rät die Natur, davon nicht erzürnen, sondern trösten lassen. Und bevor man sich partout nicht trösten lassen kann, bevor man unbedingt diese Stunde des Friedens zerschlagen muss, denke man an den Fleck an der Wand.
Ich verstehe das Spiel der Natur – dass sie, um jeden Gedanken zu beenden, der womöglich begeistern oder gar wehtun könnte, zur Tätigkeit antreibt. Daher rührt, so scheint mir, auch unsere leichte Verachtung für Männer der Tat – Männer, die, wie wir vermuten, nicht denken. Trotzdem kann es nicht schaden, hinter unangenehme Gedanken einen Punkt zu setzen, indem man einen Fleck an der Wand betrachtet.
Tatsächlich fühle ich mich jetzt, da ich meinen Blick fest auf den Fleck gerichtet halte, als hätte ich mitten auf hoher See eine Planke zu fassen bekommen. Ich verspüre eine befriedigende Echtheit, die die zwei Erzbischöfe und den Hohen Lordkanzler im Handumdrehen in Schatten von Schatten verwandelt. Hier ist etwas Konkretes, etwas Echtes. Deswegen macht man auch, wenn man mitten in der Nacht aus einem Schreckenstraum hochfährt, hastig Licht, bleibt andächtig liegen und betet die Kommode an, die Festigkeit, die Wirklichkeit, die unpersönliche Welt, die beweist, dass es eine andere Existenz neben der unseren gibt. Dessen möchte man sicher sein … Es ist angenehm, über Holz nachzudenken. Holz kommt vom Baum. Bäume wachsen, ohne dass wir wissen, wie sie das tun. Jahr um Jahr wachsen sie, ohne sich um uns zu kümmern, auf Wiesen, in Wäldern und an Flussufern – etwas, an das man gern denkt. In ihrem Schatten schlagen die Kühe an heißen Nachmittagen mit dem Schwanz nach Fliegen. Sie malen die Flüsse so grün, dass man, wenn ein Sumpfhuhn hineintaucht, in der Erwartung stehen bleibt, es werde mit grün eingefärbtem Federkleid wieder auftauchen. Gern denke ich an die Fische, die sich in die Strömung stellen wie wehende Flaggen. Und an die Wasserkäfer, die bedächtig ihre Schlammkuppeln im Flussbett errichten. Ich denke gern an den Baum selbst: erst das dichte, trockene Gefühl des Holzseins, dann das Knirschen im Sturm, dann das langsame, köstliche Fließen der Säfte. Auch an den Baum, der in Winternächten auf kahlem Feld steht, mit eingerollten Blättern, ohne den Stahlgeschossen des Mondes etwas Zartes preiszugeben, denke ich gern, an diesen blanken Schiffsmast auf einer Erde, die die ganze Nacht hindurch taumelt und schwankt. Der Junigesang der Vögel muss unglaublich laut und fremdartig sein und das Trippeln der Insekten unglaublich kalt, wenn sie sich mühsam durch die Rindenfurchen emporarbeiten oder sich auf den zarten grünen Blattmarkisen sonnen und mit diamantgeschliffenen roten Augen reglos geradeaus starren … Eine Faser nach der anderen reißt unter dem lastenden kalten Erdendruck, bis schließlich der letzte Sturm kommt und selbst die höchsten Äste tief in den Boden zurückfallen. Und doch ist das Leben noch nicht vorbei. Auf der ganzen Welt erwarten den Baum noch Tausende Existenzen voller Geduld und Wachsamkeit, in Schlafstuben, auf Schiffen, auf Gehwegen, in Wohnzimmern, wo Männer und Frauen nach dem Tee eine Zigarette rauchen. So voll friedlicher, voll glücklicher Gedanken steckt dieser Baum, dass ich jeden einzelnen davon genießen möchte – doch etwas gerät mir in den Weg … Wo war ich? Worum ging es hier? Um einen Baum? Einen Fluss? Die Downs? Whitakers Almanach? Die Moorlilienwiesen? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Alles bewegt sich, fällt, entgleitet, verschwindet … Etwas Gewaltiges erhebt sich. Jemand beugt sich über mich und sagt:
»Ich geh eine Zeitung kaufen.«
»Ja?«
»Obwohl das eigentlich sinnlos ist … Es ändert sich eh nie etwas. Verflucht sei dieser Krieg, gottverdammt sei er! … Trotzdem weiß ich nicht, was eine Schnecke bei uns an der Wand zu suchen hat.«
Ah, der Fleck an der Wand! Er war eine Schnecke.
Kew Gardens
An die hundert Stängel streckten sich aus dem ovalen Blumenbeet empor, spreizten auf halbem Weg herz- oder zungenförmiges Blattgrün und öffneten an der Spitze erhaben betupfte rote, blaue oder gelbe Blütenblätter. Dieser roten, blauen oder gelben Glut der Kehle entsprang ein kerzengerader, dick goldbestäubter Griffel samt Blütennarbe. Die Blütenblätter waren groß genug, um sich in der leichten Sommerbrise zu regen, und wenn sie das taten, legten die roten, blauen und gelben Lichter sich übereinander, sodass auf dem Erdenbraun darunter ein unendlich vielschichtiger Farbfleck entstand. Das Licht fiel bald auf den glatten grauen Rücken eines Kiesels, bald auf ein braun geädertes Schneckenhaus oder erfüllte, wenn es in einem Regentropfen landete, die hauchdünne Wasserkuppel mit einem so satten Rot, Blau oder Gelb, dass man glaubte, sie würde davon zerspringen. Stattdessen jedoch blieb der Tropfen schon im nächsten Moment wieder silbergrau zurück, weil das Licht sich jetzt auf das Fleisch eines Blattes legte, die verzweigten Äderchen im Innern zum Vorschein brachte und gleich darauf weiterzog und seinen Schein unter dem weitläufigen Gewölbe des herz- und zungenförmigen Blattgrüns ausbreitete. Als dann die Brise etwas stärker ging, wurde das farbige Leuchten emporgesandt, in die Augen der Männer und Frauen, die im Juli durch die Kew Gardens spazieren.
In einem seltsam unsteten Gang, der dem Zickzack der gaukelnden weißen und blauen Schmetterlinge nicht unähnlich war, streiften die Männer- und Frauengestalten zwischen den Beeten umher. Der Mann schlenderte müßig eine Handbreit vorweg, während die Frau entschlossener vorwärtsstrebte und nur dann und wann den Kopf danach umdrehte, ob die Kinder noch in der Nähe waren. Absichtlich, wenn auch vielleicht unbewusst, hielt der Mann diesen Abstand zur Frau, denn er wollte seine Gedanken fortführen.
»Vor fünfzehn Jahren war ich mit Lily hier«, dachte er. »Wir saßen irgendwo dort an einem See und den ganzen heißen Nachmittag hindurch flehte ich sie an, mich zu heiraten. Wie ausdauernd uns die Libelle umkreiste. Wie deutlich ich das Tier noch sehe, und ihren Schuh mit der viereckigen silbernen Schnalle an der Spitze. Die ganze Zeit, während ich sprach, hatte ich diesen Schuh vor Augen, und als der ungeduldig wippte, wusste ich, ohne aufzusehen, was sie sagen würde – ihr ganzes Wesen schien in diesem Schuh zu stecken. Und meine Liebe, mein Sehnen steckten in der Libelle. Aus irgendeinem Grund glaubte ich, wenn das Tier sich auf dieses Blatt setzte, auf das breite dort mit der roten Blüte in der Mitte, wenn es sich auf das Blatt setzte, dann würde sie sofort ›Ja‹ sagen. Doch die Libelle flog nur immer im Kreis, setzte sich nirgendwo hin – natürlich nicht, zum Glück nicht, denn sonst spazierte ich ja jetzt nicht hier mit Eleanor und den Kindern. Sag, Eleanor, denkst du manchmal an früher?«
»Warum fragst du, Simon?«
»Weil ich an früher gedacht habe. An Lily, die Frau, die ich fast geheiratet hätte … Nun, warum sagst du nichts? Stört es dich, wenn ich an früher denke?«
»Warum sollte es, Simon? Denkt man nicht automatisch an früher in so einem Park, in dem Männer und Frauen unter Bäumen liegen? Sind sie nicht die eigene Vergangenheit, was davon übrig ist, diese Männer und Frauen, diese Geister unter den Bäumen … das eigene Glück, die eigene Wirklichkeit?«
»Für mich sind eine viereckige silberne Schuhschnalle und eine Libelle –«
»Für mich ist es ein Kuss. Denk dir sechs kleine Mädchen vor zwanzig Jahren. Unten am Seeufer sitzen sie vor ihren Leinwänden und malen Seerosen, die ersten roten Seerosen, die ich je gesehen hatte. Und plötzlich ein Kuss, in meinem Nacken. Und den ganzen Nachmittag lang zitterte mir derart die Hand, dass ich nicht malen konnte. Ich nahm meine Uhr aus der Tasche und setzte mir eine Zeit, an der ich mir, für fünf Minuten nur, erlauben würde, an den Kuss zu denken. So kostbar war er, der Kuss einer grauhaarigen alten Frau mit einer Warze auf der Nase – die Mutter aller Küsse meines Lebens. Komm, Caroline. Komm, Hubert.«
Weiter am Blumenbeet entlang gingen sie, jetzt zu viert nebeneinander, und wurden bald zwischen den Bäumen, wo Sonnenlicht und Schatten zitternd über ihre Rücken schwammen, immer kleiner und durchscheinender.
Währenddessen regte sich im Oval des Beetes ganz zaghaft nun die Schnecke in ihrem Haus, das bestimmt zwei Minuten lang rot, blau und gelb gefärbt worden war, streckte den Kopf heraus und begann, über die Erdkrümel hinwegzukriechen, die sich unter ihrer Berührung lösten und fortrollten. Sie schien ein festes Ziel vor Augen zu haben und unterschied sich hierin von dem eigenartigen hageren grünen Insekt, das mit seinen langen Beinen erst ihren Weg kreuzen wollte, dann jedoch mit wie vor Unschlüssigkeit zitternden Fühlern kehrtmachte und ebenso hastig und ungelenk, wie es gekommen war, in die entgegengesetzte Richtung davonstakste. Tiefgrüne Seen zwischen braunen Steilhängen, schmale, klingengleiche Bäume, die sich von der Wurzel bis zur Spitze im Wind bogen, graue Felsbrocken, weite, zerklüftete Ebenen, deren dünner Grund knackend nachgab – all das lag dem Vorankommen der Schnecke zwischen einem Stängel und dem nächsten im Weg. Bevor sie jedoch entschieden hatte, ob sie das vor ihr hochaufragende tote Blatt umkriechen oder ihm die Stirn bieten wollte, kamen weitere Menschenfüße am Beet vorbei.
Diesmal zwei Männer. Die Miene des Jüngeren war auf womöglich künstliche Weise gelassen. Wenn sein Begleiter sprach, hob er den Blick und richtete ihn starr und fest geradeaus, nur um ihn, hatte der andere fertig gesprochen, wieder auf den Boden zu richten und sodann manchmal erst nach einer langen Pause den Mund zu öffnen oder ihn gleich ganz geschlossen zu lassen. Der ältere Mann hingegen bewegte sich auf eine seltsam unstete, schwankende Weise vorwärts, bei der er, fast wie ein ungeduldiges Kutschpferd, das nicht länger vorm Haus warten will, die Hand vorstieß und den Kopf zurückwarf. Doch bei dem Mann hatte dieses Gebaren weder Entschlusskraft noch Ziel. Er redete nahezu unablässig, dann lächelte er und redete weiter, als wäre das Lächeln eine Antwort gewesen. Er redete über die Geister, die Geister der Toten, die ihm, wie er behauptete, sogar hier beim Spaziergang allerlei Sonderbares über ihre Erlebnisse im Himmel erzählten.
»Den alten Griechen, William, galt Thessalien als Himmel, und jetzt rollt wegen dieses Krieges die Geistermaterie dort wie Donner zwischen den Bergen umher.« Er hielt inne, schien zu horchen, lächelte, warf den Kopf zurück und fuhr fort:
»Du nimmst dir eine kleine Batterie und etwas Gummi, um das Kabel zu dämmen – isolieren? – dämmen? – na, lassen wir die Details, bringt ja nichts, von Details zu reden, die keiner versteht – kurzum: Die kleine Maschine platzierst du nach Gutdünken, sagen wir, auf einem hübschen Mahagonigestell, am Kopfende des Bettes. Nachdem die Arbeiter unter meiner Anleitung dann alle nötigen Handgriffe getan haben, legt die Witwe ihr Ohr ans Gerät und ruft den Geist mit dem vereinbarten Zeichen. Frauen! Witwen! Frauen in Schwarz –«
Hier schien sein Blick auf das Kleid einer Frau ein Stück abseits gefallen zu sein, das im Schatten purpurschwarz wirkte. Er nahm den Hut ab, legte die Hand aufs Herz und machte Anstalten, ihr unter hitzigem Murmeln und Gestikulieren entgegenzueilen. Doch William hielt ihn am Ärmel fest und tippte, um die Aufmerksamkeit des Alten auf etwas anderes zu lenken, mit der Spazierstockspitze an eine Blume. Nachdem der Alte sie einen Moment lang verwirrt angeblickt hatte, legte er das Ohr an den Blütenkelch und schien auf eine daraus tönende Stimme zu antworten, denn er begann, über die Wälder Uruguays zu sprechen, die er vor Hunderten Jahren mit der schönsten Frau Europas bereist hatte. Man konnte ihn vor sich hin murmeln hören über die Wälder Uruguays, bedeckt von den wächsernen Blüten tropischer Rosen, über Nachtigallen, Sandstrände, Nixen und ertrunkene Frauen, während er sich von William, dem die stoische Geduld immer deutlicher ins Gesicht geschrieben stand, widerwillig weiterziehen ließ.
Hinter den beiden kamen, nah genug, um von den Gesten des Alten leicht befremdet zu sein, zwei ältere Damen der unteren Mittelschicht daher, die eine dick und behäbig, die andere rotwangig und flink. Wie die meisten Leute ihres Standes waren sie unverblümt fasziniert von allem Exzentrischen, das auf eine Geistesstörung hindeutete, am besten noch bei einem Gutsituierten. Allerdings kamen sie dann doch nicht nah genug, um zu entscheiden, ob diese Gesten noch exzentrisch oder schon wahrhaft irre waren. Nachdem sie den Rücken des alten Mannes einen Augenblick lang schweigend gemustert und einander einen scheelen Blick zugeworfen hatten, gingen sie energischen Schrittes weiter und setzten ihren hochkomplexen Dialog fort:
»Nell, Bert, Lot, Cess, Phil, Pa, er sagt, ich sag, sie sagt, ich sag, ich sag, ich sag –«
»Mein Bert, Sis, Bill, Opa, der alte Mann, Zucker,
Zucker, Mehl, Räucherfisch, Grünzeug,
Zucker, Zucker, Zucker.«
Mit einem seltsamen Ausdruck blickte die Behäbige durch den Vorhang aus fallenden Wörtern auf die kühl, fest und aufrecht in der Erde stehenden Blumen. Sie sah sie wie eine, die aus tiefem Schlaf erwacht und einen Messingkerzenständer auf ungewohnte Weise das Licht reflektieren sieht, dann die Augen schließt und öffnet, wieder den Kerzenständer sieht und, mit einem Mal hellwach, ihn mit ganzer Kraft anstarrt. Wie angewurzelt blieb die schwere Frau vor dem ovalen Blumenbeet stehen und tat nicht einmal mehr so, als würde sie der anderen zuhören. Sie stand da, ließ die Wörter auf sich niederregnen, wiegte langsam den Oberkörper vor und zurück und betrachtete die Blumen. Dann schlug sie vor, dass man sich langsam ein Plätzchen für die Teepause suchen könnte.
In der Zwischenzeit hatte die Schnecke sämtliche Möglichkeiten erwogen, wie sie an ihr Ziel gelangen konnte, ohne um das tote Blatt herum- oder darüber hinwegzukriechen. Denn ganz zu schweigen von der Anstrengung, die das Erklettern eines Blatts bedeutete, sie bezweifelte auch, dass dieses morsche Exemplar, das schon beim leichten Antippen mit dem Fühler unter verdächtigem Knistern ins Beben geriet, ihr Gewicht tragen würde. Und dies bewog sie nun schließlich dazu, einfach unter dem Blatt hindurchzukriechen, da es sich an einer Stelle hoch genug wölbte, um sie einzulassen. Gerade hatte sie den Kopf in die Öffnung geschoben, einen prüfenden Blick auf das braune Dach hoch über ihr geworfen und sich an das kühlbraune Licht gewöhnt, als draußen auf dem Rasen zwei weitere Leute vorbeigingen. Diesmal waren sie beide jung, ein junger Mann und eine junge Frau. Beide befanden sich in der Blüte der Jugend oder gar in jener Jahreszeit, die der Blüte der Jugend vorausgeht, jener Zeit, da die weichen pinken Blütenblätter ihre versiegelte Kapsel noch nicht gesprengt haben, da die Flügel des Schmetterlings zwar schon ausgewachsen sind, aber noch unbewegt in der Sonne verharren.
»Zum Glück ist heute nicht Freitag«, stellte er fest.
»Warum? Bist du abergläubisch?«
»Freitags muss man sechs Pence bezahlen.«
»Was sind schon sechs Pence? Ist dir das hier keine sechs Pence wert?«
»›Das hier‹? Was meinst du mit ›das hier‹?«
»Ach, einfach alles, ich meine, du weißt, was ich meine.«
Lange Pausen entstanden jeweils zwischen diesen Bemerkungen, die mit ausdrucks- und tonlosen Stimmen geäußert wurden. Das Paar blieb am Beetrand stehen, dann bohrten die beiden gemeinsam das Ende ihres Sonnenschirms tief in die weiche Erde. Dies und der Umstand, dass seine Hand dabei auf ihrer lag, drückten auf eine seltsame Art ihre Gefühle aus, so wie auch die knappen, unbedeutenden Worte etwas ausdrückten, Worte mit für ihre Bedeutungsschwere zu kurzen Flügeln, die sie nicht weit zu tragen vermochten, sodass sie recht ungelenk auf den ganz gewöhnlichen und doch, für ihre ungeübte Berührung, so gewaltigen Dingen um sie her landeten. Aber wer weiß schon (so dachten sie, während sie den Sonnenschirm in die Erde bohrten), ob diese Dinge nicht Abgründe bargen oder ob nicht auf ihrer anderen Seite Eishänge in der Sonne glitzerten. Wer weiß? Wer hat es je gesehen? Selbst als sie bloß laut überlegte, welche Sorte Tee sie einem in Kew wohl servierten, hatte er den Eindruck, dass hinter ihren Worten breit und massiv etwas lauerte. Und dann lichtete der Nebel sich langsam und gab den Blick frei auf – o Himmel, was kam dort zum Vorschein? – weiße Tischchen und Kellnerinnen, die erst sie, dann ihn anschauten. Und eine Rechnung, die er mit einer echten Zweishillingmünze bezahlen würde, und diese Münze war echt, waschecht, so versicherte er sich und befühlte das Geldstück in seiner Tasche, echt für jeden, außer für ihn und für sie. Wobei es sich sogar für ihn langsam echt anfühlte. Und dann … Doch es war zu aufregend, dort weiter zu stehen und nachzudenken, also zog er den Sonnenschirm mit einem Ruck aus der Erde und konnte es kaum erwarten, dorthin zu kommen, wo man mit anderen Leuten, wie andere Leute, Tee trank.
»Komm, Trissie, es wird Zeit für unsern Tee.«
»Aber wo trinkt man denn hier seinen Tee?«, fragte sie mit vor Aufregung ganz seltsam kieksender Stimme, blickte unentschlossen umher, ließ sich weiter den Rasenpfad entlangzerren, schleifte den Sonnenschirm hinter sich drein, wandte den Kopf bald nach hier, bald nach dort, vergaß ihren Tee, wollte bald diesen, bald jenen Weg nehmen, erinnerte sich an Orchideen und an Kraniche zwischen Wildblumen, an eine chinesische Pagode und einen Vogel mit blutrotem Federkamm, doch er zog sie weiter.
So streifte ein Paar nach dem anderen mit der nahezu immer gleichen unsteten und ziellosen Gangart an dem Blumenbeet vorbei und wurde in Schicht um Schicht aus grünblauem Dunst gehüllt, worin ihre Körper erst noch Substanz und einen Schuss Farbe besaßen, ehe sich beides in dem Grünblau auflöste. Wie heiß es war! So heiß, dass selbst die Drossel es vorzog, mit langen Pausen zwischen einer Bewegung und der nächsten wie ein Aufziehvogel durch den Schatten der Blumen zu hüpfen. Statt weiter umherzugaukeln, tanzten die Schmetterlinge einer über dem anderen und bildeten über den größten Blumen im Beet mit ihrem schneeweißen Flockengestöber den Umriss einer geborstenen Marmorsäule. Die Glasdächer des Palmenhauses schimmerten, als wäre in der Sonne ein ganzer Marktplatz aus glänzend grünen Regenschirmen aufgeklappt, und im fernen Flugzeuggedröhn raunte die wilde Seele des Sommerhimmels. Gelb und Schwarz, Pink und Schneeweiß – Gestalten in all diesen Farben, Männer, Frauen und Kinder waren einen Augenblick lang am Horizont auszumachen, bevor sie, angesichts der gelben Weite, die auf dem Gras lag, zögerten und unter den Bäumen Schatten suchten, wo sie wie Wassertropfen im gelbgrünen Dunst zergingen und ihn nur sacht rot und blau färbten. Es schien, als wären all die plumpen, schweren Körper in der Hitze niedergesunken und lägen nun regungslos dicht gedrängt da, bloß ihre Stimmen flackerten noch über ihnen, als taumelten Flammen über den zähwächsernen Leibern von Kerzen. Stimmen. Ja, Stimmen. Wortlose Stimmen, die jäh die Stille durchbrachen mit tiefer Zufriedenheit, mit feurigem Sehnen oder, im Fall der Kinderstimmen, mit taufrischer Überraschung. Die Stille durchbrachen? Es gab ja hier gar keine Stille. Die ganze Zeit rollten die Reifen und schalteten die Gänge der Omnibusse. Wie ein gewaltiger Satz stahlblecherner Schachteln, die, ineinandergestapelt, unablässig sich drehten – so klang das Gemurmel der Stadt. Darüber hin gellten die Stimmen, und die Myriaden von Blütenblättern sandten ihr farbiges Leuchten empor.
Feste Gegenstände
Das Einzige, was sich auf dem weiten Halbkreis des Strandes bewegte, war ein kleiner schwarzer Punkt. Während er sich Rippen und Rückgrat des gestrandeten Sardinenfischerboots näherte, wurde durch eine gewisse Durchlässigkeit der Schwärze erkennbar, dass dieser Punkt vier Beine besaß. Und mit jedem Augenblick wurde klarer, dass er aus den Gestalten zweier junger Männer bestand. Auch zeugte die Art, wie sich ihre Umrisse vom Strand abhoben, von einer unverkennbaren Lebhaftigkeit, einem unbestimmbaren Schwung im, wenn auch nur schwachen, Vor und Zurück ihrer Körper, der darauf hindeutete, dass den winzigen Mündern in den kleinen Kugelköpfen eine heftige Diskussion entsprang. Erhärtet wurde dieser Eindruck bei genauerem Hinsehen durch das rhythmische Vorschnellen eines Spazierstocks rechter Hand. »Du willst mir also erzählen … Glaubst du wirklich, dass …«, so schien der Spazierstock rechter Hand neben den Wellen energisch vorzubringen, während er lange schnurgerade Striche in den Sand kerbte.
»Verdammt sei die Politik!«, tönte es deutlich von dem Umriss linker Hand, und während derlei Worte gesprochen wurden, gewannen die Münder, Nasen, Kinne, Schnurrbärtchen, Tweedmützen, Raulederstiefel, Jagdmäntel und karierten Socken der Sprechenden immer mehr an Deutlichkeit. Der Rauch ihrer Pfeifen stieg in die Luft. Auf meilenlanger, schier endloser Weite aus See und Sand gab es nichts Festeres, Lebendigeres, Härteres, Röteres, Haarigeres und Männlicheres als diese beiden Gestalten.
Neben den sechs Rippen und dem Rückgrat des schwarzen Fischerboots ließen sie sich in den Sand fallen. Man kennt das: wie der Körper einen Streit abzuschütteln und für eine gewisse Hitzigkeit um Entschuldigung zu bitten scheint, wie er im Sichfallenlassen, im Betonen seiner Schlaffheit die Bereitschaft ausdrückt, etwas Neues aufzugreifen – was immer sich eben gerade anbietet. Deswegen begann Charles, dessen Spazierstock rund einen Kilometer lang den Strand aufgeschlitzt hatte, flache Schiefersteine übers Wasser springen zu lassen, und John, der »Verdammt sei die Politik!« ausgerufen hatte, machte sich daran, seine Hand in den Sand zu bohren. Während er dabei immer tiefer kam, bis übers Handgelenk und noch weiter, sodass er den Ärmel ein Stück hochschieben musste, verließ die Eindringlichkeit oder vielmehr der Hintergrund aus Überlegung und Erfahrung, der erwachsenen Augen diese unergründliche Tiefe gibt, seinen Blick und hinterließ nichts als die klare, durchlässige, reines Staunen bekundende Oberfläche, die man von Kinderaugen kennt. Sicher hatte das Wühlen im Sand etwas damit zu tun. Er erinnerte sich daran, dass, wenn man erst einmal lange genug gegraben hat, sich zwischen den Fingerspitzen das Wasser sammelt. Aus dem Loch wird so wahlweise ein Burggraben, ein Brunnen, eine Quelle, ein Geheimgang zum Meer. Während er noch darüber nachdachte, wofür er sich entscheiden sollte, trafen seine Finger im Wasser auf etwas Hartes, schlossen sich um einen prallen Tropfen von etwas Festem, den sie aus seiner Position lösten und in Gestalt eines unregelmäßigen Brockens ans Tageslicht beförderten. Nachdem die Sandschicht abgerieben war, kam ein grünlicher Farbton zum Vorschein. Der Brocken war ein Stück Glas, so dick, dass man fast nicht hindurchsehen konnte. Das Meer hatte Ecken und Kanten so stark geglättet, dass unmöglich zu sagen war, ob es einst als Flasche, Becher oder Fensterscheibe gedient hatte. Er war reines Glas. Fast schon ein Edelstein. Man müsste ihn nur in Gold fassen oder mit einer Öse versehen, schon würde aus ihm ein Schmuckstück. Der Anhänger einer Halskette oder das mattgrüne Schimmern an einem Finger. Vielleicht war er sogar tatsächlich ein Edelstein, etwas, das eine dunkle Prinzessin im Heck eines Bootes getragen hatte, während sie, dem Gesang der Sklaven lauschend, die sie durch die Bucht ruderten, die Hand ins Wasser hängen ließ. Oder die Eichenwände einer versunkenen elisabethanischen Schatztruhe waren geborsten, und die Smaragde, immer wieder und wieder und wieder vom Wellengang überrollt, hatten schließlich den Strand erreicht. John drehte und wendete ihn, hielt ihn bald ins Licht, bald so, dass die unregelmäßige Form den Leib seines Freundes samt ausgestrecktem Arm verdeckte. Das Grün wurde blasser oder kräftiger, je nachdem, ob man es gegen den Himmel oder den Körper hielt. Das Glasstück gefiel ihm, verblüffte ihn. Es war so hart, so konzentriert, ein so fest umrissener Gegenstand im Vergleich zu der dunstigen See und der diesigen Küste.
Da störte ihn ein Seufzer – ein tiefer, abschließender, der ihm bewusst machte, dass sein Freund Charles alle flachen Steine in Reichweite geworfen hatte oder zu dem Schluss gelangt war, dass weiterzuwerfen sich nicht lohnte. Seite an Seite aßen sie ihre Sandwiches. Nachdem sie aufgegessen, die Krümel abgeschüttelt und sich erhoben hatten, nahm John wieder das Glasstück in die Hand und betrachtete es schweigend. Auch Charles betrachtete es. Doch er sah sofort, dass es nicht flach war, und während er seine Pfeife stopfte, sagte er mit dem Schwung, der einen törichten Gedankengang fortwischt:
»Was ich vorhin meinte –«
Er sah nicht, oder falls doch, so bemerkte er es wohl kaum, dass John, nachdem er das Glasstück noch einen Moment länger betrachtet hatte, es auf eine zögernde Art in die Tasche gleiten ließ. Auch dieser Impuls mag der eines Kindes gewesen sein, eines Kindes, das auf einer mit Kieselsteinen übersäten Straße einen von ihnen aufhebt, ihm ein Leben voll Wärme und Sicherheit auf dem Kaminsims seines Zimmers verspricht, sich dabei in dem Gefühl von Macht und Güte sonnt, das eine solche Tat mit sich bringt, und das Herz des Steins springen zu fühlen glaubt vor Freude darüber, sich unter Tausenden auserwählt zu sehen und statt eines Daseins in Kälte und Nässe auf der Chaussee dieser Glückseligkeit teilhaftig zu werden. »Wie schnell hätte es einer der Tausenden anderen Steine werden können? Aber nein, ich, ich, ich bin es geworden!«
Ob John dies nun dachte oder nicht, das Glasstück fand seinen Platz auf dem Kaminsims, wo es, schwer auf einem kleinen Stapel Rechnungen und Korrespondenz liegend, nicht nur einen hervorragenden Briefbeschwerer abgab, sondern auch dem von der Buchseite abschweifenden Blick des jungen Mannes als natürlicher Haltepunkt diente. Wird ein Gegenstand immer wieder halb unbewusst von einem Verstand wahrgenommen, der eigentlich an etwas anderes denkt, dann verschmilzt dieser Gegenstand so untrennbar mit dem Gedankenmaterial, dass er seine ursprüngliche Form verliert und sich, leicht verändert, neu zusammenfügt zu einem idealen Gebilde, das uns, wenn wir es am wenigsten erwarten, urplötzlich in den Sinn kommt. So fühlte sich John beim Spazierengehen auf einmal von Trödelläden angezogen, bloß weil etwas im Schaufenster ihn an das Glasstück erinnerte. Das konnte alles Mögliche sein, solange es nur ein mehr oder weniger runder Gegenstand war, der vielleicht eine ersterbende Flamme tief im Innern trug, alles Mögliche eben – Porzellan, Glas, Bernstein, Fels, Marmor – selbst das glatte Oval eines prähistorischen Vogeleis genügte. Auch gewöhnte John sich an, den Blick auf den Boden zu richten, besonders auf Brachflächen, wo die Haushalte sich ihres Abfalls entledigen. Dort gab es oft solche Gegenstände – verworfen, niemandem nützlich, unförmig, abgelegt. Binnen weniger Monate hatte er vier oder fünf Exemplare beisammen, die ihren Platz auf dem Kaminsims einnahmen. Dort waren sie auch wieder von Nutzen, denn ein Parlamentskandidat an der Schwelle zum Erfolg hat jede Menge Papiere in Ordnung zu halten – Wahlreden, Grundsatzerklärungen, Mitgliedschaftsangebote, Dinnereinladungen und so weiter.
Eines Tages, als John sich eilig von seiner Wohnung im Temple-Bezirk auf den Weg zum Zug machte, um zu einer Ansprache an seine Wähler zu fahren, blieb sein Blick an einem bemerkenswerten Gegenstand hängen, der halb versteckt auf einem dieser schmalen Rasenstreifen rings um die Grundmauern imposanter Gerichtsgebäude lag. Wegen des Zauns konnte John ihn nur mit der Spazierstockspitze erreichen. Trotzdem sah er sofort, dass es sich um ein höchst außergewöhnlich geformtes Stück Porzellan handelte, das am ehesten einem Seestern ähnelte, denn ob nun gestaltet oder durch Bruch, es wies fünf unregelmäßige, aber unverkennbare Spitzen auf. Der Farbdekor war hauptsächlich blau, doch über dem Blau lagen grüne Streifen oder Punkte, und einige blutrote Linien verliehen ihm satteste Intensität und herrlichsten Glanz. John war entschlossen, das Stück an sich zu bringen. Aber je mehr er herumstocherte, umso weiter entglitt es ihm. Letzten Endes musste er in seine Wohnung zurück und notdürftig einen Drahtring am Stockende befestigen, mit dem er, vermöge größter Vorsicht und Kunstfertigkeit, das Porzellanstück schließlich in Reichweite zog. Als er es ergriff, entfuhr ihm ein Jubelschrei. Im selben Moment schlug die Uhr. Es war ausgeschlossen, dass er seinen Termin würde einhalten können. Das Treffen fand ohne ihn statt. Doch wie war das Porzellanstück in diese einzigartige Form gebrochen? Eine eingehende Betrachtung ließ keinen Zweifel daran, dass seine Sternform durch Zufall entstanden und es daher so außergewöhnlich war, dass einem wohl kaum je ein zweites unterkäme. Wie ein Wesen aus einer anderen Welt sah es aus, dort am Rand des Kaminsimses, ganz gegenüber dem aus dem Sand gegrabenen Glasstück – kurios und verrückt wie ein Harlekin. Schien in Pirouetten durchs All zu tanzen, blinkend wie ein launenhafter Stern. Der Kontrast zwischen dem so lebendigen, munteren Porzellan und dem Glas, das so stumm und nachdenklich war, faszinierte John, und staunend, versonnen fragte er sich, wie die beiden auf derselben Welt, ja sogar im selben Zimmer auf demselben Stück Marmor existieren konnten. Die Frage blieb ohne Antwort.
Hiernach suchte John immer häufiger Orte und Plätze auf, die an zerbrochenem Porzellan besonders reich sind, wie etwa Brachflächen zwischen Gleisbetten, Abrissgrundstücke und Dorfanger in Londons Umgebung. Doch kaum je wird Porzellan aus großer Höhe geworfen, derlei ist eine Seltenheit unter den menschlichen Handlungen. Man muss zum einen ein ausreichend hohes Haus finden und zum anderen eine Frau, die heißblütig und rücksichtslos genug ist, um ihren Krug oder Topf ohne jedweden Gedanken an die Menschen unten aus dem Fenster zu schleudern. Zerbrochenes Porzellan gab es zuhauf, nur zeugte es eben nicht von Gestaltung und Vorsatz, sondern bloß von irgendeinem nichtigen Haushaltsunfall. Trotzdem staunte John oft, je eingehender er sich mit der Sache befasste, über die vielfältigen Formen, die allein schon in London zu finden waren, und die verschiedenen Qualitäten und Muster boten sogar noch mehr Anlass zu Spekulation und Verwunderung. Die erlesensten Exemplare nahm er mit nach Hause und stellte sie auf den Kaminsims, wo ihre Bestimmung allerdings mehr und mehr dekorativer Natur war, weil die Papiere, die einer Beschwerung bedurften, rarer und rarer wurden.
Vielleicht vernachlässigte er seine Pflichten zu sehr, kam ihnen zu geistesabwesend nach, oder sein Kaminsims blieb den Wählern, die ihn besuchten, zu ungut in Erinnerung. Jedenfalls wählten sie ihn nicht zu ihrem Vertreter im Parlament, und als Charles, den das sehr mitnahm und der sich rasch auf den Weg machte, um dem Freund in dieser Katastrophe beizustehen, John in gänzlich ungerührtem Zustand vorfand, konnte er nichts anderes schlussfolgern, als dass etwas so Schwerwiegendes wohl nur allmählich verarbeitet wurde.
In Wahrheit war John an dem Tag nach Barnes gefahren und hatte dort auf dem Anger unter einem Ginsterbusch ein äußerst bemerkenswertes Stück Eisen gefunden, einen fast ebenso runden Klumpen wie das Glasstück, nur war das Eisenstück so kalt, massig, schwarz und metallisch, dass es sicher nicht von der Erde, sondern von einem toten Stern stammte oder gar selbst ein verkohlter Mond war. Schwer lag es John in der Tasche, schwer lag es oben auf dem Kamin, es strahlte Kälte aus. Trotzdem ruhte der Meteorit auf demselben Gesims wie der Glasklumpen und der Porzellanstern.
Während der junge Mann den Blick vom einen zum anderen schweifen ließ, packte ihn das Verlangen, noch prächtigere Gegenstände zu besitzen. Immer verbissener widmete er sich diesem Ziel. Wäre er nicht völlig vom Ehrgeiz und der Überzeugung eingenommen gewesen, dass er eines Tages mit einem Haufen noch gänzlich unberührten Schutts belohnt würde, hätten ihn die erlittenen Enttäuschungen, ganz zu schweigen von der Erschöpfung und dem Spott, sicher die Suche aufgeben lassen. Ausgerüstet mit einer Henkeltasche und einem langen Stab mit verstellbarem Haken, durchwühlte er jeden einzelnen Flecken Erde, harkte emsig unter verfilztem Gestrüpp, stöberte in sämtlichen Gassen und Häuserlücken, wo es, wie er gelernt hatte, oft derlei weggeworfene Gegenstände zu finden gab. Während seine Ansprüche stiegen, sein Geschmack sich an immer weniger erfreute, wuchs die Zahl der Enttäuschungen ins Unermessliche, doch stets lockte ein Schimmer Hoffnung, ein auf interessante Weise zerbrochenes oder gemustertes Stück Porzellan oder Glas ihn weiter vorwärts. So verging Tag um Tag. Er war nicht länger jung. Seine Karriere – also, seine politische – gehörte der Vergangenheit an. Die Leute gaben es auf, ihn zu besuchen. Er war zu schweigsam, als dass es sich gelohnt hätte, ihn zum Dinner einzuladen. Nie verlor er ein Wort über seine großen Ambitionen, weil das Verhalten der anderen deutlich bezeugte, wie wenig sie ihn verstanden.
Gerade lehnte er sich im Sessel zurück und beobachtete Charles dabei, wie er im Takt seiner Rede über das Tun der Regierung Dutzende Male die Gegenstände auf dem Kaminsims anhob und mit Nachdruck wieder absetzte, ohne ihnen auch nur die geringste Beachtung zu schenken.
»Sag mir die Wahrheit, John«, verlangte Charles plötzlich und drehte sich zu ihm um. »Warum hast du alles von heute auf morgen hingeworfen?«
»Ich habe nichts hingeworfen«, antwortete John.
»Aber dir bleibt doch nicht mal mehr der Hauch einer Chance«, erwiderte Charles schroff.
»Das sehe ich anders«, sagte John voller Überzeugung. Charles sah ihn an und fühlte sich äußerst unwohl. Ihn überkamen mächtige Zweifel und der ungute Eindruck, dass sie nicht über das Gleiche sprachen. Um seine schreckliche Niedergeschlagenheit zu vertreiben, ließ er den Blick durchs Zimmer wandern, doch die Unordnung deprimierte ihn noch umso mehr. Was hatte es mit diesem Stock und der abgewetzten Reisetasche dort an der Wand auf sich? Und mit all diesen Steinen? Als sein Blick schließlich Johns traf, erschreckte ihn etwas Starres und Fernes darin. Ihm wurde nur allzu bewusst, wie sehr es außer Frage stand, dass dieser Mann eine Rednerbühne auch nur betrat.
»Hübsche Steine«, sagte er so fröhlich, wie er konnte. Und mit dem Hinweis, dass er eine Verabredung habe, verließ er John – für immer.
Ein ungeschriebener Roman
Dieses Unglück allein reichte aus, dass der Blick einem über den Zeitungsrand glitt und sich auf das Gesicht dieser armen Frau richtete, ein Gesicht, das ohne jenes Unglück nichtssagend war, mit ihm aber nahezu ein Symbol menschlichen Schicksals. Das Leben ist, was sich in den Augen der Menschen zeigt. Das Leben ist, was sie lernen und wessen sie sich, sobald sie es gelernt haben und obgleich sie es zu überspielen trachten, stets bewusst sind. Was das sein soll? Dass das Leben nun einmal so ist, vermutlich. Dort gegenüber fünf Gesichter – erwachsene Gesichter – und in jedem von ihnen das Wissen. Schon sonderbar, wie sehr die Leute sich mühen, es zu verbergen! Wo man hinblickte, Zeichen der Reserviertheit: geschlossene Lippen, beschirmte Augen, ein jeder mit etwas beschäftigt, das das Wissen abstumpfte oder überdeckte. Die eine raucht, der Nächste liest, die Dritte prüft Einträge in einem Notizbuch, der Vierte starrt auf die gerahmte Zugstreckenkarte an der Wand und die Fünfte – das Fürchterliche an der Fünften ist, dass sie gar nichts tut. Nur das Leben ansieht. Ach, aber Sie arme Unglückliche, spielen Sie das Spiel mit – zu unser aller Wohl, verbergen Sie das Wissen!
Als ob sie mich gehört hätte, sah sie auf, regte sich leicht auf ihrem Sitz und seufzte. Sie schien sich gleichzeitig zu entschuldigen und zu sagen: »Wenn Sie wüssten!« Dann sah sie wieder das Leben an. »Aber ich weiß es doch«, versetzte ich lautlos und senkte aus Höflichkeit den Blick in die Times. »Ich weiß das alles. ›Deutschland und die Alliierten schlossen gestern Frieden in Paris – der italienische Regierungschef Signor Nitti – in Doncaster kollidierten ein Passagier- und ein Güterzug …‹ Wir wissen es alle – die Times weiß es –, wir geben nur vor, wir wüssten nichts.« Erneut war mein Blick über den Rand des Papiers gewandert. Sie fröstelte, griff sich jäh in einer seltsamen Bewegung an den Rücken und schüttelte den Kopf. Da tauchte ich zurück in mein großes Lebensbecken. »Egal was«, fuhr ich fort, »Geburten, Tode, Hochzeiten, Hofrundschreiben, die Verhaltensweisen der Vögel, Leonardo da Vinci, der Sandhills-Mord, Löhne und Lebenshaltungskosten – egal was«, wiederholte ich, »es steht alles in der Times!« Aufs Neue schüttelte sie über die Maßen ermattet den Kopf, bis er ihr wie ein müde gewordener Spielzeugkreisel in den Nacken fiel.
Die Times bot keinen Schutz gegen ein Leid wie das ihre. Doch die Gegenwart anderer Menschen verbot ein Gespräch. Am ehesten blieb einem noch, die Zeitung in ein perfektes, straffes, kompaktes Quadrat zu falten, in das selbst das Leben nicht eindringen konnte. Als dies getan war, blickte ich hinter meinem nun schützend erhobenen Schild flüchtig auf. Sie durchbohrte ihn, starrte mir in die Augen, als wollte sie jedes Stäubchen Mut in deren Tiefen zu Lehm verklumpen. Ihr leichtes Zucken reichte schon, um alle Hoffnung abzutun, alle Illusion zu entwerten.
So ratterten wir durch Surrey und über die Grenze nach Sussex. Weil aber auch ich jetzt den Blick auf das Leben richtete, bemerkte ich gar nicht, dass die anderen Reisenden einer nach dem anderen ausgestiegen waren, sodass, abgesehen von dem Leser, nur noch wir zwei im Abteil saßen. Nächste Station: Three Bridges. Langsam rollten wir in den Bahnhof und blieben stehen. Würde der Leser uns hier verlassen? Ich betete für beides – und schließlich dafür, dass er blieb. Im selben Moment fuhr er hoch, zerknüllte verächtlich seine Zeitung wie etwas endlich Erledigtes, riss die Tür auf und ließ uns allein.
Die Unglückliche lehnte sich, blass, farblos, ein Stück vor und sprach mich an – sprach von Bahnstationen und Ferien, von Brüdern in Eastbourne und der Jahreszeit, die, ich weiß nicht mehr, eine frühe war oder eine späte. Doch als sie schließlich aus dem Fenster schaute und, wie ich wusste, nichts als das Leben sah, seufzte sie: »Fernbleiben, das ist der Nachteil daran …« Ah, wir näherten uns der Katastrophe. »Meine Schwägerin«, die Bitterkeit in ihrer Stimme war wie Zitrone auf kaltem Stahl, und sie murmelte nicht mir, sondern sich selbst zu: »Unsinn, würde sie sagen – das sagen sie alle«, und zuckte dabei mit dem Rücken, als steckte sie in der Haut eines gerupften Vogels im Geflügelhändlerschaufenster.
»Oh, diese Kuh!«, rief sie so hastig, als hätte der jähe Anblick der großen Holzkuh auf der Weide sie gerade noch rechtzeitig von einer Taktlosigkeit abgehalten. Sie schüttelte sich, machte die gleiche ungelenk-linkische Bewegung wie zuvor – so als würde nach dem Schauder eine Stelle zwischen den Schulterblättern brennen oder jucken – und sah dann wieder wie die unglücklichste Frau der Welt aus, was ich ihr abermals übel nahm, allerdings nun weniger überzeugt, denn falls es einen Grund gäbe und ich ihn erführe, wäre dem Leben das Stigma fortgenommen.
»Schwägerinnen –«, setzte ich an.
Wie um das Wort mit Gift zu bespucken, schürzte sie die Lippen und ließ sie dann so. Wortlos nahm sie ihren Handschuh, lehnte sich vor und rieb derart verbissen an einem Fleck auf der Fensterscheibe herum, als gälte es, etwas für alle Zeit auszulöschen – einen Schmutz, eine unumkehrbare Verunreinigung. Und tatsächlich blieb trotz all ihrer Rubbelei der Fleck, wo er war, und unter dem vom Griff an den Rücken gefolgten Schauder, den ich zu erwarten gelernt hatte, lehnte sie sich wieder zurück. Irgendetwas trieb mich dazu, dass nun ich einen Handschuh aufnahm und an meinem Fenster zu reiben begann. Denn auch dort saß ein kleiner Fleck auf der Scheibe. Auch er blieb trotz aller Rubbelei, wo er war. Und dann durchfuhr mich der Schauder. Ich beugte den Arm und griff mir an den Rücken. Auch meine Haut fühlte sich an wie die klamme Hühnerhaut in der Auslage des Geflügelhändlers. Eine Stelle zwischen den Schulterblättern juckte und störte, schien feuchtkalt und wund. Konnte ich sie erreichen? Verstohlen versuchte ich es. Sie ertappte mich. Ein maßlos ironisches, maßlos leidvolles Lächeln huschte über ihr Gesicht. Doch sie hatte schon gesprochen, ihr Geheimnis schon geteilt, ihr Gift schon weitergegeben, sie würde nichts weiter sagen. Während ich mich in meine Nische drückte, meine Augen gegen die ihren beschirmte und nur noch die Hügel und Senken, die Grau- und Violetttöne der Winterlandschaft sah, las ich unter ihrem Blick ihre Botschaft, entschlüsselte ihr Geheimnis.
Hilda heißt die Schwägerin. Hilda? Hilda? Hilda Marsh, Hilda die Blühende, die Vollbusige, die Matronenhafte. Hilda steht, als die Kutsche hält, an der Tür, in der Hand eine Münze. »Arme Minnie, einer Heuschrecke von Tag zu Tag ähnlicher – im gleichen alten Mantel wie letztes Jahr. Tja, nun, mehr ist heutzutage mit zwei Kindern nicht drin. Lass mal, Minnie, ich mach das schon. Hier, bitte sehr, Kutscher, nein, das zieht bei mir nicht. Rein mit dir, Minnie. Ach was, ich könnte ja sogar dich tragen, also her mit dem Korb!« So gehen sie ins Esszimmer. »Kinder, hier ist Tante Minnie.«
Zögernd senken sich Messer und Gabeln. Beide (Bob und Barbara) rutschen vom Stuhl und strecken hölzern die Hand hin. Dann zurück an den Tisch und zwischen den wiederaufgenommenen Bissen vor sich hin starren. [Wir überspringen: Zierrat, Vorhänge, Porzellanteller mit Kleeblattmuster, gelbe Käserechtecke, weiße Keksquadrate, überspringen, oh, aber Moment! Mitten beim Essen einer dieser Schauder. Bob, mit dem Löffel im Mund, starrt sie an. »Iss deinen Pudding auf, Bob.« Doch Hilda missfällt’s. »Warum zuckt sie so?« Das überspringen wir, das auch, bis wir oben im Flur ankommen. Messinggefasste Stufen. Abgetretenes Linoleum. Aber ja, von der kleinen Schlafkammer aus blickt man weit über Eastbourne! Ein Auf und Ab von Dächern wie stachlige Raupen, bald hierhin, bald dorthin kriechend, rot-gelb gestreift mit blauschwarzer Schieferdeckung.] Jetzt, Minnie, ist die Tür zu. Hilda geht schwerfällig die Treppe hinunter. Du öffnest die Korbschnallen, legst ein dürftiges Nachthemd aufs Bett, stellst einen Kunstpelzpantoffel neben den anderen. Der Spiegel – nein, den meidest du. Methodisches Ablegen der Hutnadeln. Ist vielleicht etwas in der Muscheldose? Du schüttelst sie. Der Perlenstecker, wie letztes Jahr, sonst nichts. Dann schniefen, seufzen, sich ans Fenster setzen. Drei Uhr an einem Dezembernachmittag. Nieselregen. Drunten ein Licht aus dem Dachfenster eines Textilwarenkaufhauses. Ein anderes droben in einem Dienstbotenzimmer – dieses erlischt. So bleibt ihr nichts mehr zum Anschauen. Die Leere eines Augenblicks, dann: Woran denkst du? (Ich linse ums Eck, dass ich sie von vorn sehe. Schläft sie oder tut sie nur so? Woran also würde sie nachmittags um drei am Fenster sitzend denken? An Gesundheit, Geld, Rechnungen, ihren Gott?) Tatsächlich, während Minnie Marsh auf der äußersten Stuhlkante sitzt und über die Dächer Eastbournes blickt, betet sie zu Gott. Schön und gut. Vielleicht reibt sie auch an der Fensterscheibe, wie um Gott besser zu sehen. Doch welchen Gott sieht sie? Wer ist der Gott der Minnie Marsh, der Gott der Hinterhöfe Eastbournes, der Gott des Drei-Uhr-Nachmittags? Auch ich sehe Dächer, den Himmel, aber o weh, dieses Göttersehen! Eher Präsident Kruger als Prinz Albert – mehr kann ich nicht für ihn tun. Ich sehe ihn auf einem Stuhl, eher sitzend als thronend, im schwarzen Gehrock. Eine Wolke oder zwei als Sitzpolster bekomme ich auch noch hin. Und in der Hand, die zwischen Dunstfetzen baumelt, hält er einen Stock, einen Knüppel, richtig? Einen Knüppel, schwarz, dick, dornig. Minnies Gott ist ein brutaler Schinder! Hat er das Jucken, das Zucken und Drücken geschickt? Betet sie deswegen? Es ist der Schmutzfleck der Sünde, an dem sie am Fenster herumreibt. Oh, sie hat ein Verbrechen begangen!
An Verbrechen besteht reiche Auswahl. Im Sommer, wenn es im Wald sirrt und flirrt, stehen dort Glockenblumen. Und dort auf der Lichtung, im Frühling, die Primeln. Ein Abschied, richtig? Vor zwanzig Jahren? Gebrochene Schwüre? Nicht Minnies! Sie war treu. Wie sie ihre Mutter pflegte! Alle Ersparnisse für die Grabsteine. Kränze unter Glas. Narzissen in Krügen. Doch ich schweife ab. Ein Verbrechen … Sie würden sagen, sie könne ihre Trauer nicht loslassen, verdränge ihr Geheimnis – ihr Geschlecht, das würden die Experten sagen. Doch was für ein Humbug, ihr das Thema Geschlecht aufzubürden! Nein, eher so: Als sie vor zwanzig Jahren durch die Straßen von Croydon geht, fallen ihr im Schaufenster eines Textilgeschäfts die violetten, im elektrischen Licht schillernden Haarschleifen ins Auge. Sie zögert, schon nach sechs. Aber wenn sie anschließend nach Hause rennt, kann sie es noch schaffen. Sie schiebt sich durch die gläserne Schwingtür. Gerade ist Schlussverkauf. Die Auslagen quellen von Haarschleifen über. Sie bleibt stehen, zupft an dieser, befühlt jene mit den aufgestickten Rosen. Sie muss sich nicht entscheiden, muss nichts kaufen, und jede Auslage birgt neue Überraschungen. »Wir schließen erst um sieben.« Und dann ist es sieben. Sie hastet, sie hetzt, erreicht das Zuhause, doch zu spät. Die Nachbarn, der Arzt, ihr kleiner Bruder, der Teekessel, verbrüht, Krankenhaus, tot. Oder bloß der Schreck, die Schuld? Ach, die Details sind unwichtig! Das jedenfalls trägt sie mit sich. Den Fleck, das Verbrechen, das zu Sühnende, stets dort zwischen ihren Schulterblättern. »Ja«, scheint sie mir zuzunicken. »Das habe ich getan.«
Ob du es oder was du getan hast, ist mir gleich. Darum geht es mir nicht. Das Schaufenster voller Haarschleifen in Violett – das genügt schon. Ein bisschen billig vielleicht, ein bisschen gewöhnlich, wenn man die reiche Auswahl an Verbrechen bedenkt, doch es sind so viele (noch einmal ums Eck linsen – schläft immer noch oder tut so! – blass, erschöpft, der Mund geschlossen, etwas Eigensinn, mehr, als man denken würde, kein Anzeichen von Geschlechtlichkeit), so viele Verbrechen sind nicht deine, deines war billig, weihevoll nur die Strafe. Denn jetzt öffnet sich die Kirchentür, die harte Betbank empfängt sie, sie kniet auf den braunen Fliesen und – jeden Tag, winters, sommers, abends, morgens (und jetzt gerade) – betet. Und stetig fallen, fallen, fallen ihre Sünden. Auf den Fleck, auf die erhabene, rote, brennende Stelle. Da zuckt sie zusammen. Kleine Jungs zeigen mit dem Finger. »Wie Bob heute beim Essen.« Aber ältere Frauen sind am schlimmsten.
Apropos, du musst jetzt aufhören mit Beten. Präsident Kruger ist in den Wolken versunken – wie verwässert vom Grau eines Aquarellpinsels, mit einem Klecks Schwarz, denn jetzt ist auch die Spitze des Knüppels fort. So läuft es jedes Mal! Kaum hast du ihn erblickt, ihn erspürt, da unterbricht jemand. Diesmal Hilda.





























