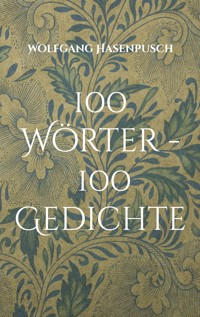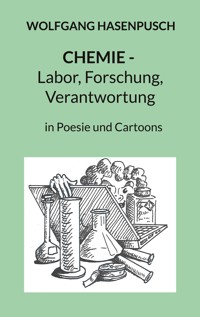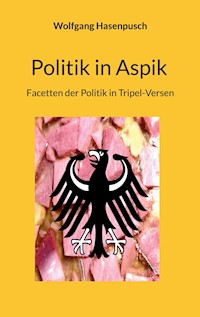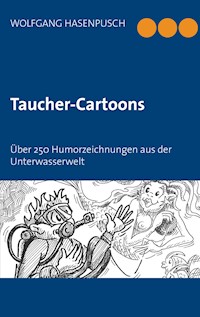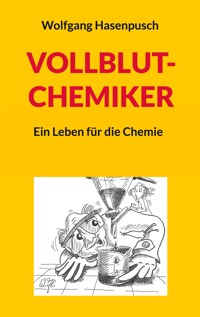
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Autor beschreibt sein Leben als leidenschaftlicher Chemiker, der alles daransetzte, in der Chemischen Industrie den bestmöglichen Einsatz zu zeigen. Aber diverse Ränkespiele in seinem Unternehmen vereitelten das bis fast zur Selbstaufgabe. Doch zahlreiche Zusatz-Begabungen sowie einige Fügungen brachten ihn immer wieder auf die Beine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Einleitung
Die Welt steckt voller Chemie, voller Stoffe, Umwandlungs-Prozesse, voller nie endender Überraschungen. Das durfte ich als 12-Jähriger auf einem Jahrmarkt erfahren: Ein Gaukler faszinierte mich mit seinen zahlreichen, farbig verwandelnden Flüssigkeiten. Ein Krug mit Wasser verfärbte sich beim Umrühren mit einem Stab in Rotwein. Beim Auffüllen mit Wasser verwandelte sich die dunkelrote Flüssigkeit wieder in Wasser. Beim weiteren Zugeben von Wasser in braunen Kaffee, dann wieder in Wasser und schließlich in Milch. Wen kann das kalt lassen?!
Später lernte ich die Zusammenhänge zwischen dem intensiv färbenden Kaliumpermanganat und den Folgereaktionen, bei denen sich mit Säure und Oxalsäure eine farblose Lösung oder mit Lauge eine dem Kaffee ähnliche Braunstein-Suspension herstellen lässt. Mich begeisterte das Farbenspiel der Lösungen in den Karaffen.
So richtete ich mir von da an eine Experimentier-Ecke auf unserem Hausboden ein, direkt vor einem runden Kippfenster, wo ich Kupfersalze löste, die sich mit Kochsalz ins Grüne verfärbten, verschmolz Blei mit Schwefel über einer Kerze oder löste Eisennägel mit Salzsäure zu einer zitronengelben Lösung auf. Zum Geburtstag wünschte ich mir das zweibändige Chemie-Lehrbuch von Heinrich Remy.
Chemie-Bücher in der Stadt-Bibliothek stellten den Beruf des Chemikers als einen dar, der nur den intelligentesten, beflissensten und ausdauernden jungen Menschen vorbehalten bliebe. Nicht gerade ermutigend! Diese gelobten Eigenschaften erschienen mir fremd.
Trotz eines öden Chemie-Unterrichts an der Tafel mit pH-Wert-Berechnungen und Massenwirkungs-Gesetz ließ mich der Wunsch, mehr über Stoffe, ihre Eigenschaften und Verwandlungskünste zu wissen, nicht mehr los. Meinen Eltern, ein eifriger Verwaltungs-Angestellter und eine Försterstochter sowie auch Kriegs-Flüchtlinge aus Königsberg, erschien meine Vorliebe für die Chemie immer unheimlicher. Aber ich erfuhr die bestmögliche Unterstützung. Der Leiter der heimischen Kali- Chemie in Brunsbüttel schwärmte nicht gerade von seinem Beruf als Chemiker, denn er war quasi gezwungen, mehrmals mit der gesamten Familie umzuziehen.
Nach der Qualifikation zum Offizier hätte ich bei der Bundeswehr bleiben können, aber die Leidenschaft zur Chemie steckte noch in mir.
Ein dreimonatiges Industrie-Praktikum bei der Condea in Brunsbüttel, bei dem ich viel lernen konnte und gefördert wurde, verstärkte noch das Gefühl, mit der Chemie meinen Lebensweg zu bestreiten.
Heute gehört es zur Routine, dass Schüler der oberen Klassen in Unternehmen ihre Praktika absolvieren können. Manche Forschungs- und Betriebsleiter geben sich auch richtig große Mühe.
Auch die Wettbewerbe, wie „Jugend forscht“ können junge Menschen für Naturwissenschaften begeistern.
Leider durchlaufen Chemie-Studenten in den ersten Semestern dann diverse Prüfungen, ob sie dieses Fach unter erschwerten Bedingungen auch durchhalten können. Daran scheiterte in meinen Semestern noch gut die Hälfte. Weniger als 2 % der Frauen fühlten sich noch 1969 zu einem Vollzeit-Studium der Chemie an der Christian-Albrecht-Universität in Kiel hingezogen.
Vor allem aber in der Industrie sind Chemiker nach kurzem Aufenthalt in der Forschungs-Abteilung gezwungen, die Chemie in den Hintergrund zu schieben, um Produktionen zu leiten, als Anwendungstechniker durch die Lande zu ziehen, um Probleme mit Firmen-Produkten zu beheben oder nach neuen Anwendungsmöglichkeiten Ausschau zu halten.
Einige Chemiker landen schließlich nach Versetzungen und Auslands-Aufenthalten auf Posten, für die sie völlig überqualifiziert sind. Oder noch schlimmer: Sie bekommen unqualifizierte, eifersüchtige Vorgesetzte, die ihnen das Leben schwer machen.
Viele Unternehmen verfügen nicht über ein effizientes und nachhaltiges Beschwerde-Management, auch wenn sie es behaupten. Um sich aus dem Kreis eines Freiwilds zu befreien, helfen in der Regel nur gerichtliche Schritte, denn auch in den Personalabteilungen dominieren die Juristen.
Ich hoffe, die Chemische Industrie befreit sich eines Tages von der Vettern-Wirtschaft und der bevorzugten Besetzung attraktiver Stellen mit fragwürdigen Verbindungsbrüdern sowie dem Neid gegenüber wahren Leistungsträgern.
Mir haben Sport und Humorzeichnen geholfen, die unfairen Behandlungen und Demütigungen heil zu überstehen.
Kollegen mit weniger Resilienz-Potential suchten die Abgeschiedenheit, den Alkohol oder begingen Dummheiten, die ihr Leben vernichteten.
Über all das wird zu berichten sein. Aber ich beglückwünsche auch all diejenigen Kollegen und Wissenschaftler, die sich in der Chemie ehrlich wie auch fair entfalten konnten und dabei ihr Glück fanden.
Dr. Wolfgang Hasenpusch Hanau,
September 2023
INHALT:
Einleitung
1. Ich will Chemiker werden
1.1 Wie bedeutsam sind Schlüssel-Erlebnisse?
1.2 Warum verleiden Schulen die Chemie?
1.3 Was beeinflusst die Berufswahl zum Chemiker?
2. Chemie: Ein interessantes Studium
3. Auf dem Weg zum Vollblut-Chemiker
3.1 Gymnasialjahre
3.2 Als Decksjunge auf großer Fahrt
3.3 Jugend-Übungsleiter im Schwimmen
3.4 Bundeswehr-Zeit
3.5 Die Zeit als Hochschul-Assistent
4. Meine Probe- und Forschungszeit als Industrie-Chemiker
5. Ab nach Brasilien
6. Wieder zurück in Hanau
7. Betriebsgruppen-Leiter der Edelmetall-Chemie
8. Das Damokles-Schwert der Platin-Allergie
9. Arbeitssicherheit und Explosionsschutz
10. Schulungen und Weiterbildung
11. Die Zeit der Kartell-Aufdeckungen
12. Patent-Unwesen
13. Das Aus als Edelmetall-Chemiker
14. Das Ende einer Edelmetall-Ära
15. Umweltschutz und Arbeitssicherheit
16. Wechsel von Frankfurt nach Hanau
17. Qualvolles „Bossing“
18. Zurück zum Vollblut-Chemiker
19. Denken – Reflektieren – Vergleichen
20. Danksagung
1. Ich will Chemiker werden
Wenn ich auf die Anfänge meines leidenschaftlichen Hangs zur Chemie zurückblicke, fallen mir im Wesentlich drei entscheidende Stationen ein:
Die Versuche auf dem elterlichen Dachboden
Die Zauber-Vorführungen auf dem Jahrmarkt
Das Interesse eines Schulfreundes für Chemie.
Schon lange bevor mich das Fach in der Schule begeisterte, faszinierten mich die Formeln, Chemikalien und farbigen Lösungen. In der städtischen Leihbücherei von Brunsbüttel, dem Ort meiner Jugend, stöberte ich nach Büchern über Chemie und über die erstaunlichen Formen der Kristalle.
Eine Bemerkung aus einem der Lehrbücher habe ich sinngemäß stets im Kopf behalten, ehrfurchtsvoll wie auch nachdenklich:
„Chemiker arbeiten mit äußerster Akribie, zeichnen sich durch geniale Erfindergabe, wie auch durch ein ethisches Verhalten auf höchstem Niveau aus und haben eines der schwierigsten, aufwendigsten und längsten Studienzeiten hinter sich.“ – WOW!
Diese literarische Einschätzung des Chemiker-Berufes hatte mich lange Zeit sehr nachdenklich gestimmt. Sie vermittelte keineswegs eine tiefgehende Begeisterung für die Auseinandersetzung mit der Materie.
Dennoch sammelte ich seit dem zehnten Lebensjahr alle Stoffe und Chemikalien, derer ich habhaft werden konnte. Beispielsweise Essig-Essenz mit 25 %-iger Essigsäure oder 10 %-ige Salzsäure aus der Apotheke.
In Zigarrenkästen verstaute ich alle möglichen Salze und Stoffe, die ich fand: Kalk- und Gips-Kristalle, Kupfer, Aluminium und Blei auf Baustellen, Schwefel und andere Chemikalien am Güterbahnhof.
Als ich mit 14 Jahren das erste Mal in den Sommerferien auf der Brunsbütteler Schleuse als Schiffsjunge anheuerte, wobei mich mein Vater sehr unterstützte, fand ich in den Laderäumen ebenfalls kristalline Substanzen, die der Kapitän mir erklären musste.
Einen Schulkameraden, den Peter Struwe, hatte auch die Faszination der Chemie gepackt. Er verfügte sogar über einen großen Kosmos-Experimentierkasten mit farbigen Chromaten, Chloriden und den Blutlaugensalzen. Auf dem Boden seines Vaterhauses begeisterten uns am meisten die Versuche, bei denen es zischte, qualmte und knallte. Alles natürlich in einem harmlosen Rahmen.
Aber wir erfuhren auch schnell, dass „Unkraut-Ex“, eigentlich technisches Natriumchlorat, gut zum Bau von Raketen und Knallkörpern geeignet ist.
Zum 15. Geburtstag wünschte ich mir ein Chemiebuch. Es war der zweibändige REMY, den ich mir selbst in der Buchhandlung aussuchen durfte. Meine Eltern zeigten sich angesichts eines derartigen Wunsches völlig überfordert. Mein Vater hatte als städtischer Angestellter in Königsberg Verwaltungsrecht gelernt. Seine Abschlussarbeit galt dem Freiherrn vom Stein. Während sich meine Mutter als Tochter eines Revierförsters auf der Hauswirtschaftsschule für ihre Aufgaben als Hausfrau vorbereitete. Chemie und akademisches Denken tauchten in meiner Ahnengallerie nie auf, obwohl Aufzeichnungen bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen.
Ich glaube, es war für meine Eltern auch etwas unheimlich, dass ich derartig fremde, abwegige Leidenschaften entwickelte. Aber sie unterstützten mich nach allen ihren Kräften.
Wie bei dem bekannten Chemiker Justus von Liebig, der von den Drogen und Farben im Geschäft seines Vaters ebenso inspiriert wurde, wie von den Schaustellern auf dem Darmstädter Jahrmarkt, war auch ich fasziniert von dem Farbwechsel der zur Schau gestellten Lösungen auf dem Jahrmarkt in meinem Heimatort.
Es war eines dieser Schicksale, dass einer der Schausteller auf einem Kirmes in Brunsbüttel, wo wir uns Buben stets herumtrieben, nach Sägespäne für seinen Esel-Parcours fragte. Ich führte ihn mit seinem Blockwagen zu einer Tischlerei, die froh war, sich der vielen Späne entledigen zu können. Zum Dank durfte ich hinter die Kulissen des Schaustellers schauen und die Vorstellung am Sonntag gratis besuchen. Das diese Begegnung zu einem Schlüssel-Erlebnis gereichte, wurde mir erst viel später klar.
Selbst beim Abitur, als der Klassenlehrer zu einem „Schlüssel-Erlebnis“ Auskunft haben wollte, hörte ich diesen Begriff das erste Mal bewusst, konnte aber mit keinem aufwarten.
1.1 Wie bedeutsam sind Schlüssel-Erlebnisse?
Mit Schlüssel-Erlebnissen befasst sich die Psychologie: So lassen sich Erlebnisse einordnen, die angelegt erscheinen, die persönliche Eigenart besonders stark anzusprechen und entsprechende Reaktionen auszulösen.
Lebensverändernde Begebenheiten, die emotional besonders belasten oder auch entlasten können, verändern Emotions-Schemata einschneidend, indem sie, bildlich gesprochen so weit gehen können, dass sie einem mehr oder minder überraschend den emotionalen Boden unter den Füßen wegziehen. Die Bedeutung eines Schlüssel-Erlebnisses steht in Beziehung zum individuellen Menschen: Sie liegt nicht in dem Ereignis oder seinem Bedeutungs-Gehalt selbst.
Der deutsche Psychiater Ernst Kretschmer (18881964), der den Begriff des Schlüssel-Erlebnisses einführte, sah darin die besondere Eignung, bei einer Person die gerade für sie charakteristische Reaktion hervorzurufen. Denn sein persönlicher Charakter und das Schlüssel-Erlebnis passen wie Schloss und Schlüssel zusammen.
Die bekanntesten Beispiele für Schlüssel-Erlebnisse mit gravierenden Folgen lassen sich aus der christlichen Religion zitieren: Saulus, der Christen-Verfolger, stürzte auf Grund eines Blitzes vom Pferd und wandelte sich zum Paulus, einem Anwalt und Missionar des christlichen Glaubens. Des Weiteren ist an Martin Luther zu denken, der sich nach einem heftigen, Furcht einflößenden Gewitter von einem lebenslustigen Studenten in einen ernsthaften Mönch wandelte.
Aber auch bekannte Chemiker können mit Schlüssel-Erlebnissen aufwarten, wie die Beispiele von Justus Liebig (1803-1873), Fritz Haber (18681934) und Linus Pauling (1901-1994) zeigen.
Der junge Justus Liebig erhielt seine Vorliebe zur Chemie auf dreierlei Weise:
durch die Materialien, die er in der Werkstatt seines Vaters, einem Drogisten und Farben-Händler, in reichlicher Vielfalt vorfand
durch Vorführungen von Gauklern und Zauberern auf den Jahrmärkten seiner Geburtsstadt Darmstadt
durch seine spektakulären Experimente mit den heiklen Gefahrstoffen „Knallerbsen“, Knallquecksilber [Quecksilberfulminat, Hg(CNO)2] und Knallsilber (Silberfulminat; AgCNO) auf dem Dachboden der Apotheke seines Lehrherrn in Heppenheim.
Diese wegweisenden Begebenheiten reichten aus, selbst den als Apotheker-Lehrling gefeuerten Liebig durch Selbststudium auf die Universität zu bringen. Seinem Chemie-Professor Karl Wilhelm Gottlob Kastner (1783-1857) in Erlangen sowie dem Naturforscher Alexander von Humboldt (17691859) waren die entscheidenden Schritte seiner erfolgreichen Laufbahn zu verdanken.
Bei dem bekannten Chemie-Nobelpreisträger Fritz Haber schien der latente Keim für die Liebe zur Chemie bereits durch den väterlichen Beruf gelegt zu sein. Der Vater, der seinen unbekümmerten Sohn Fritz verächtlich als „gänzlich phantasielosen Geschäftsmann“ bezeichnete, führte ein Handels-Geschäft für Stoffe, Farben, Lacke und Arzneimittel.
Trotz fehlender Chemie-Ausbildung am humanistischen Gymnasium in Breslau sowie einer kaufmännischen Lehre überwog dann doch der Hang zur Chemie. Ab 1886 studierte er in Heidelberg bei Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899) Chemie. Die Chemie Habers war primär die Technische Chemie mit politischer Tragweite, wie sich an der bedeutsamen Ammoniak-Synthese, aber auch an den wahnwitzigen Engagements im Gaskrieg des 1. Weltkrieges sowie an dem gescheiterten Projekt zeigte, die deutschen Reparations-Zahlungen für den Krieg mit dem Gold aus den Weltmeeren begleichen zu wollen.
Von dem doppelten Nobelpreisträger Linus Pauling ist das Schlüssel-Erlebnis für die Chemie überliefert: Während seiner Zeit auf dem Gymnasium freundete er sich mit einem Nachbar-Jungen an, der in seinem Schlafzimmer ein kleines Chemie-Labor einrichten durfte. Die gemeinsamen Experimente, bei denen es brodelte, rauchte und knallte, inspirierten Pauling zu seiner vielseitigen, erfolgreichen Chemie-Karriere.
Auch das Fluidum der väterlichen Apotheke war vielleicht nicht ganz unschuldig bei der Vorliebe für die Chemie.
1.2 Warum verleiden Schulen die Chemie?
Heute fragen sich viele Wirtschafts-Betriebe und Bildungs-Politiker: Warum entscheiden sich so wenige Schul-Abgänger für naturwissenschaftliche Berufe? Und immer wenn ich mich in fachfremden Personen-Kreisen als Chemiker vorstelle, kommen mir Antworten entgegen, wie:
„Oh, das war nicht gerade meine Stärke in der Schule!“ oder
„Wie kann nur Chemie zu einem Lieblings-Fach werden?
Mein damaliger Chemielehrer zeigte sich durchaus engagiert. Aber motivierend aufregende Experimente verlangen vom Dozenten viel Vorbereitung sowie auch den Verbrauch vieler teurer Chemikalien.
Da ist es viel einfacher, an der Tafel ein paar Reaktionen zu formulieren, und das in einer „Formel-Sprache“, auf die kaum didaktisch hingeführt wird.
Wenn dann noch den Schülern Klassenarbeiten aufgenötigt werden, die durchweg zu schlechten Noten führen, darf es keinen verwundern, das Chemie als Schulfach in die Horror-Ecke gerät.
Schlechte Noten verderben den Spaß an der Chemie von Grund auf, denn kein Schüler hat Lust mehr, sich mit dieser bedeutsamen Materie im späteren Leben auseinanderzusetzen. Diese Ignoranz gegenüber der Chemie kann aber nicht nur den Betroffenen schaden, sondern der ganzen Gesellschaft.
Andererseits hängen über Chemielehrern so viele „Damokles-Schwerter“ an Budget-Knappheit, Sicherheit und Aufsichtspflicht, dass sie kaum in der Lage sind, das volle Potential an motivierender Chemie-Erlebnis-Kultur auszuspielen.
1.3 Was beeinflusst die Berufswahl zum Chemiker?
Unter Kommilitonen haben wir uns des Öfteren ausgetauscht und diese Frage gestellt: „Warum hast Du mit dem Chemie-Studium angefangen?“
Die Antworten fielen naturgemäß sehr unterschiedlich aus. Das Motivations-Spektrum reichte von „Das Fach hat keinen Numerus Clausus als Zugangs-Beschränkung!“ bis „Mein Vater ist Chemiker und verdient gutes Geld!“
Ein Kommilitone erschien bereits nach einem Monat im ersten Semester mit einer großen Wunde an der Wange. Er war der schlagenden Verbindung seines Vaters beigetreten und hatte die erste Mensur nicht glimpflich überstanden. Wie sich später zeigen sollte, gelang es dem Vater jedoch, seinen im Studium wenig auffallenden Sohn bis in die höchsten Hierarchie-Ebenen der Chemischen Industrie zu heben.
Einigen Kommilitonen fiel das lange Arbeiten im Experimentier-Saal der Universität schwer, denn der öffnete von 08 bis 18 Uhr seine Tore. Abends kam der Assistent ins Labor und beurteilte die Analysen- und Aufgaben-Ergebnisse. Ein einziges Mal durften wir unsere Analysen-Ergebnisse noch korrigieren, beim nächsten Fehler gab der strenge Assistent eine neue Substanz aus. Aber die alte musste trotzdem mit richtigem Analysen-Ergebnis beendet werden.
Dieses Vorgehen forderte intensive Labor-Arbeit von den Kommilitonen. Denjenigen, denen das zu aufwändig erschien und lieber durch die Stadt bummelten oder Aushilfsjobs annehmen mussten, fehlte die sinnvolle Kontinuität. Sie verzettelten sich zum Teil bis zur Aufgabe ihres Studien- Vorhabens.
Einige schwenkten hinüber zum Höheren Lehramt, andere beließen es beim Grundschullehramt, um mehr Zeit für sich zu haben.
Zudem gab es schon Anfang der 1970-iger Jahre aufgrund des Mangels an naturwissenschaftlichen Lehrkräften an Gymnasien Semester-Prämien: Für Physik 750 DM, für Chemie 500 DM und für Biologie 250 DM.
Lockten noch Ende der 1960-iger Jahre Industrie-Firmen die promovierten Chemiker mit Einstiegs-Prämien von 10.000 DM, verhängten sie bereits einige Jahre später einen bundesweiten Einstellungs-Stopp.
Fernseh-Teams kamen mit ihren Kameras in die Universitäts-Laboratorien, um die Stimmungslage der Studierenden zu erfragen.
Ich befand mich gerade im organischen Praktikum nach dem Vordiplom und schwelgte geradezu von der Chemie, die so viele umwerfende Erkenntnisse für mich bereit hielt. Dem Reporter bekundete ich:
„Die Chemie ist so ein weites, unendlich interessantes Arbeits-Gebiet, das in kaum einer Branche je entbehrlich sein wird!“
Allerdings landete die Hoffnung vieler gut ausgebildeter und promovierter Chemiker ab Ende der 1970-iger Jahre, der Not gehorchend, in mitunter auch schlecht bezahlten Alternativ-Berufen, auf die sie nie freiwillig gesetzt hätten.
Man las in den Medien von akademischen Taxi-Fahrern, frustrierten Chemikern, die noch an Schulen einen Broterwerb fanden oder Kollegen, die sich in ganz anderen Berufen weiderfanden.
Einige von ihnen blieben, den Umständen gehorchend, bei ihren Notlösungen, andere vagabundierten ihr gesamtes Berufsleben von einem Job zum anderen. Von Berufung konnten sie in sich kaum noch etwas spüren.
Dabei ließen sich die arbeitslosen Akademiker doch einst von der Devise leiten:
„Akademiker finden mit Sicherheit Ihren Traumjob in Wissenschaft, Forschung, Öffentliches und Gesellschaft!“
Die Arbeitslosen-Quote unter Akademikern schwankt allgemein zwischen zwei und drei Prozent. In der Zeit von 2011 bis 2023 verweist die Agentur für Arbeit auf einen Stand arbeitsloser Chemiker von 10.000 sowie 15.000 bis 18.000 Arbeitssuchender.
2. Chemie: Ein interessantes Studium
Einen guten Einstieg in die industrielle Chemie ergab sich durch das Industrie-Praktikum als Werkstudent in den Laboratorien der CONDEA in Brunsbüttel. Da meine zweijährige Dienstverpflichtung bei der Bundeswehr Ende Dezember auslief, das Sommersemester jedoch erst im April 1969 begann, galt es, drei lange Monate sinnvoll zu überbrücken.
Bei dem Leiter der Laboratorien, dem Herrn Chemotechniker Schrader, bekam ich Einblicke in die quantitative Gas-Analytik, ins komplexometrische Titrieren von Aluminium wie auch diversen anderen Routine-Bestimmungen. Nach einem Monat durfte ich gar in der Nachtschicht Betriebs-Analysen durchführen, nach denen die Verantwortlichen in den Betrieben ihre Prozesse anpassen konnten.
Die Erfahrungen, die ich dort machen durfte, auch im fairen Miteinander unter den Beschäftigten, prägte in mir ein Vorbild für das zukünftige Berufsleben.
Das erste Semester erschien mir als das bei weitem schwerste. Bis zum Vordiplom galt es in den ersten vier Semestern, die Grundvorlesungen in Chemie, Physik und Physikalische Chemie zu hören. Daneben stand das Labor offen. Zunächst waren nach einem Grundpraktikum unter Zuhilfenahme des Lehrbuches „Einführung in die experimentelle anorganische Chemie“ nach Heinrich Biltz, Wilhelm Klemm und Werner Fischer sowie eines eigens anzuschaffenden Kartons mit Tiegeln, Reagenz- und Bechergläsern sowie auch einem Erlenmeyer-Kolben ganze 35 qualitative Analysen auf Kationen und Anionen durchzuführen.
Wer sie beim Assistenten mit dem zweiten Anlauf nicht korrekt seine Resultate ansagte, bekam eine neue, andere Mischung zu bearbeiten, ohne dass auf das Ergebnis der vorhergehenden verzichtet wurde. So kam es vor, dass Kommilitonen noch bei der fünften und sechsten Analyse der gleichen Zusammensetzung scheiterten.
Der Trennungsgang, wie er im damals gängigen Arbeitsbuch „Einführung in das anorganischchemische Praktikum“ der Hochschullehrer Gerhart Jander und Ewald Blasius vorgeschrieben war, musste schon sorgfältig eingehalten werden, um alle Inhalts-Elemente nach Farbreaktion und spezifischen Fällungen zu finden.
Beliebt waren zunächst die Separations-Analysen, indem bequeme Kollegen die Kristalle der Mischungen unterm Mikroskop zu separieren versuchten. Das klappte aber nur bei den ersten leichteren Analysen-Proben. Eine andere Vorgehensweise bediente sich des „Psycho-Tests“ mit dem Labor-Assistenten, worin einige Studien-Kollegen meisterliche Begabung an den Tag legten:
„Mir war, als fiel etwas schwarzes Blei bei der Sulfid-Fällung.“ Der Assistent schaute in sein Buch, wiegte den Kopf, um nach einer Weile zu bekunden: „Das kann nicht sein. Wiederholen Sie noch einmal den Trennungsgang!“ Und schon war dem gerissenen Chemiker-Aspirant klar, Blei war nicht in seiner Analysen-Probe.
Nach und vor jedem Semester war eine mündliche Prüfung beim Labor-Assistenten abzulegen. Dabei konnten auch allgemeine Themen aus dem „Lehrbuch der Anorganischen Chemie“ nach Arnold Frederik Holleman und Egon Wiberg zur Sprache kommen, so dass ein Lesen und Lernen in den Abendstunden sowie auch an Wochenenden für den eifrigen Studenten unausweichlich blieben.
Mein Vater hatte für mich eine Beihilfe nach dem Bundesausbildungs-Förderungsgesetz, BAFöG, beantragt. Das bedeutete für mich zwar einen monatlichen Zuschuss von 320 DM, aber auch Extra-Prüfungen in jedem Semester bis zum Vordiplom.
Da ich in dem nahe der Universität gelegenen Studenten-Wohnheim, dem Professor-Anschütz-Haus, unterkam, hatte ich bei Bedarf auch immer Gesellschaft.
Morgens um 06:00 bis 7:00 Uhr hatten wir freien Zugang zu den Tennisplätzen. Eine umtriebige Mitbewohnerin und Sportstudentin versuchte mir am frühen Morgen schon das Tennisspielen mit Rückhand und Netz-Konter beizubringen. Aber ich blieb da doch lieber bei meinem studentischen Schwimm-Training, das für die Universitäts-Meisterschaften zweimal in der Woche eine Stunde lang in der städtischen Schwimmhalle in Kiel angeboten wurde. Einmal konnte ich die Norddeutschen Hallen-Meisterschaften im 50 m Freistil mit heute lächerlichen 28,02 Sekunden gewinnen. Als Prämie suchte ich mir von einem Gabentisch, auf dem zum Teil recht wertvolle Sieger-Prämien lagen, einen einfachen Plastik-Fußball aus. Damit konnten wir auf dem Rasen neben dem Studenten-Hochhaus wenigstens bolzen und uns austoben.
Eine der vielen mündlichen Prüfungen flößte mir besonders viel Angst und Schrecken ein. Das war die „Audienz“ bei dem Senior-Professor Robert Juza (1904-1996). Grausame Gerüchte machten die Runde: Er würde das Periodensystem der Elemente in Rössel-Sprüngen abfragen oder sagen: „Schauen Sie aus dem Fenster. Die Bäume sind kahl, wie ihr Wissen. Kommen Sie wieder wenn das Laub dran ist!“
Ich lernte den gesamten Holleman-Wiberg fast auswendig, kannte jede Fußnote, auch die vom Knistersalz aus den Salinen von Wieliczka (Polen).
Dann aber verlief die Prüfung so gut, dass ich mich mit einer Eins aus dem Kolloquium verabschieden konnte. Bei der Juza-Prüfung eine derart gute Note zu bekommen, das war an der Kieler Uni der Ritterschlag zum Chemiker.
Für das Vordiplom folgten weitere Lern-Orgien mit dem „Holleman-Wiberg“, dem „Jander-Blasius“, im Lehrbuch „Grundlagen der analytischen Chemie“ von Fritz Seel (1915-1987) aus Saarbrücken, im „Lehrbuch der organischen Chemie“ von dem Berliner Chemie-Professor Hans Beyer (19051971), sowie die zahlreichen Vorlesungs-Notizen, die ich stets sorgfältig in den Semester-Ferien ausarbeitete und vervollständigte.
Überhaupt hatte ich mir keine der Semester-Vorlesungen, von der ersten bis zur letzten Stunde, entgehen lassen. Mir war schleierhaft, warum sich die Kommilitonen nach den Anfangs-Vorlesungen in die Bibliothek zurückzogen, um dort aus diversen Büchern zu lernen, wo doch alle Dozenten nur aus dem Reservoir ihrer eigenen Vorlesungen auch ihre Prüfungs-Fragen stellten, da ihnen der Stoff aus ihren Vorlesungen noch gegenwärtig war.
Ich fasste den Mut und meldete mich nach vier Semestern zum Vordiplom an. Alle Prüfungen bestand ich hervorragend mit einer Eins.
Überglücklich empfing ich die Urkunde. Meine Eltern zeigten sich ebenfalls ganz stolz. Sahen sie sich doch erleichtert, dass ich den richtigen Weg aus inniger Berufung zur Chemie gewählt hatte.
Zur Belohnung musste ich mir etwas Außerge wöhnliches gönnen. Von meinen Seefahrten als Schiffsjunge sowie aus dem zweijährigen Militärdienst hatte ich noch genügend Geld auf dem Konto.
Kurz entschlossen fragte ich eine Mitbewohnerin im Studenten-Wohnhaus, ob ihr Vater noch einen Platz in seiner Segelschule an der italienischen Adria frei hätte. Drei Tage später begab ich mich mit der Bahn bereits auf den Weg nach Triest und von da aus per Anhalter nach Sistiana, zur Segelschule des Kapitän Pinkepank mit eigener Pension. Wir waren nur acht Teilnehmer. Zwei Lehrerinnen, ein Manager, mit dem ich das Zimmer teilte, ein Apotheker mit mehreren Geschäften aus München, dem Direktor der Münchner Staatsoper, sowie zwei weiteren Herren, an die ich mich nicht mehr erinnere.
Gut habe ich aber noch das Angebot des Opern-Direktors im Gedächtnis, mich in den Münchner Diners-Club aufnehmen zu wollen, nachdem wir gemeinsam eine Regatta in unserer Conger-Jolle gewonnen hatten, sowie auch an den einmaligen und unvergessenen Sonntags-Ausflug nach Venedig und der Glasmacher-Insel Murano.
Der Manager fuhr nach der Segel-Ausbildung fast jeden Tag, und am Wochenende sowieso, zu den Gestüten von Lipizza in Jugoslawien, heute Slowenien. Er hatte sein Reitpferd dort in Obhut gegeben und brachte es fast jeden Tag auf Trab.
Der Groß-Apotheker besuchte zwischendurch halbtageweise Apotheker- und Pharma-Tagungen in der Schweiz, Österreich und Norditalien, um dort kurz seine Teilnahme für die Einkommenssteuer-Erklärung bescheinigen zu lassen.
Die Damen machten kurze Schlüsselerlebnis-Bekanntschaften mit galanten Italienern, die ihnen das Geld schon am ersten Abend aus den Hand-Taschen zogen.
Zurück in Kiel musste ich ein Semester auf den Beginn des Organik-Praktikums im Gattermann-Saal warten. Ich lernte meine spätere Frau, die Annegrete Hamkens, kennen, examinierte OP-Schwester und Tochter aus einem landwirtschaftlichen Anwesen, dem über 200 Jahre alten Leutnantshof im Eiderstädter Uelvesbüll. In diesem Jahr 2023 liegen standesamtliche Trauung in Friedrichstadt und die am Folgetag aufwendig zelebrierte kirchliche Hochzeit in dem historischen Gotteshaus auf einer Uelvesbüller Warft 50 Jahre zurück. Später sollten zwei Söhne, Malte und Boris sowie fünf Buben als Enkel folgen.
Der Hauberg „Leutnantshof“ fiel leider einem Feuer zum Opfer und damit das 1 x 1 m große Ölbild mit dem Portrait meiner Schwiegereltern, das größte Ölgemälde, das ich je angefertigt hatte.
Im Studentenheim, auf dem ersten geschlechtlich gemischten Stockwerk, ging es sehr lustig zu. Jedenfalls mit den meisten Mitbewohnern. Ich erinnere mich noch an zwei Studentinnen, die sich etwas zurückhielten: Eine Germanistin, die durchweg Bücher zu lesen schien, dann und wann aber mal in der Gemeinschaftsküche erschien, um sich zwei Eier zu braten, nie etwas anderes.
Bei der anderen Dame, eine Pharmazie-Studentin, hörte ich aus dem Nebenzimmer immer wieder die traurigen, melancholischen Balladen-Lieder des kanadischen Sängers und Liedschreibers Leonard Cohen (1934-2016). Mitunter sang sie auch selbst zur Gitarre.
Mit auf dem Flur wohnten auch zwei persische Studenten, deren Abitur in Deutschland nicht anerkannt wurde. So hatten sie ein Jahr lang eine Adaptations-Schulung zu durchlaufen. Als einer der beiden, das Jahr wiederholen sollte, war er derart verzweifelt, dass er mich um Unterstützung bat.
Nachdem ich bei dem Oberstudienrat, der für die nachzuholende Reifeprüfung verantwortlich war, vorstellig wurde, konnte ich zumindest eine Wiederholung der Prüfung herausschlagen, die der persische Studenten-Aspirant dann auch bestand und sein Studium in Angriff nehmen konnte.
Mit dem anderen Perser, der später auch Chemie studierte, hatten wir eine Reise nach Helgoland unternommen, die der Allgemeine Studenten-Ausschuss preiswert angeboten hatte.
Ich hörte Vorträge an der Kieler Universität über Kunstgeschichte und beteiligte mich an diversen Exkursionen zu Kirchen sowie zu Architektur-Denkmälern. Als der leitende Kunstgeschichts-Professor Wolfgang Müller von meinem Chemie-Studium erfuhr, stufte er mich als kunstbeflissenen Exoten ein und bot mir an, mich in den Kreis der erlauchten „Studienstiftung des Deutschen Volkes“ einzuführen.
Nach einigen Prüfungen über meine Eignung für diesen Kreis der Hochbegabten geriet ich auch an einen Medizin-Professor als weiteren Aufnahme-Prüfer. Er schien schon pikiert zu sein, dass ich