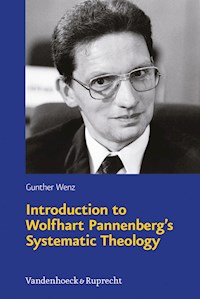Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Studium Systematische Theologie.
- Sprache: Deutsch
Der zehnte und abschließende Band der Reihe "Studium Systematische Theologie" bietet historische und systematische Informationen zur Eschatologie. Nach einer problemorientierten Analyse konfessions- und modernitätsspezifischer Ansätze wird ein Begriff christlicher Glaubensphantasie entwickelt, der als hermeneutischer Schlüssel des Lehrstücks fungieren kann. Inhaltlich wird sodann vom Tod des Einzelmenschen und dem Problem seiner Seelenunsterblichkeit, von der allgemeinen Totenauferstehung und dem Problem ihrer Leiblichkeit, von Gerechtigkeit und Jüngstem Gericht sowie von der Frage gehandelt, wie eschatologisch über Himmel und Hölle sowie die Vorstellung eines purgatorischen Interims zu urteilen ist. Nach Epilegomena zu Nah- und Fernerwartung endet der Band mit einem das Gesamtwerk beschließenden Nachwort zu theologischer Zeitgenossenschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 791
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Studium Systematische Theologie
Band 10
Vandenhoeck & Ruprecht
Gunther Wenz
Vollendung
Eschatologische Perspektiven
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-647-99711-7
Weitere Ausgaben und Online-Angebote sind erhältlich unter: www.v-r.de
© 2015, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, 37073 Göttingen /Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U. S. A.www.v-r.deAlle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlichgeschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällenbedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: textformart, Göttingen | www.text-form-art.de
Inhalt
Einleitung
1.Rechtfertigung im Endgericht. Eschatologie in reformatorischer Tradition
2.Interimslösungen und Zwischenzustände. Drei konfessionsspezifische Paradigmen
3.Kraft der Einbildung. Eschatologie unter neuzeitlichen Bedingungen
4.De novissimis. Zu Begriff und Themenbeständen der Eschatologie
5.Die Zukunft des Gekommenen. Fallstudien zum Verhältnis von „präsentischer“ und „futurischer“ Eschatologie
6.Das Kommen des Gottesreiches und die Parusie Jesu Christi. Biblische Befunde
7.Der Geist der Gerechtigkeit, der Liebe und des ewigen Lebens. Entwicklungstendenzen altkirchlicher Eschatologie
8.Inferno, purgatorio, paradiso: Mittelalterliche Jenseitsszenarien im Anschluss an Dante und Thomas
9.Alt- und neuprotestantische Eschatologie. Die Beispiele Hütter und Schleiermacher
10.Individuelle und universale Eschatologie. Ökumenische Perspektiven
11.Der Tod des Einzelnen und das Problem seiner Seelenunsterblichkeit
12.Die allgemeine Totenauferstehung und das Problem ihrer Leiblichkeit
13.De purgatorio. Gedanken zum Fegfeuer
14.Der Jüngste Tag. Himmel und Hölle
15.Katechon. Epilegomena zu Nah- und Fernerwartung
Nachwort: Theologische Zeitgenossenschaft
Personenregister
Sachregister
Einleitung
Lit.: U. Asendorf, Eschatologie bei Luther, Göttingen 1967. – A. Beutel (Hg.), Luther Handbuch, Tübingen 2005. – M. Brecht, Martin Luther. 1. Bd.: Sein Weg zur Reformation 1483–1521, Stuttgart 31990. – H.-U. Delius (Hg.), Martin Luther Studienausgabe. Bd. 1, Berlin 1979. – F. Gerke, Anfechtung und Sakrament in Luthers Sermon vom Sterben, in: ThBl 13 (1934), 193–204. – H. Junghans, Art. Spalatin, Georg (1484–1545), in: TRE 31, 605–607. – T. Kläden (Hg.), Worauf es letztlich ankommt. Interdisziplinäre Zugänge zur Eschatologie, Freiburg / Basel/Wien 2014. – J. Köstlin, Martin Luther. Sein Leben und seine Schriften. 1. Bd., Berlin 51903. – M. Luther, Werke. Kritische Gesamtausgabe. 2. Bd., Weimar 1884; 23. Bd., Weimar 1901. – Ders., Ausgewählte Schriften. Hg. v. K. Bornkamm/G. Ebeling. 2. Bd.: Erneuerung von Frömmigkeit und Theologie, Frankfurt a.M. 21983. – O.Meuffels, Ein eschatologisches Triptychon. Das Leben angesichts des Todes in christlicher Hoffnung, Tübingen 2012. – R. Mohr, Art. Ars moriendi II. 16.–18. Jahrhundert, in: TRE 4, 149–154. – H. Obendiek, Der Teufel bei Martin Luther. Eine theologische Untersuchung, Berlin 1931. – A. Reinis, Reforming the Art of Dying. The ars moriendi in the German Reformation (1519–1528), Hampshire/Burlington 2007. – C. Resch, Trost im Angesicht des Todes. Frühe reformatorische Anleitungen zur Seelsorge an Kranken und Sterbenden, Tübingen/Basel 2006. – L. Schottroff, Die Bereitung zum Sterben. Studien zu den frühen reformatorischen Sterbebüchern (1960), Göttingen 2012. – R. Schwarz, Luther, Göttingen 21998.
Anfang Mai l519 erreichte Martin Luther durch Vermittlung des aus dem fränkischen Spalt stammenden kursächsischen Kanzleisekretärs Georg Spalatin (vgl. Junghans) die Bitte eines Rates am Hofe Friedrichs des Weisen namens Marx (Markus) Schart um eine Schrift zur christlichen Vorbereitung auf den Tod (vgl. im Einzelnen Delius [Hg.], 230 f.). Luther, noch keine vierzig Jahre alt und im Begriff, zum Reformator der Kirche zu werden (vgl. Schwarz, 76 ff.), hatte damals viel zu tun und entsprechend wenig Zeit. So musste sich Schart gedulden; er erhielt eine Absage bzw. wurde auf später vertröstet. Erst als sich im Frühherbst des Jahres bei ihm wieder etwas Muße einstellte, entwarf Luther nach eigenem Zeugnis sehr eilig einen „Sermon von der Bereitung zum Sterben“ (WA 2, 680–697), „sandte ihn handschriftlich dem Spalatin zur Durchsicht und gab ihn alsdann in die Presse. Am 1. November konnte er die ersten gedruckten Exemplare verschicken: eins derselben versah er mit eigenhändiger Widmung an Schart.“ (WA 2,680) Die Schrift fand reißenden Absatz und wurde schon im nächsten Jahr ins Lateinische, zudem ins Dänische und Niederländische übersetzt. In modernes Deutsch übertragen findet sich der Text u. a. in: M. Luther, Ausgewählte Schriften. Hg. v. K. Bornkamm / G. Ebeling. 2. Bd.: Erneuerung von Frömmigkeit und Theologie, Frankfurt a. Main 21983, 15–34; danach wird im Folgenden zitiert.
Der „ganz für Laien“ (Köstlin, 281) bestimmte Sermon gehört in die Reihe behutsamer „Vorschläge zur Neugestaltung der Frömmigkeit“ (Brecht, 335). Er „steht in der Tradition der ars moriendi, die Anleitungen zu einem seligen Sterben und Sterbenstrostbücher bereitstellt, die als reine Textbücher oder auch als Bilderfolgen mit einem weitgehend normierten Programm im späteren Mittelalter sehr beliebt waren“ (Beutel [Hg.], 300). Zahllose Exemplare dieser Literaturgattung sind aus der Zeit überliefert. Ihr Ziel ist es, mahnend und erbauend auf die letzte Stunde vorzubereiten und in die Sterbekunst einzuüben, damit der Tod den Menschen nicht unvorbereitet ereile. Auch zu seelsorgerlicher Sterbehilfe und Beistand durch Priester und Nahestehende rufen sie auf. Neben Unterweisungen für den Kranken enthalten sie Mahnungen und Ratschläge, wie ihm in der Zeit des Todeskampfes beizustehen und zu helfen sei. Nicht selten waren die Anleitungen zur Kunst des seligen Sterbens mit Holzschnitten versehen, die anschaulich machten, was im Buch zu lesen stand.
ars moriendi
Auch Luthers Sermon, der auf seine Weise die mittelalterliche ars moriendi-Tradition fortführt (vgl. Resch, 53 ff.), ist trotz des Fehlens visueller Illustrationen sehr bildnah gestaltet. Doch statt äußeres Anschauungsmaterial zu bieten, richten seine Sprachbilder den Blick auf eine innere Schau aus, weil dasjenige, was im Sterben geschieht, das Innere des Menschen noch weitaus mehr angeht als sein Äußeres, so heftig auch dieses betroffen ist (vgl. Meuffels). Als ein hermeneutischer Schlüssel zum Verständnis des Sermons mag der Hinweis dienen, dass Luther „die Sterbestunde als exemplarisch für die Existenz des Menschen vor Gott“ (Mohr, 149) betrachtet hat. Zwar ist das Lebensende beispiellos, sofern es mit nichts zu vergleichen ist, was ihm vorherging; doch tritt gerade darin die einzigartige Stellung des Menschen vor Gott in seiner unteilbaren Individualität und Einmaligkeit beispielhaft zutage (vgl. Asendorf).
Der Ausgang des Lebens ist einer engen Pforte und einem schmalen Steig zu vergleichen. Enge erzeugt Angst; Abgründe tun sich auf, die Schwindel erregen. Umkehr und Rückkehr sind unmöglich. Alles droht ins Bodenlose zu versinken. Die Lage erscheint als aussichtslos. Auf Empfindungen dieser Art muss sich Luther zufolge jeder gefasst machen, dem der Tod bevorsteht. Sterben ist kein Leichtes, sondern kommt den Menschen hart und bitter an. Der nahende Tod bereitet ein Schwitzbad und frostiges Erschauern; der Teufel macht dem Sterbenden die Hölle heiß und lässt zugleich sein Herz erkalten. Es ist schlimm! Die Bibel leugnet die Schrecklichkeit des Todes mit keinem Wort, und die Psalmisten wissen, was es heißt, von Todesbanden umfangen und von höllischen Stricken gebunden zu sein (vgl. Ps 18,5 f.). Das gilt auch für Luther, den frommen Leser und kundigen Übersetzer der Hl. Schrift: „Da mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott.“ (Ps 18,7) „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich heule; aber meine Hilfe ist ferne.“ (Ps 22,2)
Der Ausstieg aus dem irdischen Leben ist schmal und die Pforte des Todes eng, „fast enge“ (WA 2,685,23), sehr eng. Aber der Todesgang ist „nit langk“ (WA 2,685,24): „Und es geht hier zu, wie wenn ein Kind aus der kleinen Wohnung in seiner Mutter Leib mit Gefahr und Ängsten geboren wird in diesen weiten Himmel und Erde, das ist unsere Welt: ebenso geht der Mensch durch die enge Pforte des Todes aus diesem Leben. Und obwohl der Himmel und die Welt, darin wir jetzt leben, als groß und weit angesehen werden, so ist es doch alles gegen den zukünftigen Himmel so viel enger und kleiner, wie es der Mutter Leib gegen diesen Himmel ist. Darum heißt der lieben Heiligen Sterben eine neue Geburt, und ihre Feste nennt man lateinisch Natale, Tag ihrer Geburt. Aber der enge Gang des Todes macht, daß uns dies Leben weit und jenes eng dünkt. Darum muß man das glauben und an der leiblichen Geburt eines Kindes lernen, wie Christus sagt: ‚Ein Weib, wenn es gebiert, so leidet es Angst. Wenn sie aber genesen ist, so gedenkt sie der Angst nimmer, dieweil ein Mensch geboren ist von ihr in die Welt.‘ (Joh.16,21) So muß man sich auch im Sterben auf die Angst gefaßt machen und wissen, daß danach ein großer Raum und Freude sein wird.“ (16 f.)
Sermon von der Bereitung zum Sterben
Luthers Sermon von der Bereitung zum Sterben, der zum Gattungsvorbild reformatorischer Sterbeliteratur wurde (vgl. Schottroff), ist nicht nach Maßgabe einer strengen Gedankenordnung in der Form eines dogmatischen Traktats, sondern in zwanzig Gesichtspunkte gegliedert, die nacheinander spezielle Themenaspekte ins Auge fassen. Ihre lose Abfolge erweckt zunächst den Anschein des Assoziativen, lässt aber bei genauerem Zusehen durchaus eine präzise Struktur und Zielrichtung erkennen (vgl. Reinis, 49 f.). Luther setzt ein, indem er eine leibliche und äußerliche von einer inneren, seelischen, geistlichen Dimension menschlichen Sterbens unterscheidet. Der Tod ist ein Abschied von der Welt und allem ihrem Treiben. Wer die Welt verlässt, muss alles, was weltlich ist, hinter sich lassen, Geld und Gut selbstverständlich eingeschlossen. Dabei soll, rät Luther, auf möglichst geordnete und umsichtige Weise verfahren werden, damit nach dem Tod, wie es heißt, nicht Ursache für Zank, Hader und Zwistigkeiten unter den Hinterbliebenen gegeben sei.
Wer der Welt Lebewohl zu sagen sich anschickt, soll das Wohl der Überlebenden im Auge behalten. Um das Zeitliche auf rechte Weise segnen zu können, bedarf es daher zunächst einmal äußerer Rücksichten, z. B. letztwilliger Verfügungen in Form eines Testaments. Noch wichtiger als solche Vorsichtsmaßnahmen ist die Klärung von Belangen, die das innere Verhältnis der beteiligten Menschen zueinander betreffen. „Zum zweiten, daß man auch geistlich Abschied nehme. Das ist, man vergebe freundlich, rein um Gottes willen allen Menschen, die uns beleidigt haben, begehre umgekehrt auch allein um Gottes willen Vergebung von allen Menschen, deren wir viele ohne Zweifel beleidigt haben, zumindest mit bösem Exempel oder zu wenig Wohltaten, wie wir schuldig gewesen wären nach dem Gebot brüderlicher christlicher Liebe, damit die Seele nicht bleibe behaftet mit irgendeiner Angelegenheit auf Erden.“ (16)
Nachdem dieses in aller Kürze gesagt ist, wendet Luther die Aufmerksamkeit ganz dem Sterbenden und seiner Vorbereitung auf den Tod zu. Zur Zurüstung auf die letzte Fahrt empfiehlt er die Beichte (17: „besonders der größten Brocken, und die zur Zeit im Gedächtnis mit größtmöglichem Fleiß gefunden werden“), die Feier des Hl. Abendmahls sowie die extrema unctio, d. h. die Krankensalbung bzw. Letzte Ölung, die er 1519 noch zu den Sakramenten zählt (vgl. im Einzelnen Gerke). Sei der Empfang der Sakramente aus irgendeinem Grund nicht möglich, so solle man darüber „nicht zu sehr erschrecken“ (ebd.), weil schon „das Verlangen und Begehren derselben tröstlich sein“ (ebd.) könne. Sind doch die Sakramente „nichts anderes als Zeichen, die zum Glauben dienen und Anreiz geben“ (ebd.). Auf den Glauben, der sich auf die in den sakramentalen Zeichen beschlossenen Verheißungen und Zusagen verlässt, kommt alles an. Ohne ihn hingegen ist alles „nichts nütze“ (ebd.).
An dieser Stelle ist einem naheliegenden Missverständnis zu wehren. Der Glaube ist, was er ist, nicht aus und durch sich selbst. Er bedarf der media salutis, der Mittel des Heils, als welche das Wort der Evangeliumsverkündigung und die verba visibilia, die sichtbaren Wörter der sog. Sakramente traditionell bezeichnet werden. Denn in, mit und unter ihnen begegnen dem Menschen Jesus Christus und der in ihm in der Kraft seines Hl. Geistes offenbare Gott. Mit Spiritualisten, die das verbum externum, das äußere Wort und den Buchstaben der Schrift verachten oder gering schätzen, hat Luther nichts gemein. Ausdrücklich sagt er, dass Wort und Sakrament ihre Gültigkeit und Wirklichkeit durchaus in sich und in ihrem rechten Vollzug haben und zwar ganz unabhängig von unserem Zutun. Aber zu heilsamer Geltung und Wirkung in uns kommen sie nicht ohne Glauben, der ihrem Gehalt vertraut und sich – im wahrsten Sinne des Wortes – auf Jesus Christus verlässt, der sich in den Heilsmitteln kraft des Geistes Gottes als Heiland vergegenwärtigt. Der Grundsatz, der als Leitmaxime des ganzen Sermons zu verstehen ist, lautet entsprechend: „(S)uche dich nur in Christus und nicht in dir, so wirst du dich auf ewig in ihm finden.“ (23) Das solus Christus ist die Basis des sola fide. Allein weil er sich auf Christus und auf ihn allein und nicht auf sich selbst oder sonst etwas verlässt, ist der Glaube und er allein und ohne weiteres heilsam.
Tod und Teufel
Glaube tut not, und er ist am nötigsten in der Not des Sterbens. Drei Destruktionskräfte sind am Werke, um dem Sterbenden Not zu bereiten, ihn anzufechten und äußerlich und innerlich fertig zu machen. Sie drängen sich dem Notleidenden auf, um sich ihm einzubilden und all seine Vorstellungen zu beherrschen. Genannt werden „das erschreckende Bild des Todes“ (18), „das grauenhafte, mannigfaltige Bild der Sünde“ (ebd.) und „das unerträgliche und unausweichliche Bild der Hölle und ewiger Verdammnis“ (ebd.). Diese Bilder sind in widriger Weise darauf angelegt, in der Vorstellung des Sterbenden ineinander zu fließen und sich wechselseitig zu überlagern, um immer widerlichere Gestalt anzunehmen. Mag der Tod als ein natürliches Übel noch als halbwegs erträglich erscheinen, sofern er für sich genommen den Sinn eines gelebten Menschenlebens nicht zwangsläufig zerstört, so nimmt er schlechterdings unerträgliche Gestalt an, sobald der Teufel ihn in seinen Bann zieht und ihn zu seinem Verbündeten macht, worauf nach Luther seine ganze satanische Bosheit ausgerichtet ist.
„Verzweiflung an Gott ist mehr als Krankheit oder Unglück.“ (Obendiek, 60) Im Bunde mit dem Teufel ist der Tod darauf aus, dem Sterbenden „den Glauben und die Hoffnung zu rauben“ (Obendiek, 61) und ihm die Hölle zu bereiten. So gesehen erscheint er nicht nur als todbringend, sondern als verdammnisbereitend; sein Bild entartet zur furchtbaren Fratze. Mit Luther zu reden: „Der Tod wird groß und erschreckend dadurch, daß die schwache, verzagte Natur dies Bild zu tief in sich hineinbildet, es zu sehr vor Augen hat. Dazu steuert nun der Teufel bei, daß der Mensch das gräßliche Gebaren und Bild des Todes tief betrachte, dadurch bekümmert, weich und zaghaft werde. Denn da wird er ihm gewiß all die schrecklichen, jähen, bösen Tode vorhalten, die ein Mensch je gesehen, gehört oder gelesen hat, daneben mit einwickeln den Zorn Gottes, wie er vorzeiten hier und da die Sünder geplagt und verderbt hat, damit er die schwache Natur zur Furcht vor dem Tode und zur Liebe zum Leben und zur Sorge um es treibe, wodurch der Mensch, zu sehr beladen mit solchen Gedanken, Gott vergesse, den Tod fliehe und hasse und so schließlich Gott ungehorsam erfunden werde und bleibe. Denn je tiefer der Tod betrachtet, angesehen und erkannt wird, desto schwerer und gefährlicher das Sterben ist.“ (18)
Es ist nach Luther die Unperson des Teufels als des Inbegriffs von allem Bösen, der den Sterbenden dazu verleitet, nichts mehr vor sich zu sehen und nichts mehr vor sich sehen zu können, ja zu wollen als den Todesabgrund und jene bodenlose Finsternis, in die ihn seine Verzweiflung stürzt. In dieser Situation scheint jede Hilfe zu spät zu sein und jeder Rat vergebens. Luther widerspricht und ruft mit aller Autorität und Vollmacht, die ihm als Diener des Wortes zu Gebote stehen, dazu auf, im Namen Gottes gegen Tod und Teufel zu revoltieren. Aus zwei Momenten besteht der revolutionäre Vollzug, der darauf angelegt ist, die Lage des Sterbenden von Grund auf umzuwälzen. Die Revolution erfolgt durch Abkehr vom höllischen Schreckensbild des Todes, das der Teufel an die Wand malt, und durch Hinkehr zum Bild des gekreuzigten Heilands, der durch seine österliche Erscheinung in der Kraft des göttlichen Geistes die Kehre ermöglicht und ihren Richtungssinn bestimmt.
Im Leben, mahnt Luther, soll man des Todes gedenken und sich im memento mori üben. Denn zu Lebzeiten ist ein gepflegtes Bewusstsein eigener Sterblichkeit durchaus lebensdienlich und zwar sowohl in individueller und sozialer als auch in religiöser Hinsicht. Wenn es aber ans Sterben geht, sind Todesgedanken nach Urteil des Reformators nicht nur nichts nütze, sondern gefährlich und daher zu meiden. Was gut und richtig ist, wenn der Tod „noch fern ist und einen nicht in die Enge treibt“ (ebd.), wird schädlich, sobald er sich nähert und distanzlos bedrängt. Dann soll man sich abwenden von seinem Bild und möglichst keinen Gedanken mehr an ihn verschwenden. Das Gedächtnis von Tod und Sterblichkeit hat seine Zeit. Zeit seines Lebens muss der Mensch es pflegen. Im Sterben hingegen sollte der Mensch den Tod möglichst vergessen. Denn dieser gewinnt einen Großteil seiner Stärke und schwächt über Gebühr, wenn „man ihn zur Unzeit zuviel ansieht und betrachtet“ (19). Nachdrücklich rät Luther dem Sterbenden, dem Tod nicht sein Gesicht, sondern seinen Rücken, besser noch: sein Hinterteil zuzuwenden. Den Rest kann man unausgesprochen lassen, obwohl deftige Sprache in diesem Falle durchaus geboten, man darf ruhig sagen: gottgeboten ist.
Luthers Rat
Energischer noch als mit dem Tod hat der Sterbende Luthers Rat zufolge mit Sünde, Teufel und Hölle zu verfahren. In ihrer unheiligen Trias und umgeben vom widerlichen Schein eines zwieträchtigen Gegensatzes zur göttlichen Trinität werden sie im Inneren des Sterbenden vorstellig, um ihm seine Verfehlungen vorzuhalten, Schuldvorwürfe zu machen, sein gesamtes Dasein für sinnlos, ja sinnwidrig und grundverkehrt zu erklären, damit er an seiner Erwählung durch Gott zweifle und einer ausweglosen Verzweiflung verfalle, die in die Verdammnis führt. Luther wusste aus eigener – sterbensnah zu nennender – Erfahrung, wovon er sprach, wie etwa folgende Liedstrophen belegen, die er wenige Jahre nach seinem Sermon gedichtet hat: „Dem Teufel ich gefangen lag, / im Tod war ich verloren, / mein Sünd mich quälte Nacht und Tag, / darin ich war geboren. / Ich fiel auch immer tiefer drein, / es war kein Guts am Leben mein, / die Sünd hatt’ mich besessen. – Mein guten Werk, die galten nicht, / es war mit ihn’ verdorben; / der frei Will haßte Gotts Gericht, / er war zum Gutn erstorben; / die Angst mich zu verzweifeln trieb, / daß nichts denn Sterben bei mir blieb, / zur Höllen mußt ich sinken.“ (EG 341,2 f.) Man kann die hier beschriebene Situation durchaus mit derjenigen vergleichen, in der Luthers Sermon den Sterbenden vorfindet. Welchen solidarischen Rat gibt er ihm? Just den, seine Augen nicht nur vom Tod, sondern auch von Sünde, Teufel und Hölle rücksichtslos abzuwenden und demjenigen zuzuwenden, der ihm mit offenen und ausgestreckten Armen entgegenkommt: Jesus Christus und Gott, dem himmlischen Vater, in ihm.
Zu Lebzeiten sollen wir der Sünde gedenken und dürfen ihr Bewusstsein nicht schuldig bleiben. Im Sterben hingegen besteht zu Sündenbetrachtungen „weder Recht noch Zeit“ (19). Entsprechendes gilt in Bezug auf Teufel und Hölle: Zeit des Lebens sind sie sorgsam im Blick zu halten, damit man auf der Hut sei vor ihrer List und ihren Nachstellungen entgehe. Denn der Widersacher geht nicht nur umher wie ein brüllender Löwe, der lautstark sucht, welchen er verschlinge (1. Petr 5,8); er schleicht sich auch verstohlen an, um schlangengleich zu vergiften und klammheimlich die Hölle zu bereiten. Auf Trugbilder des Bösen muss mithin lebenslang Acht gegeben werden. Im Sterben hingegen gilt eine andere Regel: Kein Gedanke soll mehr auf Sünde, Teufel und Hölle verschwendet werden. Was gehen sie mich an?! Sind sie doch durch meinen Herrn und Heiland allesamt überwunden: Hebe dich hinweg, Satan, und mit dir Sünde und Hölle dazu. Nur keine Auseinandersetzung mit Sünde, Teufel und Hölle im Angesicht des Todes: „Wer nun gut mit ihnen fechten will und sie austreiben, dem wird es nicht genügen, daß er sich mit ihnen zerrt und schlägt oder ringt. Denn sie werden ihm zu stark sein, und es wird ärger und ärger. Die Kunst ist’s ganz und gar, sie fallenzulassen und nichts mit ihnen zu schaffen zu haben. Wie geht das aber zu? Es geht so zu: Du mußt den Tod in dem Leben, die Sünde in der Gnade, die Hölle im Himmel ansehen und dich von dem Ansehen oder Blick nicht lassen wegtreiben, wenn dir’s gleich alle Engel, alle Kreatur, ja, wenn dir’s auch scheint, Gott selbst anders vor Augen halten, was sie doch nicht tun, aber der böse Geist macht einen solchen Schein.“ (20 f.)
Anschauung Christi
Abkehr von den Schreckensbildern des Todes, der Sünde und der Hölle sowie Hinkehr zum Bild Jesu Christi, der Ikone Gottes, so lautet die Grunddevise in Luthers Sermon. In Jesus Christus wird nicht nur das vollkommene Urbild menschlicher Gottebenbildlichkeit und die Inkarnationsgestalt des göttlichen Logos, sondern in einem damit und zugleich derjenige vorstellig, der am Kreuz gottmenschliche Versöhnung bereitet und mit dem Tod auch Sünde und Hölle samt dem Satan und allen Teufel überwunden hat, wie dies in seiner österlichen Erscheinung offenbar und durch den Pfingstgeist bezeugt worden ist. Im auferstandenen Gekreuzigten tritt zutage, woran der Christenmensch im Leben und nachgerade im Sterben Halt und Trost finden kann, ja der Crucifixus selbst ist in Person des Glaubenden Halt und Trost, der ihm statt dem Tod das Leben, statt der Sünde die Gnade und statt der Hölle den Himmel vor Augen stellt und so eine Aussicht eröffnet, wie sie herrlicher nicht sein könnte: „Kein Aug hat je gespürt, / kein Ohr hat mehr gehört / solche Freude.“ (EG 147,3; vgl. 1. Kor 2,9; Jes 64,3)
Wenn Hören und Sehen vergehen, dann wird in der Kraft des göttlichen Geistes der auferstandene Gekreuzigte vorstellig, um eine Aussicht zu eröffnen, die unerhörte Freude mit sich bringt. Verlass dich darauf, mahnt Luther, dass der Heiland dich im Tode nicht verlassen, sondern dir die Tür zum ewigen Leben aufschließen wird. Dann vergeht die Nacht und das Licht eines unvergänglichen Tages bricht an. Sieh diesem Licht entgegen, welches in der Gestalt Jesu Christi auf dich zukommt, dann wird dein Sterben in aller Not und Kümmernis nicht trostlos, sondern selig sein. – Ist all dies, so höre ich nicht nur von außen, sondern in mir selbst fragen, nicht zu schön, um wahr zu sein? Entspricht es der Realität tatsächlichen Sterbens, die doch aller Erfahrung nach nicht selten höchst grausam ist? Beruht die Aussicht, die Luther dem Sterbenden eröffnen möchte, nicht auf einer Einbildung, die zwar als zutiefst menschlich, aber nichtsdestoweniger als fiktiv erscheinen muss, als ein frommes Trugbild? Zweifel melden sich und mit ihnen die alte Verzweiflung, die auch dann Verzweiflung bleibt, wenn sie sich ein hochmütiges Ansehen gibt. Muss nicht am Ende, wenn die alltägliche Gewohnheit weicht, alles als unheimlich, sinnlos, ja sinnwidrig erscheinen? Indem er Fragen dieser Art nicht ausweicht, sondern sich ihnen beherzt stellt, erreicht Luthers Sermon seine eindringlichste Tiefe.
Abkehr von den Horrorszenarien von Tod, Sünde und Hölle sowie Hinkehr zum Bild des Lebens, der Gnade und des Himmels, das uns in der Person Jesu Christi vor Augen gestellt ist, so lautete die bisherige Devise. Aber was sehen wir eigentlich, wenn wir, wie Luther empfiehlt, Jesus Christus anschauen? Einen strahlenden Helden, umgeben vom ewigen Licht einer anderen Welt? So mag es unserer Einbildung erscheinen. Wenn er es aber ist, der sich uns einbildet, dann ergibt sich nicht nur auf den ersten Blick ein anderes Bild – ein Bild, das durch die österliche Erscheinung nicht etwa zum Verschwinden gebracht, sondern ewig unvergessen bleibt. Ecce homo! Seht welch ein Mensch! „Und um die neunte Stunde rief Jesus laut und sprach: Eli, Eli, lama asabthani? Das ist verdolmetscht: Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ (Mk 15,34) Als er dies gesagt hatte, so lesen wir im ältesten Evangelium nach Markus weiter, starb Jesus mit einem Schrei. „Der Hauptmann aber, der dabeistand ihm gegenüber und sah, dass er mit solchem Geschrei verschied, sprach: Wahrlich dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen.“ (Mk 15,39)
Das Sterbensbild des Gekreuzigten hat den Zenturio zu einer Glaubenseinsicht gebracht, die durch Ostern nicht falsifiziert, sondern von Gott selbst verifiziert wurde dergestalt, dass sich der allmächtige Gott mit dem ohnmächtigen Jesus identifiziert hat, um ihn zu seiner Rechten zu erheben, damit er dort unser Anwalt und Fürsprecher sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Zeichen des Kreuzes fasst sich das ganze Christentum zusammen, und das Heil im Leben und im Sterben ist im Bild des Crucifixus inbegriffen, den nicht wir uns einbilden, sondern der sich uns einbildet und uns eine Wirklichkeit erahnen lässt, über die hinaus eine wirklichere nicht geschaut werden kann. Im Kreuz Jesu Christi ist uns Gott näher gekommen als wir uns selbst je nahe kommen können. Am Kreuz, sagt Luther, hängt unser ureigenes Heil. Denn dort hat sich Jesus Christus, dessen Person Gottheit und Menschheit vereint, „uns sich selbst bereitet als ein dreifältiges Bild, unserm Glauben vor Augen zu halten wider die drei Bilder, mit denen der böse Geist und unsere Natur uns anfechten, um uns aus dem Glauben zu reißen. Er ist das lebendige und unsterbliche Bild wider den Tod, den er erlitten und doch mit seiner Auferstehung von den Toten überwunden hat in seinem Leben. Er ist das Bild der Gnade Gottes wider die Sünde, die er auf sich genommen und durch seinen unüberwindlichen Gehorsam überwunden hat. Er ist das himmlische Bild: Er, der verlassen ist von Gott als ein Verdammter und durch seine allermächtigste Liebe die Hölle überwunden hat, bezeugt, daß er der liebste Sohn sei und daß uns allen dies zu eigen gegeben, wenn wir es glauben.“ (24 f.)
Der auferstandene Gekreuzigte
Der Gekreuzigte ist unser Heil im Sterben, weil Gott in ihm, wie an Ostern offenbar und vom Pfingstgeist bezeugt, in Tod, Grab und Hölle uns vorangegangen ist, um in tiefster Finsternis bei uns zu sein und sein ewiges Licht leuchten zu lassen. Du bist angefochten vom Todesleid: auch Gott hat es in Jesus Christus erlitten! Du erschauderst vor dem Grab: auch Gott war in Jesus Christus in ihm gelegen! Du wirst vom Teufel ob deiner Sünde angefochten: auch Gott selbst weiß durch denjenigen um Anfechtung, der an unserer statt den Sündertod starb, um in das Reich des Todes und der Hölle hinabzusteigen. Nichts Menschliches bis hin zur resignatio ad infernum ist Gott fremd. Warum also kann das Bild Jesu Christi und dieses allein im Sterben trösten? Weil Jesus Christus nach Luther selbst das Bild des Todes, der Sünde und der Hölle vor Augen hatte, was er nicht vergisst, sondern woran er denkt, wenn er uns ein ewiges Gedächtnis stiftet bei Gott.
Von uns aus könnten wir unseren Blick gar nicht von den Schreckensbildern, die uns in ihren Bann ziehen, ab- und Jesus Christus zuwenden, würde er uns nicht selbst mit jenem Blick ansehen, der um Tod, Sünde und Hölle weiß, aber sie in der Gewissheit Gottes überwunden hat. Die Gottesgewissheit des christlichen Glaubens, deren Grund und Urbild Jesus Christus ist, ist nicht allwissend, sondern mit Unwissen mannigfacher und durchaus prinzipieller Art verbunden. Wir haben – Nahtoderfahrungen hin oder her – keinerlei Erfahrungswissen von einem postmortalen Leben, und wir werden zu unseren irdischen Lebzeiten auch grundsätzlich kein solches Erfahrungswissen gewinnen. Wir dürfen aber um Christi willen gewiss sein, dass der allwissende Gott nicht nur weiß, was es heißt, nicht allwissend zu sein, sondern auch mit seiner ganzen Allwissenheit und Allmacht nur ein Ziel verfolgt: in väterlicher Weise zu wirken, was für seine Menschenkinder, für mich und für dich und für uns alle vernünftig und gut ist. Darauf können wir uns verlassen im Leben und Sterben dank unseres gekreuzigten und auferstandenen Herrn.
Gegen Schluss seines Sermons, ab dem fünfzehnten Abschnitt, wo er noch einmal auf die Sakramente, ihre Kraft und ihren rechten Gebrauch zu sprechen kommt, unterstreicht Luther mit großem Nachdruck den, wenn man so will, exzentrischen Charakter des Glaubens. Der Glaubende ist, was er ist, nicht aus und durch sich selbst, sondern indem er außer sich gerät und mittels der Medien des Heils in der Kraft des Hl. Geistes dazu bewegt wird, sich auf Gott in Christus zu verlassen. Glauben heißt Sein in Christus. Durch Christus, wie er in Wort und Sakrament vorstellig wird und sich uns zueignet, kommt der Glaubende zu sich selbst und zur Gewissheit, die seinen Glauben ausmacht. Glaubensgewissheit hat nicht den Charakter vermittlungsloser Unmittelbarkeit, sondern ist, weil sie auf Christusgemeinschaft basiert, medial vermittelt und auf kommunial-kommunikative Vermittlung angelegt, so dass individuelles Sein in Christus und soziale Christengemeinschaft einen Zusammenhang bilden.
Communio Sanctorum
Wer mit dem solus Christus und dem sola fide ernst macht, befindet sich immer schon in der Gemeinschaft der Gläubigen, welche die Kirche ist. Dies gilt auch und gerade für den sterbenden Menschen, der sich, wie ihm die kirchlichen Sakramente wirkmächtig bezeugen, im Verein mit Christus zugleich mit den Christen aller Räume und Zeiten verbunden wissen darf, die sein Sterben begleiten. Luther scheut sich nicht zu sagen, dass alle Glieder der die Schranken des Todes transzendierenden communio sanctorum „mit dir in Christus sterben, Sünde tragen, Hölle überwinden“ (27). Man hat in solchen Aussagen und in der Annahme einer Fürbitte der Heiligen Restbestände mittelalterlicher Theologie und Frömmigkeit vermutet, die der Reformator später abgestreift habe. Aber diese These ist unzutreffend. Zeitlebens war Luther der festen Überzeugung, dass die Solidargemeinschaft der Glaubenden durch den Tod zu keinem Ende kommt.
Zwar ist durch den Tod eine Grenze gesetzt, die strikt zu achten ist. Versuche direkter Kontaktaufnahme zu Verstorbenen hält Luther für gänzlich abwegig und ausgeschlossen. Mit Spiritismus hat das Christentum schlechterdings nichts gemein, und vor okkultistischen Praktiken schlägt es das Kreuz. Damit die Verwesung nicht in der Erfahrungswelt Platz greife, ist zwischen Leben und Tod sorgsam zu unterscheiden und jeder Kontamination zu wehren, welche die Seele des Menschen verunreinigt und seinen Geist durch abseitige Wahngebilde zersetzt. Damit ist freilich nicht gesagt, dass durch die unter allen Umständen zu respektierende Grenze, die durch den Tod gesetzt ist, die Gemeinschaft der Glaubenden aufgehoben und die Bindung der Glaubenden aneinander unterbunden würde.
In der Gemeinschaft mit Christus, wie Wort und Sakrament sie kraft des durch sie in uns wirkenden Geistes Gottes vermitteln, kann jeder Christ der Gemeinschaft aller Christen im Leben und im Sterben und über den Tod hinaus gewiss sein. Weder Tod noch Teufel noch die „Pforten der Hölle“ (Mt 16,18) werden die Gemeinschaft derjenigen zerstören, die in Christus sind. Ein Christ ist niemals allein. Denn die Bindung an Christus verbindet ihn zugleich mit allen anderen Christenmenschen, die ihm ihrerseits verbunden sind. Nicht zuletzt diese Gewissheit kann ein Trost im Sterben sein und das umso mehr, wenn in rechter christlicher Weise die humane Bedeutung gemeinsamer Sterblichkeit aller Menschen, ja aller kreatürlichen Lebewesen bedacht wird.
Indem sie mit Christus vereinen, vereinen die Sakramente und namentlich das sacramentum unitatis des Herrenmahls die Christen untereinander. Wie der Apostel sagt. „Der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist’s, so sind wir viele ein Leib, dieweil wir alle eines Brotes teilhaftig sind.“ (1. Kor 10,16 f.) Damit er der Gemeinschaft mit Christus gewiss sei und sich der Gemeinschaft der Christen vergewissere, empfiehlt Luther dem Sterbenden dringend den Empfang des Abendmahls, ohne deshalb zu behaupten, die Hinderung, das gesegnete Brot zu essen und den gesegneten Wein zu trinken, würde notwendig zum Schaden gereichen. Welche Hinderungsgründe es im Einzelnen auch geben mag: einer soll und darf nicht infrage kommen, nämlich das Empfinden eigener Unwürdigkeit. Jeder, der die Gemeinschaft Christi begehrt, ist würdig, sie zu empfangen, ja er ist umso würdiger, als je unwürdiger er sich selbst und der Welt erscheint.
Die Gabe, die Gott in Christus gibt und unter der Gestalt von Brot und Wein austeilen lässt, wird unbedingt, bedingungslos und ohne jeden Vorbehalt gegeben. Denn in ihr gibt sich Gott selbst uns ganz und gar zu eigen, um durch nichts als reines Empfangen, mere passive, wie Luther sagt, geehrt zu werden. Was sollen wir also tun im Leben und insonderheit im Sterben, wenn es mit uns und unseren Kräften zu Ende geht, wenn alle Eigenmöglichkeiten vergehen und Selbst und Welt dahinschwinden? Antwort: Nichts, gar nichts als uns die Zuwendung der Liebe Gottes gefallen und uns in seine Hände fallen zu lassen, die er in Christus entgegenstreckt, damit wir von ihnen im göttlichen Geist ergriffen werden, der uns aufs beste mit unaussprechlichen Seufzern vertritt und unserer Schwachheit aufhilft (vgl. Röm 8,26). Von solchem Ergriffensein rührt der Begriff her, den Luther vom Glauben hat.
Sola fide
Glaube ist kindliches Vertrauen zu Gott, der sich in Jesus Christus durch den Hl. Geist als Vater seiner verlorenen Menschensöhne und -töchter erwiesen hat. Solcher Glaube hat Bestand, weil er in Gott selbst gründet, wie uns in Wort und Sakrament zugesagt und versprochen ist. Auf dieses Versprechen vertrauen und sich angesichts drohenden Nichts von Selbst und Welt demjenigen anzuvertrauen, der ex nihilo zu schaffen und Tod, Teufel und Hölle zunichte zu machen vermag, heißt Glauben. Glaube nur, zweifle nicht! „Glaube macht würdig, Zweifel macht unwürdig.“ (28) Mag alle Welt, mag ich mir selbst zweifelhaft werden: dies tut letztlich nichts zur Sache, wenn nur geglaubt und nicht bezweifelt wird, dass Gott für uns, dass Gott für mich ist. „Was hülfe es, daß du dir vorbildetest und glaubtest, der Tod, die Sünde, die Hölle der andern seien in Christus überwunden, wenn du nicht auch glaubtest, daß dein Tod, deine Sünde, deine Hölle dir da überwunden und vertilgt seien und du ebenso erlöst seiest.“ (Ebd.) Bitte Gott, dass er mit der in Jesus Christus gegebenen Gnade durch seinen Geist auch ihr gläubiges Empfangen und mit dem Empfangen den entsprechenden Dank schenke, der in einer Liebe tätig ist, die den Tod zwar nicht sucht, ihn aber um Gottes und des Nächsten willen auch nicht scheut. Man lese hierzu, was Luther Breslauer Pfarrern angesichts einer Pestepidemie auf die Frage geantwortet hat, „ob ein Christen menschen gezyme zu fliehen ynn sterbens leufften“ (WA 23,338,6; vgl. WA 23,321–386).
Luthers „Sermon von der Bereitung zum Sterben“ markiert den Ansatz einer reformatorischen Eschatologie, die Anspruch auf ökumenische Geltung in der ganzen Christenheit erheben darf. Integriert der Sermon selbst beispielsweise in sakramentstheologischer Hinsicht Elemente, die später aus Theorie und Praxis der Reformationskirchen faktisch ausgeschieden wurden, aber doch nicht notwendigerweise ausgeschieden werden müssen, so lassen sich unter Voraussetzung seines eschatologischen Ansatzes auch solche Traditionsbestände reformulieren, die man üblicherweise nicht im Kontext einer reformatorischen Lehre von den Letzten Dingen vermuten würde; am Fall der Purgatoriumsdoktrin soll dies exemplarisch erwiesen werden. Weitere Fallstudien zu traditionellen Beständen christlicher Eschatologie verfolgen ein ähnliches Ziel und den Zweck, die Integrationspotentiale des reformatorischen Ansatzes in Kritik und Konstruktion möglichst flächendeckend unter Beweis zu stellen. Zur Beförderung dieses Anliegens seien formale Gestalt und materialer Gehalt einer Eschatologie in reformatorischer Tradition eingangs in Grundzügen skizziert; Skizzen zu den Rahmenbedingungen aktueller eschatologischer Theoriebildung werden anschließend entworfen, damit sich mehr und mehr zu erkennen gebe, „(w)orauf es letztlich ankommt“ (vgl. Kläden [Hg.]).
1. Rechtfertigung im Endgericht. Eschatologie in reformatorischer Tradition
Lit.: P. Althaus, Die letzten Dinge, Gütersloh 41933. – G. Brüntrup, Das Leib-Seele-Problem. Eine Einführung, Stuttgart 32008. – Ders.,/M. Rugel/M. Schwarz (Hg.), Auferstehung des Leibes – Unsterblichkeit der Seele, Stuttgart 2010. – R. Dellsperger, Art. Biedermann, Alois Emanuel (1819–1885), in: TRE 6, 484–488. – G. Gasser, Hylemorphistische Theorien der Auferstehung. Eine kritische Bestandsaufnahme, in: ThPh 88 (2013), 536–559. – A. Lindemann, Eschatologie III. Neues Testament, in: RGG4 2, 1153–1560. – M. Luther, Sermon von der Bereitung zum Sterben, in: ders., Ausgewählte Schriften. Hg. v. K. Bornkamm/G. Ebeling. 2. Bd.: Erneuerung von Frömmigkeit und Theologie, Frankfurt a. Main 21983, 15–34. – T. Müller, Philosophische Überlegungen zu einer christlichen Eschatologie im Zeitalter der Naturwissenschaften. Wissenschaftsphilosophische Grundlagen und Impulse aus der Prozessphilosophie Whiteheads, in: T. Kläden, Worauf es letztlich ankommt. Interdisziplinäre Zugänge zur Eschatologie, Freiburg i.Br. 2014, 95–124. – M. Ortner, Apokastasis panton und Fegfeuer. Ost-westliche Kontroversen im Lichte von Dogmen- und Lehrentwicklung, Diss. München 2014. – G. Wenz, Theologie der Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Eine historische und systematische Einführung in das Konkordienbuch, 2Bde., Berlin/New York 1996/1998. – Ders., Religion. Aspekte ihres Begriffs und ihrer Theorie in der Neuzeit, Göttingen 2005 (Studium Systematische Theologie Bd. 1). – Ders., Offenbarung. Problemhorizonte moderner evangelischer Theologie, Göttingen 2005 (Studium Systematische Theologie Bd. 2). – Ders., Kirche. Perspektiven reformatorischer Ekklesiologie in ökumenischer Absicht, Göttingen 2005 (Studium Systematische Theologie Bd. 3). – Ders., Gott. Implizite Voraussetzungen christlicher Theologie, Göttingen 2007 (Studium Systematische Theologie Bd. 4). – Ders., Christus. Jesus und die Anfänge der Christologie, Göttingen 2011 (Studium Systematische Theologie Bd. 5). – Ders., Geist. Zum pneumatologischen Prozess altkirchlicher Lehrentwicklung, Göttingen 2011 (Studium Systematische Theologie Bd. 6). – Ders., Schöpfung. Protologische Fallstudien, Göttingen 2013 (Studium Systematische Theologie Bd. 7). – Ders., Sünde. Hamartiologische Fallstudien, Göttingen 2013 (Studium Systematische Theologie Bd. 8). – Ders., Versöhnung. Soteriologische Fallstudien, Göttingen 2015 (Studium Systematische Theologie Bd. 9).
Biedermanns Weisung
Vom Schweizer Reformtheologen Alois Emanuel Biedermann soll die hermeneutische Weisung stammen, jede Dogmatik sei rückwärts und von hinten herein, nämlich von der Eschatologie her zu lesen. Dieser Grundsatz entspricht reformatorischer Theologie und namentlich derjenigen Luthers, die in allen ihren Aspekten eschatologisch bestimmt ist. Luthers Gedanken zu den Letzten Dingen stellen nicht nur den Schlusstopos seiner Lehre dar, sondern fungieren auch als Integral, durch welches ihre einzelnen Teile zu einem Ganzen zusammengeschlossen werden. Ihre integrative Funktion für die Gesamtlehre erfüllt Luthers Eschatologie indes nicht in Form futurologischer Endzeitspekulationen, sondern durch strikte Konzentration auf die in der Kraft des Hl. Geistes erschlossene Gottesoffenbarung in Jesus Christus. Zu erwarten steht die Zukunft des Gekommenen. Durch sein österliches Perfekt wird nach Luthers Urteil künftig alles vollendet werden. Der liberale Züricher Biedermann bestätigt dies insofern, als auch für ihn der Zusammenhang von Christusglaube und christlicher Endzeithoffnung unaufhebbar ist (vgl. Dellsperger, 485 f.).
„(S)uche dich nur in Christus und nicht in dir, so wirst du dich ewig in ihm finden.“ (Luther, 23) Das Motto von Luthers „Sermon von der Bereitung zum Sterben“ aus dem Jahr 1519 kann als programmatischer Grundsatz reformatorischer Eschatologie gelten und zwar sowohl in individueller als auch in universaler Hinsicht. Das ewige Heil von Selbst und Welt gründet in Jesus Christus, von dessen Entgegenkommen der Glaube seine Zukunft erwartet. Was kommt auf uns zu? Die Antwort des Glaubens lautet: Jesus Christus, seine Parusie und im Verein mit ihr das Reich Gottes und der Geist, der ewiges Leben schafft und die Schöpfung vollendet. Christliche Eschatologie ist christologisch-trinitätstheologisch fundiert und ohne diese Fundierung grundlos. Die christologisch-trinitätstheologische Fundierung christlicher Eschatologie hinwiederum ist festgefügt nur, wenn sie der auferstandene Gekreuzigte konstituiert, in dem sich der allmächtige und gerechte Gott in der Kraft seines Geistes als der Retter erschlossen hat, der um des Leidens und Sterbens seines österlich verherrlichten Sohnes willen aus Gnade durch Glauben aus dem eschatologischen Gericht befreit. In der Person des für Menschheit und Welt gerichteten Richters Jesus Christus wird diese eschatologische Rettung zum Heil des Glaubens vorstellig werden und in Erscheinung treten. Daran orientiert sich die christliche Hoffnung in ihrer individuellen und universalen Gestalt.
Religion, so wurde wiederholt gesagt, ist die Beziehung von Subjekten zu einem fundierenden Grund von Selbst und Welt (vgl. Wenz, Religion), Offenbarung die Selbsterschließung dieses Grundes und damit die Begründung des religiösen Verhältnisses selbst (vgl. Wenz, Offenbarung). Nach dem gemeinkirchlichen Bekenntnis des christlichen Glaubens (vgl. Wenz, Kirche) hat sich der fundierende Sinngrund von Selbst und Welt in Jesus Christus, näherhin im auferstandenen Gekreuzigten offenbart. Ostern ist das Urdatum, in dem sich der Grund erschlossen hat, in dem der christliche Glaube gründet und auf den er sein Vertrauen setzt: der dreieinige Gott, als Ursprung, Mitte und Ziel von Selbst und Welt (vgl. Wenz, Gott; Christus; Geist). Das innertrinitarische Mysterium des dreieinigen Gottes wird durch die Offenbarung in Jesus Christus, dem auferstandenen Gekreuzigten, nicht etwa aufgehoben, sondern im Gegenteil als das unvordenkliche Geheimnis erschlossen, in dem Gerechtigkeit und Liebe des allmächtigen Gottes auf differenzierte Weise vereint sind. Die trinitätstheologische Lehre von der göttlichen Ökonomie hat dies in christologischer Konzentration unter schöpfungstheologischen (vgl. Wenz, Schöpfung), hamartiologischen (vgl. Wenz, Sünde), soteriologischen (vgl. Wenz, Versöhnung) und eschatologischen Aspekten zu bedenken.
Österliche Anamnese von Schöpfung und Sündenfall
An Ostern erscheint Jesus Christus als der inkarnierte Logos, in welchem der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erden, der eine Gott universaler Gerechtigkeit als Vater von Menschheit und Welt offenbar wird, der in der Kraft seines schöpferischen Geistes ein Kindschaftsverhältnis seiner Kreaturen und namentlich seines Menschengeschöpfs zu ihm selbst ermöglicht und erschließt. Die manifeste Gestalt kreatürlicher Gotteskindschaft ist der logospersonierte, ganz vom göttlichen Schöpfergeist durchdrungene Mensch Jesus, der wahre Adam und das vollkommene Geschöpf. Als solcher bringt er sich im Geiste Osterns für diejenigen in Erinnerung, die seines irdischen Lebens gedenken und dadurch zu einer Schöpfungsanamnese bewegt werden, die protologische Einsichten in Bezug auf Selbst und Welt erschließt.
Protologische, die Ursprungsbestimmung von Selbst und Welt bestimmende Einsichten sind auch prächristologisch zu erlangen, aber nur auf unbestimmte und uneindeutige Weise, die eine Zweideutigkeit mit sich führt, wenn sie in ihrer Unbestimmtheit und Uneindeutigkeit nicht eindeutig identifiziert wird, wie dies durch die Christologie geschieht. In der österlich-pfingstlich offenbaren gottmenschlichen Person des inkarnierten Logos ist das Ursprungsverhältnis von Gott und Mensch als ein Verhältnis von Vater und Sohn, als ein Vaterschafts- und Kindschaftsverhältnis offenbar, das den Glauben beten lässt: „Vater unser im Himmel“. Im Vollzug des Herrengebets wird das erste Gebot erfüllt (BSLK 507,43 f.: „Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen.“), wobei der väterliche Schöpfergott selbst es ist, der Wollen und Vollbringen wirkt, indem er uns damit lockt, „daß wir gläuben sollen, er sei unser rechter Vater und wir seine rechte Kinder, auf daß wir getrost und mit aller Zuversicht ihn bitten sollen, wie die lieben Kinder ihren lieben Vater“ (BSLK 512, 20–24; vgl. Wenz, Theologie I, 263–347).
Das Bekenntnis des ersten Glaubensartikels, wonach „mich Gott geschaffen hat sampt allen Kreaturn“ (BSLK 510,33 f.), weist voraus auf die Vaterunserbitten des Herrengebets und zurück auf das erste Gebot und alle Folgegebote, deren Erfüllung der Schöpfungsglaube ist, welcher in allen Dingen der väterlichen Allmacht und Gerechtigkeit Gottes vertraut und sich auf den Schöpfer verlässt, in dessen Güte Selbst und Welt gründen, bestehen und ihre Vollendung finden. Was es mit dem Grund dieses Schöpfungsglaubens auf sich hat, ist an der irdischen Erscheinungsgestalt des göttlichen Menschensohnes und menschlichen Gottessohnes offenbar und zur Gewissheit geworden. Offenbar und gewiss geworden ist durch den irdischen Lebensweg Jesu Christi und sein Ende aber zugleich, dass Menschheit und Welt den Glauben an Gott den Schöpfer schuldig geblieben sind, sich gegen seine Gebote verfehlt und das Gotteskindschaftsverhältnis verkehrt haben. Der Glaubende hat dies in Anbetracht des Kreuzes Jesu Christi allem zuvor für sich selbst zu bekennen: „Nun, was du, Herr, erduldet, / ist alles meine Last; / ich hab es selbst verschuldet, / was du getragen hast.“ (EG 85,4)
Das Kreuz Jesu Christi ist der Erkenntnisgrund dessen, was im theologischen Sinne Sünde heißt, nämlich Unglaube, fehlendes und schuldig gebliebenes Gottvertrauen, Selbst- und Weltvergottung, gottwidriges Verhalten etc., zuletzt Gotteshass. Was es mit dem abgründigen Fall der Sünde und dem Unwesen auf sich hat, das sie treibt, wird im Leiden des Gekreuzigten ersichtlich. Zwar ist mit einem Bewusstsein von Schuld und menschlicher Verfehlung auch jenseits christlicher theologia crucis zu rechnen. Aber die Radikalität des peccatum originale kann unter Absehung vom Gekreuzigten nicht ermessen werden. In Christi Tod wirkt sich die Verkehrtheit aus, aus der alle peccata actualia samt den mit ihnen verbundenen Übeln der Welt abgründig hervorgehen, um gemäß dem göttlichen Gesetz gerichtet zu werden. Wird dies wahrgenommen, dann sind die Folge davon Reue und Schrecken über die Sünde, „contritio seu terrores incussi conscientiae agnito peccato“ (CA XII,4).
Augenblick der Gnade
Aus der Heillosigkeit der Gewissenspein, die den Sünder in Anbetracht des Kreuzes überfällt, das ihm seine sündige Verkehrtheit vorstellig macht und vorhält, kann nur der Blick Jesu Christi selbst erretten, der, wie das Beispiel des Petrus zeigt, heillose in heilsame Reue umzuwandeln vermag, weil er anzeigt, dass der Gang ans Kreuz für uns und um unser Rechtfertigung willen geschehen ist. Die Bitte unter dem Kreuz kann daher nur lauten: „Schau her, hier steh ich Armer, der Zorn verdienet hat. / Gib mir, o mein Erbarmer, / den Anblick deiner Gnad.“ (EG 85,4) In den österlichen Erscheinungen ist der Blick des leidenden Jesus Christus als visio Dei erkennbar, in der sich der allmächtige und barmherzige Gott als reine Gnadenliebe zur Anschauung bringt, um in der Kraft seines Geistes durch Wort und Sakrament den Rechtfertigungsglauben zu erschließen, welcher bekennt: „Ich gläube, daß Jesus Christus, wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geborn und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrauen Maria geborn, sei mein HERR, der mich verlornen und verdammpten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen von allen Sunden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschüldigen Leiden und Sterben, auf daß ich sein eigen sei und in seinem Reich unter ihme lebe und ihme diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, gleichwie er ist auferstanden vom Tode, lebet und regieret in Ewigkeit; das ist gewißlich wahr.“ (BSLK 511,23–28)
Der zweite Artikel markiert die innere Mitte der drei lutherischen Katechismushauptstücke von Dekalog, Credo und Vaterunser und bestimmt, wenn man so will, das geistesgegenwärtige Präsens des Glaubens und die Gewissheit, die sein aktuelles Bewusstsein und Selbstbewusstsein ausmacht. Ohne Glaubensgewissheit, die im Vertrauen auf den auferstandenen Gekreuzigten, dem Rechtfertigungsevangelium in Person, gründet, kann es weder eine christlich zu nennende Schöpfungsanamnese und eine ihr entsprechende hamartiologische Erkenntnis noch jene eschatologische Erwartung geben, die gewisse Hoffnung erschließt. Nicht minder gilt freilich das Umgekehrte, nämlich dass ein Glaube ohne protologische Erinnerung und hoffnungsvolle Aussicht auf die endzeitliche Parusie Jesu Christi, auf das Kommen des Reiches Gottes und auf die Vollendung der Schöpfung im Geist keinen Bestand haben kann.
Ein Glaube, der keine Hoffnung hegt, schwindet ebenso dahin, wie eine Hoffnung, der die Gewissheit des Glaubens fehlt, dass auf Gott und seinen Christus bis ans Ende und darüber hinaus Verlass ist. Weil dem so ist, sind Reflexionen über das Verhältnis von Glaube und Hoffnung für die Grundlegung christlicher Eschatologie unentbehrlich. Sie müssen sich zugleich auf die Beziehung richten, die zwischen dem österlichen Perfekt der dem Glauben gewärtigen Geistpräsenz Jesu Christi in Wort und Sakrament einerseits und dem eschatologischen Futur andererseits herrscht, welches durch die Parusie Jesu Christi bezeichnet ist. Man wird vorweg vermuten dürfen, dass der künftige Advent nicht ohne das Perfekt Osterns und den Glauben an die aktuelle Präsenz des auferstandenen Gekreuzigten in Wort und Sakrament hoffnungsvoll erwartet werden kann – wie denn auch umgekehrt der Glaube der Hoffnung auf Erfüllung der Verheißungen nicht zu entbehren vermag, die mit der Zukunft des Gekommenen verbunden sind.
Glaube kann nicht ohne Hoffnung sein; Hoffnung hinwiederum bedarf des Glaubens, um Bestand zu haben. Das Bleiben im Glauben ist die Voraussetzung dafür, die Hoffnung nicht zu verlieren, wie umgekehrt die Hoffnung auf kommende Erfüllung als Bedingung für die Bewahrung der Glaubensgewissheit fungiert. In der Geschichte des christlichen Denkens hat man das Verhältnis von Glauben und Hoffen zwar verschieden bestimmt, nie aber ihre unveräußerliche Zusammengehörigkeit infrage gestellt. Es wird Aufgabe von Folgestudien sein, genauer zu ergründen, „warum die Heilsgewissheit nicht anders als in der Doppelgestalt von Glauben und Hoffen, die Eschatologie nicht anders als in der Doppel-Rede vom Bleibenden und vom Kommenden auftreten kann und inwiefern diese beiden Gestalten unlöslich zusammengehören“ (Althaus, 56). Vom Neuen Testament her jedenfalls ist diese „Doppel-Rede“ nahegelegt, sofern für alle seine eschatologischen Entwürfe „das Ineinander von bereits erfüllter eschatologischer Hoffnung und noch ausstehender, Heil oder Gericht bringender Zukunft (bestimmend ist). Christus ist bereits jetzt der Herr; aber seine bzw. Gottes Herrschaft wird sich in vollem Umfang erst bei der Parusie offenbaren, wobei die Frage nach dem ‚Wann‘ unterschiedlich beantwortet wird, ohne daß es darüber jedoch zu einer ‚Krise‘ gekommen wäre.“ (Lindemann, 1560)
Glaube und Hoffnung
Der Glaube, der sich auf den in Jesus Christus in der Kraft des Geistes offenbaren Gott verlässt, ist seines künftigen Heiles gewiss. Er weiß aber mit ebensolcher Gewissheit, dass sein eschatologisches Heil allein durch denjenigen gewährleistet werden kann, auf den er vertraut. Gerade in eschatologischer Hinsicht und in Anbetracht des eigenen Todes und eines Endes von Menschheit und Welt ist alle soteriologische Aufmerksamkeit ganz auf Jesus Christus und auf den in ihm offenbaren Gott auszurichten, der allein, wenngleich keineswegs ohne uns, sondern im Gegenteil ganz und gar für uns endzeitliches Heil zu schaffen bereit und in der Lage ist. Hoffnungsvoller Glaube wird, gerade wenn es um die Letzten Dinge geht, im striktesten Sinne Rechtfertigungsglaube sein, der die Erfüllung des eschatologisch verheißenen Heils gratis und nicht unter Voraussetzung von Eigenverdienst und heilsbegründender Mitwirkung erwartet. Dieser evangelische Grundsatz gilt sowohl für das besondere Gericht als Thema individueller, als auch für das allgemeine Gericht als Thema universaler Eschatologie; er stellt das Vorzeichen für alles dar, was über die Letzten Dinge in reformatorischer Tradition zu lehren ist.
Der materiale Gehalt und das innere Zentrum des Lehrstücks „De novissimis“ ist nach Maßgabe reformatorischer Theologie durch die Gegensatzeinheit von Gesetz und Evangelium, von gerechtem Gericht und Rechtfertigung des Sünders bestimmt, die nur im Geiste Jesu Christi und vom Evangelium her auf heilsame Weise verbunden werden können (vgl. Wenz, Theologie II, 59–236; 542–644). Evangelischer Glaube erwartet Jesus Christus als gerechten Richter, aber zugleich und darüber hinaus als denjenigen, welcher aus dem Gericht mittels seiner Gerechtigkeit rettet, die sola gratia das Rechtfertigungsurteil über den Sünder spricht, der glaubt und sich den Zuspruch der göttlichen Gnadenliebe gefallen lässt. Darauf vertrauen zu können, ist Grund eschatologischer Hoffnungsgewissheit christlichen Glaubens, wie denn auch die Zukunft dessen, der gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist (vgl. Mt 18,11; Lk 19,10), den Skopus aller Endzeitaussagen christlicher Theologie darstellt, die geistvoll und pneumatologisch angemessen zu nennen sind. Wo dieser Skopus verfehlt wird, laufen endzeitliche Überlegungen nach Maßgabe des dritten Glaubensartikels, in dessen Zusammenhang die Eschatologie gehört, Gefahr, in geistlosen, ja geistwidrigen Spekulationen zu enden.
Materialer Gehalt und innerer Sinn eschatologischer Aussagen evangelischen Glaubens sind durch die Erwartung der Parusie Jesu Christi als des den Sünder aus Gnade durch Glauben rechtfertigenden Richters bestimmt. Schon im Frühjudentum stand im Fokus eschatologischer Aufmerksamkeit der Gerichtsgedanke, welchem alle anderen apokalyptischen Vorstellungen einschließlich derjenigen einer allgemeinen Auferstehung der Toten dienend zugeordnet wurden. Warum werden die Toten endzeitlich auferweckt? Antwort: Um vor dem Gericht des einen und universalen Gottes der Gerechtigkeit zu erscheinen, der dem Tod die Macht genommen hat, die Differenz von gerecht und ungerecht auf gleichsam naturhafte Weise zu egalisieren. Solchem Vergleichgültigungsbestreben bereitet Gott durch sein eschatologisches Urteil, welches Gut und Böse scheidet, ein definitives Ende. Christliche Eschatologie schließt an die apokalyptische Fortentwicklung des jüdischen Thoramonotheismus an und übernimmt dessen Gedanken eines eschatologischen Endgerichts, konfrontiert ihn aber zugleich mit dem gläubigen Vertrauen auf eine von Gott gewährte endzeitliche Rechtfertigung derjenigen Sünder, die sich auf Jesus Christus verlassen und seinem Evangelium vertrauen. Nicht durch den Gerichts-, sondern durch den Rechtfertigungsgedanken unterscheidet sich das Christentum von seiner apokalyptischen Herkunft. Der Apostel Paulus ist dafür der wichtigste, wenngleich keineswegs einzige Zeuge.
Totenauferstehung und Seelenunsterblichkeit
Im Vergleich zur Differenz zwischen dem eschatologischen Gedanken eines gerechten Gerichts, das urteilend scheidet, und demjenigen der Rechtfertigung des Sünders durch Glauben an Christus ist der Unterschied zwischen der Vorstellung einer endzeitlichen Auferstehung der Toten und derjenigen einer Unsterblichkeit der Seele eher gering, so charakteristisch und voraussetzungshaltig die anthropologischen und sonstigen Implikationen zweifellos sind, die den beiden Vorstellungen eignen. Beide sind unbeschadet ihrer separaten Genese nicht erst im Christentum, sondern schon im hellenistischen Judentum vielfach miteinander kombiniert worden, um so die Form und den äußeren Rahmen der Eschatologie zu bilden. Ihre Kombination konnte sich dabei vor allem der Verbindung eines individuellen und eines universalen Aspekts der Eschatologie als dienlich erweisen, die beide zu unterscheiden, nicht aber zu trennen sind analog zum Verhältnis, das zwischen Selbst und Welt waltet.
Um der zwar differenzierungsbedürftigen, aber untrennbaren Selbst-Welt-Beziehung bzw. dem Verhältnis eschatologisch Rechnung zu tragen, das zwischen Selbst- und Weltbezug waltet, konnte der Tod des Einzelnen als Trennung von Seele und Leib interpretiert und die Seelenunsterblichkeit individualeschatologisch, die Sterblichkeit des Leibes hingegen universaleschatologisch geltend gemacht werden dergestalt, dass sich das eschatologische Geschick der Einzelseele im Augenblick des Todes zwar grundsätzlich entscheidet, der Leib als Medium menschlichen Weltbezugs dagegen bis ans Ende der Tage im Tod verbleiben muss, um erst im Zuge allgemeiner Totenauferstehung mit seiner Seele wiedervereinigt zu werden. Umgekehrt hat man die Vorstellung endzeitlicher Totenauferstehung im Interesse der Identitätswahrung des erweckten Einzelnen nicht in der Sphäre universaler Allgemeinheit belassen, sondern rückbezogen auf den je besonderen Fall der individuellen Menschenseele, wie immer es um deren Unsterblichkeit bestellt sein mag. Näheres hierzu, aber auch zu den diversen Zwischenannahmen und Interimslösungen, die sich mit der Unterscheidung von individueller und universaler Eschatologie im Interesse ihrer Vermittlung verbanden, werden Einzelstudien beizubringen haben. Sie werden, wie gehabt, historisch angelegt, aber zugleich bestrebt sein, eschatologische Perspektiven von systematischer Bedeutung zu eröffnen.
Identitätskriterien für Personen
Was die Thematik von Leibesauferstehung und Seelenunsterblichkeit anbelangt, so sei vorerst nur auf einige interessante Versuche verwiesen, im besagten Zusammenhang „eine längst überfällige Brücke zwischen der angelsächsischen und der kontinentalen“ (Brüntrup u. a. [Hg.], 7; vgl. auch Brüntrup) Diskussionslage zu schlagen und „die schon länger andauernde Ganztoddebatte in Deutschland mit der neueren analytischen Debatte um Identitätskriterien für Personen zusammenzubringen“ (ebd.). Einschlägig hierfür ist beispielsweise der von Godehard Brüntrup, Matthias Rugel und Maria Schwarz herausgegebene, 2010 erschienene Sammelband „Auferstehung des Leibes – Unsterblichkeit der Seele“, wobei die Überlegungen zur Verbindung von christlicher Eschatologie mit dem aristotelischen Hylemorphismus bei Thomas von Aquin besondere Beachtung verdienen (vgl. Brüntrup u. a. [Hg.], 81 ff.). Zu vergleichen ist hierzu Georg Gassers kritische Bestandsaufnahme hylemorphistischer Theorien der Auferstehung, dessen ebenfalls von der analytischen Philosophie inspirierte Untersuchung ihrerseits auf die zentrale „Frage nach der Wahrung persönlicher Identität zwischen irdischer und eschatologischer Existenz“ (Gasser, 538) konzentriert ist.
Gilt das Irreversibilitätsprinzip, wonach jede Entität, die zu existieren aufgehört hat, zu keinem späteren Zeitpunkt wieder zu existieren beginnen kann (vgl. Gasser, 539), uneingeschränkt oder nur in eingeschränkter Weise, kann bzw. muss, wenn letzteres zutreffen sollte, „ein Lebewesen einen kausalen Eigenbeitrag zu seiner Fortexistenz leisten“ (Gasser, 555), kann eine anima separata diese Funktion erfüllen und personale Identität über den Tod hinaus gewährleisten, oder vermag sie weder die Garantie todübergreifender Personidentität noch auch nur numerischer Selbigkeit zu geben? Auf diese Fragen, aber auch auf die Frage, ob bzw. inwieweit sie eschatologisch angemessen sind, wird zurückzukommen sein. Anerkennung verdient in jedem Fall der Versuch, „die christliche Hoffnung von der Auferstehung wenigstens insoweit als rational verstehbare Möglichkeit zu explizieren, dass sie der Vernunft nicht widerspricht“ (Brüntrup u. a. [Hg.], 7; vgl. ferner Müller).
Besondere und allgemeine Eschatologie
Unter den verschiedenen Gliederungsschemata der Themenbestände „De novissimis“ ist von vielen dogmatischen Lehrbüchern die Unterscheidung einer besonderen und einer allgemeinen Eschatologie bevorzugt worden. Es versteht sich von selbst, dass diese Unterscheidung nicht als Trennung missverstanden werden darf; die besondere Eschatologie verweist auf die allgemeine, und die allgemeine hat ohne die besondere keinen Bestand. Beide stehen in einem differenzierten Zusammenhang, der im dreieinigen Gott sein gemeinsames Sinnziel findet, wie denn alle Eschata, welche das Eschaton mit sich bringt, hingeordnet sind auf den Eschatos, in dessen Trinität sie ihre eschatologische Erfüllung finden. Theologisches Thema der Eschatologie ist Gott und Gott allein, dessen Alleinigkeit indes im Geiste Jesu Christi als für Selbst und Welt aufgeschlossen und offen zu denken ist. Gott kommt seinen Geschöpfen entgegen, um sie aus Sünde und Übel zurückzuführen zu sich; in solch göttlichem Entgegenkommen, wie es im auferstandenen Gekreuzigten in der Kraft des Hl. Geistes offenbar geworden ist, gründet die Zukunft von Selbst und Welt.
In der Regel hat man die Unterscheidung von besonderer und allgemeiner derjenigen von individueller und universaler Eschatologie gleichgesetzt. Besondere Gestalt nehmen die „Letzten Dinge“, von denen die Eschatologie handelt, in individueller Hinsicht, also dann an, wenn es um das Einzelgeschöpf, näherhin um den einzelnen Menschen, um sein Selbst, um ihn selbst, kurzum: um das Ich zu tun ist, welches ich selbst bin. Tua res agitur: es geht in der Lehre „De novissimis“ um dich und um mich persönlich; ohne diese Einsicht lassen sich die „Letzten Dinge“ nicht angemessen erörtern, jedenfalls nicht im Sinne reformatorischer Theologie. In Bezug auf das einzelne Selbst und seinen individuellen Selbstbezug gewinnt die Eschatologie jene Konkretheit, von der zu abstrahieren sie einer Äußerlichkeit preisgeben würde, die letztlich niemanden mehr beträfe. Die Wahrnehmung ihres besonderen, individuellen und konkreten Bezugs gehört sonach unveräußerlich zur Eschatologie und zwar nachgerade dann, wenn sie ihrem Allgemeinheitsanspruch gerecht zu werden sucht. Die universale ist in Absehung von der individuellen Eschatologie nicht zustande zu bringen, jedenfalls nicht unter christlichen Bedingungen und unter der Voraussetzung, dass die Zukunft von Selbst und Welt in der Person Jesu Christi beschlossen ist, zu deren Allgemeinbedeutung individuelle Bezüge konstitutiv hinzugehören.
Individualität und Universalität
Die allgemeine Eschatologie bedarf individueller Konkretion und einer besonderen Ausrichtung auf den Einzelnen. Doch ist das einzelne Ich in seinem individuellen Selbstbezug auch in eschatologischer Hinsicht konkret nicht zu denken ohne Beziehung zu demjenigen, was es nicht unmittelbar selbst ist, zum Mitmenschen, zur Menschheitsgeschichte und zur ganzen kreatürlichen Welt. Die individuelle Eschatologie kann mithin universaler Bezüge nicht entbehren, so wie ein Ich ohne Nichtich, ein Selbst ohne Kosmos samt allem, was ihm zugehört, nicht denkbar ist. Auch das Universum muss daher in gebührender Weise Thema der Eschatologie sein, in Form der Frage nach dem Ende und der Vollendung der Welt, nach dem eschatologischen Geschick der extrahumanen Kreatur und insbesondere nach dem Sinn und Ziel der gesamten Menschheitsgeschichte, die den umfassenden Kontext der Lebensgeschichte jedes Einzelnen bildet.
Jeder Mensch ist Mensch unter Menschen und als Mitmensch anderen in unterschiedlicher Weise geschichtlich verbunden; er kann daher auch in eschatologischer Hinsicht nur als einer unter anderen, im Kreis seiner Nächsten samt all den Umkreisen konkret in den Blick kommen, die ihn umgeben; ja, er ist, was er ist, nicht ohne die ihn umgebende Wirklichkeit, deren Inbegriff die Welt ist. Zwar ist jeder einzelne Mensch eine transmundane Größe zu nennen, insofern er seinem Wesen nach nicht nur auf Selbsttranszendenz, sondern auch auf Welttranszendenz hin angelegt ist; aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er selbst Teil der Welt ist und an ihr dergestalt partizipiert, dass er ohne Wahrnehmung dieser Partizipation konkret nicht zu fassen ist. Der Zusammenhang von Selbst und Welt ist zwar differenziert; aber er erlaubt keine Trennungen. Wo vom Ende und von der Vollendung meiner selbst die Rede ist, kann von Ende und Vollendung der Welt nicht geschwiegen werden und umgekehrt. Individuelle und universale Eschatologie bilden einen differenzierten Zusammenhang.
Kombination eschatologischer Vorstellungen
Förmlich verknüpft werden individuelle und universale Eschatologie in der christlichen Lehrüberlieferung seit altkirchlichen Zeiten durch Kombination zweier traditioneller Vorstellungskomplexe, die zwar, wie erwähnt, zunächst unabhängig voneinander entstanden, aber schon im vorchristlichen Hellenismus auf vielfältige Weise miteinander verbunden worden waren: gemeint ist einerseits die aus der frühjüdischen Apokalyptik stammende Vorstellung einer allgemeinen Totenauferstehung am Ende der Tage, will heißen: am Ende des alten Äons und der durch ihn charakterisierten Menschheitsgeschichte und Welt, andererseits die Vorstellung einer den leiblichen Tod überdauernden Unsterblichkeit der Menschenseele. Beide Annahmen sind je auf ihre Weise anthropologisch ausgerichtet und setzen den Tod des Menschen als verallgemeinerbare Gegebenheit voraus. Ausnahmen bestätigen in jedem Fall die Richtigkeit dieser Regel; denn auch wo mit Entrückungen, Himmelfahrten vor Eintritt des Todes oder mit ähnlichen Ereignissen gerechnet wird, geschieht dies doch stets unter der Voraussetzung eines vollzogenen Abschlusses des irdischen Lebens.
Für die aus der frühjüdischen Apokalyptik stammende Vorstellung einer allgemeinen Totenauferstehung ist kennzeichnend, dass sie den Tod oder ein ihm analoges Ende des irdischen Lebens generalisierend in Anschlag bringt und folgerichtig mit dem Ende der Menschheitsgeschichte, ja dem Weltende überhaupt assoziiert. Sie ist, wenn man so will, ganzheitlich angelegt, insofern sie mit dem alten Äon alles mehr oder minder in einem enden lässt, so dass, zumindest was das Enden anbelangt, zwischen Selbst und Welt momentan kein eschatologischer Unterschied besteht. Zwischen beiden unterschieden wird dann aber insofern doch, als im Rahmen des apokalyptischen Weltendes dem Ende der Menschheitsgeschichte bzw. der Auferweckung aller Menschen besondere Aufmerksamkeit zugewendet wird, wenngleich unter dem Vorzeichen der Allgemeinheit und der ihr entsprechenden Ganzheit. Ausnahmslos alle Menschen werden erweckt, nachdem sie zuvor ganz tot bzw. gänzlich an das Ende ihres Weltlebens gelangt waren. Eine prinzipielle Differenzierung zwischen Seele und Leib findet sich in der Überlieferung der frühjüdischen Apokalyptik nach Maßgabe des Menschenbildes der hebräischen Bibel zunächst ebensowenig wie eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen individueller und universaler Eschatologie.